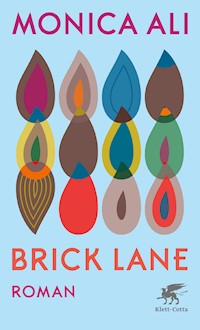6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sehnsüchte, Träume und Wendepunkte im malerischen Portugal Alentejo Blue entführt den Leser in das kleine, idyllische Dorf Mamarrosa in Portugal. Für manche ist es die letzte Zuflucht, für andere ein Ort der Langeweile. Die junge, schöne Teresa würde eigentlich fortgehen – wäre da nicht der englische Schriftsteller, der seit kurzem hier lebt. Die Familie Potts hofft, in Mamarrosa endlich das harmonische Leben zu finden, von dem sie schon lange träumt. Während die Potts kämpfen und zugleich träumen, reflektiert der alte Juao über sein langes, beschwerliches Leben. Auf einem ausschweifenden Fest werden die Sehnsüchte und Ängste aller Bewohner sichtbar – und jeder erkennt, dass er sich an einem Wendepunkt im eigenen Leben befindet. Monica Alis anspruchsvoller Roman ergründet Themen wie Glauben, Einsamkeit, Schicksal, Zerrissenheit und Hoffnung und bietet dem Leser faszinierende Einblicke in die facettenreiche Welt Portugals und seiner Bewohner.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 373
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Monica Ali
ALENTEJO BLUE
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Ein malerisches Dorf im portugiesischen Alentejo – doch die Idylle trügt. In Marmarrosa prallen Welten aufeinander, und kaum einer ist mit seinem Leben zufrieden: Ein junges Mädchen will nur weg, ein englischer Schriftsteller hofft auf neue Ideen, ein Paar verliert seine Liebe. Ob Einheimischer oder Ausländer, jung oder alt, jeder ist auf der Suche nach dem Glück. Bis eines Tages der lang ersehnte Marco Afonso Rodrigues ins Dorf zurückkehrt…
Inhaltsübersicht
Orte sind wie Menschen, [...]
Eins
Zwei
Drei
Vier
Fünf
Sechs
Sieben
Acht
Neun
Orte sind wie Menschen, wir müssen uns ihnen langsam nähern, ganz allmählich.
José Saramago
Weil ich nicht hoff, ich kehre nochmals um,
Weil ich nicht hoffen darf,
Weil ich nicht hoff auf Kehr und Dauer
T. S. Eliot
Eins
Zuerst dachte er, es wäre eine Vogelscheuche. Als er herauskam, um im matten Licht des Morgens seine Blase zu leeren, und dabei wie immer den alten Judasbaum pries, wandte Joao den Kopf und sah die dunkle Gestalt zwischen den Bäumen. Es dauerte etwas, bis er den Reißverschluss wieder geschlossen hatte. Seine Finger verhielten sich wie feindliche Agenten. Sie gaben vor, sein Werkzeug zu sein, arbeiteten jedoch insgeheim gegen ihn.
Joao trat unter den bemoosten Ästen hervor und hatte dabei nur einen Gedanken: Vierundachtzig Jahre auf dieser Erde sind eine Ewigkeit.
Er griff nach Ruis Stiefel. Sie berührten fast den Boden. »Mein Freund«, sagte er, »lass mich dir helfen.« Er sammelte Mut, um aufzublicken und in sein Gesicht zu sehen. Als es so weit war, flüsterte er mit der kratzigen Stimme eines alten Mannes: »Querido, Ruizhino.«
Joao stellte sich auf den Holzblock, den Rui weggetreten hatte, nahm sein Taschenmesser und fing an, das Seil zu durchtrennen. Mit dem freien Arm umfasste er Ruis Oberkörper unter der Achsel und spürte, wie das Gewicht sich verlagert, als die Fasern unter der Klinge auseinander sprangen.
Die Mandelbäume blühten dieses Jahr früh. Auch die Tomaten würden schnell reifen und trügerisch rot werden, aber nach nichts schmecken. Joao nahm Ruis verkrampfte Hand in seine und dachte: Das sind die Dinge, die ich weiß. Es war Zeit, die Saubohnen zu pflanzen. Der Boden, auf dem der Mais gewachsen war, musste ruhen. Die Oliven würden dieses Jahr hart und klein sein.
Er saß im hohen Gras an den Holzblock gelehnt, und Rui lehnte an ihm. Er bewegte Ruis Kopf, damit er bequemer an seiner Schulter lag. Dann schlang er die Arme um Ruis Körper. Zum zweiten Mal hielt er ihn.
Sie waren siebzehn und hungrig, als sie sich in einem Viehwaggon, der nach Osten zu den Weizenfeldern fuhr, kennen lernten. Rui zog ihn wortlos herein, und später sagte er: »Es gibt Arbeit für alle. Habe ich gehört.« Joao nickte, und als die Berge in flaches Land übergingen, das sich wie ein goldenes Versprechen vor ihnen erstreckte, neigte er sich zu ihm hinüber und sagte: »Jeder, der arbeiten will, findet Arbeit.« Sie verlagerten das Gewicht auf den hölzernen Planken und taten so, als würde ihr Hintern nicht schmerzen, und schauten hinaus, sahen weiter, als sie je zuvor gesehen hatten, weiße Dörfer wie Schaum vor dem Blau, Land, das gegen den Himmel brach.
Am dritten Tag stiegen sie am Rand einer Kleinstadt aus, und die Kinder, die zu ihnen gerannt kamen, waren genauso heruntergekommen wie Joaos Brüder und Schwestern. Joao blickte zu Rui, aber Rui biss die Zähne zusammen und schwang die Beine über den Rand des Waggons wie die anderen Männer. Die Älteren wurden zum Korkschälen oder zum Pflügen der Felder geholt, während Joao und Rui mit den Händen in den Taschen stehen blieben. Joao hatte solchen Hunger, dass er ihn in den Beinen und Händen und in der Kopfhaut spürte. Sie gingen an den armseligen Häusern vorbei – die Frauen standen in den Türen, die Hunde schnüffelten in der Gosse – in die Mitte des Ortes. »Wir bleiben zusammen«, sagte Rui. Er hatte grüne Augen, eine schmale Nase und weiße Haut, als wäre er noch nie in der Sonne gewesen.
»Wenn uns jemand will, muss er uns beide nehmen«, sagte Joao, als sei er Herr über sein Schicksal.
Sie erbettelten einen halben Laib Brot im Café dafür, dass sie den Boden wischten und den Abfall wegschafften, und schliefen mit offenem Mund auf dem Kopfsteinpflaster der Straße. Als er erwachte, sah Joao als erstes Ruis Gesicht. Den Schmerz in seinem Bauch deutete er als Hunger.
Gemeinsam suchten sie im Abfall nach Essbarem, und sie schliefen Seite an Seite. Sie trieben sich mit den anderen Männern herum, die auf Arbeit warteten, und lernten eine Menge: Wie man ein paar Worte zu einer Unterhaltung streckte, wie man an einer Mauer lehnte, wie man spuckte und wie man Gleichgültigkeit zur Schau stellte.
Am Ende des Platzes befand sich ein zweistöckiges Gebäude mit einem vergitterten Fenster im Erdgeschoss. Joao hatte noch nie zuvor ein Gefängnis gesehen. Die Häftlinge saßen am Fenster, unterhielten sich mit Freunden oder nahmen Essen von Verwandten entgegen. Eines Tages versammelten sich ungefähr ein Dutzend Leute davor. Joao und Rui hatten nichts anderes zu tun.
»Er redet von Opfern. Wer soll diese Opfer bringen, meine Freunde? Denkt darüber nach.«
Niemand blickte zu dem Häftling. Sie standen nur herum und warteten, obwohl es nichts zu warten gab.
Der Häftling klammerte sich an die Gitterstäbe und drückte das Gesicht dagegen. Seiner Nase gelang die Flucht. »Salazar«, sagte er, »bringt keine Opfer.«
Alle rührten sich, als hätte der trockene Wind Angst herangeweht.
»Hört mal her«, sagte der Häftling. Sein Gesicht war schmal und zusammengekniffen, als hätte er zu oft versucht, es durch den schmalen Spalt zu quetschen. »Im ganzen Alentejo besitzen vier Familien drei Viertel des Landes. So war es auch in anderen Ländern, zum Beispiel in Russland. Aber jetzt gehört das russische Land dem russischen Volk.«
Keiner sah den anderen ins Gesicht. Es war gefährlich, die Gedanken anderer zu lesen.
Joao blickte zu Rui. Rui wusste nicht, was die anderen wussten, oder es war ihm gleichgültig. Er schaute dem Häftling direkt ins Gesicht.
»Das Volk erwirtschaftet den Wohlstand, aber der Wohlstand gehört nicht dem Volk.«
Die Männer nahmen die Hände aus den Taschen, als wollten sie ihre Ersparnisse weggeben, bevor sie die Stadt verließen. Der Häftling schob die Hände zwischen die Gitterstäbe und bewegte sie aus dem Handgelenk auf und ab. »Uns ist es verboten, barfuß zu gehen. Salazar hat es verboten.« Der Mann lachte, und sein Lachen war so frei, wie sein Körper gefangen war. »Schaut nur, so müssen wir unsere Füße binden. Solange unsere Füße in Schuhen und Lumpen stecken, müssen unsere Bäuche voll sein.«
Ein alter Mann mit krummem Rücken, der den ganzen Tag auf Füße schauen musste, brummte laut und zustimmend. Ein jüngerer Mann, der Tränen der Wut wegblinzelte, sagte: »Das stimmt.«
Der Häftling verschwand in der dunklen Zelle, als hätte ihn eine unbekannte Kraft zurückgerissen, vielleicht die Dunkelheit selbst.
Alle freien Männer stellten fest, dass sie woanders etwas zu erledigen hatten.
»Rui«, sagte Joao, »wir gehen besser.«
Rui stand da, die Hände in die Hüften gestemmt, und warf den Kopf zurück wie ein Stierkämpfer. »Es ist vorbei«, sagte Joao. Er fasste Rui am Ellbogen und zog ihn fort.
Später kam ein Mann auf den Platz und winkte Joao. »Willst du arbeiten?«
»Ich mache alles«, sagte Joao. »Bitte.«
»Komm mit«, sagte der Mann und drehte sich um.
»Mein Freund«, sagte Joao und schaute zu Rui, der pfiff und mit der Ferse gegen die Mauer trat.
Der Mann ging weiter.
»Warten Sie«, rief Joao. »Ich komme.«
Er blickte auf und sah Ruis Hut auf einem großen Stein liegen, in einem Kreis aus milchigem Licht. Er stellte sich vor, wie Rui dort gesessen und den Hut ein letztes Mal abgenommen hatte.
Joaos Rückgrat war steif, und in seiner Brust schmerzte es. Er veränderte seine Stellung im feuchten Gras und sah, wie komisch Ruis Beine dalagen. Seine Hose war mit Schmutz gesäumt. Ein Fuß zeigte nach unten, der andere nach oben. Für uns gibt es kein Entspannen, dachte Joao.
Er war wie jeden Donnerstag da gewesen, vor der Junta de Freguesia, um Boule zu spielen. Alle waren da: Jose, Manuel, Nelson, Carlos, Abel und die anderen. Nur Mario war nicht gekommen, weil er sich die Hüfte gebrochen hatte. »Dieser Manuel«, sagte Rui, »bescheißt doch immer.« »Dieser Rui«, sagte Manuel, »ist ein dummer Esel.« Alles war so wie während der letzten achtzehn Jahre. Damals war Rui nach Mamarrosa gekommen, und Joao und Rui waren die jüngsten gewesen. »Carlos«, sagte Abel, »du wirfst wie eine Frau.« »Halt den Mund«, sagte Carlos, »was weißt du schon von Frauen.«
Malhadinha war die beste Art zu reden.
Man rollte die Kugel über den Rasen und die Worte hinterher. Auf diese Weise mussten sie sich nicht ansehen.
Anschließend sperrten sie die Kugeln in der Junta ein und gingen ins Café, um etwas zu trinken.
»Meine Enkelin will nach Lissabon«, sagte Jose.
»Mein Sohn ist von London nach Glasgow gegangen«, sagte Rui.
»Meine Tochter«, sagte Carlos, »sagt, dass sie mich rauswirft, wenn ich nachts noch einmal huste. Aber das sagt sie immer.«
Als es Zeit zum Schlafen war, ging Joao mit Nelson, und Rui ging mit Manuel. Manchmal ging Joao mit Manuel. Manchmal ging er mit Jose oder Antonio oder Mario. Aber in all den Jahren war er nie allein mit Rui gegangen.
Joao wollte nicht derjenige sein, der Ruis Frau den Hut brachte. Er überlegte, was er tun sollte. Ein Vogel landete auf der Krempe des Huts. Er war golden mit schwarzem Kopf und schwarzen Beinen. Nie zuvor hatte Joao so einen Vogel gesehen, und er deutete ihn als Zeichen, den Hut zu behalten. Dann fiel es ihm wieder ein. Ruis Frau, Dona Rosa Maria, war nicht letztes Jahr, sondern schon vor zwei Jahren gestorben. Der Tag, an dem sie beerdigt wurde, war glühendheiß gewesen. Der vierte Juli: Gedenktag an Isabella von Portugal, Schutzheilige der schwierigen Ehen und der zu Unrecht Beschuldigten.
Als sie sich zum zweiten Mal begegneten, waren sie Männer.
Joao ging an der Parade der Grünhemden auf der Praca Souza Prado vorbei und stieg die Stufen zur Rua Fortunato Simoes Dos Santos hinauf. Er war unterwegs zu seiner bevorzugten Kneipe. Oben an der Treppe drehte er sich um und sah, wie ein Junge sich aus der Reihe löste und den rechten Arm zum berüchtigten Gruß hob. Joao betrat die Bar und sah Rui. Seine Haut war dunkler, und seine Nase war nicht länger schmal (vermutlich war sie gebrochen), aber Joao erkannte Rui, weil mit ihm der Schmerz in seinem Bauch zurückgekehrt war.
Rui redete, zog alle Anwesenden mit ins Gespräch. »Ich sage nur, dass ein Mann, dem zehntausend Hektar Land oder mehr gehören und der zweimal am Tag sechs Gänge isst, ein Leben im Überfluss führt. Ermahnt uns nicht der Öffentliche Mann selbst, unsere Wünsche zu zügeln?« Rui trug ein kariertes Hemd, ein fadenscheiniges Jackett und das Haar gefährlich lang: Keine drei Zentimeter fehlten bis zum Kragen. »Niemand kann Salazar widersprechen.«
»Aber du redest wie ein … ein …« – der Mann Rui gegenüber senkte die Stimme – »wie ein Kommunist.«
»›Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen.‹ Das behaupten die doch.« Rui winkte ab. »Wer hat schon mal so einen Unsinn gehört? Warum sollte ein Mann gemäß seinen Fähigkeiten arbeiten? Warum sollte ein Mann gemäß seinen Bedürfnissen versorgt werden? Stellt euch vor, was passieren würde, wenn die Leute diesen Unsinn ernst nehmen würden! Alvaro Cunhal« – er ließ den Namen des Führers der Kommunistischen Partei eine Weile in der Luft hängen – »soll für alle Ewigkeit in seiner Zelle verrotten.«
Joao wusste, was Rui tat. So wie die anderen sich bewegten und umschauten, wussten sie es ebenfalls.
»Wir stehen auf der anderen Seite«, sagte Rui. Er blickte auf, sah Joao und etwas zog über sein Gesicht. »Schwarzhemden und Grünhemden halten zusammen.«
»Entschuldige«, sagte eine kleine Wühlmaus von einem Mann, »aber beschuldigst du Salazar des Faschismus?«
»Beschuldigen?«, sagte Rui. »Ich beschuldige ihn überhaupt nicht. 1945, als er anordnete, dass alle Fahnen auf Halbmast gesetzt werden zum Zeichen des Respekts für unseren lieben verschiedenen Hitler, habe ich das begrüßt. Wir haben die Deutschen unterstützt, deswegen war es für uns alle natürlich ein trauriger Tag.«
»Aber nein«, rief der kleine Mann mit bebenden Lippen, »wir haben niemanden unterstützt.«
»Oh«, sagte Rui und fuhr sich über die Nase. »Hatte ich vergessen. Aber trotzdem bin ich traurig, wenn man mir sagt, dass ich traurig sein soll.«
Das war 1951, das dritte Jahr, das Joao mit seiner Schwester, ihrem Mann, ihren vier Kindern, dem Bruder, der Mutter und der Tante des Mannes in einem langen niederen Haus mit drei Türen und einem Fenster lebte. Während der Saison schälte er Kork, wenn die Saison vorbei war, tat er, was immer er fand. Im Lauf der Jahre hatte er Trauben und Oliven geerntet, Ziegen gehütet, in Olhao Häute gegerbt, in Ourique Straßen gebaut und in Portimao Fische ausgenommen.
Er versuchte, Rui zu warnen. »Es gibt hier Spione«, sagte er. »Informanten. Der kleine Mann mit dem Schrumpfkopf, wovon lebt er? Niemand weiß es.«
Rui zuckte die Achseln. Er langte an seine Nase, drückte sie von der Wurzel bis zur Spitze. Er konnte sich nicht an seine Nase gewöhnen. »Bestimmt bezahlt ihn die PIDE. Die Geheimpolizei ist nicht so geheim.«
»Bitte«, sagte Joao. »Sei vorsichtig.«
Erneut warf Rui seine Leine in die dunklen Wasser der Mira. »Niemand spricht respektvoller von Salazar als ich.«
Nach dem Krieg war er in Frankreich gewesen, zusammen mit anderen Illegalen, und hatte auf dem Bau gearbeitet. Er hatte lesen und schreiben gelernt. »Liberté, egalité, fraternité«, sagte er. »In Frankreich«, sagte er, »hat ein Mann Rechte. Würde. Er wird respektiert.«
»Er lebt in Freiheit«, sagte Joao. Er setzte sich ans Ufer des Flusses.
Rui setzte sich neben ihn. In den Cafés und Bars konnte man nicht frei sprechen. Hier draußen waren sie unter sich.
Joao hörte Rui atmen. Er hörte sein Herz schlagen, oder vielleicht war es auch sein eigenes Herz, das in seinem Käfig pochte. Er blickte Rui ins Gesicht, und einen langen Moment sahen sie einander in die Augen. Dann wandte Rui wie immer den Blick ab.
»Um Gottes willen«, sagte Joao.
»Erzähl mir von Portimao«, sagte Rui.
In den Monaten, seit sie sich in der Rua Fortunato Simoes Dos Santos wiedergetroffen hatten, hatte Joao schon oft davon erzählt. Rui wollte alles über die Sardinenfabrik wissen. Der Arbeiter, der Artikel aus Avante! vorgelesen hatte – wer hatte ihn verpfiffen? Wie genau sah er aus? War Joao sicher, dass er nicht aus Aljustrel stammte, weil er sich ganz nach einem Genossen anhörte, den Rui dort gekannt hatte. Außerdem wollte er wissen: Waren die Männer zugänglich? Waren sie daran interessiert, der Partei beizutreten? Sahen sie ein, dass die Produktionsmittel den Arbeitern gehören sollten? Begriffen sie die Sache mit dem Mehrwert?
Joao dachte nicht gern an die Fabrik. Rui ließ ihn immer wieder die Baracken der Arbeiter beschreiben. Der Gestank dort war noch schlimmer als in der Fabrikhalle. Der Boden war beständig von Schleim bedeckt infolge von lockeren Fliesen, defekten Abflussrohren und blockierten Seelen.
»Mehr gibt es nicht zu erzählen«, sagte Joao. Was würde passieren, wenn er Rui die Hand auf die Wange legte? Allein schon der Gedanke ließ ihn zittern.
»Die Baracken«, sagte Rui. »Brachte es die Männer einander näher, weil sie auf so engem Raum zusammenlebten?«
»Nein«, sagte Joao harsch. Er dachte an die Männer, die er dort gekannt hatte, die nachts in sein Bett kamen, deren Frauen zu Hause auf sie warteten, deren Kinder ernährt werden mussten.
»Na gut«, sagte Rui. »Dann sind wir eben still. Wir haben keine Angst vor dem Schweigen.«
Sie blickten in die Mira, auf die nie endende Wallfahrt des Wassers, das blind und unerbittlich dahinfloss. Ein Ruderboot kam vorbei. Rui lüpfte den Hut.
Joao sah Rui an. Rui blickte ihn nicht an. Joao wartete, aus Trotz. Wenn er die Hand zwischen Ruis Beine legte, wenn er ihn auf einen dunklen Weg führte und sich umdrehte, wenn er mit ihm in den Wald ging und auf die Knie fiel und den Blick gesenkt hielt – so etwas würde Rui akzeptieren. Joao wollte nichts davon wissen. Sein Verlangen war so stark, dass es sich wie Hass anfühlte.
»Salazar«, sagte Rui, der doch Angst vor dem Schweigen hatte, »hat seit dem Tag, an dem er geboren wurde, kein wahres Wort gesagt. Wenn er sagt, dass die Sonne im Osten aufgeht, weiß man, dass sie im Westen aufgeht. Aber wir tun so, als würden wir seine Lügen glauben. Das ist das Problem mit uns. Wenn man lang genug so tut, als ob, vergisst man, dass man eigentlich nur so tut. Die Illusion wird zu einer Art Realität.« Er schaute unter die Jacke, die er auf den Boden gelegt hatte, fand den Behälter mit den Ködern und begann die Leine einzuholen. »So wie ich. Ich bin nicht zum Fluss gegangen, weil ich angeln wollte, aber jetzt halte ich mich für einen Angler.«
»Warum bist du dann gekommen?«, fragte Joao, der es hören wollte.
»Ich sag dir was«, sagte Rui, der Joao endlich anschaute. Jetzt, da er stand, konnte er es gefahrlos tun. »Salazar hat so viele Lügen erzählt, dass seine Zunge verfault. Wirklich, das hab ich gehört. Deswegen versteckt er sich meistens. Ja, mein Freund, das stimmt. Es stimmt: Salazars Zunge ist schwarz.«
Bald darauf brachten sie ihn fort, nach Oporto. Innerhalb von ein, zwei Tagen wusste das ganze Dorf, dass sich das Hauptquartier der PIDE in Oporto in der Rua de Heroismo 329 befand. Angeblich führte die Hintertür direkt auf einen Friedhof.
Joaos Neffe, der in der Portugiesischen Jugend war und jeden Mittwoch- und Samstagnachmittag mit einem hölzernen Gewehr exerzierte, sagte: »Werden sie seinen Pimmel an die Wand nageln?«
»Raus hier«, sagte Joao. »Erzählen sie euch das? Raus.«
Alle kannten die Geschichten. Sie schlugen eine schwangere Frau auf den Bauch. Sie verbrannten einem Mann die Hände und warfen ihn aus einem Fenster im obersten Stock. Sie ließen die Häftlinge die »Statue« machen; sie mussten zehn Tage vor einer Wand stehen und durften sie nur mit den Fingerspitzen berühren.
Alle kannten die Geschichten. Die Kinder schienen sie als Erste zu erfahren.
Joao hatte einen Krampf. Er musste aufstehen. Er schob Ruis Hüfte beiseite und ließ ihn vorsichtig zur Seite gleiten. Der Knochen fühlte sich hart an. Er schob die Hand unter das Unterhemd und fuhr damit über den Bauch, die Rippen, die Haut, die locker war wie bei einem neugeborenen Kalb. Der Duft nach Eukalyptus erfüllte die Luft, während die Hitze vom Boden aufstieg. Irgendwo begann ein Hund zu winseln. Die Korkeichen behielten ihre Ansichten für sich. Er war zweihundert Jahre alt, der Baum, den Rui ausgesucht hatte. Vierundachtzig Jahre war kaum ein Anfang.
Joao ging zu dem großen Stein und nahm den Hut. Der Filz fühlte sich warm an zwischen seinen Fingern. Er ließ sich auf dem Stein nieder und setzte den Hut auf. Wo blieben die Tränen? Warum flossen sie nicht?
Er blickte hinunter auf alten Ziegenkot und dachte an die Plakate, die überall im Dorf hingen. PCP stand in großen roten Buchstaben darauf. In der oberen Hälfte prangten stolz Hammer und Sichel. Valeu a pena lutar!
Der Kampf hatte sich gelohnt. Fünfzig Jahre zuvor waren Männer für das Recht, das auszusprechen, gestorben. Auch die, die überlebten, starben ein bisschen. Was dachten die Jungen? Was dachten sie, wenn sie Rui sahen, seine zerschlagene Nase, seine haarigen Ohren, seinen demütigen Buckel? Aber natürlich schauten sie nicht einmal hin; und der Kampf war jetzt ihrer, und es war kein Kampf, den Joao verstand. Er blickte auf. »Was meinst du?«, fragte er Rui. »Sollen wir als Letztes sagen, dass sich alles gelohnt hat?«
Sie hatten eine gemeinsame Nacht, als Rui mit der gebrochenen Nase und mit grün und blau geschlagenem Körper und Herzen und den grünen Augen, an denen keine Wimpern mehr waren, aus Oporto zurückkehrte und an eine der drei Türen in dem langen niederen Haus klopfte. Die anderen gingen ihnen aus dem Weg, und danach hielt Joao Rui in den Armen, ihre Füße gegen das rostende eiserne Bettgestell gestützt. Sie wussten, dass man sie hören konnte, dass seine Schwester und sein Schwager im Dunkeln den Atem anhielten und horchten und glaubten, dass das Weinen der vergangenen Tortur galt, während es tatsächlich den gerade beginnenden Qualen galt.
Danach wollte Rui nicht mehr mit ihm allein sein. Innerhalb von sechs Monaten war er verheiratet. Dona Rosa Maria war die Tochter des örtlichen Leichenbestatters. Sie hatte einen Überbiss und eine Art, die Hände auf dem Rücken zu halten, als würde sie etwas verstecken, eine Bauchspeicheldrüse vielleicht oder eine Niere. Zwei Monate später zogen sie fort. An diesem Abend folgte ein Mann Joao aus der Bar, und gemeinsam gingen sie in den Wald.
Ein Kuckuck rief, verstummte und rief erneut. Ein Vogel, dachte Joao, muss nie entscheiden, was er als Nächstes tun wird. Dieser Gedanke traf ihn mit ungeheurer Wucht, als hätte er ihn nie zuvor gedacht. Ein Vogel weiß immer, was er empfindet. Wenn er Hunger hat, sucht er Nahrung. Wenn er Angst hat, fliegt er davon. Wenn er einen Gefährten braucht, findet er einen. Er ist entweder hungrig oder nicht hungrig. Er hat entweder Angst oder er hat keine. Er weiß, wann er still sein und wann er singen muss.
Joao legte sich neben Rui. Er schloss die Augen, legte die Hand auf Ruis Schulter und streichelte sein Schlüsselbein. Er berührte das Seil um seinen Hals mit den Fingerspitzen; er fuhr über die blaue Stelle, die sich wie ein Tintenfleck bis zu seinem Ohr ausgebreitet hatte, das kühl und weich wie ein Bofist war; wenn er darauf drückte, würde es in einer zarten Wolke explodieren. Durch das dünne weiße Haar schimmerte Ruis papierene Kopfhaut, braun gefleckt vom Alter und rot, vielleicht vom Tod. Joao schob den Kopf näher zu Rui. Er wollte ihn riechen. Aber er roch nur das Leben auf dem Waldboden.
So viele Lügen, sagte er zu Rui. Tag für Tag, die Lügen.
Eine Weile lang lag er neben der Leiche. Lass mich etwas fühlen, flehte er, während Bitterkeit in ihm aufwallte wie Blut in einer tiefen weißen Wunde. Wenn das Verlangen verschwunden ist, dachte er, bleibt nichts mehr.
Bevor Rui nach Mamarrosa zog, sah Joao ihn nur noch einmal. Er besuchte seinen jüngsten Bruder in Sao Teotonio. Er ging durch das Dorf auf der Suche nach etwas und sah eine Frau, die im tanque vor der Casa do Povo Wäsche wusch. Dona Rosa Maria richtete sich auf und steckte die Hände hinter den Rücken.
Sie führte ihn die drei Kilometer zum Haus, balancierte dabei einen großen Korb auf dem Kopf und sprach kaum ein Wort. Vor dem Haus standen reihenweise Tomaten, Bohnen und Kinder, die an ihrem Kleid zupften, wenn sie vorbeiging.
Rui saß an dem Tisch aus rohen Brettern. Er stand auf, als er Joao sah, setzte sich wieder und sagte: »Du bist gekommen.«
Er war Gehilfe eines Lastwagenfahrers, und er war oft tagelang von zu Hause fort. »Wenn ich hier bin«, sagte er, »schlafe ich.« Er schaute auf die Kinder, die sich um sie scharten, das jüngste noch unsicher auf den Beinen, als fragte er sich, woher sie gekommen waren.
Sie tranken sauren Rotwein, während Dona Rosa ein großes Eisen mit schwelender Holzkohle füllte und am Ende des Tischs bügelte.
»Meine Frau«, sagte Rui und drückte seine Nase, »arbeitet als Dienstmädchen beim Doktor. Heute ist ihr freier Tag, aber sie bügelt ihre Sachen.«
Sie tranken den Wein, und dann brüllte Rui Dona Rosa an, sie solle ins Dorf gehen und mehr kaufen. Er beugte sich vor und klammerte sich an seine Knie. Seine Wimpern waren weiß nachgewachsen. »Ich bin noch immer dabei«, sagte er. »Diese Dreckskerle.«
»Du bist hoffentlich vorsichtig«, sagte Joao.
»Ja, natürlich.« Er schüttelte den Kopf. »Die Welt wird sich verändern. Ich weiß es. Sie wird sich verändern, mein Freund, dann sind nicht mehr wir es, die vorsichtig sein müssen.«
Sie tranken mehr und sprachen weniger, und Joao verbrachte die Nacht auf einem Flickenteppich vor dem Kamin. Ein Hund hatte sich neben seinen Füßen zusammengerollt, und fünf kleine Körper atmeten im Raum.
Am Morgen zog Rui vor Tagesanbruch los, und Dona Rosa trat Joao gegen die Schulter, um ihn zu wecken. Es regnete, und Dona Rosa bedeckte den Kopf mit einem Tuch und sperrte die Kleinen im Haus ein, damit sie nicht nass wurden, während sie für den Doktor, seine Frau und seine Kinder kochte.
Joao schaute zu den zitternden Blättern empor. Ich bin alt, und ich bin ruhig, dachte er. Nicht weil ich weise bin. Nicht weil ich erfahren bin. Sondern weil das Verlangen verschwunden ist. Die Welt hatte sich verändert, veränderte sich noch immer. Unvorstellbar, dass Veränderung einst etwas gewesen war, wofür man hatte kämpfen müssen!
Wie lange würden die Korkeichen, die jetzt zweihundert Jahre alt waren, noch stehen? Joao hatte es nicht mit eigenen Augen gesehen, aber er hatte gehört, dass es jetzt Plastikkorken für Weinflaschen gab. Nein, nichts war vor Veränderung gefeit.
Die großen Besitzungen waren aufgeteilt worden, wie Rui behauptet hatte, nach der Revolution, die er vorhergesagt hatte. Aber zudem waren fast alle Arbeiterkollektive verschwunden. Die Landbesitzer, stets auf der Gewinnerseite, kauften das Land spottbillig zurück. Und jetzt verkauften sie es weiter. Es wurde von einem Hotel mit sechshundert Betten an der Küste gesprochen, von einem Golfplatz, einem Park mit Wasserrutschen. Die einen sprachen von Japanern. Andere behaupteten, Marco Afonso Rodrigues würde zurückkehren und das Hotel bauen.
Rui hatte immer gesagt, man sollte sie aus ihren quintas jagen. Jetzt übernahmen das die Deutschen, die Holländer und die Briten.
Als Rui und Dona Rosa nach Mamarrosa zogen, arbeiteten ihre drei Kinder, die überlebt hatten, im Ausland.
»Es sind gute Kinder«, sagte Rui. »Gute Arbeiter.«
Joao war schockiert von seinem dünnen Haar, seinen hängenden Schultern.
»Sie vergessen uns nicht«, sagte Rui und meinte, dass sie Geld schickten.
Dann wieder sagte er, »Sie haben uns vergessen«, und meinte, dass sie nicht oft genug nach Hause kamen.
Sie trafen sich jeden Donnerstag zum Boule und zwischendurch auf der Straße und in der Bäckerei. »Ach«, klagte Rui einmal, als das Brot zu hart gebacken war, »es ist nicht mehr so wie früher.«
Joao legte sich Ruis Kopf in den Schoß. Rui hatte keine Angst vor dem Tod gehabt. Das hatte er vor langer Zeit schon bewiesen. Nur vor einer Sache hatte er Angst gehabt; eins hatte er nie sagen wollen. Joao lächelte, weil er endlich begriff, dass Rui im Tod gesprochen hatte. Er blickte hinauf zu dem Ast, dem schönen, bemoosten Ast, den Rui ausgesucht hatte, an diesem Baum, an diesem Ort und keinem anderen, als er endlich, stillschweigend die Wahrheit gesagt hatte.
Joao betrachtete Ruis Gesicht. Ein Lid war fast geschlossen über dem Augapfel, der nahezu aus seiner Höhle zu bersten schien. Die Brauen waren lang und weiß und dicht. Auf der Nase war ein lila Fleck. Ruis Mund stand offen, um endlich ein Geständnis abzulegen. Die Zunge, seine Zunge verfärbte sich schwarz.
Zwei
Die Tochter der Potts betrat das Café im Schlepptau ihres Rufs, so dass alle verpflichtet waren, sie anzustarren. Sogar Stanton, der einen Monat lang nicht in Mamarrosa gewesen war, musterte sie öfter, als streng genommen nötig war. Vasco, der hinter dem großen Resopaltresen stand, servierte ihr wachsam und ohne zu lächeln eine Himbeerlimonade. Das Mädchen setzte sich auf den Rand des Billardtischs, ließ die Beine baumeln und betrachtete ihren gepiercten Nabel. Ihr Haar fiel nach vorn und gab den Blick frei auf ein hässliches braunes Hörgerät, und Stanton sah weg.
Das Gespräch kam ins Stocken und erstarb auf den Lippen wie eine aufgedeckte Lüge und lebte ebenso plötzlich wieder auf. Die alten Männer standen an der Bar, liebkosten ihre Macieiras und tauschten hustend Erinnerungen aus. Mit ihren schwarzen Filzhüten, schwarzen Westen und roten Halstüchern erschienen sie Stanton wie aus der Vergangenheit entsprungene Postkarten, so pittoresk wie die gewundenen Straßen und geweißten Häuser, die farbenfroh blau und gelb umrandeten Türen und Fenster.
Eine junge Mutter schalt und schlug und küsste ihr Kind, die verströmte Liebe so greifbar wie der Rauch ihrer Zigarette.
»Immer schlagen sie zu«, sagte Dieter.
Stanton schaute hinaus durch die offene Tür auf die Sonne, die hoch über den weit entfernten rauen Bergkämmen stand. Es musste bald Mittag sein. Auch halb zwölf war annehmbar für ein Bier. Er wartete, dass Vasco, der Aschenbecher mit einem feuchten Lappen säuberte, zu ihm schaute, aber Vasco ließ das Potts-Mädchen nicht aus den Augen. Stanton ging zur Theke und nickte den alten Männern zu. »O Escritor«, sagten sie, als wäre es das erste Mal. Es war ein guter Witz.
»Ja, Sir?« Vasco sprach Stanton so warmherzig an wie ein Mann von Welt den anderen. Er wischte die Theke mit lobenswertem Nachdruck, insbesondere für einen Mann seines Umfangs. Vasco wischte immer. Es war eine Gewohnheit, die er sich bei seinem legendären Aufenthalt als Barkeeper in Provincetown, Cape Cod, Vereinigte Staaten von Amerika zugelegt hatte.
Sein innovativer Beitrag bestand allerdings darin, dass er stets denselben nie gewaschenen Lappen benutzte und Asche und Schmutz von einer Oberfläche zur nächsten schob.
Stanton bestellte zwei Sagres und war dem Potts-Mädchen und ihrem weichen weißen Bauch dankbar, weil sie Vasco ablenkten.
»Mir ist gerade eingefallen«, sagte Dieter und strich sich über eine Augenbraue, »wenn du bar zahlst, kannst du die Mehrwertsteuer vergessen. Spart dir eine Menge Geld.« Er zuckte die Achseln. »Wenn du möchtest, gehe ich gleich mit dir zur Bank.«
»Aber die fossa«, sagte Stanton. »Sie ist undicht. Das Ding ist noch nicht fertig.«
Dieter rollte Tabak in einem Zigarettenpapier mit Fingern, die von Nikotin und Schwielen gelb gefleckt waren. »Das ist – wie sagt man? – ein falsches Verständnis.«
Er hatte die krumme Haltung eines großen Mannes, auch wenn er saß, und sein breiter Brustkasten wirkte konkav. Sein Haar, volle dunkle Locken, war in Stufen geschnitten, fiel ihm fast bis auf die Schultern und glänzte widerlich. Ohne hinüberzublicken, dachte Stanton an die mausgrauen Strähnen des Potts-Mädchens. »Der Faulbehälter ist ein offenes System«, fuhr Dieter fort. »So nennen wir das. Fester Abfall bleibt drin. Das Wasser fließt durch einen Filter hinaus. Nein, das ist ein falsches Verständnis.«
»Missverständnis«, sagte Stanton. »Aber es ist keins. Ich wollte dieses System nicht, weil es zu teuer ist. Dafür habe ich nicht genug Geld.«
Dieter lächelte. »Glückspilz«, sagte der Deutsche. »Du bezahlst für ein geschlossenes und kriegst ein offenes. Großes Glück gehabt.«
»Das verdammte Ding ist nicht dicht«, sagte Stanton. Er verscheuchte eine Fliege. »Und der Boden im Bad ist nicht gefliest.«
Der Bauunternehmer schüttelte den Kopf. Die Locken hüpften unanständig. »Die Leistung ist gut. Du willst nicht zahlen, aber die Arbeit ist gut.« Er zündete die Zigarette an und zog heftig. Er schüttelte den Kopf und schmollte.
Mein neuer Freund, sagte sich Stanton. Er dachte voll Bitterkeit an die Freunde, die er zurückgelassen hatte, obwohl ihm der Abschied nicht schwer gefallen war. Dieter berührte ihn am Arm. »Schau«, sagte er und deutete auf die Männer an der Bar. »Vormittags schon Brandy. Unmöglich, in diesem Land etwas getan zu kriegen. In Deutschland – da arbeiten die Leute. Hier …« Er strich sich in einer seltsam femininen Geste mit der Außenseite der Hand das Haar zurück. »Du siehst die Probleme. Du leidest, mein Freund, und ich leide auch.«
»Du wirst es also richten?«, sagte Stanton. »Und die Fliesen. Du weißt doch, dass keine der Türen im Inneren eingehängt ist?«
»Mistkerle«, sagte Dieter. »Noch ein Bier?«
Stanton schaute auf die Uhr. »Warum nicht?« Der Tag war sowieso gelaufen. Er würde nach Hause gehen, sich kurz an den Computer setzen, Fieber kriegen, sich einen Nachmittag der Recherche verschreiben, ein paar lustlose Stunden mit seinen Büchern verbringen, spazieren gehen, um seinen Kopf zu lüften, und rechtzeitig für einen Drink zum Sonnenuntergang wieder zurück sein. Jede Phase würde unvermeidlicherweise in die nächste übergehen, alle gleich vergeblich. »Wenn du nicht arbeiten musst«, sagte er, ohne sich um einen höflichen Tonfall zu bemühen.
»Ich habe zu viel Arbeit«, beklagte sich Dieter. Er nahm die Biergläser, und Stanton sah, dass die Schwielen weich wurden, sich weiße Ringe um den gelben Kern bildeten. Am anderen Ende des Raums herrschte Aufregung. Stanton wandte sich um und sah, wie das Potts-Mädchen durch das Café schlenderte, ihr Gang hatte etwas Unverschämtes. Hinter dem Tresen fuchtelte Vasco mit den kurzen Armen.
»Ladra!«, schrie Vasco. Diebin. Er öffnete eine Luke und quetschte sich durch die Lücke in der Theke, wobei er durch seine nicht unerhebliche Fülle behindert wurde.
In der Tür drehte sich das Mädchen um, setzte eine ungeheuer große Sonnenbrille auf, machte kurz das Siegeszeichen und verschwand. Vasco stand keuchend da. Er musste sich seine Hosen schneidern lassen, aber sie schienen jetzt nicht weit genug, da sein Bauch sich vor Anstrengung und Gefühlsaufwallung hob und senkte. Seine Gäste – diejenigen, die aufgestanden waren – setzten sich wieder und schnalzten mit der Zunge. Vasco ging bebend zu dem drehbaren Ständer neben dem Zigarettenautomaten. Er fuhr mit der Hand über die Postkarten, Comics, Kaugummis, Spielzeugpistolen und Sonnenbrillen, vielleicht um zu spüren, was noch fehlte, vielleicht um die verbliebenen Dinge zu trösten. Es dauerte eine Weile, bis er sich so weit beruhigt hatte, um wieder Bier auszuschenken.
»Aber sie gehen nicht zur Polizei«, sagte Dieter und stöhnte. »In Deutschland wäre es – bla, bla.« Er brach ab, als hätte selbst er es schon zu oft gehört. »Kennst du die Familie? Sie leben ein, zwei Kilometer von deinem Haus entfernt. Engländer.«
Stanton hatte von ihnen gehört. »Nicht wirklich.«
Dieter rollte sich eine weitere Zigarette, bröselte Tabak auf seine Hose. »Der Vater ist, du weißt schon.« Er tippte sich an die Schläfe. »Louco. Als sie kamen, hatte er Geld. Vielleicht Drogengeld, wer weiß? Er wollte sich von mir einen Swimmingpool bauen lassen. Sie leben in einem Wohnwagen, aber er will einen Swimmingpool. Ich hol die Erdarbeiter, und bevor der Pool fertig ist, sagt er, jetzt bauen wir das Haus. Ich hör auf mit dem Pool und fang an mit dem Haus, aber bevor das Dach drauf ist, ist das Geld alle. Die Frau ist wie ein …« Dieter dachte einen Augenblick nach. »Wie nennt man das Stück Stoff, mit dem man Teller sauber macht? Ein Spüllappen, ja wie ein Spüllappen. Sie haben einen Jungen, ungefähr elf, zwölf«, sagte er rasch, um endlich zum eigentlichen Thema zu kommen, »und natürlich das Mädchen, Ruby. Sie hat die Schule geschmissen und macht nur Ärger. Es gab eine Schlägerei zwischen ihr und den Huren vom Bordell. Weißt du, wo das ist? Neben dem GNR. Die Polizei passt auf die Mädchen auf. Diese Schlägerei – wie ich gehört habe, ging’s ganz schön zur Sache – die Huren haben gesagt, dass sie ihnen das Geschäft ruiniert, weil sie’s umsonst macht.« Er verschob die Knie, stieß gegen den Tisch und hielt ihn fest. »Das ist die Geschichte. Wahrscheinlich stimmt sie nicht. Aber das ist die Geschichte.«
Stanton stellte sich das Mädchen vor, ihr T-Shirt unterhalb der Brüste abgeschnitten, ihr Fuck-you-Gang, die lächerliche, mit Schmetterlingen verzierte, gestohlene Sonnenbrille. Fünfzehn, vielleicht sechzehn. Anämische Haut und Grübchen in den Knien. Unattraktiv, ungebildet, behindert. Das Hörgerät war prähistorisch. »Arme Schlampe«, sagte er, stand auf und entschied sich gegen ein weiteres Bier und für einen Macieira.
Er ging hinaus zu seinem Pick-up und drückte die Hand gegen die Tür, wo die Sonne das rote Metall weiß schimmern ließ. Er fuhr aus dem Dorf, vorbei an den Orangenbäumen, die die schmalen Gehsteige säumten, an der Wasserpumpe, wo eine bucklige alte Frau Plastikbehälter füllte, an dem kleinen Platz mit den protzigen Blumenbeeten und dem dunkelgrünen Teich mit den vielen Fröschen und bog rechts ab an der Ampel, die nicht dazu diente, den Verkehr zu kontrollieren (an dem Mangel herrschte), sondern ein Zeichen für die Zukunft setzen sollte.
Er betrat das Haus und ging geradewegs zum Computer im Schlafzimmer. Abgesehen von zwei Stühlen und einem Hocker auf der Terrasse befand sich die gesamte Einrichtung hier. Für ihn gab es eine Korrelation zwischen der Leere des Hauses und der Qualität seiner Arbeit, die Kargheit des einen versprach die Fülle der anderen. Er las die letzten paar Seiten auf dem Bildschirm, löschte und fügte hinzu und versuchte, in die Geschichte einzutauchen. Er stand auf und setzte sich wieder. Er biss die Zähne zusammen. Es war hoffnungslos. Es war, als wollte man sich umbringen und versuchte, sich mit dem Gesicht im Waschbecken zu ertränken.
Er fuhr den Computer herunter und beschloss, keine Unterbrechungen am Vormittag mehr zuzulassen. Er nahm sein Buch und ging auf die Terrasse und schaute zu den Korkeichen jenseits des Gartens, den dicken, geschälten erdroten Stämmen, den weit ausgreifenden bemoosten Ästen, die bis in eine uralte Zeit zurückreichten. Stanton setzte sich, schlug das Buch auf und wurde sofort abgelenkt von einer Eidechse, die in einen leeren Blumentopf hinein- und wieder herauskroch. Er wandte sich erneut dem Buch zu, quälte sich durch ein halbes Kapitel und warf es dann in den Garten.
Es war vermutlich das schlechteste Buch, das er je versucht hatte zu lesen. Er fällte dieses Urteil und fühlte sich augenblicklich aufgeblasen von dieser Recherche. Er war wie ein Sumo-Ringer, der sich Ballettschuhe anzog in der Hoffnung, Pirouetten drehen zu können. Was konnte er schon noch über Blake erfahren? Je weniger er über ihn wusste, umso einfacher wäre es, den Roman zu schreiben. Himmel, womöglich könnte er sogar etwas erfinden.
Ohne die Tür abzusperren, eine Gewohnheit, die aufzugeben er sich gezwungen hatte, schlenderte er die Terrassentreppe hinunter, aus dem Garten und vorbei an den Eukalyptusbäumen mit den zarten Blättern, die psst-psst machten, still waren, sich erneut regten und wieder beruhigten. Er ging die übliche Strecke in den Korkeichenwald, ohne Freude zu empfinden, außer bei dem Gedanken an den Gin, den er bei seiner Rückkehr trinken würde. Zwischen den Eichen standen hier und dort Pinien, und er hob einen Zapfen auf, trug ihn eine Weile in der Hand und ließ ihn wieder fallen. Die Bäume standen jetzt weiter auseinander, ließen Platz für Grasflächen und Schafe. Der Schäfer trug über seinem Hemd ein Schafsfell, in das ein Loch für den Kopf geschnitten und das in der Mitte mit einer Schnur gebunden war. Stanton winkte. Den ganzen Tag – der Mann verbrachte den ganzen Tag damit, Schafe zu hüten. Die Dürftigkeit seines eigenen Unterfangens war beschämend.
Er kam zu einer Lichtung, auf der alte Bäume gefällt worden waren und die Frühlingsblumen üppiger wuchsen, und blieb stehen. Hier wucherten Anemonen, Zistrosen, Gemeines Seifenkraut und wilde Geranien. Der Stechginster spross gelb auf den Baumstümpfen.
»Sie sind Engländer«, sagte der Junge. Stanton hatte ihn nicht bemerkt.
»Hallo, Landsmann«, sagte er.
Der Junge wurde unsicher. Er köpfte Blumen mit einem Stock.
»Wir sind beide Engländer«, sagte Stanton.
»Schaun Sie«, sagte der Junge und warf den Stock. Er flog hoch und landete etwas entfernt in den silvas.
»Guter Wurf.«
»Ja«, sagte der Junge. »Danke.« Er lächelte und rieb sich mit der Hand über den Kopf, der nahezu kahl geschoren war; die Kopfhaut schimmerte rosa. Läuse, dachte Stanton. Die Nase des Jungen war mit Sommersprossen gesprenkelt, die sich bis auf seine Wangen zogen. Es war ein hübsches Gesicht, offen und willig.
»Sie schreiben Bücher«, sagte der Junge. »Ihr Wagen gefällt mir.«
»Ich gehe zurück«, sagte Stanton.
»Ich auch.«
Sie gingen gemeinsam den tief gefurchten Weg entlang. Der Junge stampfte mit den Füßen im Gras auf, damit die Grillen aufhüpften. Seine Schuhe sahen aus, als würden sie den Heimweg nicht überstehen. Er fand einen marmorierten Stein, schnappte ihn sich und steckte ihn in die Tasche.
»Wie heißt du?«, fragte Stanton.
»Jay«, sagte der Junge. »Jay Potts. Wir hatten auch so ein Auto wie Sie.«
»Was ist damit passiert?«
Der Junge hob die dünnen Arme. »Zu Schrott gefahren.«
»Papa oder Mama?«
»Ich.« Er schwieg, und als Stanton das Schweigen nicht brach, fuhr er fort: »Ich fahre nur auf Nebenstraßen. Auf so Wegen wie diesem, bei unserem Haus und auf den Wiesen. Weiß nicht genau, was passiert ist. Nur dass ich gegen einen Feigenbaum gefahren bin und wochenlang so ein Halsding tragen musste.«
Stanton lachte. »Und womit fährst du jetzt?«
»Mein Vater hatte einen Traktor und hat mich manchmal damit fahren lassen, aber er hat ihn in den Graben gefahren, und wir kriegen ihn nicht mehr raus. Und wir haben noch den Renault 4, aber mit dem fahre ich nicht. Fragen Sie mich nicht, warum.«
»Warum?«, fragte Stanton.
»Ich weiß es nicht«, sagte Jay. »Fragen Sie mich nicht.«
Eine Eule flog über die Bäume und in niedriger Höhe über den Weg. »Die ist früh aufgestanden«, sagte Stanton. Er dachte daran, etwas Vitamin C zu sich zu nehmen und den Saft einer Orange in seinen Gin zu pressen. »Gehst du in die Schule oder hast du Wichtigeres zu tun?«
Sie kamen wieder am Schäfer vorbei, und Stanton wechselte ein boa noites, und der Junge sprach Portugiesisch mit einem so starken Akzent, dass Stanton nichts verstand. Sie gingen die Anhöhe zum Haus hinauf, die Eukalyptusbäume kamen in Sicht, wässrig im dämmernden Licht. Der Abend lag vor ihm, und Stanton begann, sich zu entspannen.
»Wir müssen nicht reden«, sagte der Junge. »Ich geh einfach mit Ihnen.«
Ein Paar schlanker Zypressen markierte den Beginn des Grundstücks. »Friedhofsbäume«, hatte Dieter gesagt, als er gekommen war, um seinen Kostenvoranschlag abzugeben. Sie standen auf jedem Friedhof, wurden hoch und dick auf den Ablagerungen in der Erde. Jay stemmte die Hände in die Hüften. Er starrte auf den Boden und trat mit den Fersen in den Staub. »Also«, sagte Stanton. Jay blickte in die Ferne, als hätte er ein schwieriges Thema angesprochen.
»Ich habe vielleicht ein Coke im Kühlschrank.«
Sie tranken auf der Terrasse und sahen zu, wie die Sonne am Himmel tiefer sank. Stanton freute sich anfänglich über die Gesellschaft des Jungen, als hätte er etwas Unangenehmes zu erledigen, das er so noch eine Weile aufschieben konnte. Jay nippte an seinem Getränk, streckte es. Seine Arme waren mager, aber kräftig, die Muskeln zeichneten sich blau ab. Er sagte nichts, bewegte sich kaum, hoffte vielleicht, vergessen zu werden.
Nichts veränderte sich, aber alles begann anders auszusehen. Der Junge war im Weg. Stanton schaute zu dem fernen Hügel, der wie eine Pyramide geformt war, und versuchte, die seltsame Beklemmung abzuschütteln. Das Gefühl, dass der Junge ihn davon abhielt, den Abend zu beginnen, wurde langsam stärker, obwohl er nichts zu tun hatte. Er wollte gerade etwas sagen, als Jay aufsprang. »Muss jetzt gehen.« Auf der Treppe wandte er sich um. »Mir gefällt Ihr Auto.«
»Irgendwann darfst du mitfahren«, sagte Stanton, erleichtert und großzügig. »Aber ich sitze am Steuer.«
Er öffnete eine Flasche vinho verde und ging ins Schlafzimmer. Er setzte sich auf die Bettkante, trank und betrachtete die Schatten an der Wand. Wenn ein Mann Erfolg haben soll, dachte er, dann erst spät im Leben. Nicht so spät, dass ihm keine Zeit mehr bleibt, ihn zu genießen. Aber auch nicht so früh, dass er noch zu wenig Erfahrung hat, um ihn schätzen zu können. Er dachte es nicht zum ersten Mal, aber er dachte es zum ersten Mal an diesem Tag, und das, so meinte er, war so etwas wie ein Fortschritt.
Stanton arbeitete. Da er keine Vorhänge hatte, erwachte er bei Sonnenaufgang, und statt sich das Laken über den Kopf zu ziehen, stand er auf und ging zum Tisch. Die Tage wurden länger. Bald schien es, als wäre er kaum ins Bett gegangen, bevor die Sonne ihn wieder rief. Dennoch stand er auf und ließ sich nicht unterkriegen. Nachmittags redigierte er das Geschriebene und hielt die Verzweiflung mit wütenden Kürzungen und einer Flasche des örtlichen Brandys im Zaum. Dieter lernte, erst nach fünf Uhr aufzukreuzen. Manchmal tranken sie auf der Terrasse, meist gingen sie ins Dorf. Dieter fand eine Frau. Eine Holländerin mit großen Knochen und einem enttäuschten Gesicht. »Sie sind lächerlich«, sagte sie. »Diese Portugiesen.« Sie klopfte mit zwei Fingern auf den Tisch, und Dieter nickte. Stantons Schweigen wurde, so vermutete er, als Zustimmung gedeutet, aber es war ihm gleichgültig. Das ständige Gejammer war ein Tonikum, eine Immunisierung gegen diese Krankheit der estrangeiros.
Das Potts-Mädchen suchte das Dorf heim. Sie war immer allein. Auch wenn sie unter Leuten war, war sie allein. Stanton sah sie in der Bar neben der Casa da Povo