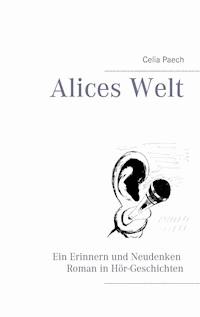
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Alice, das Fluchtkind, will eine bessere Welt. Die Ich-Erzählerin beobachtet kritisch die Gesellschaft, stellt sich Fragen der Zeit, mischt sich ein, reflektiert die Folgen, setzt Akzente, verändert, zieht Bilanz - in einer fiktiven Radio-Sendereihe "Erzähltes Leben" als Podcast im Internet. Alices Welt ist erdverhaftet, schnörkellos realistisch, menschenwarm. Hör-Geschichten, die ein Erinnern sind und ein Neudenken mit Impulsen zum Handeln im Hier und Jetzt. Dieser Roman ist eine Hommage an das Erzählen in gesprochenem und geschriebenem Wort.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 349
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gewidmet den Alices dieser Welt und allen, die mit dem Herzen sehen … und handeln.
Hinweis:
Die Namen der Personen sind geändert oder frei erfunden. Die Handlungen und Geschehnisse können sich so oder so ähnlich ereignet haben. Der Roman enthält autobiografische Elemente.
© Copyright 2017 Celia Paech: Alices Welt
© Grafik: Gisbert Paech
Inhalt
Die Schachtel
Krähen im Erdbeerfeld –schwarzrotgrün
Menschen, Medien, Messages
Bilder in die Augenin die Seelen
Knick im Sofa-Kissen
Abenteuer Armut
Mobil – freier Menschen Knebel
GöttlichWeibliches
Erzähltes Leben
AbschiedsWelt
Alices Traum
Minimal-Lyrisches
Stimme aus dem Off: Sie hören die Sendereihe „Erzähltes Leben“. Heute: „Alices Welt“. Erstes Kapitel: „Die Schachtel“.
Leise erklingen Synthesizer-Klänge, eine Melodie schwingt sich hoch, nimmt den Zuhörenden mit und senkt sich zu einem Musikteppich, der die Stimme unterlegt. Androgyn. Nicht eindeutig als männlich oder weiblich einschätzbar. Wohlklingend. Sie fährt fort:
Die Schachtel
Alice, das Fluchtkind, entdeckt eine Heimat, erschließt sich ein Zuhause in einer kleinen Stadt neben einer großen Stadt an einem väterlichen Fluss. Fremdsein weicht Vertrautheit. Sie baut ein Nest für ihre Küken, nicht rund, wie sie es liebt, höhlenartig, naturbelassen, erdumschlungen. Mit Ecken vorgegeben, in die setzt sie liebevolles Geborgensein, Sich-Freuen auf jeden Tag, Mit-Fühlen mit allem Lebendigen, guten Willen für gutes Tun, kritisches Blicken nach innen und außen, weltoffenes Leben. Alice schafft sich ihre eigene Höhle, ein Rund im Eckigen. Sie liebt es, sich zu verkriechen, um Kraft zu schöpfen, gestärkt hervorzutreten in die Welt der Zacken, Kanten, Winkel, Spitzen, um mitzuteilen wie schön RUND ist, voll Harmonie.
Die Musik blendet sacht aus.
Alice beginnt zu erzählenmit leicht knarrender Stimme, ein Laptop vor sich auf dem Studiotisch:
Einst hatte ich ein Haus. Es war nicht groß, aber ich fühlte mich wohl darin. Nun gut, nicht immer. Es gab Zeiten, zwischendurch, da war mir unwohl, ich fühlte mich belastet, verunsichert. Doch über fast dreißig lange Jahre blieb es mein Zuhause, mein Heim. Ich nahm zwölf Monate Abschied von ihm, seinem Flair, seinen Räumen, seinen Wänden, seinen Geschichten, seinem Leben. Bis ich es verließ und weit weg ging.
Das Haus nannte ich liebevoll 'Meine Schachtel'. Es gab mir Geborgenheit. Hier wuchsen meine Kinder auf. Frei, so laut sie sein wollten, unabhängig von sich einmischenden, meckernden Mitbewohnern oder Vermietern. Rundrum frei - mit Gartenhof und Gärtchen. Umzäunt. Freistehend, wie die Maklerin titulierte, als ich es verkaufen musste. Gartenbungalow freistehend Wohlfühlhaus. Eine Fremde, Haus-Erfahrene, beschreibt mein Haus beim ersten Betreten als 'Wohlfühlhaus'. Setzt dieses Wort in den Ausschreibungstext ins Internet, in den Schaukasten, auf die Anzeige – Wohlfühlhaus. Fast drei Jahrzehnte. Erbaut in wenigen Wochen. Herbst 1975 entstand der Keller. Ein Kuriosum wie später manche sagten. Teilunterkellert mit einem weiten Kriechkeller, gerade einen knappen Meter hoch, gebückt auf Knien zu durchrobben. Labyrinth mit Wänden, Türöffnungen – geheimnistragende Spielwelt meiner Kinder, ihrer Freunde. Später vollgestopft mit Dingen dieser Zeit.
Unser Haus barg liebendes Vertrauen, Ehebruch, Jugendkrisen, Tränen und viel Lachen.
An einem Montagfrühmorgen im Mai nach dreißig Jahren schwebte der viele Tonnen schwere Kran ein: Kreissäge, Dachfräse, etliches Material. Vier Männer schnitten fünf Tage lang stückweise die Teerkieshaut auf, den Unterbau aus Holz, das Dämmvlies, erneuerten Meter für Meter die große Fläche, den Schutz vor Sonne, Schnee, Eiswind und Regen. Es entwich der Geist, Erinnern und Erleben, verschlossen fest in meiner Schachtel. Stück für Stück. Viereck nach Viereck. Öffnung des Siegels. Entfloh in Bildern, Hauch, in Seele leicht, hoch in den sonnenklaren Frühlingshimmel. Blieb kurz haften in den Bäumen, der mächtigen Birke, der süßen Kirsche, dem Bergahorn mit den kanadischroten Blättern. Hing eine Weile in der Zypresse, nahm mit den Duft des üppigen Wachholder. Hinweg ins Freie, unendlich Weite, in die Höhe. Machte Platz für meinen langen Abschied, gedankenschwer. Öffnete sich für neue Menschen. Die Familie, Patchwork zusammengefügt, die unser Haus im Winter nach dem Mai mit ihrem Alltagsleben füllte und neu beseelte.
Die Musik ertönt erneut. Es ist „Oxygène“ von Jean-Michel Jarre. Der 'Ohrwurm' damaliger Zeit. Sphärenklänge wie aus dem All.
Einst hatte ich dies Haus. Es war aus Holz, aus Rigipsplatten, Glas, Steinen und Beton. Fertighaus der Zeit, Flachdach-Bungalow, umsäumt von Straße, Bürgerweg und Mauer, Zaun zum Nachbarn hin. Ich seh’ die Kinder spielen. Im Bausand vor dem Haus, sich Bretterbuden basteln. Zwei Wochen war die Bauzeit, täglich fuhren wir hinaus. Mach du das, sagte mein Mann. Gern war ich diese Bauherrin. Lieferungen unterschreiben, Kaffee und Gebäck fürs Fertighaus-Bauteam aus Jugoslawien mitbringen. Sie arbeiteten im Akkord. Zwanzig Stunden lang die erste Woche, bis es dunkelte. Sie schliefen in einem Bauwagen auf dem Firmengelände, wie sie sagten in gebrochenem Deutsch. Beschweren, nein, das dürfen wir nicht. Wir verdienen gutes Geld. Wir kehren bald zurück. Ich baue mir ein Haus für meine Frau, meinen kleinen Sohn, der aussieht wie Ihr Kleiner, sagte ein junger Mann. Er nahm ihn auf den Arm, Tränen im Blick. Ich habe große Sehnsucht, weiß nicht, ob ich das schaffe. Zwei Tage später war er fort. Der Bauleiter sagte, es ist ein Fehler, dass ich immer mit den Kindern komme. Das tat mir weh, doch wusste ich und sagte still für mich: Ja, das war richtig, dass du gingst. Das wichtigste, das sind die Kinder, das ist dein Wohlfühlgefühl.
Noch vor Ostern zogen wir ein. Mit Kisten und Kästen aus der kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung unterm Dach, weg von der Vermieterin darunter, die sich störte am Getrappel kleiner Füßchen, als unsere Tochter laufen lernte und lange noch flink über Teppichboden und PVC-Fliesen krabbelte. Der Kinderwagen im Treppenhaus sie täglich ärgerte. Wohin denn sonst, die Wohnung war zu klein. Vergaß sie, wie es war, als sie mit ihren Söhnen auch zur Miete wohnte? Die Frau trägt die Nase hoch. So sagten die Nachbarn, direkt nebenan die alte Frau, die meine Kleinen ins Herz geschlossen hatte, mir viel erzählte vom Dorf und seinem Leben. Schlicht und ehrlich war sie, nicht ohne Humor. Sie war traurig, weil wir wegziehen wollten. Weg von der stark befahrenen Straßenkreuzung, den Schrammborden, nur gegenüber gab’s den Bürgersteig. Weg vom Bäcker, Fleischer hinter dem Trafohäuschen. Weg vom Lärm, Gestank der großen Stadt. Weg von der Grundschule, in der ich monatelang fürs Lehramtsstudium praktizierte, allein unterrichtete in Musik, Deutsch, Rechnen, Heimatkunde, allein, gegen jede Regel, aus Lehrernot - und meine Liebe zu Kindern vertiefte, die wie die Kletten an mir hingen in den Pausen und später mit mir und meinen Kleinen spazieren gingen, den Kinderwagen schoben, mir Gemaltes und Gebasteltes mitbrachten und uns mit Mutter im neuen Haus besuchten. Weg von den Feldern mit Getreide, Kohl und Rüben. Weg von dem Arzt, zu dem auch der berühmte Sänger Heino ging, der mit den lichtempfindsamen Augen, der wohltönenden Stimme 'Schwarzbraun ist die Haselnuss ...' ist mir im Gedächtnis geblieben, als auf dem Schulplatz das große Festzelt stand und Heino ein Heimatkonzert gab, zu dem alle, alle kamen, nur nicht wir. Bis morgens früh sangen die Leute begeistert, noch als der Star längst gegangen war. Unsere Musik war Jazz, waren Lieder von mittelalterlichen Barden, Folklore, auch Westernsongs zu dieser Zeit, französische Chansons vom Leben und vom Meer, Lieder mit Inhalt, Romantik und politischem Protest. Und heute rockt der alte Sänger in Lederkluft und dunkler Brille die Fans in ausverkauften Sälen. Vom Heimatlied zum Heavymetal. Die Texte unverändert. Mutig, schmunzle ich für mich. Ein Generationen mitreißender Erfolg.
Tief in Gedanken verlasse ich meine Schachtel, mein Haus. Mein Abschiedsgang. Beschreite gewundene Wege zwischen vielen anderen Schachtel-Häusern, ein- oder zweigeschossig. 'Gartenhofbebauung' stand in der Bauleitplanung. Die Stadt erhielt einen Preis für Fuß- und Radwegefreundlichkeit. Wege nicht straßenbegleitend, sondern durch das Labyrinth der Schachtel-Häuser führend. Schwierig für Fremde, sich hier zurecht zu finden, die Hausnummern-Logik verstand keiner. Verschachtelt - die Neubauviertel der kleinen Stadt.
Ich gehe den kleinen Berg hinunter durch den Park, verweile am Ehrenmal für Kriegsopfer aller Weltkriege, nein, für die gefallenen Soldaten, die Helden dieser Stadt, nicht für die zivilen Opfer, da hätten die zwei Bronzetafeln mit Namen nicht ausgereicht. Ein hübsches rundes Bauwerk, 19. Jahrhundertstil, schiefergedeckt, eine kleine Kapelle, vorn offen zum schmiedeeisernen Gitter, mit Stufen zum Niederknien und Beten – an Gedenktagen. Stets brennen Lebenslichtkerzen im Innern. Dauerhaft haltbarer Grabesschmuck am kleinen Altar. Ruhe, Besinnlichkeit.
Gern saß ich davor auf einer Bank. Doch das Schönste an dieser Stelle war die riesengroße Kastanie, mehr als hundert Jahre alt, ausladend kugelige Krone. Tags und nachts eine Augenweide in seiner machtvoll stillen Vollkommenheit. Achtsam gepflegt, mit Beton ausgegossen, mit Stahlseilen manch morsch werdender Ast gehalten, die Form gewahrt. Zu Silvester in sternenklarer Nacht eine Silhouette naturkunstvoller Harmonie. Und darunter die Lichter der kleinen Stadt, ein Straßendorf, eine gerade Landstraße, links und rechts Bauernhäuser zu Geschäftshäusern umgebaut, kein eigener Charakter, zerstört zu achtzig Prozent von Bomben der Alliierten im Zweiten Weltkrieg. Nur die alte Kirche blieb stehen, nahezu unversehrt. Kunst der Geomantik, der richtigen Ortswahl für ein Bauwerk, die der Klerus seit Alters her pflegt.
Das Dorf, die kleine Stadt, die – als wir ihre BürgerInnen wurden – achttausend Seelen zählte, als ich sie endgültig verließ, lebten hier fünfundzwanzigtausend Menschen. Die Bebauung nach oben ausgedehnt bis zum weitläufigen Waldgebiet, dessen Zugang ein Autobahnzubringer sperrte. Eine Zäsur. Fußgängerbrücken, ein paar Autobrücken. Abruptes Trennen von Lebensadern zwischen Mensch und Natur.
Ich gehe weiter durch den Park, die Rasenlandschaft am kleinen Flüsschen entlang nach Süden. Überschwemmungsgebiet. Im Frühjahr und Herbst fluteten die ins Betonbett gezwängten Wasser reißend die Auen-Wiesen. Ich sehe vor mir das fröhliche Lichtermeer um loderndes Martins-Feuer, wenn ganze Bäume hoch geschichtet in Flammen aufgehen und sich Hunderte rotwangige Kindergesichter mit leuchtenden Augen im Halbkreis drängen, selbst gebastelte Laternen an gestreckten Ärmchen im Abendwind pendeln, helle Stimmen die traditionellen Lieder singen und sehe im Erinnern den 'Heiligen Sankt Martin' mit Goldhelm und Purpurgewand auf einem hohen Ross ums Feuer reiten. Ein heimeliger Brauch im Rheinland im November. Fackelzug durchs Städtchen. Danach das 'Schnörzen', Liedchen singen von Haustür zu Haustür mit Laterne – und die Nachbarn füllten die mitgebrachten Säckchen der Kinder mit Süßigkeiten, Mandarinen und Äpfeln. In der letzten Zeit zogen die Kinder nur noch vereinzelt durch die Wege der Siedlung. Ängstlich beäugt von vorsichtigen Erziehenden, die abseits im Dunkeln standen. Es hatte Übergriffe gegeben und die Medien warnten. Das Vertrauen in die Gemeinschaft der Gebenden war beschädigt. Es passiert halt so viel, hieß es. Schade! Heute ist Halloween zu Ende Oktober beliebter. Leuchtende Kürbisköpfe grinsen am Hauseingang oder von Gartenzaunpfosten. Die Kinder, verkleidet als kleine Monster, rufen: Süßes oder Saures? Und die Gabe ist Geld. Amerika lässt grüßen. Globalisierungskultur.
Mein Weg führt mich über die geschwungene Holzbrücke mit aufwändigem Schindeldach, kleines Bänkchen, fast asiatisch im Stil. Objekt kommunalpolitischen Streits. Des Bürgermeisters Idee, auch der Teich am Spielplatz. Nett gedacht. Doch ging der Bau zu Lasten der sozialen Arbeit mit Kindern und jungen Menschen. Der Teich wurde bald umzäunt und vergittert, nachdem fast ein Kleinkind ertrunken wäre. Der Kletterturm zwischen Teich und Spiellandschaft wurde bald entfernt, nachdem sich die ersten Obdachlosen des Städtchens nächtens einquartierten, Schnaps- und Bierflaschen, zerbrochenes Glas, stinkende Essensreste das Idyll zerstörten und den Nachwuchs zu gefährden drohten. Später besetzte die Jugend der Stadt dieses Brückchen. Treffpunkt für heimliche Liebesspiele im Dunkeln oder zum Rauchen von Grass, Marihuana, Hanf – dem Vorbeigehenden würzig zur Nase schwebend. Wer nicht zur Gruppe dazu gehörte, traute sich nicht mehr diesen Weg zu gehen.
Die hölzerne Brücke erobert von jungen Menschen, die sich zurückholten, unbewusst, was Politiker ihnen vorenthielten, ihren Frei-Raum. Entscheidungsträger im Städtchen, die lieber bauten, betonierten, asphaltierten. Fußwege, Straßen, Betonanlagen für städtisches Grün, Überführung, Unterführung für Straßen, die die Schachtel-Haus-Haufen trennten wie Grenzen, grauer Beton. Grau in Grau. Hart knallt der Blick auf Wände, die Jugend später in Nachtaktion mit Sprüchen und Bildern farblebendig besprühte.
'Brutalismus'-Bauwerke, nannte man später diese Architektur. Roher, unverputzter Beton. Plattenbauten und Trabantenstädte. Darin lebten nicht die Konstrukteure und Bauherren, sondern Familien, die sich nicht wehren konnten. Heute schreien die Ghettos nach der Abrissbirne.
'Wirklich wichtig ist das, was wir sehen', meinten die Verantwortlichen. Erziehung ist ein Fass ohne Boden, Prozess über Jahre, Ergebnis weit fern. So entschieden die Menschen, selbst Kinder im Haus, ganz gegenständlich, fast kindlich, nur das zählt, was ich begreifen, was ich anfassen kann.
Ich nähere mich dem Stadtteil mit hoher Schachtelbebauung, sechs- bis zwölfgeschossige Häuser, Flachdach, Betonfertigbauweise, Fahrstuhl, Klingeln und Namensschilder in unerreichbarer Kinderhandhöhe. Der soziale Brennpunkt. Bausünde jener 1970er Jahre, relativ groß für das kleine Städtchen, relativ klein gemessen an Städten in Ballungsgebieten. Aufgeschachteltes Leben. Menschen gestapelt, versorgt, weggesperrt. Hier wohnten von jeher die Migranten. Gastarbeiter mit ihren nachgezogenen Familien, Deutsche mit geringem Einkommen, immer mehr Alleinerziehende mit vielen Kindern. In viel zu kleinen Wohnungen. Ein buntes Völkergemisch. Wer konnte zog weg. Es blieben vor allem die Kraftlosen, die arabischen Fremden, die Sprachlosen, die Russlanddeutschen und der Geruch von Gewürzen und Wodka. Hinzu kamen Ratten, angelockt von organischem Müll am Rande und im stehenden Wasser des Flüsschens. Halbherzige Nachbarschaftsfeste vor allem zur Wahlzeit rückten das Leben und Leiden der Menschen ins Bild. Es gab manche Hilfen, doch letztlich blieb stehen, was einmal erbaut, vergammelt, von Wettern gebeutelt. Spiele für Kinder, Gegrilltes, Salate, Baguette und auch Bier. Den Menschen Vergessen schenken für einen Moment. Ein offenes Ohr für die Nöte. Ein Lächeln, Verständnis, wir sind alle gleich, wir BürgerInnen des Städtchens. Das Ende eines jeden Festes war auch immer gleich: Beschimpfen, Zerraufen, Fresse einschlagen im Alkoholrausch bei einigen Frauen und Männern. Das war’s. Es änderte sich nie etwas. Und gleicher wurden sie sich nicht.
Erst kürzlich erfuhr ich, dass keine Partei mehr ein Fest dort veranstaltet. Es gibt ja die Märkte, Straßenfeste der Geschäftsleute, des City-Marketing. Die Einkaufsmeile und der Neue Markt. Das ist sauber, geregelt, Polizei und Bürgerschaft kontrolliert. Dort haben Parteien ihre Stände für Glanzdruckbroschüren, Luftballons, Stifte und verständnisinniges Lächeln. Sprechen mit ihresgleichen, doch kaum noch mit Menschen der 'Unterschicht'. Ihnen fehlen Rezepte gegen die neue Krankheit, sie verbergen die eigenen kalten Ängste vor dem Abrutsch ins ökonomische Nichts.
Gitarrenriff. Ein Saitenklimpern. Die leicht quetschige Stimme Franz Josef Degenhardts raunt ins Mikrofon. „Spiel nicht mit den Schmuddelkindern“. Er singt sein Lied von den Welten der Unterstadt und der Oberstadt und dem Reiz der Anarchie. Metallisch verklingt der Gitarrenton.
Alice setzt ihren Erzähl-Rundgang fort:
Der Weg wird lehmig, grasbüschelwurzelig. Ich gehe weiter am Flüsschen entlang in Richtung der Reiterhofburg vorbei an den letzten Flachdachbungalows im Süden der Stadt. Verkaufen lassen sie sich schlecht. Eigentümerwechsel schafft die Zwangsversteigerung hier im Schatten der verkommenden Hochhaussiedlung. Ich wende den Schritt parallel zur Zubringerautobahn, quere die Kreis-Straße, die die hinteren Dörfer mit dem kleinen Mittelzentrum unserer Stadt verbindet, schlage den Weg zur Neuen Mitte ein. Hier gab es kaum Häuser mit Flachdach, der Architektenfantasie wenig Grenzen gesetzt: Steildach, Pultdach, Walmdach, versetzte Dachkonstruktionen, gewölbte Dächer. Baugebiet der 1990er Jahre.
Aus den Fehlern früherer Stadtplanung gelernt. Bewegtes Bild. Und dennoch öde. Keine Farbe. Die Häuser weiß, die Dächer anthrazitschwarz, manchmal rot. Labyrinthartige Fußwege beibehalten. Nur im Sommer belebt das Grün der Gärten, Wege begleitende Büsche, Ranken, Hecken, Platanen, Akazien, Birken die Kleinstadtlandschaft. Zu viele Bäume, zu viel Laub zu kehren – beklagen die Einen. Die Wurzeln treiben das Betonsteinpflaster hoch – sehen andere Gefahr fürs alltägliche Gehen. Nur wenige sind zufrieden. Die Motorsäge wird bald verstümmeln und lichten die wuchernde Vegetation.
Ich umrundete eine der vielen kleinen Baustellen, die dem Übel abhelfen sollten. Bäume fällen, Wege plattieren, begradigen, gewundene Wege, die außer Schulkindern und Jugendlichen kaum jemand geht. Gefallen ist noch keiner. Bürgersteige absenken, die wenige Jahre zuvor erst geplant und gebaut, eine Zentimeter-Hürde für Kinderwagen, Fahrrad, Rollator und Rollstuhl. Im Haushalt der Stadt sind Hunderttausende dafür vorgesehen und verausgabt. Der Gedenkstein zum Tag der Deutschen Einheit, ein kostbarer Findling kolossaler Größe – kein Thema im Jahr 1990. In gleicher Sitzung des Stadtrates kürzte die konservativ-liberale Mehrheit die Gelder für die Jugendarbeit, das Obdachlosenheim, die Sozialarbeit, Bildungsangebote und appellierte an ehrenamtliches Engagement. Nur schwach die wenigen Gegenstimmen.
Meine Stadt. Eine von vielen am Reißbrett entstanden, die Ballungszentren zu entlasten. Hier wohne ich, hier kaufe ich ein. Der Slogan der örtlichen Werbegemeinschaft. Hier wohne ich, hier lebe ich gern, hier will ich mitgestalten. Mein Wunsch, mein Interesse zu verändern, was mir nicht gefällt, was mir für andere besser erscheint. Ich machte mich auf den Weg, im kommunalen Geschehen politisch mitzumischen. Die 1980er Jahre mobilisierten. Das Land war im Umbruch. Proteste, Demonstrationen, unzählige Bürgerinitiativen. Eine Revolution von unten - auf nie vorher dagewesene Art. Unser Haus, meine Schachtel, wurde Stätte des Wirkens, Brut-Stätte schwärmerischer Weltenverbesserung - das bürgerliche Wohnzimmer eine Zelle der heimlichen Revolution.
Die Sphärenklänge der Synthesizer-Musik heben an und tragen den Zuhörenden eine Weile fort und verklingen, als Alice weiterspricht:
Mein Leben … ist verwoben mit dem Leben anderer Menschen. Vieler. Weil es bunt und lebhaft war. Ich sehe sie vor mir. Einige von diesen Vielen, deren Schicksal mich berührte, mit hineinzog in ihr Leben, mich zu einem Teil ihrer Verstrickungen machten, mit hinein knoteten. Nicht immer gelang es, diesen Knoten zu lösen.
Es ist doch so, nicht wahr, liebe Hörerin, lieber Hörer: Ihr aller Leben verschlingt sich ineinander. Irgendwo zu einer bestimmten Zeit. Spannend. Wie finden Sie den 'Roten Faden'? Den Faden, der – wenn Sie daran ziehen – das Gewirr löst. Ähnlich diesem Fadenspiel zwischen Kinderhänden. Kennen Sie das noch? Ein Finger der einen Hand hebt den um die andere Hand geschlungenen Faden auf, zieht ihn zu sich hinüber, dann nimmt der Finger der anderen Hand einen Faden der einen auf. Und so weiter. Nach bestimmten Regeln. Und das Umschlingen wird enger, immer enger, presst beide Hände zusammen, bis kein Finger mehr Faden von einer Hand aufnehmen kann. Und wir wenden die Hände mit geschicktem Ruck nach unten. Und wir staunen über das Flechtwerk, das sich knotenfrei auflöst in unseren einen Faden, der unser Leben ist und keinen Anfang und kein Ende hat. Und wir erkennen: Alles ist der 'Rote Faden'. Es gehört zu uns, zu mir.
Mein Leben … begann in einer Kaserne. Nebenbei fielen Bomben auf Gleise, über die Züge rollten mit Panzern, Waffen, Soldaten. Richtung Osten. Russlandfeldzug. Stalin, der Feind Hitlers. Sowjetunion, die Macht, die der deutschen die Vorherrschaft streitig machte in Europa. Russen und andere slawische Völker, die seit Urzeiten den Raum besiedelten, den das germanische 'Volk ohne Raum' für seine Zukunft erobern und besetzen wollte. Britische Bomber, die einst Verbündeten, mit den Königshäusern Verwandten, die Feinde wurden, weil kein Herrscher dem anderen Machtzuwachs gönnt. Teile und herrsche. Es kann nur Einen geben. Und sie reden ihren Völkern Hass ein, verdummen mit Propaganda ihrer Medien und hetzen und geifern. Währenddessen floriert der Handel mit bestimmten Waren, Gütern und Geldern. Kriegswirtschaften. Kriegsgewinnler. Spionagenetzwerke. Agententreiben. Und Ländereien werden neu verteilt: Wir hier – ihr dort. Geostrategische Kriegsspielerei. Damals wie heute. Der 'Rote Faden' der Menschheitsgeschichte. Blutig, voll Leid.
Meinen ersten Schrei auf dieser Welt dämpfte das Dröhnen von Bombenfliegern, das von Ferne herangrollte im hellen Licht der kalten Wintersonne. Ein zweiter Schrei, der auch ein erster war, folgte im Schmerzensrausch unserer gebärenden Mutter. Ein Zwillingspaar. Zwei Leben.
Alice hebt die Hand. Die Zwischentöne. Instrumental. Gefälliger Ohrenklang. Ein paar Sekunden. Sie nickt.
Unser Kindsein spielte sich ab zwischen Trümmern, Ruinen, Baustellen und Neubausiedlung – nach dem Fliehen. Der Vater geriet kurz vor Kriegsende in Gefangenschaft, abgefangen von sowjetischen Truppen an einer Grenze, verschleppt in den Gulag im Ural, Schweigelager im Kaukasus – für Jahre. Die Mutter floh - noch im Wochenbett - bei Nacht und klarem Sternenhimmel, vorbei am brennenden Dresden, ins US-amerikanisch besetzte Sachsen, das bald, eingetauscht gegen Berlin, unter sowjetische Vorherrschaft geriet. Sie litt im erbärmlichen Nachkriegsleben, hungerte, eine von vielen kinderreichen Flüchtlingsfrauen in überfüllten Heimat-Dörfern - und floh erneut in einer Sternennacht aus der neuen DDR in die neue BRD im geteilten Deutschland - als die Nachricht kam, der Mann ist frei, erwartet dich im Ruhrgebiet.
Angst. Unsere Lebenswegbegleiterin. Vor britischen und US-amerikanischen Bombern, vor russischen Vergewaltigern, vor Flüchtlingshassern, vor dem Ungewissen. Hunger. Nach Nahrung, nach Geborgenheit. Nach Frieden. Angst und Hunger, Erschrecken und Entsetzen. Scharfe Säuren Mensch gemachter Qualen ätzen die Seelen, brennen in unserem lebenslangen Erinnern.
Aliceschweigt. Stille im Äther. Lippengeräusche. Dann fährt sie fort.
Verängstigt trafen wir den fremden Vater. Im wattierten grauen Gefangenendrillich fegte er den Hof einer Fabrik. Ich hatte Angst vor diesem Mann, fünf Jahre war ich alt, wie ein Vollmond sein Gesicht, fahlweiß verquollen und seine blutigrote Narbe überm Kinn bis hoch zur Wange. Wasser, sagte die Mutter, er hat Wasser, schau, wenn du die Haut eindrückst, bleibt eine Delle. Da waren wir bereits wieder eine Familie mit einer Wohnung und er hatte eine gute Arbeit und ich sah ihm heimlich zu, wenn er bei Sonnenschein sich einen Stuhl auf den winzigen Balkon nach Süden stellte, sein Gesicht mit dieser gezackten schroffen roten Narbe wohlig in die Wärme hielt.
Erst spät, sehr spät hab ich ihm verzeihen können, dass er, ein Offizier mit Befehlsgewalt, das Unrecht mitgetragen, mitgestaltet hatte, vernichtete, mordete. Menschen, die er nicht kannte, die ihm nichts getan hatten. Höheren Befehlen selbst gehorchte und nicht seinem eigenen Gewissen. Verzeihen können, weil ich miterlebte, wie er hart bestraft mit Schmerzen, Leiden, schlimmen Traumata am Kriegsgeschehen, an Folter und Gefangenschaft in Schweigelagern, im Gulag, litt, an Kummer um seine Frau, seinen Kindern, die fernab den Siegermächten ausgeliefert waren. Sein Leben lang nicht loskam von dem Erinnern, sühnte - und eigentlich ein guter Vater für uns war, der sich sorgte, arbeitete und Geld heimbrachte, uns den Lebensweg ebnete und bis ins hohe Alter meine Mutter liebte und verehrte.
Der Krieg hatte ihn hart und verschlossen werden lassen. Eispanzer um die Seele. Sein Fühlen begann erst sehr langsam sich zu regen, den Panzer schmelzen zu lassen. Jahre dauerte es.
Ein neues Erwachen aus lähmendem Albtraumschlaf. Bleischwer. Es dämmerte ein Glücksgefühl. Er hatte überlebt. Er hatte Frau und Kinder – behalten. Doch gesprochen hat er nie darüber.
Väter dieser Zeit züchtigten ihre Kinder mit Teppichklopfer, Ledergürtel, Händen. Wir Kinder dieser Zeit schrien oder schwiegen, bissen die Trauer in uns hinein und litten an diesen Vätern, die nicht das ersehnte Vorbild und kein Freund für uns als Kinder waren. Im Wohlstandswunderland galt noch immer elterliches Züchtigungsrecht und Prügelstrafe. Mein Vater strafte mich noch mehr mit Ignoranz, schloss sich gar für Tage ins Schlafzimmer ein, begrub sein Elend unter vielen Akten mit zähem Fleiß, der half Erlittenes zu verdrängen. Täter war er und Opfer gleichermaßen. Die gesamte Generation - erkannte ich im Älterwerden.
Die kostbaren, schönen Momente bescherte unser Vater, wenn er auf seiner Hohner-Mundharmonika spielte. Lieder, die ihm sein Soldatsein erleichterten, die Gefangenschaft überleben ließen.
Alice tippt auf ein Tabletfeld, wischt mit dem Finger über den Bildschirm und Musik ertönt. Sehnsuchtsmusik der Liebenden. „Wenn der weiße Flieder wieder blüht“. Max-Greger-Orchester. Instrumental. Sie summt mit.
Musik. Jungsein. Jugendlichsein. Teenager oder Backfisch. Der 'Weiße Flieder', Operetten. Das waren die Lieder unserer beiden älteren Schwestern und die unserer Eltern. Wir Nachkriegsgeborene sangen sie ebenso, tanzten Walzer und Foxtrott danach und ließen uns doch vom 'American Way of Life' mitreißen, ertrotzten uns den Jazz, die von unserem Vater verpönte 'Neger-Musik'. Wir erlernten die Besatzersprache, die zur Weltsprache wird: Englisch. Wir sangen und lasen und diskutierten in dieser Sprache – und neideten den jungen Muttersprachlern ihren Vorzug, in einer Welt zu leben, in der fast jeder Englisch spricht. Und wir schwiegen in Deutsch. Wir erlagen der Faszination von Schlagerwelt und Hitparaden im Radio der GI's und Tommy's und dem Reiz bewegter Bilder: Hollywood-Filme, Zeichentrickfilme, Western und neue deutsche Heimatfilme – das Kino prägte unser Heranwachsen, denn Fernsehen hatten wir noch nicht.
Mein Freund spielte Trompete, ich sang in einer Band, die alles spielte, heute sagt man vielleicht 'Crossover' dazu, und er spielte Jazz und Dixieland wie sein Idol Bix Beiderbecke oder Satchmo Louis Armstrong. Ich sang vom 'Tag als der Regen kam', 'Summertime' – besonders stark, da hatte ich noch das hohe C, und immer wieder Blues und 'Jatz'. Mit fünfzehn fing ich an zu singen, 'Tipsy Tigers' hieß die erste Band. Ich sang bei verschiedenen anderen und hörte auf damit, als unsere Liebe sich festigte, zog mit ihm zu seinen Konzerten in die Kellerclubs der Jugend anderer Städte und der westeuropäischen Nachbarländer, saß brav auf Apfelsinenkisten, zerschlitzten Sofas, gammeligen Ex-Bus-Sitzen den ganzen Abend, zuzuhören, ihn bewundernd anzublicken und nur mit ihm zu tanzen. Heitere Leichtigkeit. Für uns selbst. Für unser Jungsein. Auf dem Trümmerfeld. Im kalten Mief der Luftschutzbunker, in die sie uns verbannten. Hier hört euch keiner. Hier stört ihr nicht. Zurück ging’s weit nach Mitternacht bis morgens früh auch in der Woche im vollgepackten VW-Bully-Bus oder im VW-Käfer, manchmal halb liegend unter Schlagzeugtrommeln. Das war ein Feeling. Auf dem Marktplatz noch eine Curry-Wurst und eine Cola. Ich fand’s aufregend, tankte Kraft ohne Schlaf für den nächsten Tag, für Schule, Prüfungen, den Berufsanfang.
Musik ist jung. Kunst ist jung. Erneuert sich über der Kruste des Alten, durchdringt das Historische und verflechtet es mit dem Modernen, mit dem in jeweiliger Zeit Angesagten – zu Neuem. Kraft kreativer Machtfülle – wenn es in ein Vakuum trifft.
Musik. Lebensgefühl im Swing. Seelenschmeichler. Warum habe ich nicht weiter gesungen, das Singen verlernt – als ich anfing Reden zu schwingen, um die Welt zu verbessern, die Welt, wie ich sie sah, wie ich sie erlebte – in meiner wachsenden (Nach-)Kriegs-Phobie? Ich hätte Lieder texten, meine Botschaften in Töne und Rhythmen kleiden, in die Herzen anderer Menschen versenken sollen – wie Musik dies ohne Gleichen zaubert.
Ich entschied mich für das gesprochene und geschriebene Wort, um zu überzeugen. Die Adenauer-Alten, die im Kaiserreich Jungen, erreichte ich nicht, sie schüchterten ein. Sie sind frei von Schuld, erklärten uns die neuen Machthaber und machten sie zu unseren Lehrern. Waren sie das? Frei von Schuld? Hatten sie nicht vorbereitet, was kam und die Menschheit quält bis zum heutigen Tage?
Zunächst lehrten sie uns das Preußentum, uns Entwurzelten brachten sie bei, Gefühle wie Sicherheit, Stabilität, Uniformität schätzen zu lernen – und begannen in Geschichte mit dem Neandertaler, etwas Ägyptisches, viel Griechisch-Römisches folgten, ein wenig Kelten und Nordisches, Mittelalter und Papsttum, Kaiser- und Königreiche, etwas Romantik und Freiheitskämpfe von der Bastille zum Vormärz und Hambacher Fest, an die anzuknüpfen geboten ist.
Von den Weltkriegen unserer Großeltern und Eltern erfuhren wir nichts. Ihr eigenes Erleben blieb stumm. Verloren lag die Weimarer Republik dazwischen. Auslassen, verschweigen. Nur nicht daran rühren. Die Lehrmethode des Eiertanzens dieser Zeit.
Und unser Misstrauen wuchs, wir spürten das Unterschwellige. Und unser angeborener Freiheitswille nährte sich aus dem Geist, der von Westen über den Ozean wehte. Amerika. Vereinigte Staaten von Amerika. Land of the Free. Lady Liberty. Und der Osten ist Rot und voller Gewalt und Unterdrückung. Über das Leben der Menschen in der Sowjet-Union oder dem amputierten östlichen Teil Deutschlands, der DDR, erfuhren wir nichts. Und wir wunderten uns über Hiroshima und Nagasaki, den Atomtod Unzähliger durch amerikanische Bomben, über Korea-Krieg und Stellvertreter-Kriege überall in der Welt, wo die grausam konkurrierenden Machtblöcke ihre Claims absteckten. Wir erstarrten fassungslos angesichts erster Bilder aus dem Vietnam-Krieg. Napalm. Chemische Waffen entlaubten Urwälder, entstellten Kinder- und Frauengesichter, mordeten. Inzwischen wussten wir mehr.
Mit Vierzehn schockte uns die Lehrerin im Fach Geschichte. Sie, die Witwe eines adligen Offiziers des Widerstandes gegen Hitler, zeigte uns, der reinen Mädchen-Klasse, die ersten Fotos in Schwarz-Weiß von verhungerten Gestalten im KZ, von massenweise aufgetürmten bleichen Knochenleichen. Hohläugige 'Muselmane' starrten kraftlos in die Kameras ihrer Befreier – und uns an. Kraftlose Blicke, die sich tief ins Herz des Betrachters bohren … Das 'Tagebuch der Anne Frank', von einer Gleichaltrigen im Geheimversteck in Holland geschrieben, bevor auch sie in der Gaskammer umkam – nur weil sie Jüdin war ... Das war mehr, als ich ertragen konnte. Ich schrie meinen Vater an: Du Mörder. Du Nazi. Du Verbrecher. Die Schuld des Massenmordens. Ich schämte mich, Deutsche zu sein.
Mit Siebzehn reiste ich nach England. 'Die Brücke', hieß der Verein, der deutsche Jugend mit der britischen vertraut machen wollte, in den 1960er Jahren. Meine Gastfamilie, der Vater, ein Major der königlichen Marine, riet mir, um Schwierigkeiten zu vermeiden, mich außerhalb als Schwedin auszugeben, nur nicht als Deutsche. Doch sie wollten eine bessere Zukunft für die Jugend, damit sich nie wieder Coventry und Schlimmeres ereignete, nie wieder ein Hitler Macht erlangte über so viele Menschen. Ich wollte reisen, mich versöhnen, andere Völker und Lebensweisen kennen lernen und offen sein. In den Nachbarländern Europas und in den USA zerfiel der Kreis von Menschen, denen ich begegnete, in Deutschenhasser und in vorsichtige Freunde.
Diese Erfahrungen verunsicherten die Jugendlichen unserer Zeit, zerrieb uns fast zwischen bleierner Betroffenheit, mitfühlendem Hinwenden, Mit-Schuldgefühl und Verantwortung. Wir steigerten uns in politische und kulturelle Aktivitäten für Frieden - und in Abwehrzorn und wütenden Protest gegen die Elterngeneration. Das Lebensziel: Nie wieder! Nicht mit uns!
Unsere Mutter, wortgewandt, belesen, warmherzig und 'hausfraulich', entsprach dem Frauenbild der Zeit. Sie stand 'zwischen Baum und Borke', ein geflügelter Ausdruck, der das Dilemma der Eltern beschreibt. Sie lehrte mich Versöhnung, sprach nicht über das was war, nur dass es besser werden musste, nie wieder so etwas geschehen durfte und jeder Mensch dem Menschen Wohl tun soll. Sie wünschte sich Regierende, die meditieren und lehren wie Gandhi, Fröbel und Rudolf Steiner.
Wir Nachkriegsjugend wollten liebend sein, fröhlich bunt, erfreuten uns an Vielfalt und Anderssein, sangen vom Frieden – und machten unsere eigenen Fehler.
Irritiertes Jungsein zwischen Wagemut und Versagensängsten. Alles oder Nichts – ein Dazwischen gab es für uns nicht. Jugend mit viel Mut. Jugend, die sich mit Wucht befreite aus den Verstrickungen der Vorgeneration, die zerrte an Fesseln, die auch sie zu umschlingen drohten. Nein, genetisch verankerte Schuldskrupel in ewige Zeiten hinein, das darf nicht sein! Sich lösen, sich herausschälen aus Ängsten und Traumata. Sich selbst finden, eine eigene Identität ausbilden.
Wir erkannten allmählich wie eingebunden und abhängig Menschen sind von politischen und institutionellen Gegebenheiten, von Vorgaben, von Vorgeschichte - und vom Druck anderer. Wir lebten nach dem 'heißen' Krieg und seinen Folgen im 'Kalten Krieg' und unter atomarer Bedrohung. Massenvernichtung noch schlimmer. Krieg – das Trauma einer Menschheitsepoche. Vergasen, vergiften, verstümmeln. Wo sind die Nutznießer des Ganzen? Die Kriegsgewinnler, die das herstellen, was andere vernichtet? Mir versagte die Stimme zum Singen aus lustvollem Herzen. Und ich hörte denen ergriffen zu, die die richtigen Lieder sangen.
Leise beginnt Joan Baez mit dem Bob-Dylan-Lied „Where are all these flowers gone … blowing in the wind“ - Sag mir wo die Blumen sind, wo sind sie geblieben … die Antwort weiß allein der Wind.
Jeder von uns hatte seine eigenen Prozesse zur Erkenntnis: Du kannst die Welt nicht verändern, aber: Die Welt ändert sich, wenn DU dich veränderst. Das Ideal schwebt über allem. Schwebt. Lässt sich nicht greifen. Wird niemals wirklich. - Ist das so?
Wir begaben uns auf die Suche nach den Verursachern all diesen Leidens. Protestierten öffentlich. Zerrten ans Licht, was im Finstern verborgen wurde. Malten in bunten Farben die Welt, die wir gestalten wollten. Jeder Mensch ist gleichwertig. Menschenrechte für alle. Lebten ein Freisein vor, das uns bald in neue Schranken verwies. Im Kleinen wie im Größeren. Widerstand und Wohngemeinschaft. Jede/r ist willkommen. Freie Liebe. Spirituelles. Mehr als Konsum im Wirtschaftswunder. Our Culture is sharing. Brüche. Umbrüche. Und wir entdeckten die Natur neu und ganz nah. Begannen zu reisen, die Gegenden der Welt zu erkunden und die unterschiedlichen Lebensweisen. Faszination. Und merkten kaum, was dies mit uns selber machte.
Unsere Ehen scheiterten prozesshaft oder auf Knall und Fall. Die eigene bestand schon nicht mehr, als sie besiegelt wurde im Sonnenschein und kühlem Wind an einem Herbstnovembertag. Für die Familie musste es sein, für unsre eigene Bestätigung und Stellung nach außen. So war das damals. Wir wollten Kinder, drei oder vier. Familie, das war angesagt, das Band, das Menschen eint und kriegszerrissen faserte.
Familie, Gemeinschaft – nicht genetisch bestimmt, sondern freiwillig zusammengefügt. Locker im Konsens. Offene Ehe. Freie Liebe. Erziehung war im Umbruch, eine Generationenfrage entwickelte sich zu einem Abstands-Krieg der jungen Erwachsenen gegen die Eltern, die verstrickt waren in ihrer historischen Schuld. Aus Trümmern bauten sie neue Gebäude, mit alten Steinen und frischem Beton in Fertigbauweise. Schnell. Mit Notausgängen und Tiefgaragen, die das Labyrinth schummrig-schimmeliger Luftschutzkellergänge ersetzten. Spießig, das Eigenheim der Eltern aus der Adenauer-Doktrin: 'Bollwerk gegen den Bolschewismus'. Heimat war gestern. Ein Zuhause konnte überall sein. Auf Zeit. In Wohnungen. Die meisten jungen Menschen lebten zur Miete. Mobil wollten wir sein.
Und die Habenden schicken weiter Millionen Menschen auf die Flucht – überall. Das Dresden von damals heißt heute Aleppo in Syrien. Die Mauern weinen in Aleppo, Hussein, sie klagen das Totenlied aus blutgetränkter Erde, sie fallen in Stücke, zerbröseln zu Staub. Schachtelhäuser – dicht an dicht, Flachdach, gestapelt über Flachdach, der Baustil sonnenheißer Wüstenstädte, die so viel buntes, wirbelndes Leben bergen. Und jetzt kratzen verzweifelte Männer mit bloßen Händen den überlebenden Säugling aus dem Schutt heraus. Überlebt. Der Bazar, ein Weltkulturerbe, ein zu schützendes Gut. Kein Leben in ihm. Nur Steine und Tod. Und die Welt schämt sich nicht.
Und wieder sind es Alliierte des Westens gegen die des Ostens und Südens, Bombenschläge fremder Mächte, die verbrecherisch eindreschen auf Wehrlose, die nicht mehr wissen wohin … Wie damals als sie Deutschland zerbombten. Es gibt diese Blöcke nur zum Schein. Es geht immer nur um Interessen und den Ausgleich von Interessen. Welche Interessen? Wem nützt dies, was so vielen schadet? Was tun Menschen anderen Menschen an und - wozu nur, wozu? Unsere Fragen und Zweifel enden hier nicht. Endzeitstimmung - genetisch eingeimpft in jede (Nach-)Kriegsgeneration. Und wir fragen: Wenn nicht wir, wer sonst? Wenn nicht jetzt, wann dann? Und beginnen den Widerstand gegen das perfide Unmenschliche.
Es sind wohl ähnliche Hirne, die Geröllwüsten auf dem Mars ebenso erregend finden wie die Trümmerwüsten, in die sie Städte zerbomben. In denen nichts grünt, blüht – lebt. In den Sphären der Gestirne suchen sie nach Spuren von Leben. Das Lebendige, Gelebte auf Erden atomisieren sie, zerlegen es in Nanoteilchen. Bizarr. Finden Sie nicht? Es gibt keine Gründe dafür. Nichts rechtfertigt zu hassen, zu rächen. Die bunte bewegte Welt in starre graue Steinbrocken zu zerschlagen. Das ist krank. Einfach nur krank. Heal the world!
Die Frage brennt in uns: Wird es einen dritten Weltkrieg geben? Einen heißen, keinen kalten? Einen Terror- und Bürgerkrieg? Einen Luft- und Drohnenkrieg? Einen Cyber War?
Der Erste Weltkrieg ist ein Stellungs- und Giftgas-Krieg in Schützengräben gewesen. Millionen Tote, Schwerverletzte, Traumatisierte. Der Zweite Weltkrieg ist ein Panzer- und Luftkrieg gewesen. Erfasste die Völker. Zerstörung, Flucht und Vertreibung – ungekannten Ausmaßes. Stellvertreterkriege beuteln seitdem die Menschen dieser Welt. Angst. Ohnmachtsgefühl. Eingefräst in die Seelen des Menschseins. Geißel des Krieges. Mensch gemacht. Hört ihr denn nie auf?
Der Rhein – silbrig schimmernde, sich windende Lebensader Westeuropas. Die Elbe. Die Oder. Ihre Wasser tragen Trümmer und Tote fort in die Meere der Welt, die ebenso voll davon sind.
Alice, das Fluchtkind, findet ein Zuhause am Rhein, aber eine Heimat wird es nicht. Heimat? Zuhause? Das sind Gefühl geprägte Orte. Das ist Naturerleben. In abgestufter Intensität. Entwurzelte Menschen treiben neue Wurzeln ein in jede Erde, um sich zu verankern. Sie überleben und gestalten ihr Dasein. Wenn sie willkommen sind im Umfeld des fremden Zuhauses, sich wohl, angenommen und sicher fühlen, dann mag sich ein Heimatempfinden entwickeln.
Alice ist dankbar, entwickelt sich zum Gut-Menschen, tut sich zusammen mit anderen Gut-Menschen, um die Welt zu heilen. Das Nicht-Gute, das Böse fixierend im Blick, wo immer es sich zeigt.
Ich beende meinen gedanklichen Rundgang durch meine kleine Stadt am neuen Ratssaal. Ein Gebäude, eingeschossig, schachtelartig, in dem einmal ein Lebensmittelgeschäft die BewohnerInnen des Ghettos versorgte und lichterloh abbrannte. Lange stand die Ruine. Ein hoher Bauzaun schützte vor Eindringlingen, verhinderte den Vandalismus nicht. Ein Schandfleck. Stadtdirektor, Bürgermeister, Mehrheitsfraktion setzten den Neubau eines Ratssaales für die Gemeinde durch. Die Opposition plädierte für ein kulturelles Begegnungshaus mit sozialpädagogischer Begleitung. Die Ausstattung war vom Feinsten: Marmor, Edelholz, teppichartiger Bodenbelag in königlichem Blau, bemustert mit den Wappen der Stadt. Aber dazu später mehr.
Ich kehre ins Hier und Heute zurück, nehme die Fäden auf, die sich in mein Erzählen eingesponnen haben und in die Gegenwart führen. Ich nehme Sie mit, liebe Hörerin, lieber Hörer, skizziere, was mich bewegt und zum Handeln motiviert, damals wie jetzt.
Die kosmische Sphärenmusik mildert das erzählte Geschehen in bewegendem Rhythmus. Alice räuspert sich.
Mein Leben … Was ist so besonders daran, dass ich es Ihnen hier erzähle? Eben. Es ist genauso besonders wie Ihr eigenes Leben. Erzählen Sie Ihres. Sprechen Sie. Schreiben Sie. Die Welt ist voller Geschichten, sagen Sie? Warum meine noch hinzufügen? Selbstdarstellung? Nabelschau? Egozentrismus, ja, Narzissmus unserer Zeit? Wohl auch. Das Ego ist ein Ich von Vielen. Hören wir einander zu. Ähnliches und doch ganz Anderes. Jeder Mensch ein Künstler, eine Künstlerin des WIE seines Lebens. Wie gehst du, wie gehen Sie um, mit dem, was herausfordert, was knechtet und prügelt? Wie ist dieser Prozess des Reifens, wenn ich die Chance zum Älterwerden bekomme? Was lässt den Menschen scheitern? Gibt es Scheitern wirklich oder ist dies eine Form, Probleme zu lösen? Aus dem Scheitern erwächst manchmal neue Kraft oder – wenn die eigene Kraft versiegt – setzt es Zeichen für andere Menschen. Das menschliche Leben ist eine Skizze, ein Entwurf eines Entwurfs eines Entwurfs … Immer im Wandel. Immer in Fluss.
Bilderwelten. Der Mensch, das Augentier. Bilderfluten. Medien bilden Wirklichkeit, inszenieren Abbilder und imaginäre Bilder. Bilddominanz unserer Zeit.
Das Radio. Ein Hörmedium. Ein Zu-Hör-Medium. Sie sehen mich nicht. Sie hören meine Stimme. Sie zeichnen sich vielleicht ein Bild von mir nach dieser Stimme. Sie erfassen die Merkmale. Und zeichnen. Oder Sie hören nur dem Gesagten zu. Dem Inhalt. Der Botschaft. Die Stimme aus dem 'Off'. Haben Sie gemerkt, dass sie schwer zuzuordnen ist? Ist sie männlich? Ist sie weiblich? 'Androgyn' würde es heißen. Ist das wichtig für Sie? Eher nicht. Sie ist dominant, diese Stimme, dennoch wohlklingend. Sie macht aufmerksam. Und meine Stimme? Sie ist eindeutig weiblich. Können Sie mein Alter erkennen?
Ich finde: Den Stimmen wohnt ein Zauber inne … Sie geben Rätsel auf – und sind im Radio Mittel des Transports von Wörtern, Sätzen – Gedankenprosa. Klang, Rhythmus, Melodie. Faszinierend. Und ob Sie sich öffnen für die Botschaft des Wortes, entscheidet Sympathie. Manchmal reißt uns das Gegenteil aus unserer Beschaulichkeit. Der Schrei. Die Wut. Die Aggression. Das Ungelenke. Das Zerfaserte im Sprechgebilde. Und wir hören hin.
Alice nickt. Eine Harfen-Melodie schwingt hoch, füllt den Raum und verklingt sacht.
Mein Leben … ist so interessant für Sie … wie Ihr eigenes. Oder? Erzählen berührt … wie Bilderansehen. Beim Zuhören entstehen Bilder in Ihrem Kopf. Und wir suchen und erkennen das Ähnliche und das ganz Andere.
Ich sehe Bilder in meinem Erinnern und folge ihnen nach, bis ich wahrnehme, was mir meine Augen, meine Sinne in dieses Bild verdichteten. Und dann der Abgleich. Wie automatisch schießen bildhafte Eindrücke in mir hoch.
Ruinenstadt Aleppo in Syrien. Weltkulturerbe-Stadt Sanaa im Jemen. Die berühmten schmucken mehrstöckigen Lehm-Ziegel-Häuser – verrutscht ins Trümmerfeld.
Mir brennt die Seele, wenn ich diese Bilder sehe – und im Erinnern taucht mein Schulweg auf. Ich war sieben Jahre alt. Wir Kinder kraxeln über Beton- und Steinetrümmer durch verwilderte Gärten, pflücken Blumen. Wucherndes Sommergrün. Vermeiden den Blick auf den zerbeulten Kinderwagen, das geborstene Schaukelpferd – daneben.
In den Trümmerwüsten Arabiens gibt es keine bunten Blüten, nur Staub und Steine.
Flüchtlingslager für Millionen Menschen weltweit. Ich sehe Schachtelstädte in Jordaniens Wüsten. Eng an eng. So weit das Auge reicht. Schachtel an Schachtel. Ein provisorisches Zuhause zum Überleben auf Zeit. Wie lange? Unsere Flüchtlingslager nach dem Zweiten Weltkrieg waren Nissenhütten und Holzbaracken, auch Betonbunker. Ein 'Marshall-Plan' holte uns da raus. Wir haben diesen Kredit über Jahrzehnte abgezahlt im aufblühenden 'Wirtschaftswunder'. Hilfe zur Selbsthilfe – hieß das. Sind afrikanische, arabische Menschen weniger WERT?
Im 'Welt-Report' unseres Fernsehens sehe ich Szenen wie diese:
Ein Mädchen, vielleicht acht Jahre alt, in Flicken buntem Kleid und Kopftuch, nackte braune Füße, hockt vor einem Zuber mit wenig Wasser darin und spült mit bloßen Händen fast liebevoll zerdelltes Kochgeschirr. Ein Topf. Eine Kasserolle. Mehr nicht. Keine Seife. Kein Spüli. Kein Tuch. Wenig Wasser. Warm oder kalt? Sie werden kaum Fett, kaum Öl haben in den Slums Afrikas, Asiens, Südamerikas – oder Europas. Sie garen ihren Reis, das Gemüse, das Fleisch – wenn es eine bessere Mahlzeit ist – in wenig Wasser, das kostbar ist.
Gruselndes Erinnern in mir: Die Zinkwanne, in der wir gebadet wurden, wir mageren Kinder der Nachkriegszeit, in der dämpfigen Waschküche im dunklen Keller. Mir zieht sich das Herz zusammen. Vergessen wir wirklich, dass Frieden fragil ist, dass auch in unseren Breiten Elend herrscht, dass wir Mit-Verantwortung tragen? Etliche von uns in Trümmern aufwuchsen oder ärmlichen Verhältnissen? Kriegerisches Morden und Zerstören bis heute wirklich sind, nur anderswo, uns aber folgen in unsere Polster möblierten Wohnzimmer, Fleisch reichen oder veganen Küchen, unter den üppigen Duschstrahl mit duftendem Gel, in das entspannende Schaumbad unserer ausladenden Badewannen …
Poor Lives Matter …
Bilder. Untermalt mit Geräuschen und Melodien unseres Alltags. Und wir fühlen uns wohl und fühlen uns sicher. Dasselbe sollten Menschen auch anderswo empfinden können. Arme-Leute-Leben geht uns alle an … Was ist so schwer daran?
Ein Dach über dem Kopf, Wände ums Dasein, Boden unter den Füßen. Eine Schachtel für jeden, eine Höhle zum Kuscheln. Die Schachtel, die dein Leben birgt. Dein Lachen und Dein Weinen. Dein Heim ist, dein Zuhause. Kein Insolvenzverwalter, Gerichtsvollzieher dir enteignen darf. Keine Bombe es zerstören. Ein Ob-Dach mit Lebensqualität. Wasserströme aus Leitungen. Ver- und Entsorgungskanäle. Energie ernten aus der Natur. Intakte städtische, dörfliche Infrastruktur. Wer sein Zuhause verliert, Mensch gemacht und gewollt, aus Hass, Rache und Machtkalkül oder ungerechter Justiz, der leidet, der weiß ein schlichtes Heim zu schätzen, vielleicht strebt er später nach Luxus, nach schönen Dingen, nach Kitsch und nach Kunst, um den Verlust zu vergessen – nur Eigenes muss es sein, gekauft oder gemietet oder selbst gebaut. Er klammert an Hab und Gut – und dem Lebenwollen.
Und nach all dem Schrecklichen wird es nie wieder Kriege geben … So dachte ich – mit etlichen anderen mitfühlenden Menschen. Und jeder Mensch wird haben, was er zum Leben nötig hat. Human Basic Needs. Genau beschrieben und fest geschrieben in den Verfassungen der Staaten unserer Welt. Schwarz auf Weiß. Theorie. Und die Praxis? Wunschdenken? Und das tatsächliche Tun?
Alice hebt den Kopf, gibt ein Handzeichen. Ein Lied fädelt sich ein. Panflöte wie eine singende Stimme. Sie gleitet dahin und verklingt.





























