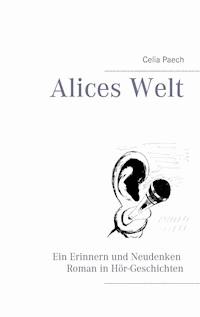Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Finderin findet Menschen, Schicksale, Lebensgeschichten vor ihren Augen und betrachtet mit schlichtem Blick das Besondere, Auffallende, Fremde, das so schockierend vertraut ist und tief berührt. "Die Finderin" ist ein Roman - in einzelnen Geschichten erzählt - über die Liebe in Zeiten zunehmender sozialer Kälte, über das Leben im materiellen Nichts - Armut, Obdachlosigkeit, Heimatlosigkeit - und über Menschen, die sich verlieren und wieder finden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 254
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Gedanken
Wie ein Freund
Liebe riecht immer gut
Die Pflanze küsst den Stein
Ich bin einer von Vielen
Anders als der Schein
Mangel weist den wahren Wert
Warum - ist keine Frage
Die Augen der Fenster
Prinzessin vom Hindukusch
Du bliebst nicht über Nacht
Sozial ist, was uns glücklich macht
Wie kuschelig der Nordpol ist
Minimal-Lyrisches
Zur Autorin
Gewidmet den Menschen,
die nichts haben,
außer sich selbst.
Hinweis:
Die Personen und ihre Namen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten zu lebenden Personen sind rein zufällig. Die Handlungen und Geschehnisse können sich so oder so ähnlich ereignet haben.
©2008 ©2016 Celia Paech
Gedanken
Sie findet und findet und findet ... immer etwas Neues, ergründet in sich, in Menschen ihrer Umwelt, ihren Lebenslagen, das was den Sinn des Lebens, ihres Lebens, ausmacht und bestimmt.
Dieses Finden ist ein Prozess, dem Leben immanent, Sinn stiftend. Das Suchen allein ist hohl, ohne Inhalt, wenn nichts gefunden wird und eine neue Suche beginnen kann. Es kann nicht Nichts gefunden werden, weil immer etwas da ist und sich finden lässt, wenn Mensch offen dafür bleibt. Wir FINDEN, was wir suchen. Immer.
Die Finderin findet Menschen, Schicksale, Lebensgeschichten, bewahrt sich den schlichten Blick in das Besondere, Fremde und doch so schockierend Vertraute.
Der Mensch ist Geschöpf seiner Lebens-Zeit. Ein Leben lang sucht er sich selbst. Am Ende eines jeden Lebens steht die Erkenntnis, dass das eben sein jeweiliges Leben gewesen ist. So, wie es war. Mehr nicht.
Die Frage nach dem WARUM bringt allein keine Erkenntnis. Ursachenforschung ist rückwärtsgewandt, dient dem aus Vergangenem, aus Fehlern lernen, um seine gegenwärtigen Handlungen zu ändern.
Die Frage nach dem WESHALB und WOZU, nach dem Zweck, dem Ziel, der ergebnisorientierten Wirkung ist die Frage nach dem SINN und bringt letztlich die Erkenntnis. Sie darf nie fehlen. Sie ist vorwärts gerichtet, peilt die Zukunft an – weil Leben weitergeht. Unendlich.
Ergründen wir WAS WAR.
Akzeptieren wir WAS IST.
Denn: Es ist WIE es ist.
„Die Finderin“ ist ein Roman der Gegenwart, in einzelnen Geschichten erzählt, über das Leben im materiellen Nichts - Armut, Obdachlosigkeit, Heimatlosigkeit – und über die Liebe in Zeiten zunehmender sozialer Kälte.
Wie ein Freund
Blitzeis. Ich trage Pumps mit Pfennigsabsätzen. Den Swing in den Beinen. Das Trompetensolo im Ohr. Sinnenrausch durchtanzter Nacht. Kein Alkohol. Keine Drogen. Nur Leidenschaft. Ich lache und schlittere auf glatter Ledersohle, rutsche aus, setze mich auf den Popo, umhüllt von Wollmantel, Rock und Petticoat, dämpft den Stoß. Der Versuch, am Laternenpfahl Halt zu finden, sich wieder hoch zu hangeln, scheitert. Vor Lachen.
Die Nacht ist schwarz. Pechschwarz glänzend der Straßenteerbelag im schwachen Schein der wenigen Laternen. Hauchdünn überzieht eine Eisschicht alles was Figur, was Form hat und die entsprechende Temperatur. Nieselregen, eiskalter Ostwind frischt mein Gesicht, besprüht mit glitzernden Tropfen meine schwarze Fellmütze, den dunklen Stoff meines Mantels. Bäume, Büsche – jedes Ästchen, jedes Blättchen glänzt, konserviert in Kälte für die Ewigkeit. Die Laterne verwehrt den sichernden Griff ohne Handschuhe. Aalglatt, feuchtkalt gefroren die zarte Eishaut um den Eisenpfahl. Ich atme tief die nassklare Luft. Kein Auto auf der Straße. Gegenüber wackelt eine männliche Gestalt, ein Fahrrad schiebend, unsicher über dem Gefrorenen, sonst kein Mensch in dieser Winternacht in den 1960er Jahren. Nur wir.
Vier junge Leute auf dem Nachhauseweg. Zu Fuß etwa zehn Kilometer durch die schlafende Stadt. So spät fährt kein Bus mehr. Wir bringen uns gegenseitig Heim. Erst die Mädchen, dann die beiden Jungen. Erprobt so viele Male zu jeder Jahreszeit. Frisch verliebt. Ich rutsche auf die Knie, erfasse das Hosenbein meines Freundes, der noch schwankend steht. Heftiges Lachen erschüttert meinen Körper. Ich kann mich kaum beherrschen. Mein Zwerchfell schmerzt. Zu komisch diese Situation. Werden wir nun Millimeterweise nach Hause robben müssen? Bis zum Morgengrauen, wenn endlich Streuwagen fahren. Ich finde dies lustig, ängstige mich nicht. Zuversicht – meine Jugend-Wegbegleiterin.
Und siehe da: Es klappt. Mir gelingt, mich aufzurichten. Ich ziehe meine Gamaschen so über die Schuhe, dass ich stumpf und weich gehen kann. Die werden hin sein danach, denke ich, egal, ist ersetzbar. Ich muss irgendwie heile in mein Bett kommen. Ich balanciere. Der Mensch passt sich erstaunlich geschickt den natürlichen Widrigkeiten an. Viele Meter weiter bewege ich mich elastisch biegsam wie eine Schlittschuhläuferin, an den Gamaschen klebt dick das Eis, beherrsche fast das eisige Element unter meinen Füßen. So geht es auch den Anderen. Fröhlich schnatternd schaffen wir den Weg zu Fuß in unsere Zuhauses. Dreimal so lang, doch was ist Zeit?
Vier dunkle Gestalten in mondloser eiskalter Nacht, die sich winden sich krümmen lang dehnen hoch strecken wie Würmchen auf brikettschwarzem silbrig schimmerndem Asphalt. Warm ist uns innerlich in dieser Eisesnacht. Wohl fühlen wir uns in unserer Heiterkeit. Erst im geheizten Zimmer im kuscheligen Bett werden die Glieder schwer. Der Schlaf ist tief und fest. Das Erinnern bleibt gegenwärtig.
Es hätte ein lustiges Erlebnis bleiben können, gefolgt von Muskelschmerz und ein paar blauen Flecken. Schwarz auf Weiß lasen wir zwei Tage später, was neben uns geschehen war. Ein Mann – tot auf einer Parkbank in unserem Liebeswäldchen, erfroren, im Suff, mit eingeschlafenem Arm. Penner-Tod.
Der Obdachlose war fast wie ein Freund. „Sagt Olli zu mir“, klingt noch in meinen Ohren mit norddeutschem Slang. Zur See ist er gefahren, bei der Marine im vernichtenden Krieg. Überlebt. Nur ein Bein verloren. Die verwundete Seele heilte nie.
Manches hat er uns erzählt. Wir hockten uns neben ihn auf dem Schulweg durch den Park oder setzten uns auf die Steinmauer zur Bahnunterführung, wo er meist saß auf einem schmuddeligen Kissen, ein Pappschild und einen Blechnapf vor sich hielt: „Habe fürs Vaterland gekämpft.“ Nicht jeder der Vorbeieilenden hatte Verständnis. Manche schimpften: Eine Schande ist das, hier zu sitzen und zu betteln. Geh nach Hause. Du kriegst doch Rente von unserem Staat.
Es war seine Art, die Botschaft zu übermitteln: Seht her, das hat der Krieg aus mir gemacht. Er wollte sich nicht verstecken in einem Seemanns- oder Obdachlosenheim. Er wollte zeigen, aufrütteln, gegenwärtig sein in seinem Leiden. Sagte er uns immer. Vielleicht hätte er auch gar nicht anders gekonnt. Trotz allem hatte er Humor. Wir hörten ihm gerne zu. Er erzählte nicht nur vom Kriegsgeschehen. Er erzählte vom Menschlichen, vom Meer, von der Weite des Himmels, den Stürmen, dem wahnsinnigen Wind und den wogenden Wellen. Die Gemeinschaft der Kameraden auf dem Zerstörer. Nur Männer. Eine besondere Gesellschaft. Die Geschichten – Seemannsgarn dabei. Spannend für uns junge Landratten. Wir kannten Seeräuber-Stories, Piratenfilme – die Wahrheit über den Krieg auf See kannten wir nicht.
Wir gaben ihm unser Pausenbrot, brachten hin und wieder eine Decke, ein Kleidungsstück mit, heimlich von zu Hause entwendet, auch einmal Schnürschuhe, die meinem Vater nicht mehr passten, ich erzählte es meiner Mutter. Von unserem Taschengeld zweigte jeder etwas ab. Wir hatten selbst nicht viel damals, doch immer noch mehr als er. Olli, der Seemann. Zwei Schiffe hat er überlebt und viele, viele Kameraden. Wie alt er war? Ich weiß es nicht. Für uns steinalt, so grau sein Haar und seine Haut, vom Alkohol überzeichnet. Rückgerechnet nach seinen Berichten und Geschichten, konnte er höchstens in den Dreißigern gewesen sein.
Krieg zerstört Leben vielfältig.
Uns kam der Gedanke, beim Obdachlosen-Asyl vorbei zu gehen und nachzufragen, ob Olli etwas hinterlassen hatte, ob es Angehörige gab, ob wir irgendwie helfen konnten und – wir wollten wissen, wo er begraben lag.
Mit Blumen schmückten wir die Bank, die sein Zuhause, und den Platz, der ihm Berufung war. Nein, Angehörige hatte er nicht, es war nichts bekannt, er hat kaum gesprochen, nur geschlafen, gebadet, gegessen, sagte die Ordensschwester. Aber hier sind ein paar Habseligkeiten, die er vergessen hatte, als er zum letzten Mal hier war. Nehmt das ruhig mit. Wir würden es sonst wegwerfen. Sie überreichte uns ein geschnürtes Päckchen. „Hans Ollert“ stand darauf. Wir hatten nicht gewusst, wie er wirklich hieß unser „Olli“. Er hat ein Armenbegräbnis bekommen, mit anderen Armen zusammen, hörten wir noch die Schwester sagen. Kein Grab. Anonym. Mit der Masse. Massengrab? Wie bei den Nazis.
Wir schwiegen, gingen hinaus aus dem Dunst von Kernseife, Armut und Hoffnungslosigkeit, suchten ein trockenes Eckchen im Eisenbahntunnel nahebei, hockten uns hin und lösten mit klopfendem Herzen den Knoten der rauen Schnur. Festes, rotbraunes Ölpapier. Ein Foto, schwarzweiß, zerknittert, Mäusezähnchen drumrum, ein schmales schwarzes Buch, fleckig, Eselsohren, ein kreuzstichbestickter Kissenbezug, leicht ausgefranst, mit dem Bild eines Häuschens mit Garten, Wiese, blühende Blumen, oben rechts eine Sonne, oben links ein rotes Herz, und ein blechernes Kästchen. Das war es. Das Foto zeigte wohl ihn mit seiner Mutter, einem Bruder, einer Schwester, in einem Garten, unter Bäumen. Kein Haus, keine Scheune. Es könnte überall sein. Keine Schrift hinten drauf. Die Gesichter offen, lächelnd. Kleidung gut bürgerlich zu ihrer Zeit. Ein Tagebuch?
Wir blätterten, wohl Ollis Schrift, Bleistift, keine Tinte. Dicht beschrieben jede Seite, die letzten waren noch frei. Ich las vor, ein Brief: „Liebste, wirst Du noch auf mich warten? ...“ Als Datum rechts oben: „Auf dem Wasser im Jahre 1943“.
Wir beschlossen, uns morgen Nachmittag wiederzutreffen, bei meiner Freundin zu Hause. Sie nahm alles mit. Wir wollten in Ruhe lesen, was Olli uns hinterlassen hatte. Uns? Ja, irgendwie fühlten wir uns als Erben. Vielleicht waren wir wirklich die einzigen Menschen, denen Olli vertraute und die ihm noch nahe standen? Wir, die Teenager einer Höheren Schule, die Nachgeborenen nach einem fast alles vernichtenden Weltkrieg, der mit einem Blitzkrieg begann, um die Nachbarvölker über Nacht einzuverleiben und in Schutt, Asche, Elend, Traumata, Tod endete.
Die Idee kam uns fast gleichzeitig: Der nächste Sonntag sollte wieder ein Sammelsonntag werden. Wir spielten oft mit Freunden aus unseren Jazz-Bands vor der Fußgänger-Unterführung für einen guten Zweck. Wir Mädchen gingen mit scheppernden Blechbüchsen unter die zuhörenden Leute. Dixieland, Swing – das war unsere Musik zu dieser Zeit. Trompete und Klarinette spielten unsere Freunde. Wir sangen, sie die tiefen bluesigen Partien, ich hatte die hohen Töne. Doch nicht hier im Freien wegen der fehlenden Akustik und Technik, nur in den Clubs und Sälen, wo unsere Bands auftraten. Wir sammelten für die Kriegsgräberfürsorge. Das passte zum Winter. An sonnigen Sonntagen sammelten wir Spenden fürs Rote Kreuz oder Müttergenesungswerk. Amtlich verplombt, mit Ausweis, über die Schule organisiert. Wir wollten diesmal noch einen Topf hinstellen mit einem Schild: „Für die kriegsversehrten Obdachlosen unserer Stadt.“ Das taten wir auch. Den Erlös brachten wir der Ordensschwester. Die Lokalzeitung berichtete über uns.
Wir wussten nicht, was wir damit lostreten würden, vorahnen ließ es sich durch die Reaktion mancher Spaziergänger, die vorüber gingen, stehen blieben, uns ansprachen oder uns beschimpften. Kriegsversehrt ja – aber obdachlos nein! Fast zwanzig Jahre nach dem Krieg gab es das nicht. Die Trümmer waren weggeräumt, Wohlstand zog in die neu errichteten Siedlungen, Eigenheime – dem Bollwerk gegen den Kommunismus. Jeder Mensch wurde versorgt. Zum Image des aufkeimenden Wirtschaftswunderlandes passte das Bild von obdachlosen Menschen gar nicht. Heimatlos – obdachlos. Das war gestern. Jeder hatte eine Bleibe. Eben nicht.
Die mit sich selbst beschäftigte Öffentlichkeit erfuhr, dass es noch dieses Rest-Elend ehemaliger Wehrmachtsgetreuer gab. Wie war das? Der Dank des Vaterlandes ist dir gewiss!? Die Kriegsheimkehrer, auf die niemand mehr wartete oder die ihre Angehörigen und Freunde nicht mehr wiederfanden. Davon gab es reichlich. Sie hockten in Bahnhofsnähe, besuchten verschämt die Suppenküchen von Heilsarmee und Bahnhofsmission, die christlichen Teestuben, stellten sich in die lange Reihe der Wartenden für ein Bett, ein Bad, etwas Kleidung im städtischen, im kirchlichen Obdachlosen-Asyl, sie sprachen kaum oder gar nicht, leere Blicke, nach innen gekehrt, fast ausgelöscht. Sie verkrochen sich in nahe gelegene Wälder, in die Grünanlagen, die Parks mitten in der Stadt und auf die Trümmergrundstücke, verlassene Ruinen ehemals stattlicher Villen mit üppig wuchernden Büschen, duftenden Blüten im Sommer. Zahlreiche zerlumpte Gestalten besiedelten aufgelassene Fabrik-Gelände, düster und kalt, erprobten eine Form des Zusammenlebens, der die menschliche Wärme fehlte. Eine Schatten-Gesellschaft.
Unübersehbar – in ihrer Not.
Die Obdachlosigkeit dieser Zeit war männlich.
Wir Vier waren unzertrennlich. Zwei Liebespaare. Raimund und Sabine. Volker und ich. Wir lebten für die Schule, unsere Musik und uns. Die älteren Geschwister, die jeder von uns hatte, waren bereits aus dem Haus, selbständig. Wir hatten jeder ein eigenes Zimmer im Reiheneinfamilienhaus oder in der Doppelhaushälfte mit Gärtchen im öffentlich geförderten Wohnungsbau in verschiedenen Stadtteilen. Kinderreich waren die Siedlungen. Unsere Väter waren im Öffentlichen Dienst, verbeamtet, versorgt. Unsere Mütter waren Hausfrauen.
Wie es weiterging mit Ollis Nachlass? Wir trafen uns bei Sabine, lasen das schmale Büchlein mit Ollis Bleistiftschrift, manches verwischt und verblasst. Es waren Briefe an eine Freundin, eine Geliebte, eine Ehefrau, die es vielleicht schon damals nicht oder nicht mehr gab. Warum sonst hätte er Briefe in ein Buch geschrieben und nicht zur Post gebracht?
Ein Tagebuch war es eigentlich nicht. Kein Datum. Nur ungefähre Zeitangaben. Manchmal stand dort: „Im Frühling“, „Spätnachts“, „Nach dem Sturm“, „Vor dem Landgang“. Die Jahreszahlen endeten 1946. Er hat also noch bis nach dem Krieg geschrieben – und dann nicht mehr. Er beschrieb vor allem seine Gefühle, romantisch verklärt. Er schilderte seine Träume, seine Wünsche, seine Hoffnung für die Zukunft zu Zweit. Er muss sehr einsam gewesen sein. Ein wenig enttäuscht waren wir, hofften wir doch geheimnisvolle Seefahrergeschichten als Logbuch zu lesen. Oder wenigstens den Menschen Olli näher kennen zu lernen, seine Gedanken, seine Gefühle – auf hoher See im Krieg.
Das blecherne Kästchen ließ sich leicht öffnen. Es enthielt drei Bleistiftstummel, einen kleingerubbelten Radiergummi, einen silbernen Anspitzer – und ein Schmuckkästchen für einen Ring. Ein Herrenring, schweres Gold mit einem dunkelroten, flach polierten Stein, die Initialen HO verschlungen eingraviert. In der Innenseite ein Prägestempel. Echt Gold. Unter dem samtroten Schmuckkissen lag eine Kette, wie eine Schlange gewunden. Echtes schweres Gold. Auch der Anhänger. Er war zum Öffnen.
Wir sahen das Bild eines jungen Olli und einer fremden jungen Frau. Seine Schwester? Sie ähnelte dem einen jungen Mädchen auf der Schwarz-Weiß-Fotografie. Oder war es seine Freundin, die „Liebste“, an die er schrieb? Wir werden es wohl nie erfahren. Hatten die Ordensschwestern nicht hinein gesehen? Ollis einzige Wertsachen. Hinübergerettet in die neue Zeit. Ein Verkauf hätte ihm wirtschaftlich helfen können. Er hat es nicht gewollt.
Wir waren betroffen von dem menschlichen Schicksal, ahnten die Trauer, das Leid. Den kleinen Besitz wollten und konnten wir nicht behalten.
Sabines Vater kannte den Stadtarchivar. Zu ihm brachten wir Ollis Habe.
Er sammelte Zeitzeugnisse und versprach, den Suchdienst einzuschalten. Vielleicht gab es noch diese junge Frau.
Wir erhielten ein Stück Papier, eine Quittung mit Stempel, säuberlich aufgelistet jedes Teil aus Ollis Ölpackpapierpäckchen.
Liebe riecht immer gut
Es klingelte. Die Holztreppe knarrte unter meinen eiligen Füßen. Ich öffnete die Haustür und umarmte die weinende Sabine. Sie hatte als erste geheiratet. Ihren Raimund. Sie arbeitete als Übersetzerin für Englisch und Spanisch in einer Botschaft. Er studierte Jura. Unsere Schulabschlüsse lagen hinter uns zwei befreundeten Paaren. Ich hatte eine Stelle als Sachbearbeiterin in einem Verband gefunden. Mein Volker studierte Ingenieurwesen in einer anderen Stadt. Wir beide Frauen tippten die Semesterarbeiten, später die Examens- und Diplomarbeiten unserer Männer. So war das damals.
Die Frauen fügten sich. Vor ihnen lag eine gesicherte Zukunft an Heim und Herd, natürlich mit Kindern. Selbst studieren kam nicht in Frage. Unsere Töchter haben alle eine gute Ausbildung, erklärten uns die Mütter und Väter. Besser gebildet als die Frauen-Vorgenerationen. Mehr muss nicht sein. Arbeiten zum Geld-verdienst ist nicht erwünscht, wenn der Ehemann versorgt.
Selbstverwirklichung?
Emanzipation? Vokabeln, die wir in den kommenden Jahren lernen sollten. Lange dauerte es, die Bedeutung zu erfassen, auf uns selbst zu beziehen. Ein schleichender Erkenntnisprozess, der Persönlichkeiten schuf, Beziehungen veränderte, Strukturen aufbrach. Welten gingen unter, neue schwappten empor. Verlässlich blieb das eigene Ich.
Sabines Vater war tot. Kriegsbedingtes Leiden stand in der Sterbeanzeige. Vor drei Tagen gestorben. Morgen war Beerdigung. Ich führte sie behutsam die Treppe hoch in mein Jungmädchen-Zimmer. Ließ sie weinen, streichelte sie sanft. Mir liefen selbst die Tränen über die Wangen.
Sabine war einen Kopf kleiner als ich, schmal wie ich, ihr Haar schwarzglänzend gelockt, üppig, meines blond, glatt, lang, strähnig, zu einer weichen Innenwelle gebürstet. Ihre Augen blaugraugrün wie meine, nur größer und – wie ich fand – viel schöner. Ihre Wangen waren rund und immer rosig oder rot, Apfel-Bäckchen. Leichte Stupsnase. Volle Lippen. Nebeneinander wirkten wir fast wie Schneeweißchen und Rosenrot. Wir überlegten einmal sogar als Schwester-Duo aufzutreten unter diesem Namen. Das gefiel unseren Partnern überhaupt nicht, passte auch nicht in die Jazzer-Szene. Langsam beruhigte sich ihr Schluchzen. Sie atmete tief ein.
Ich mochte ihren Vater. Er war still, sah einen direkt an, lächelte kaum, sprach leise, höflich, half im Haushalt mit, die groben Arbeiten wie Kehren, Wischen, Fensterreinigen erledigte er. So kannte ich es auch von meinem Vater, beobachtete es in anderen Familien.
Manche Männer des Krieges bemühten sich dankbar, ihren Frauen das Leben zu erleichtern. Wie viele Schwüre hatten sie geleistet im Schlachtengetümmel, im Schützengraben, im Lazarett, im Gefangenenlager, was sie alles tun werden, anders machen, wenn sie dies nur überlebten. Einige hatten dies später vergessen, viele andere nicht.
Sabine und Raimund lebten im Haus ihrer Eltern, oben zwei kleine Zimmer, Flürchen, enges Bad, die Küche im Erdgeschoss benutzten sie gemeinsam. Über ihnen der Trockenspeicher, über eine schmale Holztreppe erreichbar. Dort fand sie ihn, am Dachbalken hängend, der Schemel unter seinen Füßen lag quer. Kriegsbedingtes Leiden. Er bekam die Bilder nicht aus seinem Kopf, die Gerüche von Blut und Fäkalien, die Schreie, das Stöhnen, das Wimmern aus mit Schmerz ringenden Kehlen, die Hitze, die Kälte, das Dröhnen, Getöse mechanischer Tötungsgeräte vielfältigster Art - die Stimmen der Hölle. Nachts war es am schlimmsten.
Er war aufgewacht nach dem vernichtenden Traum, in Schweiß gebadet, hat sich leise aus dem Ehebett geschlichen, von der Seite seiner schlafenden Frau - vielleicht roch er noch einmal an ihr, er liebte ihren Körpergeruch, sog ihn noch einmal tief in sich ein - war die Stiege hoch unter das Dach, hat den Schemel genommen, den Strick, eine Wäscheleine – alles lag seit vielen Monaten bereit in einer Ecke, unbeachtet von der Familie. Das Todeswerkzeug. So einfach war das. Und doch so schwer.
Er konnte nicht mehr. Die Familie versorgt, die Kinder erwachsen. Die Frau hatte sich lange schon abgewandt von ihm, konnte die Nähe, seinen Körper auf ihr nicht mehr ertragen, konnte ihn nicht mehr riechen, wie sie sagte. Aus. Schon lange Aus. Nur Ruhe finden, nur Ruhe. Kriegsbedingtes Leiden. Die Wunden am Kopf, der durchtrennte und wieder angenähte Arm – alles heilte, vernarbte. Die zerrissene Seele nicht.
Wir standen ihr bei, unserer Freundin, ihrer Familie. Fast täglich ging ich zu ihr oder sie kam zu mir. Raimund wich Sabine kaum von der Seite, begleitete sie überall hin, wie es zeitlich möglich war. Ich hatte ihn doch gerade erst wieder gefunden, klagte sie oft, als meinen Vater erkannt und geliebt. Nun hat der Krieg ihn mir doch noch fort-genommen. Mir und Mutti.
Akzeptieren den Freitod, nicht verhindern, nicht helfen können, wenn der Todeswille die Übermacht hat. Eine drückende Last für die, die zurückbleiben.
Es war Sommer, ein halbes Jahr vergangen, als sie wieder singen konnte. Mit noch mehr Blues in der tiefen Stimme.
Wir feierten am Pavillon. Mit Spanferkel am Spieß, einem Fass Bier, Wasser für mich, ich trinke keinen Alkohol und rauche nicht. Ein lauwarmer Sommertag, klarer dunkler Sternenhimmel. Der Pavillon lag am Ende eines weitläufigen Parks einer großen Villa hoch über dem Fluss. Mehrere Bands mieteten ihn als Proberaum. Hier störte niemanden das laute Musizieren. Feste durften wir feiern, sagten den Besitzern Bescheid, räumten ordentlich auf. Kein Thema.
Sabine und ich hatten Salate vorbereitet, Kartoffelsalat, Pampelmusen-Chicorée-Salat. Wir waren wieder einmal die einzigen Frauen. Vielleicht kamen später noch Mädels vorbei. Die Jungs hatten sich ein Besäufnis vorgenommen. Manche brauchten eine Wegbegleitung nach Hause, andere wollten gleich hier übernachten. Na, Klasse. Wir ließen uns ein dickes Stück Fleisch abschneiden, außen verkohlt, innen noch leicht roh und rosig. Senf, Brot, Salat auf den Teller dazu. Wir zogen uns zurück auf die Liebesbank in der lauschigen Ecke am kunstvoll geschmiedeten Geländer, eingegrünt, überwuchert von duftenden Rosen wie eine Laube, mit weitem Blick über den Fluss. Wir redeten eine lange Zeit. Unsere Männer vermissten uns nicht.
Ein stiller Trinker, mein Vater. Sabine erzählte. Nur nachts trank er, wenn wir alle im Bett waren. Ich habe das erst spät bemerkt, eigentlich erst, seit Raimund und ich zusammen bei meinen Eltern wohnen. Er sitzt in der Küche, vor sich Bier und Schnaps. Kein Laut. Nur sein Atmen, den Blick nach unten gerichtet. Einsam. Nach Stunden erst schleicht er sich ins Bett zu meiner Mutter, wenn sie eingeschlafen war. Jeden Abend. Nie fand ich Spuren davon in der Küche vor. Er räumte alles weg, wusch ab. Gerochen habe ich das nicht. Meine Mutter sagte einmal, Vati riecht nicht mehr gut. Früher war das anders. Den Alkohol meinte sie wohl nicht allein. War es das Trauma des Krieges, das den Poren entströmte?
Mein Vater dagegen: Liebe und Angst halfen ihm, den Krieg zu überleben. Das Bild seiner Frau, den Duft ihres Körpers immer in sich getragen. Wenn sie saß, im Sessel, auf einem Stuhl, näherte er sich manchmal von hinten, nahm ihren Kopf sanft in beide Hände, beugte sich vor und roch an ihrem Haar. In diesen Momenten entspannte er sich, sein Gesicht zeigte Schimmer von Glück. Glücklichsein.
Wir machten uns Gedanken.
Wie ist das bei dir? Riecht Volker gut für dich? Wir befragten uns gegenseitig nach unseren Sinnen, der Wahrnehmung unserer Liebe, unseres intimen Liebesempfindens. Freundinnen-Gespräch. Offen, mitfühlend, respektvoll, nicht entblößend, nicht nackt. Voll Vertrauen. Enttabuisierung kam später, Liebe als Ware in allen ihren Facetten entblättert, abgelichtet, beschrieben, bis übrig blieb die schiere Gier nach Sex. Öffentlich. Käuflich. Und auch unsere Männer nicht ausließ. Und uns Frauen irritiert zurückließ.
Emanzipation hatten wir – so - nicht gewollt.
Liebe macht blind, heißt es landläufig. Sie trübt das Sehen, die Sicht auf den Partner, weichzeichnend bis zur absoluten Verdunkelung. Nicht nur das Sehen leidet unter dem allumfassenden, Hormon steigernden Fühlen.
Wahrnehmung wird zur Einbahnstraße. Kein Zurück. Nur eine Richtung – nach vorn. Jedes Fünkchen anderes Empfinden leitet Liebe ab. Eine Geisterfahrt ähnliche Eingebung, der auszuweichen ist. Warnsysteme der Vorsicht, der Gefahr vor Betrug, vor Bedrohung sind ausgeschaltet.
Sich fallen lassen in Vertrauen, das eigene Sein mit dem des anderen verweben. Ein schönes Gefühl. Trügerisch. Die Liebe setzt Naturgesetze außer Kraft und schafft ein Neues. Der geliebte begehrte Mensch verlockt, macht süchtig. Der Duft des Körpers verlangt nach Nähe, Sehnen nach verschmelzender Vereinigung. Für immer. Hörst du gern seine Stimme? Sie ist weich, zärtlich, schmiegt sich ein in dein Hören, egal was sie sagt zu dir. Du schwebst auf dem Teppich ihres Klangs, unterlegt, empor getragen von der Musik, die zu deinem Fühlen passt. The Power of Love. Die Magie, der du nicht entrinnen kannst, auch nicht willst, die dich verzaubert.
Er schmeckt gut, der Körper, den du liebst. Du leckst ihn, küsst ihn, möchtest ihn verschlingen. Eins werden in dir. Du tastest seine Haut, jede Unebenheit ist dir vertraut. Kein Pickel, keine Pustel, keine Narbe stört dich. Du akzeptierst, was du wie vorfindest. Aus Liebe.
Und doch währt es oft nur kurze Zeit. Es gibt das Erwachen, das Abkühlen der Gefühle, die Ernüchterung. Das Erkennen des Fremd-Sein. Nicht mehr verstehen, wie es vorher war, welch berauschendes Fühlen. Das Schlimmste kommt danach. Abkehr. Abscheu. Ekel. Manchmal auch Hass. Du schreckst zusammen, wenn du diese Stimme hörst. Wendest dich ab. Du erträgst seine Nähe nicht mehr. Die Härchen deines Körpers richten sich auf. In Abwehr. Die Poren ziehen sich zusammen, bieten Schutz. Vor der ausdunstenden Haut des Gegen-über. Sie wehrt sich, beginnt zu jucken, sich zu röten. Kortison hilft, ein Gegenhormon, lindert den Reiz der Gegenwehr. Du riechst den Eiter der Pusteln, den Tabak und Alkohol geschwängerten Dampf seines Körpers, du findest keinen Schlaf neben dem röchelnden, schnarchenden Mann, der dir Nacht-Schweiß, schwere, stinkende Atemluft ins Gesicht bläst mit jedem Stoß seiner verräucherten Lunge. Du könntest erbrechen, es würgt in dir. Kein Deodorant, kein Parfüm, kein Waschen übertüncht den Geruch des nicht mehr Geliebten. Deine Nüstern sind offen. Du kannst wegsehen, ihn nicht mehr anblicken, doch wegriechen geht nicht. Der Andere liegt plötzlich mikroskopisch vergrößert auf dem Seziertisch. Die eigene Hand führt das scharfe Skalpell, obduziert deine Liebe mit forschendem Blick.
Das absolute Ende einer Liebe. Schlimm, wenn du als Einzige so fühlst, dich arrangieren musst in einer gesellschaftlich manifestierten Beziehung. Aushalten musst. Bis ans Ende deiner Tage.
Ein Symbol dieses Zustandes ist oft, sichtbar für andere – das getrennte Schlafzimmer.
Schaffst du, dich los zu lösen, Trennung, Scheidung, kein Wiedersehen, braucht es lange, ehe du frei bist, wieder unschuldig rein. Bereit für den Beginn einer neuen Liebe, die du suchst, immer wieder suchst. Manche schaffen dies nie mehr in ihrem Leben.
Viele Gedanken in dieser Sommernacht, an der Seite der Freundin. Nicht alle ausgesprochen, doch vor-gefühlt.
Im Herbst heirateten Volker und ich. An einem windigen hellsonnigen November-Tag. Kurz war mein Schleier, mein Brautkleid in Weiß für die Kirche, rotleuchtend mein Kostüm mit Mini-Rock für das Standesamt tags zuvor. Weiße Wolken jagten über hellblauem Himmel. Die Birken bogen sich im Wind. Trauzeugen waren Sabine und Raimund. Ein fröhliches Familienfest mit guten Freunden. Wir fuhren zusammen ans Meer. Hochzeitsreise zu Viert. Wir mieteten ein kleines Fischerhäuschen hinter dem Deich. Treppe hoch – und vor uns lag das weite graublaue Meer, gischtschäumend, viele Meter hoch die Wellen, der Wind beugte unsere Körper, riss an Anorak und Kapuze, belebte das Gesicht, rötete die Ohren unserer Männer unter den weichen wollenen Mützen. Wir schrien, jubelten, lachten, hüpften herum, ausgelassen fröhlich wie die Kinder. Winter-Stimmung.
Raimund kam allein zu uns. Wir bewohnten eine Zwei-Zimmer-Wohnung mit Wohnküche und Dachschrägen in einem Drei-Familien-Haus. Gemütlich eingerichtet, viel Holz, orange gebeizt, grüne Stoffe, Schilfgras- und Reisstrohteppiche, Grünpflanzen, bunte Mobile mit Figuren aus Papier, Holz, Federn hingen von den Decken. Weißes Schleiflack-Schlafzimmer, bunte flower-power-Vorhänge. Unser erstes gemeinsames Zuhause.
Raimund zog seinen Kopf ein. Er war zu groß für unsere Wohnung mit den niedrigen Decken, den Holzbalken, den Schrägen. Lang, schlaksig. Sein Kopf wirkte klein zwischen den breiten Schultern. Kurz geschoren. Eine schmale gebogene Nase, darunter ein Schnäuzer, leicht rötlich-blond, mit liebevoll nach oben gezwirbelten Spitzen. Braune Augen. Großrautierter Pullunder über gestreiftem Hemd, kleinkarierte Bäckerhose. Die Hornbrille stand ihm gut.
Auch Volker trug einen Oberlippenbart und lange Koteletten, das dunkle Haar schulterlang. Protestzeichen unserer Generation. Stahlgraublaue Augen hinter einer Nickelbrille. Freundliche Lippen, die gern sangen, gelegentlich auch meckernde Worte herausließen, wegen Belanglosigkeiten, je nach Stimmung. Er war einen Kopf kleiner als Raimund. Eine Sandkasten-Freundschaft verband sie solide, kumpelhaft zu dieser Zeit, ehrlich. Wir alle hatten uns auf einem Schulfest kennen gelernt. Zehn Jahre fast war dies her. Raimund, Volker, Sabine und ich.
Mit ruhiger weicher Stimmer erzählte er uns, Sabine ist im Krankenhaus, sie hatte eine Fehlgeburt, dritter Monat, sie haben nicht gewusst, dass sie schwanger war, es geht ihr schon besser. Am nächsten Tag ging ich nach der Arbeit zu ihr. Es ist einfach so passiert, sagte sie ungläubig. Gefreut hätten wir uns, aber darauf angelegt haben wir es auch nicht. Sie nahm noch keine Anti-Baby-Pille, er benutzte kein Kondom, Koitus Interruptus war ihr Verhütungsprinzip. Wie bei uns, den meisten Paaren zu dieser Zeit. Ungewollt schwanger werden als Unverheiratete hing wie ein Damoklesschwert über unseren Beziehungen, über jeder Liebe. Ich kannte einige Frauen, die nach Holland zur Abtreibung fuhren, wenn sie das Geld dazu hatten. Mittellosen Frauen blieb die Engelmacherin oder sie legten selbst Hand an sich, verbluteten oder verletzten sich schwer. Grauenvoll. Wir hatten Glück vor unserer Ehe. Sabine erholte sich rasch.
Es war im Spätsommer nach einem langen trockenen, fast mediterranen Sonnensommer. Das Leben der Menschen spielte sich vor allem im Freien ab, so bald Büro, Fabrikhalle, Kaufladen, Werkstatt verlassen werden durften. Eine 45-Stunden-Woche war normal für die Arbeitenden, noch Anfang der 1970er Jahre. Hitzefrei gab es nur für die Schulen. Die Arbeitstage zogen sich quälend lang.
Sonntag war Tanztee. Der letzte in unserem Lieblingslokal. Das historische Gebäude mit den uralten Linden, dem römischen Brunnen im Außen-Café sollte abgerissen werden, dem Bau eines Omnibusbahnhofs weichen. Bürgerproteste fanden kein Gehör. Die Nachfrage nach Tanztee-Veranstaltungen hatte nachgelassen. Ins Café oder Restaurant ging auch kaum noch jemand. Also verzichtbar. Die Menschen blieben zu Hause in eigenen vier Wänden oder reisten nach Süden, Italien, Griechenland waren angesagt.
Jugendkultur gab es nicht wirklich. Versteckt in Kellern vielleicht noch ein wenig wie zu unserer Zeit. Die ersten Jugendheime waren entstanden, städtische, kirchliche, die mangels Alternativen gut besucht waren. Unsere Bands hatten sich aufgelöst durch Studium, Heirat, Beruf, fehlendes Interesse. Die Straßen waren wie leer gefegt des Nachts. Gut bürgerliche Zeiten. Die Ruhe vor dem Sturm.
Wir machten uns fein, Sabine und ich. Cocktail-Kleid mit angesteckter Stoffrose, Perlenkette, Perlenohrclips, kirschroter Mund, die Augen leicht schwarz umrandet, die Nase gepudert, Rouge auf den Wangen. Chanel No 5 dezent hinter die Ohren getupft, Stöckelschuhe mit schmalen Spitzen, die die Zehen einquetschen. Unsere Männer wie eh und je in dunklem Anzug. Die Tanzfläche war leer. Eine Tanzkapelle spielte. Die meisten Tische waren besetzt, wir hatten reserviert vorsichtshalber. Walzer, Foxtrott, Jive, Boogie-Woogie. Wir legten los. Wir hatten Spaß. Verschwitzt legten wir die erste Pause ein, gingen nach draußen zum Brunnen unter die Linden.
Raimund sah als erster das Knäuel aus Kleidung, drum herum ein paar Menschen. Neben der ausladenden Treppe. Eine zusammengesackte Gestalt. Wütende Rufe nach Polizei, eine Schande dieses Lumpengesindel, säubern die Stadt von diesem Schmutz ... Wir wollten helfen. Die Erinnerung an Olli kam in uns hoch, Hans Ollert, unser obdachloser Freund. Wir sahen uns an und waren schon da.
Dem Menschen ging es schlecht, das sahen wir sofort. Einen Krankenwagen, rief ich. Volker eilte ins Café zum Telefonieren. Sabine und ich beugten uns vor, ich schob die Schiebermütze zur Seite. Er atmete heftig, unregelmäßig, schwer, hielt sich im Krampf den Leib. Es war Jupp, der Rheinländer, noch jung damals und häufig an Ollis Seite. Er arbeitete als Tagelöhner im Straßenbau, setzte sich oft zu ihm, sprach mit ihm, hörte zu, war begeistert von unserer Straßenmusik. Jetzt sah er aus, als hätte auch er kein Zuhause, kein Dach über dem Kopf. Leicht wehte Alkohol aus seinem röchelnden Atem. Wir sprachen ihn an mit seinem Namen. Er blickte schwach auf zu uns, erkannte uns nicht, seine Miene entspannte sich etwas. Der Krankenwagen kam. Sabine und ich begleiteten ihn ins nächste Krankenhaus. Wir ließen uns nicht abwimmeln, wollten erreichen, dass man ihm half. Not-Operation. Der Blinddarm kurz vor dem Durchbruch. Er bekam ein schönes Zimmer mit zwei anderen Männern zusammen. Man versorgte ihn gut, sprach freundlich mit ihm. Er blühte auf. Hätte er auch diese Behandlung erfahren ohne unser Beisein? Wohl kaum.