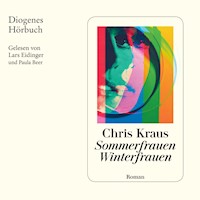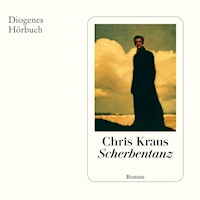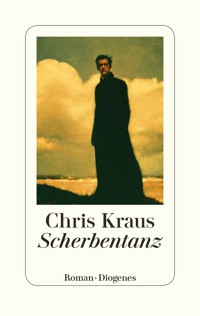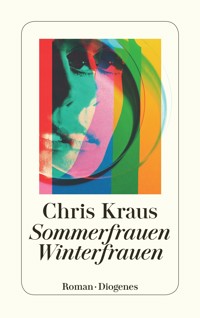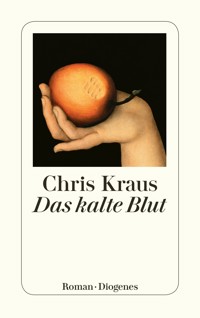Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Matthes & Seitz Berlin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ende der 1990er-Jahre fliegt Chris Kraus, die Figur dieses Romans, nach Berlin, um ihren Film "Gravity & Grace" auf einem Festival zu zeigen. Nicht auf der Berlinale natürlich, die das Filmprojekt über Hoffnung, Verzweiflung und quasireligiöse Ekstase nicht annehmen wollte, sondern nur auf einem kleinen Festival, für das sich niemand interessiert. Chris ist gescheitert. In ihrem Liebesleben sowieso, jetzt noch in ihrer Kunst und bald sicher auch in ihrem Denken. Während das neue Jahrtausend vor der Tür steht, wartet sie auf E-Mails ihres SM-Partners, der gerade in Namibia einen Hollywoodfilm dreht. Hilfe suchend wendet sie sich erneut Simone Weils Klassiker "Schwerkraft und Gnade" zu, der sie vor Jahren zu ihrem gefloppten Film inspirierte. Chris versinkt immer mehr im Leben und Denken der französischen Philosophin. Ausgehend von deren Askesepraxis sieht sie in der Anorexie eine Möglichkeit, den eigenen verhassten, dysfunktionalen Körper ein für alle Mal zu verlassen. Durch die Auseinandersetzung mit Ulrike Mein ofs theoretischem Werk, Paul Theks Kunst und Aldous Huxleys Drogenerfahrungen gelingt es Chris, ihre Perspektive auf das eigene Scheitern und Sein zu verändern.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 349
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Chris Kraus
Aliens & Anorexie
Aus dem amerikanischen Englisch von Kevin Vennemann
Dieses Buch ist der Erinnerung anDavid Rattray und Lily gewidmet.
Inhalt
Aliens & Anorexie
Teil 1
Teil 2
Teil 3
Teil 4
Teil 5
Gavin Brice
Schwerkraft & Gnade
Teil 1: Neuseeland
Teil 2: New York
Danksagung
Bibliografie
Aliens & Anorexie
Countdown auf der Millenniumsuhr an der Ecke 34th Street und 7th Avenue in Manhattan. Ein Raster aus zuckenden Lichtpunkten, die sich zu Ziffern zusammensetzen, umringt von Sponsorenlogos in leuchtenden Farben, die in das Plastichrome gebrannt sind – TCBY, Roy Rogers, Staples und Kentucky Fried Chicken – eine neomittelalterliche Mitteilung unserer Sponsoren, die uns davon in Kenntnis setzt, dass zwar die Zeit flüssig sein mag – das Kapital jedoch ist von Dauer –
Noch 468 Tage, 11 Stunden, 43 Minuten, 16 Sekunden
1
New York City, Herbst 1978
Wir befinden uns in einem großen Raum im ersten Stock, wo Pisti und Eva wohnen. Squat Theater, eine ungarische Gruppe von Schauspielern-Künstlern-Untergrundintellektuellen, deren Arbeit in Budapest verboten war, weil sie »moralisch anstößig, obszön« sei und nicht der »kulturpolitischen Zielstellung der Regierung« diene, lebt jetzt in einem Gebäude auf der West 23rd Street mit ihren Kindern. Sie brauchen einen Ort, wo sie leben und arbeiten können, wo sie die Grenzen zwischen ihrem kollektiven Alltag und ihren Performances, dem Inneren ihres Theaters/Zuhauses, zwischen Passanten und Straßenverkehr auflösen und neu ausrichten können. Sie verbringen Monate damit, zu planen und die Details ihrer Performances zu diskutieren, doch sie proben nicht.
In Andy Warhols letzte Liebe sitzt Eva Buchmuller, eine junge Frau mit langem Haar und bekleidet mit einem kurzen schwarzen Unterrock, vor einem Bücherregal an einem Tisch. Sie beschwört die Stimme der toten Ulrike Meinhof durch ein Paar Kopfhörer hindurch. Sie raucht, hört angestrengt zu:
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Hier spricht Ulrike Meinhof zu den Erdenbewohnern. Ihr müsst euren Tod öffentlich machen. Am Abend des 9. Mai 1976 in einer speziellen Einzelhaftzelle des Stammheimer Gefängnisses, in derich ohne Schuldspruch und auf Anweisung des Oberstaatsanwaltes der Bundesrepublik Deutschland als eine der Anführerinnen der Roten Armee Fraktion gefangen gehalten wurde
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Als sich der Strick um meinen Hals zusammenzog, im selben Moment, in dem ich meinen Verstand verlor, verlor ich mit einem Mal auch meine Wahrnehmung, gewann jedoch mein gesamtes Bewusstsein und Urteilsvermögen zurück. Ein Außerirdischer machte Liebe mit mir.
Wenn es tatsächlich wahr ist, wie manche Tageszeitungen schreiben, dass man Spermaspuren auf meinem Kleid fand, stammen diese womöglich vom Geschlechtsverkehr.
Nachdem wir Liebe gemacht hatten, stellte ich fest, dass mein Bewusstsein in einem neuen und unverletzten Körper weiter wirkte.
Im Anschluss nahm mich der Außerirdische mit zu einem besonderen Planeten, der zu Andromeda gehört. Die Gesellschaft dort geht mit Zeit und Raum intensiv, sanft, diszipliniert und frei um. Over …
In diesem Stück treffen Andy Warhol und Ulrike Meinhof aufeinander, zwei kulturelle Ikonen, die gegensätzlicher jedoch kaum sein könnten. – Sie bilden eine dialektische Synthese, die in psychische Zustände transponiert wurde. Jahre später schrieb Eva Buchmuller: »Ulrike Meinhof ist eine Legende, die Politik in tragische Poesie verwandelte […]. Nach den Grundsätzen der Popkultur ist Andy Warhol ein Klon seiner selbst. Deshalb ist er so real, wie es eigentlich nur geht. Wie sind Andy Warhol und Ulrike Meinhof einander begegnet? Reiner Zufall.«
Am 17. Januar 1996 flog ich von Los Angeles nach Berlin.
Ich war unterwegs nach Deutschland, um den Berliner Filmfestspielen beizuwohnen, beziehungsweise, um genauer zu sein, um zum European Film Market zu gehen, weil nämlich Gravity & Grace, jener billige Indie-Film, den ich in den drei Jahren zuvor produziert, geschrieben, geschnitten hatte, bei dem ich Regie geführt hatte und den ich nun auch noch vertreiben musste, bereits zweimal in allen drei Kategorien der Berliner Filmfestspiele abgelehnt worden war. Vor einigen Jahren war der European Film Market den Festspielen als kommerzielle Plattform hinzugefügt worden – eine profitable Handelsmesse, auf der all jene Waren gekauft und verkauft wurden, die als unpassend für die Festspiele galten. Hunderte von europäischen Fernsehdramen, asiatischen Action-Filmen, lateinamerikanischen Thrillern wechselten die Besitzer und wurden zwischen Produzenten und Vertrieben, Einkäufern fürs Fernsehen, Entertainment-Anwälten, Banken und Regierungskonsortien hin und her gereicht. Der European Film Market ist der beste Ort für den Zweitmarkt des »Welt-«Films – das heißt für alles das, was außerhalb von Hollywood produziert wird.
Gravity & Grace war ein experimenteller 16-mm-Film über Hoffnung, Verzweiflung, über religiöse Gefühle und religiöse Überzeugungen. Er ist sehr philosophisch, anstatt von Handlung oder Figuren getragen zu werden, und er rahmt das Leben zweier Teenager-Mädchen und einer desillusionierten Frau in ihren Vierzigern.
Tagebucheintrag auf dem Flug von Los Angeles nach London, 17. Januar, die ersten neun Stunden der zwanzigstündigen Reise: »Ich will nicht nach Berlin.«
Weil keine meiner Bekannten oder Freundinnen diejenige sein wollte, die mir endlich ins Gesicht sagt, dass der Film gescheitert sei, taten alle so, als sei diese »Einladung« zum European Film Market eine Ehre und sogar eine Chance. Und dann gab es ja noch jene urbane Legende, dass Jennifer Montgomery, die Ex-Freundin meiner Freundin, der Lyrikerin Eileen Myles, im Jahr zuvor auf dem Marketeinen Vertriebsvertrag mit New Yorker Films für ihren Spielfilm Art for Teachers of Children unterzeichnet hatte, obwohl der Film vom Festival abgelehnt worden war …
Doch Gravity & Grace war schlicht und einfach unattraktiv das Heimvideo einer Amateurintellektuellen, auf bulimische Längen ausgedehnt, gefilmt und geschnitten in drei Ländern mit einer Besetzung und Crew von insgesamt siebzig oder achtzig Personen, das ungefähr so viel wie eine Dreizimmerwohnung in Park Slope gekostet hatte. In den sechs Monaten nach seiner Fertigstellung war der Film von jedem größeren Filmfestival abgelehnt worden, von Sundance bis Australien und Turin.
Glücklicherweise unterhielt die New York Foundation for the Arts ein Programm, das Filmen wie diesem unterstützend zur Seite stehen sollte. Von der unternehmungslustigen Lynda Hansen initiiert, kaufte die Delegation der American Independents and Features Abroad jedes Jahr einen ganzen Satz von Plätzen auf dem European Film Market und verkaufte sie dann an ein Dutzend Filmemacher weiter. Der Preis – etwa 3000 Dollar – deckte die Registrierung für den Market und eine Aufführung des Films. Als kostenlosen Bonus sorgte die NYFA dafür, dass jeder Film eine Seite PR-Gequatsche in der American Independents-Broschüre erhält und der Regisseurin auf dem Market der Zugang zu »dem Stand« ermöglicht wird, was im Grunde nur bedeutete: Zugang zu den Nachrichtenfächern der Produzenten, die diese Fächer wiederum, wie sich in meinem Fall erwies, überhaupt nicht nutzten.
In diesem Januar 1996 hatte ich nun bereits seit zweieinhalb Jahren aus meinem Koffer gelebt, war unablässig damit beschäftigt, Geld zur Finanzierung des Films aufzutreiben und meinen Ehemann Sylvère Lotringer – ein distinguierter europäischer Intellektueller – für mich zu prostituieren. Einmal war ich überzeugt, mich nun endlich vollkommen der reinen Verschwendung unterworfen zu haben, die dieser Film darstellte, als ich 350 Dollar für eine einzige FedEx-Sendung ausgab, mit der ich 16-mm-Filmbänder von Neuseeland aus, wo das Versprechen einer kostenlosen Labor-Verarbeitung nicht eingehalten worden war, nach Toronto sandte, wo die nötigen Veränderungen immerhin nicht allzu viel kosteten. Und dennoch hatte ich das Gefühl, dass dies nun noch immer nicht alles war. Einer Abwärtsspirale so weit wie möglich zu folgen hat etwas Symmetrisches. In L. A. half mir meine Freundin Pam Strugar dabei, einen Haufen handgemachter Pressebroschüren anzufertigen – ich erinnere mich an eine Diskussion über die Farbe der Büroklammern –, und also schickte ich der NYFA einen Scheck, kaufte ein Flugticket und machte mich auf den Weg.
Weil die 16 kg schwere Nullkopie von Gravity & Grace im Grunde unersetzbar war, nahm ich sie und eine Tasche Pressebroschüren mit ins Flugzeug. Und das war die richtige Entscheidung gewesen, weil nämlich die Fluglinie mein Gepäck in Heathrow verlor, während ich auf meinen Anschlussflug nach Berlin-Tegel wartete, der verschoben worden war. Es dauerte drei Tage, bis das Gepäck wieder auftauchte.
Nach einer 24-stündigen Reise trat ich mit dem Film und ganz ohne Winterkleidung in die kalte und bleierne Januarluft hinaus. Ich hatte ein Stück Papier mit der Adresse und Telefonnummer der Gelegenheitsfreundin eines Radioproduzentens aus Los Angeles, den ich kaum kannte. Bei ihr sollte ich unterkommen. Gudrun Scheidecker erwartete mich. Wir hatten einmal telefoniert. Sie hatte mal einen Sommermonat lang mit dem Radioproduzenten zusammengewohnt und betrachtete meinen Besuch unerklärlicherweise nun als Gelegenheit, ihre Schuld zu begleichen. Ich hatte mich auf dieses Arrangement gestürzt, weil der Wechselkurs zwischen dem US-Dollar und der Deutschen Mark so niedrig war. Ich wusste inzwischen längst alles über die Wechselkurse ausländischer Währungen.
Am frühen Abend des 18. Januar also nahm ich mit der Nullkopie und den Pressebroschüren unterm Arm ein Taxi vom Flughafen zu Gudrun Scheideckers Wohnung in einem zentral gelegenen Viertel namens Kleistpark. Ich trug nichts als ein Sweatshirt über meinen Reiseklamotten.
Weil wir beide Mädchen waren, berichtete mir Gudrun Scheidecker alles über ihr Leben.
Obwohl sie, wie sie selbst schon bald betonte, sehr viel jünger aussah, war Gudrun Scheidecker 48 Jahre alt. Sie war nie verheiratet gewesen, hatte jedoch zwei Liebhaber, deren Existenz sie beiden jeweils verheimlichte. Das klang kompliziert, folgte jedoch einem exakten Zeitplan: mit dem einen traf sie sich immer montags und donnerstags; mit dem Zweiten samstags und mittwochs, und an den übrigen Abenden schlief sie allein.
In Europa stehen bestimmte Formen gegenkultureller Zeit still. Gudrun Scheidecker sprach mehrere europäische Sprachen und beschrieb sich als Gymnasiallehrerin und Reisende. Ihre Stelle ermöglichte ihr, regelmäßig unbezahlten Urlaub zu nehmen, weshalb sie immer nur gerade lang genug arbeitete, bis sie wieder aufhören und ein Jahr lang reisen konnte. Die Stadt Berlin gab sich längst nicht genug Mühe, die Gudrun Scheideckers aus Vierteln gehobener Preisklasse wie Kleistpark herauszuspülen: Sie brüstete sich damit, dass sie in dieser ungeheizten, mietgeschützten Dreizimmerwohnung mit hohen Decken nun schon seit fast dreißig Jahren wohnte.
Plötzlich schüttelte Gudrun Scheidecker ihr gepflegtes langes braunes Haar und fragte mich, ob ich die Künstlerin Sophie Calle möge. »Hm, ich glaube schon«, sagte ich. »Ich liebe sie«, quietschte Gudrun, »und zwar, weil sie genau wie ich ist!«, und dann erzählte sie mir alles über das neue »Hobby«, dem sie nachging, um sich in den Jahren aufzumuntern, die sie nicht auf Bali oder Sumatra oder Fidschi verbringen konnte: »Erinnerst du dich an das Projekt, das Sophie mit ihrem Adressbuch gemacht hat? Nun«, sagte sie, »manchmal macht es mir Spaß, draußen herumzugehen und nach gutaussehenden Männern zu suchen. Ich teste, wie lange ich ihnen folgen kann, ohne dass sie mich sehen.«
Ich sah sie erschrocken an: eine schlaksige Frau in Stiefeln und Jeans, mit handgestricktem Pullover und den vollen, dunklen Lippen und der seidigen Haut einer 28-Jährigen. Mit fast fünfzig hatte Gudrun Scheidecker keinerlei Vergangenheit, war nicht gebunden, hatte keinen Beruf, keinen Besitz und nichts vorzuweisen als ihr jugendliches Aussehen. Interessanterweise fühlte nun auch ich mich wie verjüngt von dem Schauspiel dieser Gudrun. Wenn man jung ist, betrachtet man ältere Frauen, als seien sie Chiffren. Chiffren, die man lieber nicht decodieren möchte, weil man ahnt, dass man die eigene Zukunft zu Gesicht bekommen könnte. Ihre Niederlagen und Kompromisse sind so offenkundig. Man fragt sich, ob sie bemerken, dass man ihre Gesichter studiert, während sie sprechen: das hängende Fleisch um den Mund herum und auf der Stirn, die schweren, fragilen Augenlider, man fragt sich: Könnte ich das sein? Vage Ahnungen eines Mädchens, das überzeugt davon ist, dem Schicksal trotzen zu können, obwohl sie nur allzu gut weiß, dass die Frau, die sie sieht, einst auch einmal ein Mädchen war … Der Unwille, dann noch weiter darüber nachzudenken, wie man letztlich unweigerlich von hier nach dort gelangen wird. Beziehungsweise, genauer gesagt, der Unwille, sich die Ereignisse auszumalen, die einen in den bevorstehenden zwanzig Jahren noch entstellen werden …
Es war bereits dunkel geworden, und es hatte zu schneien begonnen. Gudrun Scheidecker half mir, meine Sachen zu verstauen. In der Wohnung war es kalt. Das Zimmer, in dem wir gesessen hatten, Gudruns Schlafzimmer, wurde von einem kleinen Kohlenofen aus Keramik geheizt. Weil das andere Zimmer, das Gästezimmer, überhaupt nicht geheizt wurde, gab sie mir zwei Wolldecken, als sie mir eine gute Nacht wünschte.
Am nächsten Morgen drückte Gudrun mir eine U-Bahn-Karte in die Hand und wünschte mir viel Glück. Es war Montagmorgen. Ich nahm die U-Bahn bis zum Ku’damm, gegenüber vom Zoo. Ein riesiges Vordach am Gebäude, in dem sich das Hauptquartier der Berliner Filmfestspiele befand, verkündete die Weltpremiere, morgen Abend, eines Action-Films mit Sharon Stone. Der European Film Market war in einem vierstöckigen Bürogebäude in der Nähe untergebracht, das man für diese Woche in ein Messezentrum mit sechs Vorführsälen, 340 Informationsständen und 6000 hungrigen Medienprofessionellen verwandelt hatte.
Der Stand der American Independents-Delegation befand sich in einer hinteren Ecke in der Nähe des Kodak-Film-Stands auf dem dritten Stock. Gordon Laird, der Koordinator dieser »Delegation« der New York Foundation for the Arts, den ich noch nie getroffen, mit dem ich jedoch am Telefon gesprochen hatte, überreichte mir ein Informationspaket und einen Zeitplan, dann drehte er sich um, um jemand Wichtigen zu begrüßen.
Na ja, ich musste nirgendwo sein und hatte nichts zu tun, also lehnte ich mich an den Stand und blätterte in den Broschüren. Ich fand eine Liste mit Vorführzeiten für die zwölf Filme der Delegation. Ich hatte bereits das Gefühl, dass der richtige Zeitpunkt von großer Bedeutung war, es gab Tausende von Vorführungen, und Gravity & Grace war für 9 Uhr am Freitagmorgen eingeplant, dem letzten Tag des Market. Ich ging davon aus, dass die Leute erst gegen 11 Uhr in die Messehalle zu stolpern beginnen würden, wenn überhaupt, und zwar nach einer oder gar mehreren wilden Abschlusspartys, zu denen ich, wie ich feststellte, ebenfalls nicht geladen war. Und dass die Partys am allerwichtigsten sind, wissen ja alle. In Rotterdam beim Cinemarket vor zwei Jahren war ich überhaupt nur deshalb an ein paar Meetings gelangt, weil ich mich besoffen und dann mit einem ehemaligen Philosophen geflirtet hatte, der nun als Produzent arbeitete und dem ich erzählte, ich sei die Großnichte des Satirikers Karl Kraus. Meine einzige Einladung hier galt für die einzige von der NYFA gesponserte Cocktailparty am Dienstagabend …
Ich zog Gordon am Ärmel und fragte ihn: »Was ist mit den Partys?« »Mach dir keine Sorgen«, antwortete er, »du wirst noch Leute treffen, die dich dann zu den anderen Partys einladen.«
Das erschien mir schon jetzt ziemlich zweifelhaft. Überall um uns herum wurden Geschäfte gemacht, und ich schwitzte, konnte keinen Ort finden, an dem ich meinen schweren Lammfellmantel hätte ablegen können, den Gudrun mir geliehen hatte, bis mein Gepäck ankam, und also zuckte ich mit den Achseln und lächelte auf charmant selbstironische Weise. »Nun, Gordon, dann denke ich mal, wenn schon sonst nichts passiert, bekomme ich immerhin eine Menge Filme zu sehen.« Er sah mich spöttisch an. »Das ist ein Filmmarkt. Zu den Vorführungen haben nur Einkäufer Zugang.« Sofort zuckten meine Gedanken über das Dreieck zwischen Messezentrum, U-Bahn-Station Kleistpark und Gudrun Scheideckers Wohnung hinweg. Ich hatte keine Kontakte, keine Termine. »Und denk bitte daran, dass du hier bist, um zu netzwerken«, sagte Gordon und entließ mich.
»Warte!«, sagte ich. Ganz egal, wie sehr Gordon Laird mich auch hasste, wie unbedeutend, absurd meine Anwesenheit war, ich war eine New Yorker Jüdin und hatte deshalb das Recht, darauf zu pochen, dass ich etwas für mein Geld bekomme. »Was meine Vorführung angeht – sie findet so früh statt, am allerletzten Tag. Glaubst du wirklich, dass da irgendwer kommt?« Gordon sah mich an und sagte: »Das hängt ganz von dir ab. Du weißt schon, du musst die Leute auf dem Market ein bisschen bearbeiten, Flyer verteilen.«
Meine Gedanken schossen voraus zu einem Bild meiner selbst, wie ich in den Messehallen in Gudruns Lammfellmantel Flyer austeilte wie eine Zeugin Jehovas. Es war kein angenehmes Bild. Gordon sah das. »Weißt du«, sagte er, »es könnte durchaus sein, dass du noch eine zweite Vorführung zu einer besseren Zeit kaufen kannst.«
Als ich zustimmte, übergab er mich an seine Assistentin Pam, eine junge schwarze Absolventin des Sarah Lawrence College, die mir einige Formulare zum Ausfüllen gab und mir erklärte, an wen ich mich zu wenden hatte. Dieses Projekt dauerte weitere 40 Minuten und kostete 300 Dollar. Und nach all dem war es noch immer erst halb zwölf morgens. Überall wurden in anderen Sprachen Geschäfte getätigt, und nirgendwo konnte man sich hinsetzen, ohne drei Dollar für einen Kaffee zu bezahlen, und sogar wenn ich das tat, wollte niemand mit mir sprechen.
Draußen war alles grau und matschig. Ich zitterte auch trotz des Mantels, in dem ich den ganzen Morgen geschwitzt hatte. Als ich hier auf dem Bürgersteig mit dem dicken Verzeichnis des European Film Market unterm Arm stand, mit einem tragbaren Büro in der Handtasche, mit selbstgemachten Pressebroschüren, kopiertem Briefpapier mit Briefkopf und einem Filzstift, war ich mit meinem Film an einen Endpunkt angelangt. Genau hier geht alles zu Ende, dachte ich.
Innerhalb weniger Augenblicke nach ihrem Tod im Jahr 1976 wurde Ulrike Meinhof zu einer Außerirdischen. »Erst im Moment des Todes erlangt ein Erdling die Eigenschaften und die Intensität, mit der Außerirdische geboren werden.« In Squat Theaters Stück reitet Andy Warhol auf einem weißen Pferd in den Financial District von Manhattan ein. Meinhof kehrt zurück, um ihm entgegenzutreten, sie bewohnt den Wirtskörper eines Kindes. Zzzzzz. »Ihr müsst«, sagt sie, »euren Tod öffentlich machen.«
Genau wie vom Squat Theater heraufbeschworen, treffen der Mythos Warhol und der Mythos Meinhof in einer Performance aufeinander. Anstatt vorab alles schriftlich auszuarbeiten, »wurde ein potenzielles Handlungsfeld abgesteckt«. Diese Unberechenbarkeit erweckte die Wirklichkeit zum Leben, die nun auf sehr viel unmittelbarere Weise theatralisch war als das Theater.
Lange bevor der Künstler Gerhard Richter in seinen verschwommen spektralen Gemälden ihrem mythischen Bild einen Körper verleihen sollte, hatte Meinhof ihr Leben zu einem Mythos umgestaltet. Wie war sie zum Mythos geworden? Während Andy Warhol, wie das Squat Theater behauptete, »entkräftete Kunst in tägliche Nahrung verwandelte und seine Freiheit in der vollkommenen Einheit mit der existierenden Welt fand«, lebte Meinhof in der Opposition. Für Eva Buchmuller existiert ihre Politik außerhalb der historischen Zeit – als Akt »tragischer Dichtung«.
Was mich an Meinhofs Leben am meisten bewegt, ist die Art und Weise, auf die sie eine öffentliche Transformation durchlief. Die Art und Weise, auf die sie die sehr bewusste, gewissenhaftigkeitsgetriebene Welt des akademischen öffentlichen Diskurses weit hinter sich ließ und unmittelbar vor ihrem Tod in das Reich der reinen Empfindung eintrat. So wie das Squat Theater die Arbeit eines Schauspielers beschreibt, genau so lebte sie: »eine Existenz manifestierend, die sich über ihre bloße Repräsentation hinwegsetzte«.
Am 14. Mai 1970, als sie Andreas Baader dabei half, aus dem Tegeler Gefängnis auszubrechen, überschritt Ulrike Meinhof die Trennlinie zwischen Aktivistin und Terroristin. Als jene Fernsehjournalistin getarnt, die sie tatsächlich einst gewesen war, organisierte sie ein Interview mit ihm und dem schicken Deutschen Zentralinstitut für soziale Fragen. Als er ankam, in Handschellen zwischen zwei Gefängniswärtern, wartete sie mit ihrem Presseausweis und einer Pistole. Dann traten auf Kommando zwei Mädchen mit Perücken und Aktenkoffern ein und begannen mit den Wärtern zu flirten, schufen auf diese Weise eine Ablenkung für den maskierten Mann, der mit gezückter Waffe hereinkam. In den folgenden verwackelten 30 Sekunden drückte Ulrike eines der bleischweren Fenster auf, die von Wand zu Wand reichten, griff nach Andreas’ Hand und sprang. Sie landeten und rannten.
Bis dahin war Meinhof eine zunehmend militante, aber überaus sichtbare Journalistin und Intellektuelle gewesen, die kurz mit Klaus Rainer Röhl verheiratet gewesen war, einem Funktionär des Mainstream-Kommunismus, der später behauptete, ihr alles beigebracht zu haben. Jahre später schrieb er in einer selbstverliebten Autobiografie, dass ihre Liebe zum Kommunismus und zu ihm im Grunde ein und dasselbe gewesen seien. Mit 18 hielt man sie für brillant, sie gewann Stipendien und Preise und wurde von der Führung von Röhls eigener Partei umworben, die ihr eine große politische Karriere vorhersagte.
Mit 27 war sie Chefredakteurin von konkret, einem einflussreichen Politmagazin. Sie und Röhl hatten Zwillingstöchter und ein Landhaus. Sie hielt Vorträge, kommentierte fürs Fernsehen das politische Geschehen, schrieb. Sie war die symbolische Vorzeigefrau auf jedem Panel. Und trotzdem fand sie kein Gefallen an ihrem Leben. »Das Verhältnis zu Klaus […], [d]as Haus, die Partys, Kampen, das alles macht nur partiell Spaß, ist aber neben anderem meine Basis, subversives Element zu sein […]. Menschlich ist es sogar erfreulich, deckt aber nicht mein Bedürfnis nach Wärme, nach Solidarität, nach Gruppenzugehörigkeit«, schrieb sie mit 31 in ihr Tagebuch.
Während Meinhofs schwieriger Schwangerschaft, die ihr unablässige, lähmende Kopfschmerzen verursachte, übernahm Röhl ihre Position bei konkret, das er in eine Art deutsches Evergreen verwandelte: Politik vermengt mit affigen Bildchen nackter Hippie-Mädchen, »eine Wichsvorlage«, wie sie es nannte. 1968 ließ sie sich von ihm scheiden und führte einen Aufstand gegen das Magazin an, über den weit und breit Bericht erstattet wurde.
Und dann nahm sie sich ein Jahr lang frei und recherchierte einen Fernsehfilm namens Bambule. Sie hing im Eichenhof herum, einer Reformschule in Berlin für analphabetische, abgefuckte Teenager-Mädchen. Meinhof war zu ihrem Einfluss und Erfolg gekommen, weil es ihr nie an Worten gemangelt habe, doch in diesem Moment verliebte sie sich in die verwirrte Logik der Stimmen dieser Mädchen. Ihr fiel auf, dass es ihr unmöglich war, sie zu objektivieren. Sie stritt sich mit dem Regisseur, rebellierte gegen die Rolle der Journalistin.
In dem Manuskript, das Jahre nach ihrem Tod im Jahr 1976 publiziert wurde, lässt Meinhof ihre Figuren in ebenjenem nüchternen und abgestumpften Rhythmus ihrer eigenen Worte über das Leben auf der Straße sprechen. Sie eröffnet die Geschichte von Irene aus der Perspektive der Beobachterin: »Irenes Geschichte ist eine Kindergeschichte, ein Schabernack. Sie endet mit Polizeieinsatz und Bunker.« Und dann übernimmt Irene …
Erika und ich, wir durften ja immer auf den Hof, weil se gehofft ham, daß wir abhaun. Aber den Gefallen haben wir denen ja nicht getan. Na sind wir unten geblieben, ham da Blödsinn gemacht. Und die hat aus der Schule rausgekiekt, die Lehrerin war grad nicht rin. Und da sagt sie, sie will abhaun, ob wir ihr helfen. Naja, ham wir gesagt, ist gut.
… Ham wir so ne kaputte Leiter da an die Mauer gestellt, ging nicht, ist se nicht hochgekommen. […] Ham wir gedacht Scheiß. […] … Naja – ich hab den Anfang gemacht. Bin auf die Mauer geklettert und hab een Stein nach’m andern nach hinten runtergeschmissen. Na ich hab gedacht, hat keener gesehen. Kam Eka [sic] mal dran, hat een-zwe Steine runtergeschmissen. Bin ich wieder hoch. Nachher war die Mauer nur noch so hoch, daß man eben drübersteigen konnte. Und da [hat] se sich dann bequemt und is gegangen.
… Komm ich unten ins Zimmer, da sitzen da die ganzen hohen Tiere da. Die ham gesagt, was ich eben da hinten gemacht habe? Hab ich gesagt: Gar nischt. Und da sagt se: Was heißt gar nischt? Von der Mauer ist ja nichts mehr zu sehen. Mein ick, naja wird wohl einer n paar Steine abgenommen haben. … Naja, ein Wort ins andere, hab ich dann doch gesagt, daß ich’s war. Da wollt se wissen, wer noch bei war. Hab gesagt, na hab ich allein gemacht.
… Na ist gut, Du kommst in Bunker. Hab ich gesagt, na, ihr kriegt mich aber nicht rin, wa. […] Na ham se gesagt, müssen wir eben d’ Polizei holen. Hab ich gesagt, macht doch, mach ich mir nichts draus.
… Na hab doch nicht damit gerechnet, daß die wirklich die Polizei holen. Ham se angerufen, kam zwee Polizisten, ham gesagt, ich soll uffstehen. Hab ich nicht gemacht. Hat der eene mich hochgezogen, der andre mir n Tritt gegeben, da lag ich im Bunker, wa. […]
Und dann entdeckt Meinhof-die-Journalistin die übersinnliche Mobilität der Fiktion. Sie wechselt die Seiten, beginnt sich einzufühlen, aus der Perspektive der Mädchen zu sprechen:
Der primäre Zusammenhang zwischen Heimleben und späterem Leben ist: weil die Mädchen niemanden und nichts hatten und sich damit nicht abfinden wollten, kamen sie ins Heim. Daran, daß sie niemanden und nichts haben, hat das Heim nichts geändert. Niemanden haben, das bedeutet, daß wenn man von der Arbeit kommt, keine Butter und kein Brot im Haus ist, wenn man nicht selber eingekauft hat. […] Niemanden haben bedeutet mit anderen Worten, daß man in Kneipen und Lokalen rumhängen muß, wenn man jemanden treffen will, das bedeutet Geld ausgeben, das bedeutet, die Nacht durchmachen, das bedeutet, daß man nicht weiß, was das alles für einen Sinn hat.
Als arbeitende Journalistin und Intellektuelle empfand Meinhof eine gewisse Empathie, hatte jedoch keine direkte emotionale Verbindung zu dem, was sie an diesen Mädchen am meisten beunruhigte, was sie an ihnen als so verlockend empfand: der Mangel an Ambitionen, an Plänen, der schwebende Zustand des Verloren- und Unbedeutendseins. Anders als ihr Zeitgenosse Alexander Kluge, der die in eine Schieflage geratene Jugendliche »Anita G.« in seinem vielgepriesenen Film Abschied von gestern anthropologisierte, war Meinhof bereit, über die Distanz zwischen ihr selbst und den jungen Mädchen nachzudenken, die sie sich zum Thema gemacht hatte. Und dennoch waren sie Welten voneinander entfernt.
Würde Meinhof wirklich einen sprachlichen Krieg führen, nun da sie dem »bewaffneten Widerstand« beigetreten war? Direkte Aktion als Flucht aus der gehemmten Klaustrophobie eines arroganten, objektivierenden Diskurses. Ein Jahr später hatte sie sich mit Gudrun Ensslin angefreundet, einem Mitglied der RAF, und war federführend an Andreas Baaders Flucht aus dem Tegeler Gefängnis beteiligt. Hier ist der Wortlaut des Kommuniqués, das sie im Anschluss an ihre Flucht verfasste:
unsere aktion am 14. mai 1970 ist und bleibt die exemplarische aktion der metropolenguerilla. […] die aktion war exemplarisch, weil es im antiimperialistischen kampf überhaupt um gefangenenbefreiung geht, aus dem gefängnis, das das system für alle ausgebeuteten und unterdrückten schichten des volkes schon immer ist und ohne historische perspektive als tod, terror, faschismus und barbarei; aus der gefangenschaft der totalen entfremdung und selbstentfremdung, aus dem politischen und existenziellen ausnahmezustand, in dem das volk im griff des imperialismus, der konsumkultur, der medien, der kontrollapparate der herrschenden klasse, in abhängigkeit vom markt und vom staatsapparat zu leben gezwungen ist.
Direkte Aktion als Weg, dem Schicksal zu entgehen. Wie jeder terroristische Akt war der Überfall auf das Deutsche Zentralinstitut für soziale Fragen »exemplarisch«, eine Metapher, die von den Rändern aus auf eine sehr viel größere Bildfläche explodierte. Meinhof jedoch lebte nach wie vor innerhalb der engen Grenzen diskursiver Sprache. Es sollte noch sechs Jahre dauern, bis auch sie, als sie in ihrer Hochsicherheitszelle im Gefängnis Stammheim einsaß, »exemplarisch« wurde. Dass sie zu einer Außerirdischen wurde – zu jemandem also, die sich verändert hatte.
Ein paar Wochen vor ihrem Mord/Selbstmord, schreibt sie in ihrem geheimen Tagebuch in demselben dunklen Tonfall, mit dem sie einst die Mädchen in Eichenhof transkribiert hatte:
das Gefühl, es explodiert einem der Kopf (das Gefühl, die Schädeldecke müßte eigentlich zerreißen, abplatzen) – das Gefühl, es würde einem das Rückenmark ins Gehirn gepreßt, das Gefühl, das Gehirn schrumpelte einem allmählich zusammen, wie Backobstz. B. das Gefühl, man stünde ununterbrochen, unmerklich, unter Strom, man würde ferngesteuert – das Gefühl, die Assoziationen würden einem weggehackt – das Gefühl, man pißte sich die Seele aus dem Leib, als wenn man das Wasser nicht halten kann – das Gefühl, die Zelle fährt. Man wacht auf, macht die Augen auf: die Zelle fährt
Mit 42 hatte sie endlich denselben übersinnlichen Raum bezogen, in dem sie sehnsüchtig einst die inhaftierten Teenager-Mädchen beobachtet hatte.
Einige der Menschen, die an Außerirdische glauben, halten sie für feindliche, sadistische und emotionslose Invasoren, die menschliche Genitalien und Ani mit Hightech-Teleskopspiegeln erforschen. Ein bisschen wie SM, bloß ohne jedes Vergnügen.
Genau wie im Kino und wie bei SM folgt die Entführung durch Außerirdische einer Art narrativer Struktur in fünf Akten. Das Opfer wird aus der Sicherheit ihres Hauses oder ihrer Nachbarschaft entführt. Sie wehrt sich vergeblich, bis sie unter Drogen gesetzt wird, und dann werden unsägliche Experimente an ihrem Körper durchgeführt. Ihre Identität und ihr Wille werden gebrochen. Schließlich, nachdem sie diese Marter überstanden hat, wird sie mit einer Audienz bei dem verantwortlichen Außerirdischen belohnt.
Ausnahmslos ist dieser Außerirdische männlich. Die Entführte bemerkt, dass er all den anderen Außerirdischen übergeordnet ist: seine Körpergröße, seine mentalen Fähigkeiten, sein außerordentliches Ausdrucksvermögen. Sie ist dankbar für die Großzügigkeit, die er ihr zukommen lässt, indem er mit ihr spricht. Angesichts der Anforderungen seiner Zeit und der Allwissenheit seines Willens und seines Einflusses, ist seine Aufmerksamkeit ein kostbares Geschenk.
Der Große Mann, ups, ich meinte natürlich »der verantwortliche Außerirdische«, erfreut und foltert sie sodann mit einer unvollständigen Erklärung. Er erzählt ihr Dinge über außerirdische Technologie und Kultur, die sie niemals wirklich verstehen wird. Er sagt, dass er ihr die Gründe dafür begreiflich machen wolle, warum sie entführt worden sei. Sie sei als Zeugin ausgewählt worden, oder vielleicht deshalb, um mit einem außerirdischen Baby schwanger zu gehen. Er lässt quälend wolkige Andeutungen auf das apokalyptische Schicksal fallen, das die Außerirdischen planen …
In allen Fällen wird dem Opfer erst durch diese Befragung ein »Wissen« vermittelt. Die sexuelle Begegnung wird im Anschluss dann als Preis erachtet für dieses »Wissen« und nicht als dessen Quelle. Menschen, die sich vor Außerirdischen fürchten, sind extrem puritanisch. Ähnlich einer wiederhergestellten Erinnerung sind die Experimente von Außerirdischen eine beschämende und entsetzliche Qual. Noch nie hat jemand gesagt: »Ich wurde von Außerirdischen entführt und hatte den besten Sex aller Zeiten.«
Andere, die an Außerirdische glauben, betrachten sie als Freunde. Ausnahmslos ist dieser Kontakt asexuell. Der Zeitrahmen ihrer Begegnungen mit Außerirdischen ist diffus und vertrackt wie ein experimenteller Film.
Diejenigen, die es nach Begegnungen mit Außerirdischen verlangt, organisieren sich normalerweise in Gruppen, um nach ihnen zu suchen. Einem weitverbreiteten Glauben zufolge fühlen sich Außerirdische von magnetischen Energien angezogen, die größer sind als die Energien einer Einzelperson. Um zu einer Gruppe werden zu können, muss jede Person kleine Stücke ihrer selbst abgeben. In einem Magnetpool vergrößern sich die Stücke. Höhlen im Körper jeder einzelnen dieser Personen, die von den Bruchstücken eines aufgegebenen Egos geschaffen wurden, verwandeln sich in Rezeptoren für die Gruppenenergie, für Außerirdische und für das Dritte Gehirn.
Auf diese Weise wird die Gruppe zu einem sich selbst perpetuierenden Riesendurcheinander, das seinesgleichen verschlingt und ausscheidet.
Ganz grundsätzlich sind solche Arten von Gruppen vertrackt, führungslos und harmlos. Diese Menschen suchen außerhalb ihrer selbst nach Hilfe von Außerirdischen, weil sie so unbedingt »aus der gefangenschaft der totalen entfremdung und selbstentfremdung, aus dem politischen und existenziellen ausnahmezustand« entkommen wollen.
Die Aufzeichnungen, die die Philosophin Simone Weil während des Krieges in ihrem Notizbuch festhielt und die posthum in einem Buch namens Schwerkraft und Gnade erschienen, sind eine Chronik ihrer Bereitschaft, auf Gott zu warten. In dem Film Gravity & Grace, benannt nach Weils Buch, wartet eine Gruppe zu allem entschlossener Wahnsinniger auf Außerirdische, die sie aus einem Kleinstadtgarten in Neuseeland befreien sollen.
Gegen Mitte des Jahrhunderts, gegen Ende des Jahrhunderts. Immer wenn sich eine meiner befreundeten Rivalinnen in New York nach dem Film erkundigte, sagte ich: »Ich arbeite an einem kleinen Film über Gott.« Das brachte sie normalerweise zum Schweigen.
Millenniumscountdown: noch 454 Tage.
Die zweite Vorführung war für 15 Uhr am Donnerstag angesetzt, und jetzt war es Montagnachmittag. Zum Informationspaket gehörte eine Liste aller Einkäufer auf dem Market. Ich fand ein schmuddeliges chinesisches Restaurant am Ku’damm, bei dem ich davon ausging, dass man mich dort den Nachmittag über sitzen lassen würde. Beim Überfliegen der Liste fand ich etwa zwanzig Namen, mit denen ich vage vertraut war. Von diesen hatten zehn mein Werk bereits gesehen, ohne es sonderlich zu mögen.
Wenn ich auch keine Filme machen konnte, so wusste ich doch immerhin, wie man einen Brief schreibt. Ich nahm das Papier mit Briefkopf und Pressebroschüren heraus und schrieb zwanzig persönliche Briefe per Hand, variierte dabei die Tonlage und mein Verkaufsargument je nachdem, was ich über die Vorlieben des jeweiligen Empfängers wusste. Als dann endlich alle Briefumschläge versiegelt waren, wurde es dunkel, und es schneite.
Ich zahlte meine Rechnung und ging mit dem Gedanken zurück zum Market, dass ich meine Pakete in die Briefkästen der Einkäufer werfen würde. Doch anders als die American Independents hatten diese Leute keine eigenen Postfächer. Sie konnten nur erreicht werden, indem man die Pakete persönlich in ihrem Hotel ablieferte. Ich holte den Stadtplan hervor. Die Einkäufer waren in sieben verschiedenen Luxushotels untergebracht, die innerhalb eines Umkreises von knapp fünf Kilometern vom Ku’damm entfernt lagen. Gut und gerne hundert Dollar für ein Taxi aufzuwenden, um diese hoffnungslose Mission zu erfüllen, war undenkbar. Und so ging ich los …
Auf den Bürgersteigen lag der Schnee schon wadentief. Die vollen Straßen jedoch waren frei, und so folgte ich dem matschigen Rinnstein vom Interkontinental zum Regency zum Park Royal und überreichte die Pakete an Conciergen und Portiers. Die Innenstadt wand sich um mich herum wie ein gebördelter Samtschal. Szenen der Macht, des Wohlstandes, der Ambition, aus der Perspektive eines Maulwurfs betrachtet – Flashbacks zu jener Zeit, als ich in meinem ersten Jahr in New York City noch als Kurier arbeitete und mich auf verrückte Weise beschwingt fühlte von dem Wissen, dass das hier etwas ist, was ich nie wieder tun werde.
Gudrun Scheidecker hatte auf mich gewartet, als ich gegen 23 Uhr zum Kleistpark zurückkehrte. Sie war entzückt, mit einer amerikanischen Filmemacherin unter einer Decke zu stecken, die zum Filmfestival eingeladen worden war. Sie hatte es allen ihren Freunden erzählt. Und ob es nicht unglaublich sei, dass Frauen tatsächlich noch zu unseren Lebzeiten dieselben Möglichkeiten erhalten wie Männer, wenn sie einen Film drehen wollen? Ich musste von meinem ersten Tag auf dem Market berichten – ob ich auf irgendwelche Partys gegangen sei? Mit wem habe ich geredet, und wie sei es gewesen?
Tagebucheintrag am 19. Januar gegen Mitternacht unter der Decke: »Noch vier Tage von all dem hier.«
Können Filme mit Bildern beginnen? Wer war es noch mal – war es Flaubert? –, der gesagt hatte, dass er den gesamten Roman Die Erziehung des Herzens geschrieben habe, um die Farbe des blätternden Lacks eines Fensterbretts zu evozieren? Dreißig Jahre lang hatte er rückwärts geschrieben, und ich stelle mir dieses Gelb vor: Senf, der von dem Schimmelgrau des Gebäudes getrübt und vertieft wurde.
Irgendwann in den späten Achtzigern kam ich auf Besuch zurück nach Neuseeland. Alles hatte sich verändert. Innerhalb von zwei Jahren hatte das Land fünfzig Jahre übersprungen und war von einem verschlafenen Kaff aus den Vierzigern zu einem Außenposten der Neuen Weltordnung katapultiert worden.
Wie in einem Dritte-Welt-Land war das globale Kapital in Windeseile zugeströmt und hatte diese Transformation quasi über Nacht erwirkt. Was einst die sozialdemokratische Nation einer xenophoben Mittelklasse gewesen war, war nun polarisiert und entweder sehr reich oder sehr arm. Lange Benz- oder BMW-Prozessionen krochen durch die Geschäftsmetropolen. Andere gingen zu Fuß. Nachdem man die Kupferminen in Twizel stillgelegt hatte, wurden die Arbeiterhütten umgebaut und als Wochenend-Ski-Eigentumswohnungen verkauft. Alle Regierungssubventionen für Butter, Milch und Schaffleisch – Nahrungsmittel, die einst als elementare Menschenrechte gegolten hatten – waren aufgehoben worden. Der Markt und die dazugehörige New-Age-Ideologie der Selbst-Aktualisierung hatten die Herrschaft übernommen.
Meine engste Freundin, die Arbeiterführerin Eunice Butler, war von ihrer Position als Leiterin der neuseeländischen Unfallentschädigungsgesellschaft beseitigt worden. Der gesamte Fonds war aufgelöst worden. Eunice, eine brillante, charismatische, disziplinierte Politikerin, verbrachte nun ihre Tage damit, Arbeitslosengeld zu erhalten, Workshops zu besuchen, auf denen man lernt, wie man ein astrales Medium wird und sich selbst hinterfragt. Was hatte sie falsch gemacht? War es Selbstsabotage? Wie auch der Krebs kann das Scheitern doch nur eine Manifestation der geheimen Wünsche einer Person sein. Die meisten Markenzeichen neuseeländischer Populärkultur waren verschwunden. In den Teesalons der Bahnhöfe gab es nun keine Porzellantassen mehr und kein steinhartes Gebäck. Sie waren allesamt geschlossen oder durch Fast-Food-Ketten ersetzt worden.
Unterwegs auf dem Highway 2 von Wellington Richtung Norden nach Masterton hörte ich eine Diskussionssendung auf einem christlichen Radiosender. Eine dreifache Mutter berichtete dem selbstgefälligen und sorgenfreien Moderator davon, wie Gott ihr geraten hatte, ihrem kleinen Sohn den Hintern zu versohlen. Genau wie in Rumänien und Guatemala hatte sich auch in Neuseeland der Evangelismus amerikanischen Stils rasend schnell verbreitet. Die Frau hatte jenen vertrauten, quengeligen neuseeländischen Akzent, ihre Stimme erhob sich am Ende eines jeden Satzes zu einer Frage, und ich dachte über diese merkwürdige Amnesie nach: Wie man man selbst bleiben könne und dennoch einen solch außerirdischen Glauben verfechten.
Ich fuhr in Silverstream ab, um etwas zu essen, bevor der Rimutaka-Gebirgszug begann. Die Stadtgrenzen von Wellington hatten sich verschoben. Einst hatte die Stadt bei Lower Hutt aufgehört, und Silverstream war ein Nest auf dem Land gewesen. Doch jetzt wirkte alles hier sehr unfertig, weil sich zwei Zeitschaften dabei beobachten ließen, wie sie sich verschoben und zusammenbrachen. Es gab noch immer eine Wurstfabrik und Lagerhäuser, einen Metzger und ein Ratenkaufgeschäft.
Um 18 Uhr war die Stadt geschlossen. Ich fuhr herum und fand eine Take-out-Burgerbar in einer Seitenstraße den Hügel hoch. Drinnen hatten sie eine einzelne Weihnachtslichterkette längs des Fensters aus Spiegelglas genagelt. Und alles, was ich bislang gesehen hatte, gerann in der Traurigkeit dieser Lichter –
In dem Film Gravity & Grace gerät Ceal Davis, eine neuseeländische Kleinbürgerin in ihren Vierzigern, aus der Spur ihres Lebens und in die Verzweiflung. Sie trifft einen Mann namens Thomas Armstrong, der an fliegende Untertassen glaubt. »Den ganzen Frühling über«, sagt sie zu ihm, »bin ich mir vorgekommen, als stünde ich auf dem Rand von etwas, so als ob sich etwas in meinem Rachen verfangen habe. Ich spüre da eine unglaubliche Traurigkeit, eine gute Traurigkeit jedoch. Ich will nicht, dass sie endet.«
Für Thomas ist ihre Traurigkeit eine Quelle. Gegen Ende der Landkriege im Jahr 1862 hatte der Māori-Prophet Te Ua am Vorabend des europäischen Sieges eine Vision, dass die Welt mit einer Flut enden würde. Daheim in ihrem Tudor-Haus in Remuera nehmen Außerirdische zu Ceal Kontakt auf, die ihr mitteilen, dass die Welt mit einer Flut enden wird. Ceal weiß nicht recht, ob sie das glauben soll, doch sie tut es.
Mithilfe einer numerologischen Lesung des Buches Daniel sagte der Bauer William Miller aus Massachusetts im Jahr 1818 voraus, dass die Welt in ungefähr 25 Jahren enden werde. Es gelang ihm, diese Botschaft weiter zu verbreiten, als er 1839 den wohlhabenden Geschäftsmann Joshua Humes bekehrte.
1840 warteten dann bereits Tausende von Menschen aus dem Mittleren Westen bis New Hampshire auf den Mitternachtsschrei. Zeitungen, Zeitschriften, Traktate und Pamphlete, die die kommende Herrlichkeit verkündeten, wurden überall wie Herbstlaub verstreut und in die Welt hinausgeschickt. Man legte das Datum auf den 23. April 1843 fest. In jenem Jahr waren die Erweckungstreffen so derart überlaufen, dass es unmöglich geworden war, die Massenhysterie noch in Grenzen zu halten. Man hörte davon, dass Einzelne wahnsinnig wurden. Als der 23. April kam und ging, revidierte Miller seine Prophezeiung gemäß jüdischem Kalender. Ein zweites Datum wurde festgelegt: diesmal der 22. Oktober 1844. Merkwürdigerweise schien dieser erste Widerrufden allgemeinen Glauben nur noch zu verstärken.
Joshua Humes berichtete: »Ich habe noch nie einen stärkeren oder aktiveren Glauben erlebt.« In jenem Sommer weigerten sich die Bauern in New Hampshire, ihre Felder zu eggen, weil der Herr ganz sicher noch vor dem Winter kommen werde. Andere, als sie in die Felder gingen, um ihr Gras zu schneiden, stellten fest, dass sie nicht dazu in der Lage waren, weiterzuarbeiten, und so ließen sie ihre Ernte auf dem Feld stehen, um auf diese Weise ihren Glauben zu demonstrieren. Städtische Jünger verkauften ihr Hab und Gut, um die Welt als ehrbare Menschen und bar jeder Schuld zu verlassen.
Doch am Morgen des 23. Oktobers, nachdem man die ganze Nacht über gewartet hatte, berichtete ein Jünger der Bostoner Tagespresse: »Unsere edelsten Hoffnungen und Erwartungen wurden vernichtet, und es überkam uns ein solches Weinen, wie ich es noch nie erlebt hatte. Diese Enttäuschung erschien uns viel schlimmer als der Verlust all unserer irdischen Freunde. Wir weinten und weinten, bis der Tag anbrach.«
Als ich mir den Film Gravity & Grace zum zweiten Mal ansah, lebte ich in East Hampton mit meinem Mann. Nach einer Reihe leerer Erledigungen, die in der letzten Zeit immer mehr meiner Tage anfüllten, befand ich mich auf dem Heimweg. Ich war nicht mehr arm. Arm zu sein jedoch hatte immerhin eine Art von Struktur bedeutet, und jetzt war ich ein Niemand.
Alles schien hoffnungslos. Es war ein verregneter Nachmittag, Anfang November. Bachs Partita für Violine in h-Moll, in der Cello-Version von Ute Uge, lief im Radio. Ich hielt auf dem Seitenstreifen der Springs Fireplace Road an und weinte. Meine Haut wurde so porös, dass das Vibrato des Cellos in meinen Körper kroch wie ein Außerirdischer.
Hier spricht Ulrike Meinhof zu den Erdenbewohnern. Ihr müsst euren Tod öffentlich machen. Als sich der Strick um meinen Hals zusammenzog, machte ein Außerirdischer Liebe mit mir … Wie gelingt es eigentlich irgendwem, sein Leben in den Griff zu bekommen? Es gibt ein Gemälde von Franz von Assisi in der Sammlung Frick, auf dem er sich auf dem Boden windet, nachdem ihm Gott erschienen ist. Nicht länger ist er der sanfte Heilige der Vögel und Tiere. Er ist nun vollkommen geistesgestört.
Begegnungen mit Außerirdischen sind Markierungsphänomene – Nadeln auf der Karte einer emotionalen Landschaft, durch die man sich bewegt hat, ohne eine Form bemerkt zu haben. Verzweiflung ist die rührselige Ekstase des barocken Romantizismus. Man wartet auf Zeichen.
Am nächsten Tag, Dienstag, dem 20. Januar, schien es mir sinnlos, zum Market zu gehen, doch es war zu kalt in Gudrun Scheideckers Wohnung, um daheim zu bleiben.
Ich nahm die U-Bahn zum Ku’damm, und während ich hinaufging, um nach meinen Nachrichten zu sehen, dachte ich darüber nach, dass es zwar nett wäre, aber nicht sehr viel wahrscheinlicher als das Leben nach dem Tod, wenn auch nur einer der zwanzig auf meinen Brief geantwortet hätte.
Mein Postfach war leer. Gordon Laird war in eine Unterhaltung vertieft mit den Co-Produzenten eines Trailers für einen Film über irgendwelche College-Mädchen und -Typen, der für reichlich Wirbel sorgte. Ich versuchte Blickkontakt zu ihm herzustellen, und weil mir das nicht gelang, begann ich langsam über das Messeareal zu laufen, den Lammfellmantel in der Hand haltend und lächelnd. Die Rolltreppen hoch und runter, Stock eins bis vier. So ging das ungefähr zwei Stunden lang. Irgendwann bettelte ich dann die Person, die an der Tür zu Todd Verows Frisk stand, so lange an, bis sie mir schließlich erlaubte, mich hinzusetzen und mir den Film anzusehen. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich ganz ungemein beeindruckt war.
Eine Umfrage der Weekly World News verkündet, dass Frauen nur vor einer Sache mehr Angst haben als vor Schlangen und Nagetieren: und zwar davor, alleine auf eine Party gehen zu müssen, wo sie niemanden kennen.