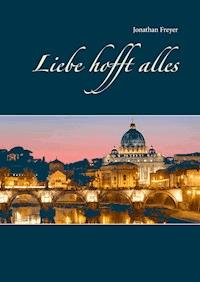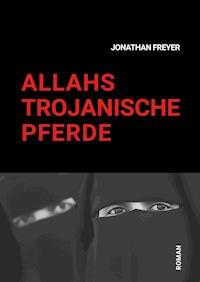
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Durch unterschiedliche aber ähnlich leidvolle Schicksale verbunden begegnen sich Rahman, der charismatische Sohn eines afghanischen Opiumbauern und Yasin, der introvertierte Sohn eines syrischen Gewürzhändlers in einem türkischen Flüchtlingslager. Von dort aus machen sich fortan beide gemeinsam begleitet durch ein paar Gefolgsleute Rahmans auf die beschwerliche Reise über die Balkanroute nach Deutschland. Schnell wird Yasin klar, dass nur er tatsächlich auf der Flucht vor Krieg und Elend ist. Für Rahman hingegen, der bereits als Führungskader des Islamischen Staates in Syrien und dem Nordirak gegen die Ungläubigen gekämpft hat, ist diese Reise keine Flucht. Er ist unterwegs auf einer heiligen Mission, die Europa in ihren Grundfesten erschüttern soll. Sein Auftrag hat nichts Geringeres zum Ziel, als die Trojanischen Pferde Allahs, die schlafenden Muslime in Deutschland und allen angrenzenden Ländern Zentraleuropas zu erwecken. Hin und hergerissen zwischen Zorn und Zaudern, Wut und Werten in den Fluten der gegensätzlichen Strömungen einer aus den Fugen geratenen Welt wanken die beiden Freunde zwischen Liebe und Verderben. Auch wenn der Islamische Staat territorial besiegt zu sein scheint, hat die eigentliche Schlacht um die Herzen der Menschen erst begonnen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 552
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für die Opfer des islamistischen Terrors
aus der Odyssee nach Homer
So sprach der Seher, aber keinem der Helden, obgleich sie hin und her sannen, wollte ein Mittel einfallen, wie dem grausamen Kriege ein Ziel gesetzt werden könnte; der einzige Odysseus kam endlich durch die Verschmitztheit seines Geistes auf ein solches. »Wisset ihr was, Freunde«, rief er, freudig bewegt durch den glücklichen Einfall, »lasst uns ein riesengroßes Pferd aus Holz zimmern, in dessen Versteck sich die edelsten Griechenhelden, so viele unser sind, einschließen sollen. Die übrigen Scharen mögen sich inzwischen mit den Schiffen nach der Insel Tenedos zurückziehen, hier im Lager aber alles Zurückgelassene verbrennen, damit die Trojaner, wenn sie dies von ihren Mauern aus gewahr werden, sich sorglos wieder über das Feld verbreiten. Von uns Helden aber soll ein mutiger Mann, der keinem der Troer bekannt ist, außerhalb des Rosses bleiben, sich als Flüchtling zu ihnen begeben und ihnen das Märchen vortragen, dass er sich der frevelhaften Gewalt der Achajer entzogen habe, welche ihn um ihrer Rückkehr willen den Göttern als Opfer schlachten wollten. Er habe sich nämlich unter dem künstlichen Rosse, welches der Feindin der Trojaner, der Göttin Pallas Athene, geweiht sei, versteckt und sei jetzt, nach der Abfahrt seiner Feinde, eben erst hervorgekrochen. Dies muss er den ihn Befragenden so lange zuversichtlich wiederholen, bis sie ihr Misstrauen überwunden haben und ihm zu glauben anfangen. Dann werden sie ihn als einen bemitleidenswerten Fremdling in ihre Stadt führen. Hier soll er darauf hinarbeiten, dass die Trojaner das hölzerne Pferd in die Mauern hineinziehen. Überlassen sich dann unsre Feinde sorglos dem Schlummer, so soll er uns ein zu verabredendes Zeichen geben, auf welches wir unsern Schlupfwinkel verlassen, den Freunden bei Tenedos mit einem lodernden Fackelbrande ein Signal geben und die Stadt mit Feuer und Schwert zerstören wollen.«
Nach Gustav Schwab , Sagen des klassischen Altertums, 1982, Insel Verlag
„Selbst wenn der Islamische Staat territorial besiegt sein wird, so wirkt sein Gift immer noch in den Adern seiner Anhängerschaft. Aus seinen Ruinen werden sich die Söhne der Wüste erheben und eine neue Bewegung wird sich ausbreiten. Diese nächste uns ereilende Welle sollte uns mehr beunruhigen, denn jenen wird es nicht mehr um ein Territorium gehen, sondern um die zerrissenen Herzen der Kinder unserer Zeit.“
Jonathan Freyer
„Die Islamisierung Europas ist keine Fiktion, sondern eine mathematische Gewissheit.“
Jonathan Freyer
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Zum Geleit
Feuer im grünen Band
Feuersturm
Schmelztiegel Herat
Vom Niemandsland nach Masshad
Entbindung
Heimsuchung
Simran
Herzflimmern
Freiheit
Die Tauben von Aleppo
Der Syrische Herbst
Der Duft des Todes
Bruder für Bruder
Flucht aus Aleppo
Der Erleuchtete
Öncüpinar
Missionar und Lehrer
Griechenland
Mazedonien
Serbien - Ungarn
Endstation Budapest
Geflüchteter Wandel
Berlin
Köln
Sylvester am Dom
Schweiz
Berstende Schleusen
Sebastian & Muhammad
Lies
Anleitung
Das wahre Kalifat Allahs
Dumpfe Töne
Saisonbeginn
Skyline
Gedankenspiel
Wiedersehen
Arbeitstag
Auftrag und Vermächtnis
Die Flut
Nachwort
Vorwort
Was wir sind, ist nicht nur das, was das Leben mit uns macht, was uns prägt, was wir erlernen, was uns widerfährt oder wem wir begegnen.
Was wir sind, ist nicht nur das, woher wir sind, was uns mitgegeben wurde oder wer uns begleitet.
Was wir sind, ist was wir glauben. Was wir sind, ist was wir denken.
Was wir sind, ist was wir tun. Was wir sind, ist Hingabe. Was wir sind, ist Leidenschaft. Was wir sind, ist was wir werden. So ist, was wir sind, ein dauerhaftes Sein und Werden, ist Wandel und Veränderung, Wachstum und Verfall, Scheitern und Siegen. Wir sind und werden durch ein stetiges Gedeihen und Reifen. Jedoch gedeihen und reifen wir am intensivsten im Leiden. Die einen reifen zum Guten, die anderen reifen zum Bösen, die meisten aber von uns gedeihen zu beidem, oft genug gut und edel im Denken aber böse und grausam im Tun.
So ist, was wir sind ein gereifter, grenzenloser Ozean. Ein Ozean voller Tränen. Tränen der Freude und der Traurigkeit, des Überschwangs und der Zerrüttung.
Jeder einzelne Tropfen dieses stetig wachsenden Ozeans ist ein winziger Teil eines unendlichen, unergründbaren Meeres, voller Mysterien, gefangener Energie, dunkelster Tiefen und überschäumenden Lebens.
Am Ende aber ist es eine Sonne, die den Zauber des Lebens bewirkt, Erquickung bringt und Trost spendet im tobenden Orkan oder in nie enden wollender Flaute.
... und genau in jener Stunde, wenn man es am wenigsten erwartet, genau dann versinkt diese glühende, göttliche Sonne im unerschöpflichen Ozean unserer phantastischen Existenz.
Zum Geleit
Es steht uns nicht zu, das zu beurteilen und zu verurteilen, was sich von uns selbst unterscheidet. Es steht uns nicht zu, das zu dämonisieren, was wir gar nicht oder nicht gut genug kennen. Nichts sollte uns daher ferner liegen, als das, woran andere Menschen glauben, worauf sie fußen und was sie antreibt, zu verdammen oder zu belächeln, denn Erhebung über den Anderen und das Andere bringt den Menschen keinen Frieden. Wozu erhebt er sich über den Anderen?
Was maßt er sich an, sich selbst über ihn zu stellen, sich als wertvoller und kostbarer zu erachten als den anderen und dem Fremden, dem Andersartigen seine Meinung, seine Haltung, seine Ideale aufzudrängen?
Auf einer unendlich langen Reise durch die Jahrhunderte hat ein Teil der Menschheit die Werte der Aufklärung und der Demokratie, der Toleranz und der Akzeptanz von anders Denkenden, anders Liebenden und anders Glaubenden in vielen Regionen unseres Planeten mühsam erstritten und bitter bekämpft. Unrecht wurde ertragen und verursacht, Leid wurde durchlitten und angetan. Millionen Geschöpfe haben ihr Leben gelassen im Kampf für die Freiheit und die Gleichheit aller Menschen unabhängig von Herkunft, Hautfarbe, Geschlecht, sexueller Orientierung oder Religion. Es ist der unverrückbare Sockel unserer Kultur, der mit blutigen Händen aus dem Felsen unserer Geschichte herausgemeisselt wurde.
Aber es ist eine abwegige Illusion zu glauben, dass diese Arbeit, diese Mühsal beendet ist. Es ist ein romantischer Trugschluss zu denken, dass diese Schlacht endgültig geschlagen und gewonnen wurde. Freiheit kann nicht dauerhaft bewahrt werden, ohne dass sie immer wieder neu erstritten, neu erkämpft und gegen Anfeindungen verteidigt werden muss. Es ist schlichtweg fahrlässig zu meinen, dass im 21.
Jahrhundert all unsere moralischen und ethischen Errungenschaften unangreifbar und unantastbar sind. Wir halten Freiheit und alle anderen unveräußerlichen Menschenrechte für die universellen Rechte eines jeden Menschen. Wir glauben fest daran, dass gerade diese Freiheit für alle Menschen auf diesem Planeten gelten sollte und zwar unabhängig davon, ob diese Freiheit auf allen Kontinenten und in allen Kulturen wertgeschätzt wird und ein anzustrebendes Ziel in jeder Gesellschaft sein muss. Wir sind überzeugt davon, dass Freiheit für alle Menschen in ihrer Zeit erreichbar sein muss. Doch ist auch dies eine Anmaßung? Die Freiheit, die wir jedem Individuum gönnen und unser Verständnis davon selbst sind sie Ausdruck einer arroganten, überheblichen Utopie? Freiheit und Menschenwürde gehen Hand in Hand auf dem Boulevard alles Existenziellen. Beides ist angreifbar. Beides verletzlich. Wir persönlich sind angreifbar und verletzlich, jeder Einzelne von uns.
Freiheit ist unsere Wiege, Freiheit ist unser Fundament. Sie zu verteidigen und das zu beschützen, was die Seele unseres gemeinsamen Lebens ausmacht, ist natürlich auch ein „Kampf der Kulturen“. Vielleicht ist es auch ein Krieg unterschiedlicher Epochen oder zeitversetzter Einsichten, mäandrierender Erfahrungen und individueller Erkenntnisse. Es ist in dieser Stunde und am Ende wohlmöglich sogar die letzte große Schlacht um die universellen Wahrheiten.
Ich erinnere mich an jenen einen Tag in meinem Leben, an dem ich diese Schlacht um die eine Wahrheit hautnah erlebt habe.
Noch immer habe ich den Geruch leichengetränkten Staubes in der Nase.
Noch immer habe ich das Geräusch der zusammenbrechenden Zwillingstürme in den Ohren und noch immer reißen mich die Bilder der eingeschlossenen und schreienden Menschen aus dem Schlaf. Mit eigenen Augen habe ich die Zeitenwende gesehen. Die Geschichte der Menschheit ließ sich nach jenem Tag im September 2001 einteilen in ein Vorher und ein Nachher.
Auch vorher hatte es Kriege gegeben. Auch vorher hat es Schlachten und zivile Opfer gegeben. Der Tot von Zivilisten wurde auch vorher billigend in Kauf genommen, aber dies galt stets als notwendiger, zwangsläufiger Kolateralschaden. Seit 9/11 jedoch ist die Ermordung, die geplante, massenhafte Tötung von Unschuldigen und Unbeteiligten das eigentliche Kriegsziel.
„Allahu Akbar“, „Gott ist groß“ schreien die fanatisierten, islamistischen Terroristen mit ihrem Verständnis von Glaube und Weltordnung in die Welt hinaus, wenn sie die Zünder ihrer Sprengstoffwesten aktivieren.
„Allahu Akbar“, „Gott ist groß“ brüllen die vermeintlichen Märtyrer, wenn sie mit Salven aus Schnellfeuergewehren unbeteiligte Menschen wahllos niedermähen.
„Allahu Akbar“, „Gott ist groß“ rufen die todessüchtigen Gotteskrieger, wenn sie Fahrzeuge als Waffen verwenden und willkürlich in flanierende Menschenmengen steuern.
„Allahu Akbar“, „Gott ist groß“ jubelten sie auch damals, als sie die Flugzeuge in die Gebäude des World Trade Centers schickten.
„Allahu Akbar“? „Gott ist groß“?
Wenn Allah, den sie den Barmherzigen, den Allerbarmer nennen, groß ist, dann muss auch seine Barmherzigkeit groß sein. Wenn seine Barmherzigkeit aber groß ist, dann muss auch seine Liebe groß sein.
Offensichtlich liebt dieser Allah in den Meinungen einiger Muslime jedoch nicht alle Menschen. Er gesteht jenen anderen die Freiheit anders zu sein, anders zu leben, anders zu glauben nicht zu. Nein, Allah liebt nur die Seinen und sein Prophet hat im Koran unser aller Schicksal mit dem Zwang an diesen einen Gott zu glauben verknüpft.
Der elfte September hat etwas Elementares, etwas Grundsätzliches geändert. Die Zäsur war nicht die dämonische Dimension und perfide Professionalität der Tat.
Die Zäsur war der Verlust unserer Illusionen. Wie aus der Zeit gefallen, wie aus einer Utopie erwacht, sahen wir am elften September zum ersten Mal auf den Bildschirmen dieser Welt dem Bösen in seinen alles vernichtenden Schlund. Wir haben tief in die Abgründe des Menschlichen gesehen und jeder der diesem Angriff folgenden Terrorakte hält diese Erinnerung an unsere eigene Zerbrechlichkeit in unseren Herzen wach. Für den überwiegenden Teil der Menschheit, ist seit jenem Tag unsere jederzeitige Verwundbarkeit, die unvermeidbare, willkürliche Verletzbarkeit allgegenwärtig geworden.
Seit jener Stunde fühlen wir uns weniger sicher, weniger behütet, weniger geschützt.
Für andere Erdenbürger wiederum löste diese Art eines mörderischen Gottesdienstes eine magische Anziehungskraft aus. Sie spürten einen Zauber des Grausamen oder besser eine Magie des Schrecklichen, der eine fanatisierte Sehnsucht nach dem Jenseits inne wohnt.
So brach in Folge des elften Septembers ein Krieg aus, der gerade erst begonnen hat.
Erst in tiefer Erschütterung lässt das Leben uns Reifen. Erst in intensiver Zerrüttung lässt es uns Gedeihen. Erst zurückgebombt auf das Existenzielle erkennt der Mensch seine eigene Schwäche, seine eigene Ohnmacht und wird schließlich langsam demütig und achtsam.
Die Flugzeuge von 9/11 haben uns tief an unserer verwundbarsten Flanke getroffen „unsere Freiheit“.
Ein solches Verständnis eines nur die Seinen liebenden Allahs nimmt uns unsere Freiheit und unsere Illusionen. Wer nicht für ihn ist, ist gegen ihn. Wer gegen ihn ist, ist ihr Feind. So beraubt uns ein solches Verständnis von Religion am Ende unsere Utopie von Frieden und Freiheit.
Diese liebgewonnene Freiheit ist unsere Quelle. Sie ist unsere Seele und unser aller Fundament.
Aber genau diese Freiheit ist auch unsere Achillesferse und vielleicht schon bald unser Untergang.
„… und erschlagt sie (die Ungläubigen), wo immer ihr auf sie stoßt, und vertreibt sie, von wannen sie euch vertrieben; denn Verführung zum Unglauben ist schlimmer als Totschlag.“
Sure 2 Vers 191
Feuer im grünen Band
Wie ein breites, grünes Band ruhten die klein parzellierten Felder in einem wild anmutenden Flickenteppich kaum variierender Farbkontraste an den ausgefransten Ufern des behäbig dahinplätschernden Flusses. Von Jahr zu Jahr hatte der einst so mächtige Strom immer weniger vom braunen Wasser mit sich geführt und nur noch im Frühling, zur Zeit der Schneeschmelze weit oben im Hochland, trug er die Bezeichnung Fluss zu Recht. Seit Jahrhunderten hatte das Frühlingshochwasser den kostbaren Schlamm angeschwemmt und die Wüstenböden mit einer dienbaren Krume bedeckt. In diesen lang vergessenen Zeiten quoll noch üppiges Leben aus dem fruchtbaren Morast. Doch seit dem Bau des großen Damms wurde die Bestellung der Felder mühsamer, die Ernten dürftiger und die Not der Talbewohner größer.
Eigentlich hatte die gewaltige Konstruktion des großen Stauwerks die Menschen der Talsenke vor den ungezähmten Naturgewalten schützen sollen, doch mit der Sicherheit hatte auch die Not immer mehr Einkehr gehalten. Wasser und Schlamm, die Geschenke Allahs an die Kinder der Wüste, waren seltene Kostbarkeiten geworden. In mühsamer Handarbeit, mit einfachen Hacken und Schaufeln oder mit bloßen, schwieligen Händen waren unter Schweiß und Entbehrung über Generationen hinweg die kleinen Rinnsale des weitverzweigten, ausgeklügelten Kanalsystems zur künstlichen Bewässerung der unzähligen rechteckigen und quadratischen Parzellen angelegt worden. Diese Frucht spendenden Wassergräben, die das ganze Gebiet mit dem nährstoffreichen Nass versorgten, mussten seit der Fertigstellung der gewaltigen Stauanlagen weit oberhalb des Flussbettes, immer tiefer ausgehoben werden, um das verbliebene Wasser auch in die entlegendsten Winkel der Äcker strömen zu lassen. Doch vor allem mit dem Ausbleiben des Frühjahrshochwassers und den ganzjährig schwindenden Wassermengen besonders in den heißen Sommermonaten wurde der Anbau von Getreide, Obst oder gar Gemüse ein mehr und mehr sinnloses Unterfangen. Und dennoch füllte die tiefe Senke immer noch ein saftgrüner Streifen bis weit an den südlichen Horizont hinab.
Von einem seichten Hügel hatte Rahman einen weiten Blick über das fruchtbare Tal, das sich zwischen all den pflanzenlosen Steinhügeln einer kargen Wüstenlandschaft den Fluss entlang hinunterschlängelte. Vom Nordosten her strömte der Fluss, jene uralte Lebensader der ganzen Provinz Helmand aus den Gebirgsregionen Uruzgans und Daykundis an Kajaki vorbei bis tief in den Süden des Landes. Es war Ende Mai und schon bald würde wieder die beschwerliche Erntesaison beginnen. Rahman, der einzige Sohn eines einfachen paschtunischen Kleinbauern, blickte vom nackten, massiven Felsblock einer einsamen Bergkuppe hinunter auf Puzeh, seinem Heimatdorf inmitten der ausgedehnten Anbaugebiete in der sich vor ihm ausweitenden Ebene. Die Farben der Felder changierten jetzt so kurz vor der Ernte in einem leichten Lila-Grün. Ein betörender, süßlich-herber Duft nach Nüssen und exotischen Blüten lag über der ganzen Flur. Eingebettet in die kargen Wüsten, die Steindünen und schroffen Felsschluchten ruhte die Talniederung selbst wie eine lang gezogene Oase vor dem Betrachter. Schwärme artenreich umherfliegender Insekten besiedelten in den Frühlingsmonaten die feuchtwarmen Pflanzungen, so dass man stets ein dumpfes, allgegenwärtiges Surren und Summen vernahm. Unterbrochen wurde dieses schwirrende, zirpende Konzert nur vom gelegentlichen blechernen Bimmeln der Schellen an den Hälsen der Ziegen und dem kreischenden Geräusch der Schleifsteine, mit denen die Bauern des Dorfes ihre metallenen Werkzeuge für die anstehenden Erntewochen schärften. Gelegentlich war aus der Entfernung sogar das Geräusch eines verlorenen Fahrzeugs auf der staubigen Schotterstrasse zu hören, das mit dem lauten Nageln und Knattern eines schwerfälligen Dieselmotors die schmale Piste, die wichtigste Nord-Süd-Achse der ganzen Region, entlangfuhr. Immer seltener passierte ein Militärkonvoi die holprige Strasse in Richtung nördliches Territorium. Rahman hockte mit angewinkelten Beinen auf seinem natürlichen Podest. Seine starken, adrigen Arme umschlangen seine kraftvollen Unterschenkel. Über der langen, wallenden braunen Hose trug der Junge bereits die landestypische, im Schulterbereich geknüpfte Wollweste mit ausladenden Ärmeln. Er war für einen noch so jungen Paschtunen mit seinen knapp einmeterachtzig Körpergröße bereits ein außergewöhnlich hoch aufgewachsener Junge. Mit den breiten, massigen Schultern, den langen schwarzen Haaren und den adrigen Händen war er seinen Altersgenossen schon in seinem Erscheinungsbild um Jahre voraus.
Nur sein weiches, flaumloses Gesicht, das von den erbarmungslos heißen Sommern und den noch erbarmungsloseren eisigen Wintern nicht so ledrig und ausgemergelt aussah, wie das seines Vaters, ließ sein fast kindliches Alter erahnen. Rahman Seyd Khatak war insgesamt eine sehr auffällige Erscheinung, wozu vor allem seine durchdringenden hellgrünen Augen beitrugen. Das Smaragdgrün seiner Iris leuchtete in einer fast schon unwirklichen Klarheit und kristallenen Tiefe. Nicht selten wirkte sein Blick mystisch, geheimnisvoll und wie nicht von dieser Welt. Etwas Unantastbares, etwas Jenseitiges lag in seinen Augen. Mit seinen gerade einmal vierzehn Jahren hatte er bereits ein sehr bewegtes, hartes und arbeitsreiches Leben hinter sich.
Seine Mutter war bereits kurz nach seiner Geburt gestorben. Keine Erinnerung verband ihn mit ihr. Sein Vater sprach nicht über sie und seine hartherzige, strenge Großmutter, die sich seiner Erziehung angenommen hatte, schwieg, wenn es um die viel zu früh Verschiedene ging. So wuchs Rahman in einer Kindheit ohne weibliche Wärme und mütterliche Fürsorge auf. In dieser archaischen, traditionellen Welt, in dem die Männer wertvoll, die Frauen nützlich waren, hatte er seine viel zu kurze Kinderzeit ohne Zuneigung, ohne Zärtlichkeit und ohne das Weibliche durchlebt. Er war ein bedauernswert einsamer Junge, der sich in seinen Traurigkeiten selber tröstete und in seinen Zweifeln selber suchte. Vielleicht auch deshalb war der stattliche Junge ein Außenseiter in seiner Familie und in seiner Sippe. Allenfalls mit seinem Freund Ferid hatte er Freude teilen können und die drängenden Fragen eines Heranwachsenden ausgesprochen. Rahman hatte schon als kleines Kind mit gerade einmal acht Jahren auf den Feldern des südafghanischen Helmandtals mitarbeiten müssen, gerade so wie es Allah und die Tradition seines Stammes befohlen und die Not es ihnen auferlegt hatte. Die Furchen, die die schwere Arbeit an den Bewässerungskanälen in die rissige Haut seiner Hände hinterlassen hatte, gaben Zeugnis von der Beschwerlichkeit eines Lebens jenseits von Komfort und Wohlstand. Die ihm unbekannte Mutter, jener leblose Schatten, der ihn zeitlebens begleitete, fehlte ihm jeden Tag, ohne dass er wusste, was er genau vermisste. Rahman kannte weder Geborgenheit, noch Obhut. Fürsorge erlebte er nur im Darreichen von Nahrung und wenn er genau das tat, was ihm aufgetragen wurde. In einer Gesellschaft mit klarer Rollenverteilung blieb ihm das Sanfte, das Herzliche weitestgehend unbekannt. Von seiner Großmutter lernte er Disziplin und Gehorsam, vom Vater Opferbereitschaft und Demut. Aber tief in ihm schlug das Herz eines Löwen, eines Rebellen, der sich nicht mit einem gottgegebenen Schicksal begnügen wollte.
Noch durfte Rahman keine Waffe tragen, wie die anderen Männer des Stammes. Aber bald würde es endlich soweit sein. Dann würde er zumindest rituell aufgenommen werden im Kreis der Männer, jene stolzen paschtunischen Krieger, selbst wenn sie ihn als Sonderling aufgrund seines Aussehens nie vollständig akzeptieren würden. Rahman würde dann endlich ein vollwertiger Mann sein, ein Kämpfer.
Dann würde er wie alle erwachsenen Männer bewaffnet sein und erhaben die ihm gebührende Stellung und ein hohes Ansehen innerhalb seines Stammes erlangen. In seiner Seele fühlte er sich bereits seit langem wie ein Erwachsener. Er sah aus wie ein Erwachsener, bewegte sich wie ein Erwachsener, posierte wie ein Mann, aber noch fehlte ihm die Übergabe einer Waffe durch die Stammesführer, um sichtbar für alle ein wahrer Paschtune zu sein. Der Geist der Jahrhunderte wehte durch das Tal und sein Dorf. Er, der Junge mit den Smaragdaugen, war ein kleiner Teil eines großen Ganzen. Er war ein Mosaikstein im Bild der Familie, ein winziges Rädchen im Uhrwerk des großen Stammes und ein hineingeborenes Element im monotonen Leben dieses Tals, das sich vor seinen Augen wie ein Gemälde ausbreitete. Seit Generationen wurde alles geteilt, alles gemeinsam verrichtet. Jeder der Männer ihres Klans hatte seine Rolle, jeder seine Funktion und jeder seine Daseinsberechtigung. Sie waren verbunden mit ihrem Volk, mit ihrer Erde und mit Allah in einer streng islamisch geprägten Gesellschaft, in der sowohl den Männern, als auch den Frauen, als auch den Kindern klare Regeln vorgegeben waren. Jedem Einzelnen waren Aufgaben zugewiesen, um das Überleben des Ganzen zu sichern. Rahmans Klan war einst, wie so viele Afghanenstämme, ursprünglich ein Nomadenvolk gewesen. Die Sippe, der Rahman angehörte, hatte aber schon seit Menschengedenken in dieser gebirgigen Wüstenregion gelebt. Sie hatten sich vor hunderten Jahren hier niedergelassen und wohnten nun im fruchtbaren Tal wie auf einer Insel, mit Puzeh als ihrer Mitte. Spärlich war ihr Besitz, hart ihr Alltag. Schon früh hatte Rahman gemeinsam mit seinem Vater Ajmal, seinem Onkel und dessen schon erwachsenen Kindern die kargen Äcker bestellt, die Pflanzungen gehegt und deren Früchte geerntet.
Seine gewaltigen, adrigen Hände, der muskulöse Oberkörper und die kräftigen Oberarme gaben Zeugnis von der jahrelangen, anstrengenden Arbeit auf den lehmigen Ackerböden. Rahman hatte teilweise mit einfachen Konservendosen tiefe Gräben ausgehoben, schwere Steinblöcke weggetragen, gegraben, geschaufelt und gehackt. Seine muskulöse Statur wirkte wie von einem austrainierten Olympioniken im besten Athletenalter und passte noch so gar nicht zu dem knabenhaften, bartlosen Gesicht des Jungen. In vielem war er noch ein Kind, in manchem schon ein junger Mann. In seinem Herzen aber war er ein einsamer Berglöwe, bereit auszubrechen aus der Enge seines Käfigs.
Still hockte er auf dem Felsen. Seine rauen Hände streichelten die grobe Wolle seines staubgetränkten Beinkleids. Von seinem Platz aus streiften seine leuchtend grünen Augen sehnsuchtsvoll über die steinigen Hügel der Umgebung, die im Norden aufragenden Bergmassive, das schmale Tal und die ihn umgebenden Steinwüsten. Er war ganz allein hier oben. Keine Menschenseele störte hier die seltenen Augenblicke seiner friedlichen Einsamkeit. Ferid, sein bester und einziger Freund, der ihm wie ein Bruder war, hatte heute einmal mehr keine Zeit gehabt, mit ihm auf der großen Schotterfläche unterhalb des Hügels etwas Fußball zu spielen. Das Herumkicken mit einem abgenutzten Tennisball war die einzige Ablenkung, die den beiden Nachbarsjungen in der wenigen freien Zeit, die sie hatten, vergönnt war. Rahman und Ferid kannten sich schon seit Kinderzeiten. Sie waren gleich alt und im engen Verbund der Stammesfamilie wie Geschwister zusammen aufgewachsen. Ferid aber musste heute noch einmal mit seinem Vater die Bewässerungskanäle auf ihren blühenden Feldern ausbessern. Rahman sah weit unten die beiden kleinen dunklen Flecke am Rande eines Mohnfeldes. Immer wieder beugten sich die beiden Schatten auf und nieder. Der junge Paschtune ahnte seinen Freund mit seinem Vater dort mit Hacke und Schaufel einige Wassergräben neu ausheben. Eine Schule hatten die beiden Jungen nicht gekannt. Viele im Dorf konnten weder lesen noch schreiben.
Mädchen durften nicht zu Schule gehen. Rahman und Ferid konnten es nicht. Zu weit weg war die nächste größere Ortschaft, in der es so etwas wie eine Volksschule gab. So hatten die beiden ihr Wissen von dieser Welt und den Dingen, die sie umgaben, entweder von den eigenen Eltern, der Großfamilie oder von einigen Stammesführern beigebracht bekommen. Als erste Sprache hatten sie innerhalb ihres Stammes das in dieser Gegend übliche Paschtu erlernt. Doch seit ein paar Jahren lehrte sie der älteste Sohn eines Nachbarn, ein Rückkehrer aus der Provinzhauptstadt, auch die zweite Amtssprache Dari, eine Variante des Persischen. Dieser schon ältere Nachbarssohn teilte mit ihnen im Rahmen seiner Möglichkeiten auch sein Wissen über Geographie und sonstige Naturwissenschaften. Sie lernten das Wissen aus einer Welt jenseits ihres Alltags mit großer Hingabe und Leidenschaft. Beide Jungen waren neugierig auf die Welt hinter den Bergen, doch zählte in ihrem Alltag nur das, was das Leben im Tal von ihnen einforderte. Allerdings spürte nur Rahman ein unstillbares Verlangen nach der Welt jenseits der ihm auferlegten Zwänge und Enge. In seinen Adern kochte das Blut des Abenteurers, des Entdeckers und des Wissenschaftlers. Innerhalb ihres Klans waren vor allem Kenntnisse und handwerklichen Fertigkeiten im Landbau von Nöten und die Schwerpunkte ihrer Ausbildung. Die beiden aufgeweckten Jungen Rahman und Ferid lernten früh, wie man Mohnpflanzen anbaut, ihren kostbaren Saft erntete und wie man die Werkzeuge der Bauern handhabt und pflegt. Schon mit zehn Jahren hatte Rahman von seinem Vater Ajmal beigebracht bekommen, wie man einer Ziege, einem Huhn oder einem Esel mit einem scharfen Messer den Hals durchschneidet. Er lernte, Tiere ausbluten zu lassen, sie auszuweiden und ihr Fell abzuziehen. Er lernte ihre Körper zu zerlegen, ihre Eingeweide zu lesen, ihr Fleisch zu trocknen, ihr Fell zu gerben und ihre Knochen zu zermahlen. Die Stammesführer und die Ältesten ihrer Familien lehrten Rahman und seinem Freund Ferid die zahlreichen paschtunischen Traditionen und den starren Ehrenkodex ihres Volkes. Dieser war der Kern ihrer Ausbildung. Der „Paschtunwali“, jene Jahrtausende alte Richtschnur ihres Stammes und aller Paschtunen, war in Verbindung mit den strengen Lehren eines sunnitisch geprägten Islam die Ordnung, in der sie sich zu fügen hatten. Er war das Zentrum ihrer Kultur. Die Ältesten und Väter waren ihre Lehrer im Leben, im Arbeiten und im Glauben. Ihr ganzes Volk und der ganze Stamm, dem Rahmans Vater und die ganze Khatak-Familie angehörte, lebten seit Jahrhunderten in der weitestgehenden Abgeschiedenheit ihres Tales nach diesen präzisen, konservativ islamischen Regeln und Wertevorstellungen. Die Menschen verschrieben sich dabei gehorsam einer gottgegebenen Ordnung, die die Stammesführer und die diese Region kontrollierenden Taliban streng regelten. Wenn es sein musste, wussten die Taliban diese Ordnung mit brutaler Gewalt nach den Vorgaben der Sharia kompromisslos durchzusetzen. Die hiesigen Taliban waren damals aus einigen Stämmen der Paschtunen und gesponsert von Saudi- Arabien sowie der amerikanischen CIA rekrutiert worden. Diese berüchtigte Gruppe streng islamischer Mudjahedin waren zu Zeiten der russischen Besatzung militärisch hervorragend ausgebildet worden und kamen ab 1994 nach Afghanistan zurück, um seither ein gottesstaatähnliches Regime zu errichten. Alle Taliban waren Paschtunen, aber nicht alle Paschtunen waren Taliban. Soweit hatte Rahman die oft verwirrenden Geschichten der Ältesten über diese Männer verstanden. Im kleinen Dorf Puzeh wusste man aber bis hierher nur wenig von der Unterdrückung und Schreckensherrschaft dieser politisch-religiösen Elite. Nur gelegentlich wurde von einigen verstörenden Taten und drakonischen Maßnahmen der Taliban im Dorf etwas bekannt, zum Beispiel, wenn in der Provinzhauptstadt wieder einmal öffentliche Bestrafungen wie Stockhiebe, aber auch Steinigungen und gelegentliche Hinrichtungen nach den Vorgaben der Sharia durchgeführt worden waren. Nicht selten aber wurden dort ertappten Dieben die Hände abgeschlagen oder andere archaisch anmutende Maßregelungen auf Plätzen oder in Stadien im Namen Allahs vollzogen. Recht, Ritus, Gesellschaft und Gesetz – alles entsprang den Worten des Propheten und der Paschtunwali. Alles war Gottes Weisung niedergeschrieben als seine wörtliche Offenbarung im heiligen Koran. Einige der hier seit Epochen angesiedelten Paschtunenstämme, so auch der Stamm, dem Rahmans Familie angehörte, hielten sich obendrein für einen der zehn verlorenen Stämme Israels.
Manche Klans sahen sich sogar in direkter Nachfolge der Familie des Propheten. Rahmans Stamm waren „Seyd“. Sie hielten sich also direkte Nachkommen Mohammeds. Dies erfüllte alle Mitglieder des Stammes mit großem Stolz, gelegentlich aber auch mit einer unnachgiebigen Arroganz, die auch den jungen Afghanen Rahman als sich überlegen fühlende Attitüde umgab. Das ganze öffentliche und private Leben in Puzeh und den umliegenden Ortschaften fußte im ganz Alltäglichen auf der ultrakonservativen Auslegung eines sunnitischen Islam und einem seit Generationen tradierten streng orthodoxen Ehrenkodex. Dieser über viertausend Jahre alte Kodex stand höher als die Gesetze der Regierung in Kabul. Dieser Kodex war wichtiger als alle Verlautbarungen der Provinzregierung. Er war mehr als nur Gesetz. Er war das Band, das sie einte, das Korsett, das sie zusammenhielt und in dem es ihnen zu atmen erlaubt war. Er war streng, fordernd und mühsam, aber er war eindeutig und zweifelsfrei. Rahman liebte diese feste Struktur und die klare Ordnung seiner Heimat, wenngleich sie ihn einschnürte. Und doch träumte er sich hinaus aus dieser Welt. Oft genug zerrissen ihn diese unvereinbaren Gefühle zwischen Ordnung und Abenteuer. Eingefärcht in den Mauern aus Pflicht, Verantwortung und alltäglicher Obliegenheiten würde er sein Tal, seinen Klan und seine Familie niemals verlassen können, aber sein Herz sehnte sich fort. In ihm tobte die Natur seiner Vorfahren.
Rahmans Seele war die eines Nomaden. Seine jugendliche Neugier trieb ihn seit Kindesbeinen regelmäßig auf diesen einsamen Hügel hinauf, um sehnsuchtsvoll von der unbekannte Welt hinter dem Horizont zu träumen. Dort in der unendlichen Ferne, weit hinter der Provinzhauptstadt Lashkar Gah ahnte er ein Land, das weniger von Entbehrungen und Not geplagt war, wie das seine. Dort hinten, jenseits dieser steinernen Wüsten wähnte er Wissen und Weisheit. Seit 1999 dauerte nun schon die strafende Dürre. Seit Monaten hatte es nicht geregnet, die meisten Brunnen waren versiegt und der ewige Fluss des Lebens führte kaum noch ausreichend Wasser für Menschen, Tiere und Felder. Weit unten im Süden führte er gar kein Wasser mehr in seinem ausgedörrten Bett. Die Bewässerung der Felder wurde daher talabwärts immer schwieriger und je weiter man dem Helmand gen Mündung folgte, umso karger wurden die Äcker und umso hungernder die Menschen. Hunger und Not waren Alltag auch im grünen Band der Flussniederung. Rahmans Vater Ajmal Seyd Khatak war ein redlicher, einfacher Landarbeiter, ein bodenständiger Bauer, der für Geld das auf seinen schwer zu bewirtschaftenden Feldern anbaute, was ihm seine Stammesführer vorgaben und abkauften. Dafür bekam er in der Regel zuverlässig und rechtzeitig ein paar Afghani-Geldnoten oder Naturalien, um für sich und seinen Sohn sorgen zu können. Viel war es nie, aber es reichte zum Überleben. Hier auf dem Land litt die Bevölkerung oft weniger Not als die Menschen in den großen Städten, trotz der dortigen großzügigen Unterstützung internationaler Hilfsorganisationen. Über eine Million Kinder im ganzen Land waren unterernährt, jedes Kind war de facto mangelernährt.
Afghanistan hatte die zweithöchste Kindersterblichkeit auf der ganzen Welt, aber in Puzeh hatten die Bewohner zumindest meistens ausreichend Nahrung und genießbares Wasser. Die meist ungebildeten Bauern kämpften mit einfachsten Mitteln und allem, was ihnen an natürlichen Ressourcen zur Verfügung stand gegen das allgegenwärtige Elend vor allem der Neugeborenen und Kleinkinder an. So hatten es die Dorfbewohner einst mit dem Anbau von Baumwolle versucht, doch ohne bleibenden Erfolg. Wie alle seine Nachbarn und Stammesangehörigen hatte Ajmal Seyd Khatak daher vor Jahren auf Weisung der Stammesführer wieder angefangen, auf ihren Parzellen Schlafmohn anzubauen. Schlafmohn „die Pflanze der Freude“, wie die alten Sumerer ihn einst nannten, war ein Segen Allahs für die bitterarmen Familien der gesamten Talregion. Aus ihm gewannen die Kleinbauern Mohnsaft, den man hinlänglich als Rohopium bezeichnet. Die Nutzung seiner kleinen Ackerflächen zur Opiumproduktion war für Rahmans Vater wie für alle im Tal neben ein paar Ziegen und Eseln wirtschaftlich quasi die einzige Existenzgrundlage. Jetzt in den Zeiten heißer werdender Tage und kürzer werdender Nächte würde schon in zwei Wochen die langersehnte Erntezeit anbrechen. Dann mussten wieder alle männlichen Familienmitglieder vom Kind bis zum Greis helfen, um den kostbaren Milchsaft zu gewinnen. Ein bis zwei Wochen nach der Blüte des Mohns wurden dazu in aller Sorgfalt die Samenkapseln meist am späten Nachmittag etwa einen Millimeter tief angeritzt. An der Stelle dieser bewusst herbeigeführten Verletzung der Pflanzen trat dann der begehrte Milchsaft aus. Am darauffolgenden Morgen wurde dann das schwarz-oxydierte Rohopium von den Kapseln abgeschabt. Diese braun-schwarze Masse, das Gold Afghanistans, wie die Ältesten sagten, verkauften die Kleinbauern dann an ihre Stammesführer oder direkt an die Regionalfürsten oder Unterkommandeure der Taliban. Rahmans Vater Ajmal hatte auch dieses Jahr wieder gesät, gewässert, gepflegt und es sah trotz der Dürre nach einer einigermaßen einträglichen Ernte aus, die ihnen das Überleben für ein ganzes Jahr würde sichern können. Der junge Paschtune Rahman wusste zwar von der berauschenden und betäubenden Wirkung des Pflanzenmarks aber nicht genau, wofür man so große Mengen Opium verwendete. Sein Vater Ajmal ließ ihn in dem Glauben, es werde für medizinische Zwecke in Kabul, Herat und im Ausland weiterverarbeitet. Rahmans weitergehende Fragen jedoch nach dem genauen Nutzen des Mohnsaftes ließ Ajmal regelmäßig unbeantwortet.
Auch die Stammesführer oder andere Mitglieder des Klans schwiegen, wenn Ferid und Rahman mehr über den medizinischen Nutzen der Pflanzen, die Preisentwicklung des Opiums und seine Abnehmer in Erfahrung bringen wollten. Doch je älter Rahman wurde, umso wissbegieriger wurde der Junge. Was mit dem Opium ganz genau passierte, wusste Rahmans Vater in der Tat selber nicht und wollte es wohl auch gar nicht so genau wissen. Er war nicht einfältig und wusste grundsätzlich vom Rauschgifthandel. Details kannte er nicht. Außerdem konnte sich ein Vater wie er in der Not ihres alltäglichen Daseins moralische Bedenken nicht leisten. Ajmal verrichtete seine Arbeit ohne intensiver über sein Tun und die Konsequenzen dessen für die Konsumenten des Opiums nachzudenken. So übte er sein Tagwerk jahraus jahrein ohne Murren aber auch ohne Widerspruch gegenüber den Weisungen der Taliban und seiner Stammesältesten aus.
Und obschon er sich nie beklagte, nie opponierte, so hatte er doch tief im Herzen genug vom Schlafmohnanbau und dem alltäglichen Kampf ums Überleben in einer eher lebensfeindlichen, wenig zugänglichen und kaum erschlossenen Region Afghanistans. Das entbehrungsreiche Leben im Tal hatte ihm seine Frau genommen, für die er mehr als die in ihrer Tradition übliche Zuneigung empfunden hatte. Ajmal hatte sie wirklich geliebt. Sie war seine Cousine und man hatte sie ihm damals zugesprochen. Weder er noch sie hatten damals über ihre Heirat zu befinden gehabt. Ihre Väter hatten dies für sie arrangiert und sich den Segen der Stammesältesten dafür abgeholt. Das hatte gereicht, um ihren Bund zu besiegeln. Und trotz dieser wenig romantischen Übereinkunft war Ajmals Herz bereits nach kurzer Zeit trunken von ihr. Er hatte für seine Gemahlin Gefühle gehegt, die weit jenseits dessen lagen, was die Menschen des Klans kannten und was üblicherweise in seinem Volk als liebevolle Zuneigung empfunden wurde. Während die Heirat sonst eher ein Zweckbündnis im Sinne der Großfamilien war, hatte ihre Verbindung etwas Besonderes, etwas Tieferes. Dennoch waren Ajmal und seine Frau als Paar in der Tradition ihres Paschtunenklans gefangen geblieben. So hatte Ajmal in den wenigen Jahren seiner Ehe etwas nie im Hellen sehen dürfen: das Gesicht seiner Frau. Kein Mann außer ihrem Vater und ihren Brüdern hatte sie je völlig unverschleiert gesehen. Auch die anderen Frauen in den anderen Dörfern des Tals zeigten sich selbst ihren Männern niemals oder nur sehr selten mit offenem Gesicht. Auch noch viele Monate nach ihrer Eheschließung hatte sie ihren schwarzen Schleier nicht abgenommen. Nicht im Hof, nicht im Haus. Nach draußen ging sie ohnehin niemals. Getreu der uralten paschtunischen Überlieferung, dass die Frau nach der Hochzeit ihr Heim, erst als Tote wieder verlassen sollte, war Rahmans Mutter an ihr Haus gebunden. Genügsam und zufrieden war sie Ajmal aber eine warmherzige Gefährtin gewesen. Und obwohl sie bereits vor Jahren gestorben war, so fühlte Ajmal sich ihr immer noch nah, gerade so, als wäre sie noch unter ihnen. Frauen hatten in ihrem afghanischen Alltag grundsätzlich keine Rechte. So hatte auch Ajmals Frau ein Dasein gefristet, das ultrakonservativ und traditionell islamisch geprägt war. Ihr Leben war gekennzeichnet von Opferbereitschaft und dem widerspruchslosen Dienst an ihrem Mann. Die meisten Frauen gebaren mehr als fünf Kinder. Doch bereits nach der Geburt ihres ersten Kindes war Rahmans Mutter gestorben. In seinem einzigen Sohn sah Ajmal seine tote Gefährtin wieder. Er hatte ihre Augen, diese dramatisch fesselnden, smaragdgrünen Augen. Ajmal vermochte es kaum, seinem Sohn in diese kristallenen Seelenspiegel zu schauen, ohne dass ein beißender, stechender Schmerz sein Herz quälte und die nie vernarben wollende Wunde des Verlustes erneut aufriss. Rahman war alles, was ihm von dieser großen Liebe geblieben war. Diese für seine Sippe so sonderbare Beziehung zu einer Frau, verstanden viele Klanmitglieder nicht.
Ajmal hatte nie wieder einer Frau beigewohnt. Er hatte keine weiteren Kinder gezeugt, obwohl man ihn im Sinne des Fortbestandes seines Stammes mehrmals dazu gedrängt hatte. So betrachteten ihn seine Stammesangehörigen mit Argwohn und Distanz. Er galt ihnen als fremdartiger Sonderling, als dumm und einfältig und das übertrug sich zwangsläufig auch auf Rahman. Ajmal Seyd Khatak blieb den seinen ein Rätsel genau wie sein riesenhafter Sohn Rahman. Den fleißigen Vater Ajmal selbst störte das nicht. Sein Leben verlief in den Bahnen, die das Schicksal und Allah für ihn vorgesehen hatten. Das Kostbarste was ihm der Erbarmer geschenkt hatte, war sein Sohn. Nur ihm gegenüber fühlte er sich verpflichtet. Nur ihm galt all seine Fürsorge. Nur für ihn arbeitete er. Ajmal wusste auch um die Macht des Opiums als Droge in seiner Sippe und fürchtete sein Sohn würde eines Tages ihrem Reiz erliegen. Oft hatte er Rahman vor den Gefahren des Opiums und dem Gebrauch des Mohnsaftes gewarnt. Manch ein Stammesangehöriger hatte der Versuchung nicht widerstanden und war dem Rausch verfallen. Immer wieder erinnerte er ihn daran, dass es nur für Schwerkranke aus medizinischen Gründen verwendet werden sollte. Schließlich wollte er seinen Sohn vor allem bewahren, was ihm irgendwie schaden könnte. Rahman war für ihn die lebendige Erinnerung an seine innig geliebte Gefährtin. Seine Gesichtszüge, seine Gesten, sein Temperament, seine Klugheit vor allem aber seine Augen erinnerten Ajmal jeden Tag an seine viel zu früh verstorbene Frau. Sie war von ihnen gegangen, weil es damals weit und breit kein Medikament gegeben hatte, um eine schwere Sepsis zu behandeln.
Ajmal war bis in die Provinzhauptstadt gereist, um ein Präparat zu bekommen, aber ohne Erfolg. Seine Frau starb als Rahman gerade erst wenige Monate alt war. So hatte er anfangs noch versucht, seinem Sohn Vater und Mutter zugleich zu sein, aber sein Herz vermochte es nicht, seinem Jungen auch die Liebe einer Mutter zu schenken. Gewiss liebte er seinen Sohn, aber nie verstand er es diese Zuneigung auszudrücken. Liebevolle Gesten und warmherzige Geborgenheit versickerten in der ausgedörrten Wüste seines Herzens.
Ajmal war sicherlich ein guter, wenn auch strenger Vater gewesen, aber seine Wärme war erkaltet unter der eisigen Decke der Trauer um seine Frau. Er wollte Rahman behüten und ihn vor allen Gefahren bewahren. Auch darum hatte Ajmal meist Besseres zu tun, als seinem Sohn unangenehme Fragen zum Opiumhandel zu beantworten, deren genaue Erklärung er obendrein selber nur unzureichend kannte. Immerzu erinnerte er sich an das Lächeln seiner geliebten Gefährtin.
Immerzu sehnte sich sein Leib nach ihrer Wärme. Seine Ohren dürsteten nach ihrer Stimme. Doch es blieb stumm und leer in seiner Seele. Ajmal war fürwahr ein bodenständiger, erzkonservativer aber im Alltäglichen eher pragmatischer, wenn auch manchmal jähzorniger Mensch und fürsorglicher Vater. Schulbildung hatte er selber keine genossen, aber er verfügte über einen gesunden Menschenverstand und eine skeptische Grundhaltung zu allem was fremd oder neu war.
Der seit dem Tod seiner Frau noch zurückhaltender und verschlossener wirkende Paschtune ging seiner alltäglichen Arbeit mit einer stoischen Leidensfähigkeit nach, die ihn auch innerhalb des Klans und seines ganzen Stammes immer mehr zu einem Außenseiter gemacht hatte. Ajmal lachte nie. Er sprach wenig. Freude kannte er keine, sondern nur Pflichterfüllung. Er hatte sich mit dem bescheidenen, koranfürchtigen und entbehrungsreichen Leben begnügt, das Allah für ihn vorgesehen hatte. Widerspruchslos und opferbereit lebte er im strengen Kodex des Paschtunwali nach den Weisungen des Koran, der Sunna und den Befehlen der Anführer einer hierarchischen Stammesgesellschaft. Längst hatte er keine Träume mehr. Längst hatte er keine Liebe mehr, außer der verborgenen Zuneigung eines Vaters für sein Kind. Er spürte für sich selbst keinerlei Sehnsüchte mehr. Ajmal hatte nur noch den einen sehnlichen Wunsch. Er hatte ein Versprechen zu erfüllen, dass er seiner Geliebten auf dem Sterbebett gegeben hatte.
Ajmal wünschte sich, dass sein Sohn so viel lernen möge, dass er eines Tages nicht würde wie er auf den Mohnfeldern arbeiten müssen.
So oft es ging betete er dafür zu Allah und hoffte auf das Wunder, dass sein einziger Sohn eines Tages lernen könnte und später irgendwo in der Provinzhauptstadt, in Kabul oder in Herat als Händler oder Verwaltungsangestellter würde arbeiten können. Dafür arbeitete er, dafür rackerte er sich ab, das trieb ihn an. Bisher aber blieb sein sehnlichster Wunsch, sein eisernes Versprechen an seine Frau lediglich eine unerfüllbare Hoffnung, ein unerreichbarer Traum. Zu sehr war er eingebettet in die unterwürfigen Regeln und Prinzipien seines Stammes. Zu sehr blieb er verhaftet in seiner Rolle und der starren Struktur dieser traditionellen Gesellschaft. Zudem verdiente er viel zu wenig mit der Bewirtschaftung der kleinen Mohnfelder, um auf mehr hoffen zu dürfen, als das tägliche Überleben. Die existenzielle Abhängigkeit vom Wohlwollen der Taliban war allgegenwärtig. Das was er verdiente, das was sie ihm für seine Ernte gaben, bestimmten die Führer und Fürsten. Es reichte gerade einmal für das Notwendigste und so war besonders nach den letzten Dürrejahren die Hoffnung geschwunden, dass er seinem Sohn ein besseres Leben würde ermöglich können, als er selbst es zu führen bestimmt war. Einer uralten Tradition folgend und den strikten Maßgaben seiner Stammesführer gehorsam hätte sich Ajmal eigentlich rasch nach dem Tod seiner ersten Frau, wenige Monate nach der Geburt Rahmans eine neue Frau nehmen müssen. Aber sein Herz ließ es nicht zu und bis heute hatte niemand anderes einen Platz darin. Zu sehr hatte er um seine Frau getrauert. Zu schmerzhaft war der Verlust. So vergingen die Jahre. Und nun in den Wirren des zweiten Afghanistankrieges als Folge der Terroranschläge des elften Septembers 2001 fühlte Ajmal, dass es zu spät war. Oft hatte ihn seine Sippe aufgefordert, einer neuen Heirat zuzustimmen.
In allem war er folgsam, in allem loyal, aber der Weisung, eine neue neue Vermählung einzugehen, hatte er nicht nachkommen können. Es wäre gewiss leicht gewesen, dem Drängen des Klans nachzugeben und sich für Rahman eine neue Mutter und für sich eine neue Ehefrau zu nehmen. Andere Stammesmitglieder hatten gleich mehrere Frauen, aber Ajmal konnte es nicht. Seine tiefe Trauer über den Tod seiner jungen Frau begleitete ihn auch noch nach all den Jahren. In Afghanistan galten Mädchen und Frauen zwar grundsätzlich als wertlos, aber nicht so für Ajmal. Seine Frau war ihm nicht nur kostbar und wertvoll gewesen. Sie war ihm alles gewesen. Sie war sein Schicksal.
Und so blieb er allein und ließ seinen Sohn in den ersten Lebensjahren erst einmal von dessen Großmutter erziehen, um noch mehr arbeiten zu können. Ajmal zog sich nicht zurück, aber er blieb für sich und dies gegen alle Regeln der Sippe und zum Widerwillen der Ältesten, jedoch eingebettet in die Sicherheit der Familie und seines Stammes.
Rahmans dachte auch hier auf dem Felsen an seinen Vater, der unten an ihrem Haus herumwerkelte. Dann aber ließ er seine melancholischen Gedanken an den vereinsamten Vater und die fehlende Mutter fallen. Er liess seinen weiten Blick über den Horizont schweifen, der in einem cremigen Rosa unter einem hellblauen Himmel ruhte. Noch immer saß er an jenem Nachmittag gehockt auf dem Hügel. Er legte seinen Kopf in den Nacken. Seine langen, schwarz gelockten Haare fielen in Strähnen über seine kantigen Schultern. Die mandelförmigen, grünen Smaragdaugen blinzelten aus einem zarten, gebräunten Gesicht in ein wolkenloses Firmament. Das helle Blau der von einer glühenden Sonne durchfluteten Unendlichkeit lag über ihm. Nur um die Gipfel der am Horizont aufsteigenden Gebirgsketten hingen ein paar milchige Schleierwolken. Die ganz hohen Gipfel waren noch immer von Schnee bedeckt. Die weißen Tupfen glänzten im Schein der Sonnenstrahlen wie ein riesiges kristallenes Tuch, das jemand auf die Grate der Gebirgskette gelegt hatte. Rahman ahnte die wachsenden Sorgen seines Vaters, die dieser einmal mehr mit sich selber ausmachte. Dieses Jahr war die Frühlingsflut deutlich schwächer ausgefallen als je zuvor. Nach der Ernte würde das kommende Jahr ein besonders Hartes werden, das wussten beide Männer schon jetzt. Puzeh war seine Heimat, aber wenn er von hier oben in die Ferne blickte, dann wuchs in ihm immer stärker die Sehnsucht endlich aus diesem Leben auszubrechen. Er wollte endlich richtig lernen, eine richtige Schule besuchen, Sprachen lernen, irgendwann einmal studieren, um dann für sich und seinen Vater die Güter und Waren kaufen zu können, von denen er jetzt nur träumen konnte. Oft verlor er sich auf jenem Felsen in Tagträumen von einem Leben als Pilot. Er würde fremde Orte und Länder kennenlernen, würde eine gewaltige Flugmaschine beherrschen und er wäre frei und ungebunden dort oben über den Wolken. In diese Phantasien verlor er sich seit einigen Monaten immer öfter, obwohl er noch nie ein Flugzeug aus der Nähe gesehen hatte oder gar geflogen wäre. Rahman hatte lediglich die milchigen Bahnen der großen Passagier- und Transportmaschinen hoch oben am Himmel verfolgt, die winzigen Umrisse der mehrstrahligen Jets gesehen und war in Gedanken ihren weißen Kondensstreifen gefolgt. Gelegentlich hatte er auch ein einsames Militärflugzeug gesehen, das in geringer Höhe über das Tal hinweggeflogen war. Aber Rahmans Sehnsucht galt den Jumbos, die majestätisch und erhaben weit über dem dörren Boden seiner Heimat durch die Troposphäre glitten. Am heutigen Tag aber blickte Rahman in einen leeren Himmel. Sein brauner Pakol, die weiche runde Kopfbedeckung, lag neben ihm auf dem Felsen. Er schloss die smaragdgrünen Mandelaugen mit den langen schwarzen Wimpern. Tief atmete er die spröde Trostlosigkeit der Steppe. Es war still. Nur eine leichte Böe wirbelte das leise Summen der schwirrenden Insektenschwärme vom Tal hinauf zu seinen Ohren.
Er nahm einen tiefen Atemzug und roch den nussig-herben Duft der blühenden Mohnfelder. Dann hörte er ganz leise ein sich langsam näherndes, waberndes, fast pumpendes Geräusch. Im ersten Augenblick vermutete er wieder einmal eine Puma-Aufklärungsdrohne, die regelmäßig von einem nahen Stützpunkt der Besatzer das Tal hinaufflog. Doch das Geräusch war nicht das vertraute Surren, sondern eher ein dunkles Brummen. Dieses mal war es auch kein Militärkonvoi, der sich mühsam in Richtung Kandahar vorwärtsmühte, stets auf der Hut vor Heckenschützen von Al-Quaida oder den Taliban, die immer wieder, aber viel weiter südlich mit Panzerfäusten auf die Mannschaftswagen der Nato-Streitkräfte feuerten. Rahman dachte eher an einen einsamen Truck oder einen alten Pick-up, der sich mühsam die Schotterpiste neben dem Helmand flussaufwärts hinaufquälte. Noch behielt er die Augen geschlossen, um gespannt zu erraten, was sich dort so unaufhaltsam näherte. Wieder inhalierte er den vom Tal her aufsteigenden leichten Duft der blühenden Mohnfelder. Plötzlich aber hörte er dumpfe Schläge, die in einem unrhythmischen Takt kontinuierlich lauter wurden. Ein grollender, pochender Ton näherte sich stetig intensiver werdend und rollte bedrohlich auf ihn zu. Rahman öffnete hektisch seinen Blick in Richtung des Geräuschs. Wieder hörte er ein dumpfes Pochen begleitet von einem intensiven Rumoren.
Anfänglich hatte er im gleißenden Licht der glühenden Sonne gedacht, jetzt wäre es einmal mehr eine Hellfire-Kampfdrohne, die die US Army einsetzte, um Stellungen der Taliban weit oben im Hochland ferngesteuert zu bombardieren. Vor einigen Wochen hatte ein Überflug einer solchen unbemannten Drohne schon einmal für große Aufregung und Besorgnis bei den Dorfbewohnern gesorgt. Doch das Geräusch klang jetzt anders. Dann sahen seine sich schärfenden Pupillen mehrere Helikopter wie ein gewaltiger Hornissenschwarm immer größer werdend auf sich zufliegen. Fünf Kampfhubschrauber flogen in Formation von Süden her kommend über das lila-grün gefärbte Tal. Er sah gebannt, wie sie irgendetwas abwarfen. Einschläge waren zu hören. Inmitten des lila changierenden Grüns der Felder blitzte es auf und mehrere Feuerbälle breiteten sich aus. Ein weiterer Einschlag, ein weiterer Feuerball, ein Lichtblitz dann der nächste und wieder einer. In rasendem Tempo näherten sich die Bomben werfenden Helikopter seinem Heimatdorf Puzeh. Immer wieder schlug es ein in die Felder und Bewässerungsanlagen bis auch die südlichsten Parzellen seines Vaters getroffen wurden und lichterloh in Brand standen. Ein eisiger Schrecken stand Rahman ins Gesicht geschrieben. Sein Gesicht wurde fahl und weiß. Auch auf dem Feld, auf dem sein Freund Ferid mit seinem Vater arbeitete, warfen die Hubschrauber ihre tödliche Fracht ab. Sie setzten ihre zerstörerische Mission in Richtung Norden fort, ohne die Intensität des Bombardements zu reduzieren. Das ganze Tal war binnen Minuten eingehüllt in sich schnell ausbreitenden Flammen und beißendem schwarzen Qualm.
Den hellblauen Himmel spalteten schwarze Rauchsäulen in zwei Hälften. Es war das vierte Jahr der Dürre, kurz vor der Ernte und das Feuer hatte leichtes Spiel. Das sich seinem Dorf nähernde flammende Inferno hatte Rahman aus allen Tagträumen gerissen. Hastig sprang er auf und stürzte eilig den Hügel hinab. Der Junge hastete ein langes Schotterfeld hinunter, stolperte, schlug sich Knie und Ellbogen auf, rannte weiter bis er die ersten Mohnfelder seines Dorfes erreichte.
Seine Wunden bluteten leicht und schmerzten. Schließlich gelangte er an die Parzelle, auf der er vorhin noch seinen Freund Ferid mit seinem Vater an den Bewässerungsgräben hatte schuften sehen. Der ganze östliche Teil des Feldes stand in Flammen. Von weiter hinten, etwas abseits von einem breiten Kanal hörte er plötzlich grauenhafte Schreie. Rahman ahnte die verzerrte Stimme seines Freundes. Er stolperte über irgendetwas, blickte vorwärtsstrebend zurück und sah den toten und vom Feuer entstellten Körper des Vaters seines Freundes. Dann hörte er wieder Ferids unerträgliches, gequältes Gebrüll.
Kurz darauf erreichte er seinen vor Schmerzen sich auf dem Boden windenden Freund am Saum des Ackers. Eine Bombe musste in unmittelbarer Nähe detoniert sein. Ferids Beine waren zerfetzt, Blut rann aus tiefen Kerben in seiner Haut und aus seinem Unterleib quollen die Eingeweide aus einer klaffenden breiten Wunde. Ein kantiger Granatsplitter steckte in seiner Leiste. Rahman sah überall Blut. Panisch griff er nach Ferids Hand. Er schrie wieder und wieder lautstark um Hilfe für seinen schwerverwundeten Freund, doch sein Rufen blieb ungehört. Zu laut donnerten noch immer die Bomben aus der Entfernung. Zu laut prasselte das Feuer. Rahman zog Ferid aus dem Feld auf eine Lichtung jenseits eines Grabens. Er riss sich seine Weste und das Hemd vom Leib und legte beides auf den offenen Unterleib seines besten Kameraden. Ferids grausame Schreie hallten durch den Qualm und Rahman ahnte, dass die Verletzungen seines Freundes zu schwer waren, als dass er ihn noch hätte retten können. Blut strömte aus Ferids Mund und Nase. Sein Freund krümmte sich vor Schmerzen und Qualen. Rahmans Weste und Hemd waren binnen Sekunden blutgetränkt, obwohl er den Stoff mit breiter Hand fest auf die Wunde seines Freundes presste. Er beugte sich hilflos über den zuckenden Körper seines Kameraden. Rahman fühlte sich hilflos, wusste nicht was zu tun war. Ein Zittern durchlief ihn am ganzen Leib und Angstschweiß rann über seinen Körper. Er beugte sich noch tiefer hinunter und neigte seinen Kopf an die Schläfe seines besten Freundes. „Ferid!
Ferid!“, schrie er ihn an, als würde er ihn mit seinem Rufen daran hindern können, zu sterben. Dann klammerte Ferid sich an ihn und riss ihn noch dichter an sich heran, aber er brachte kein Wort mehr heraus so sehr schüttelten ihn nun die unsagbaren Schmerzen. Rahmans Lippen begannen die Schahada vor sich hin zu flüstern: „Aschhadu an la-ilaha-ill-allah wa aschhadu anna muhammadan rasulullah (Es gibt keinen Gott außer Allah und Muhammad ist sein Prophet.)".
Unwillkürlich und unentwegt wiederholte Rahman das islamische Glaubensbekenntnis für seinen Freund. Ferids um Hilfe bettelnden Augen waren unnatürlich weit aufgerissen. Seine matte Hand griff noch einmal fest nach Rahmans Unterarm. Die inzwischen fast stummen Schreie des Freundes zerrissen Rahmans Herz. Er öffnete seine kraftvollen Hände und umschloss den Hals des vor ihm liegenden Jungen. Tränen strömten über seine Wangen. Aus Rahmans Mund flossen unentwegt die gleichen heiligen Worte: „Aschhadu an la-ilaha-ill-allah wa aschhadu anna muhammadan rasulullah. aschhadu an la-ilaha-ill-allah wa aschhadu anna muhammadan rasulullah.“
Dann drückte er zu. Ferid blickte ihn mit aufgequollenen Augäpfeln an, griff nach Rahmans Händen. Seine Muskeln zuckten wild in seinen malträtierten Gliedern. Doch Rahman ließ nicht von ihm ab. Er schloss seine tränengefluteten Augen und drückte den in seinen Händen liegenden Hals des Freundes noch fester zu. Rahman schrie wie ein Besessener in den blauen Himmel über ihm, den Kopf in den Nacken gelegt: „aschhadu an la-ilaha-ill-allah wa aschhadu anna muhammadan rasulullah!“ Weinend brüllte er all seine Verzweiflung, all seinen Zorn heraus und begann zeitgleich zu weinen, während seine mächtigen Hände den Freund weiter würgten. Ein Schauer durchlief die beiden Freunde im gleichen Augenblick. Ferid klammerte sich ein letztes Mal an den kräftigen Arm seines Freundes. Dann floss das Leben aus seinen Gliedern und sein Leib sackte in sich zusammen.
Ferid starb in den Händen seines Freundes. Rahman wollte seine Augen nicht öffnen. Dann plötzlich zuckte und zitterte sein eigener Körper, seine Hände lösten sich von Ferids Hals und er kippte auf die Seite. Ein mächtiger epileptischer Anfall schüttelte ihn. Seine ganze Muskulatur verkrampfte, seine Augen verdrehten sich und schaumiger Speichel floss aus seinem Mund. Dann fiel er völlig entkräftet mit immer noch bebenden Gliedern in Ohnmacht. Es mögen nur wenige Minuten vergangen sein, als er wieder zu sich kam. Rahman blickte auf den in einer Blutlache liegenden, zerschmetterten Körper des toten Freundes. Jetzt erst hörte Rahman die panischen Rufe und lauten Schreie, die aus der Richtung seines Dorfes zu ihm herübertönten. Er sprang auf, wusch sich den Schleim vom Mund und hob den Leib seines geliebten Freundes aus dem Dreck. Seine kraftstrotzenden Arme trugen Ferids toten Körper vor sich, geradeso als wenn er ein gottgefälliges Opferlamm dargebracht hätte. Schnellen Schrittes eilte er immer noch unter Tränen den schaudererregenden Geräuschen entgegen. Die Bewohner seines Dorfes liefen aufgeregt und orientierungslos umher. Sie starrten auf den Jungen, der den Leichnam seines Freundes trug. Doch sie hatten keine Zeit, ihm mehr Beachtung zu schenken. Alles was Beine hatte versuchte die verheerenden Brände zu löschen. Männer, Kinder und Frauen schrien, weinten und suchten mit bloßen Händen und halbvollen Wassereimern die Flammen niederzukämpfen. Es war aussichtslos. Es blieb ihnen nur noch, zumindest ein paar ihrer Behausungen vor dem Ausbreiten der Feuersbrunst zu schützen. Rahman erreichte mit dem leblosen Ferid auf seinen Armen das Haus seines Vaters. Ajmal kämpfte verzweifelt mit seinem Onkel, um das verheerende Flammenmeer von ihrer Hütte fernzuhalten. Ihr Haus lag etwas abseits und ganz in der Nähe ihrer Felder. Die Stallungen der Ziegen hatten bereits Feuer gefangen. Die Tiere schrien, als sie im Inferno verbrannten. Es war ein einseitiger, aussichtsloser Kampf, dass zu retten, was nicht mehr zu retten war.
Ihr Haus, die Stallungen und sämtliche Vorratskammern brannten lichterloh. Ajmal blickte mit erstarrten, entrückten Augen auf Rahman und den toten Jungen auf den Armen seines Sohnes. Nie hatte er Rahman so gesehen. Blutüberströmt, ohne Hemd und Weste und mit gewässerten Pupillen stand sein einziges Kind wie ein Gespenst vor ihm mit dem Leichnam des besten Freundes im Arm. Rahman legte Ferids zerstückelten Körper behutsam an einer sicheren Stelle ab, beugte sich zu dessen Gesicht hinab und küsste seinem Freund die Augen zu. Dann wandte er sich um und starrte auf Ajmal. Auch Rahman hatte seinen Vater nie so gesehen. Er erkannte ihn in diesem Augenblick kaum wieder. Wie ein Geist wirkte der aschfahle Mann in seiner zerlumpten Kleidung. Rahman blickte fragend auf den sonst so stolzen, tapferen und gefühlskargen Mann, dem nun die Tränen in Strömen über seine erblassten Wangen liefen. Von einem Moment auf den anderen hatte die Invasion der Amerikanischen Truppen selbst diese vergessene Provinz Afghanistans erreicht. Die Bomben der Alliierten Streitkräfte hatten ihnen alles genommen. Es schien als hätten die alten Frauen recht gehabt, wenn sie sagten, Afghanistan wäre für Kinder einer der schrecklichsten Orte der Welt, um dort geboren worden zu sein. Die Besatzer hatten Rahman den besten Freund genommen, den er je hatte. Sie hatten ihm den Bruder genommen, der ihm nie vergönnt gewesen war. Sie hatten Leid und Not über die Seinen gebracht. Sie hatten getötet, gemordet und geschändet. Rahman hatte mehr gesehen, als ein Kind je sehen sollte. Nie würde er vergessen, was sie ihm angetan hatten. Niemals.
Feuersturm
Die Flächenbombardements des Helikoptergeschwaders hatten ganze Arbeit geleistet. Aus dem grünen Band war ein toter, grauer Streifen geworden, der nur noch an vereinzelten Stellen einen grünlichen Schimmer erkennen ließ. Wie stumme Zeugen eines Infernos ragten die verkohlten Stängel der verbrannten Schlafmohnpflanzen widerspenstig aus dem gelbschwarzen Boden heraus. An einzelnen Pflanzen züngelten noch ein paar letzte Flammen. Die filigranen Wassergräben waren verschüttet, die kleinen Wälle und Furchen zerstört. Die lang gezogene lila-grüne Schlangenlinie des insektenreichen Tals war einer verrußten, öden Steppe gewichen, aus deren Sohle noch immer beißend zäher Rauch aufstieg. Der Tod hatte seine gierigen Arme über die ganze Flussniederung ausgebreitet und viele unschuldige Bewohner in seiner bitteren Finsternis willkommen geheißen. Der klammernde Griff der Sterblichkeit hatte seine Unausweichlichkeit so unversehens und überraschend über die Menschen und Tiere geschickt, dass alles Lebendige wie erstarrt war. Ohnmächtige Trübsal und lautlose Wut gingen mit Verwirrung und Ratlosigkeit Hand in Hand. Ajmal Seyd Khatak und sein Sohn Rahman hatten wie einige ihrer Nachbarn ihr primitives Ziegelhäuschen, ihre wenige Tiere, deren erbärmliche Stallungen und fast all ihre sonstigen Habseligkeiten verloren. Bei einer ersten Begutachtung der Schäden hatte der eigenbrötlerische Ajmal schnell verstanden, dass die diesjährige Ernte komplett verloren war und im nächsten Jahr würde es mit dem Anbau nichts werden. Die Kanäle nahezu aller Felder waren fast allesamt irreparabel beschädigt und müssten von Grund auf neu ausgehoben werden. Es würde einige Monate, vielleicht sogar Jahre dauern, das alles wieder in einen bewirtschaftbaren Zustand zu versetzen.
Ajmal schüttelte ungläubig den Kopf, während seine spröden Hände ein paar verkohlte Pflanzenstängel vom Rand eines Feldes pflückten.
Desillusioniert betrachtete er die kräftigen Stängel und die verbrannten Blütenkugeln an ihrem Ende. Die gesamte Lebensgrundlage von Vater und Sohn und ihrer ganzen Sippe lag in Schutt und Asche. Alles Hab und Gut war binnen Minuten verbrannt im Feuer eines Krieges, dessen Zweck sie nicht kannten und deren Grausamkeit alle Menschen in Puzeh in den anderen Dörfern der Opiumbauern nicht verstanden. Der Tod aus dem Nichts hatte doch bisher nur die Taliban getroffen, wenn Lenkflugkörper in ihre vermeintliche Verstecke einschlugen. Doch sie, die einfachen Leute vom Land, gottesfürchtig und vergessen vom Rest der Welt, sie hatten doch niemandem etwas getan. Sie hatten niemanden angegriffen, geschädigt oder beleidigt. Der Helikopterschwarm der Ungläubigen, der wie Hornissen über sie gekommen war, hatte ihnen mit einer gewaltigen Feuerwalze mehr genommen als nur ihre Nahrung, ihre Tiere und Unterkünfte. Diese Bomben werfenden Bestien hatten sie all ihrer Hoffnung, ihrer Würde und all ihres Stolzes beraubt. Seit Jahrtausenden waren sie wehrhaft gewesen gegen die Eindringlinge. Von Alexander dem Grossen bis hin zu den Briten und Russen hatten sie sich verteidigt, verteidigen können, verteidigen müssen. Doch mit diesen modernen Waffensystemen, die feige aus großer Distanz auf sie abgeschossen werden konnten, waren sie mit ihren Kalaschnikows, Pistolen und Karabinern machtlos. Ohne Kriegserklärung gegen ihren Stamm hatten die Besatzer Bomben auf ihre Mutter Erde, ihre irdische Heimat regnen lassen. Das war kein fairer Krieg. Das war Werk des Unglaubens. Während es für Ajmal, diesem von tiefem Misstrauen gezeichneten Eigenbrödler mit seinen neununddreißig Jahren überhaupt nicht nachvollziehbar war, warum die US-Amerikaner überhaupt nach Afghanistan gekommen waren und nun auch in seiner Region kämpften, hatte Rahman sehr wohl eine dumpfe Ahnung, weshalb das alles geschehen war. Die Intuition des aufgeweckten Knaben war außergewöhnlich und sie hatte ihn nur selten getäuscht. Er, der zumindest etwas lesen und schreiben konnte, ihm schwante, dass es bei diesem Bombenregen nicht um Vergeltung gegangen war. Rahman war ein sehr guter Zuhörer und obwohl er nur unregelmäßig den improvisierten und meist religiös gefärbten Unterricht der Stammesführer und die sporadischen Lernstunden eines Nachbarjungen besuchen konnte, so hatte er immerhin einigermaßen die beiden Sprachen Paschtu und Dari gelernt. Wenn dieser Junge, dieser Sonderling unter den vielen Kindern und Jugendlichen des Tals, der Vielen allein aufgrund seiner Statur und seiner Aura stets etwas unheimlich erschienen war, nicht gerade auf den Feldern hatte helfen müssen, so las er. Er las alles, was er irgendwie in die Finger bekam. Er las und lernte. Er versuchte auch die fremdartigen Schriftzeichen und Worte anderer Sprachen zu erforschen, ohne dafür Lehrbücher oder Anleitungen gehabt zu haben.
Ob Texte auf Verpackungen, alte Zeitungen, die ihm sein Onkel aus der Provinzhauptstadt mitgebracht hatte, Flugblätter, Zettel oder Bücher, er las wie besessen. Rahman war hungrig nach Bildung. Er saugte dabei alles Wissen auf wie ein Schwamm. Selbstständig versuchte er aus den oft mehrsprachigen Gebrauchsanweisungen oder Produktbeschreibungen meist auf Lebensmittelverpackungen Bruchstücke des Englischen zu verstehen, ohne dass er die richtige Aussprache und Betonung einzelner Wörter kannte. Aus den textlichen Fragmenten eines Konvoluts an Magazinen, Broschüren, Zeitschriften und sonstigen Schriftstücken hatte sich in seinem Kopf im Laufe der Zeit ein Weltbild entwickelt, dass sich vielleicht etwas unstrukturiert und einseitig darstellte, aber er glaubte mehr von der Welt jenseits seines Tales zu wissen, als sonst jemand in seinem Stamm.
Die Schriften in Dari waren dabei besonders wichtig, weil sie sich vornehmlich überregionalen Themen widmeten. Es gab kein Internet, es gab kein Fernsehen. Allenfalls ein schlecht empfangbarer Radiosender aus der Provinzhauptstadt informierte regelmäßig über regionale und gelegentlich auch über weltpolitische Ereignisse. Doch auch hier sprachen die Moderatoren und Nachrichtensprecher nie vom Opium, der Armut oder den vollzogenen Bestrafungen der Taliban.
Meist waren es nahezu inhaltslose Informationen, die durch den Äther drangen, wenn er meist abends gemeinsam mit seinem Vater ein paar Stunden während des gemeinsamen Mahls den Rundfunkübertragungen zuhören durfte. Vom afghanischen Opiumhandel, seinem Wert und seiner wahren Bestimmung wusste Rahman kaum etwas. Aber aus einigen Fetzen einer Monate alten Ausgabe eines Nachrichtenblattes, das er vor wenigen Wochen per Zufall beim Queren der großen Strasse gen Norden gefunden hatte und die vermutlich jemand aus einem Konvoi aus einem Truck geworfen hatte, wusste er vom allgegenwärtigen Krieg in seinem Land, der Jagd nach Osama Bin