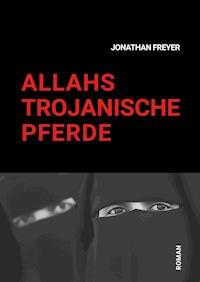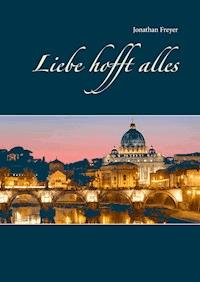
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Enttäuscht vom Leben und den Menschen darin und unfähig an einen Gott zu glauben reist der aus dem Rheinland stammende, ehemalige Bankmanager Peter von Bergen jedes Jahr Ende März von seiner neuen Heimat Basel aus zum legendären Bocca della Verita nach Rom, um dort in ganz intime, lebhafte Erinnerungen an ein verlorenes Leben und eine verlorene Liebe einzutauchen. Einem Wallfahrtsort gleich erfühlt er dort immer genau am Geburtstag seiner einzigen Liebe, der jungen Geschichtslehrerin Anna noch einmal, wie in einem ewig sich wiederholenden Ritual seine eigene Geschichte aufs Neue. Gedanklich kehrt er von dort aus zerfressen von Selbstmitleid und Seelenschmerz zurück zu den Stätten verlorenen Glücks. Er erinnert sich alter Freundschaften, den Zweifeln an Ehre und Moral seines früheren Bankberufes und dem Leben in seiner Heimatstadt Aachen. Voller Melancholie erlebt er seine verlorene Vergangenheit wieder aufs Neue, von seiner Zeit als Musiker bis hin zu jenem magischen Tag, als es sich in Anna, seine Traumfrau verliebte. Diese eine Liebe schien damals unzerstörbar zu sein, auch als Peter und Anna nur durch glückliche Umstände die Terroranschläge von 9/11 in New York City überlebten. Doch nicht dieses Ereignis, sondern irgendetwas Ungreifbares rüttelt vehement an ihrer unbeschwerten Zweisamkeit. Wieder und wieder belasteten seltsame Ereignisse, mysteriöse Zufälle und subtile Anfeindungen einer oder eines Unbekannten die Liebe des jungen Paares. Der Verdacht liegt nahe, dass sich hier jemand persönlich aus dem beruflichen Umfeld von Peter rächen möchte. Immer öfter wird die euphorische Liebe und die hemmungslose Leidenschaft der beiden gestört durch Angriffe jenes gesichtslosen Feindes. Doch dieses das alles auslösende Unbekannte bleibt verborgen und nicht greifbar. Nach einer sehr drastischen Bedrohung gelangt Peter an einen Punkt, an dem er nur noch durch einen radikalen Schritt, das Leben, die Gesundheit und die Zukunft Annas gewährleistet sieht. Er fühlt sich schuldig und verlässt Anna in der Hoffnung, dass sie dann endlich wieder glücklich werden kann, nicht ahnend, dass er damit seinem unbekannten Gegner erst recht in die Hände spielt. Trotz tiefer Depressionen versucht er ein neues Leben zu beginnen, aber die Vergangenheit holt ihn ein und verschmilzt in einem dramatischen Moment mit der Gegenwart. Just in diesem Augenblick erfüllt sich sein Schicksal.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 443
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wie Treibgut im Ozean spülen uns die Strömungen, Gezeiten und Stürme des Lebens eines Tages an die Küste unserer Bestimmung.
Mich spülten sie in die Obhut meiner Familie, dem Fixstern in meinem Kosmos und in die Arme meines besten Freundes, dem Leuchtturm in meinen Stürmen.
In Demut und Dankbarkeit widme ich Ihnen dieses Buch.
Obwohl sich einige wenige der hier geschilderten Ereignisse und Begebenheiten in einzelnen fragmentarischen Szenen so zugetragen haben, ist die Geschichte im Wesentlichen ebenso völlig frei erfunden, wie die beschriebenen Personen und Charaktere. Jegliche Ähnlichkeit oder Verwechslung mit lebenden oder verstorbenen Personen ist nicht beabsichtigt und rein zufällig.
Das Hohe Lied der Liebe (1 Korintherbrief 13,1-13)
Wenn ich in den Sprachen der Menschen und Engel redete, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich ein dröhnendes Erz oder eine lärmende Pauke.
Und wenn ich prophetisch reden könnte und alle Geheimnisse wüßte und alle Erkenntnis hätte; wenn ich alle Glaubenskraft besäße und Berge damit versetzen könnte, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich nichts.
Und wenn ich meine ganze Habe verschenkte, und wenn ich meinen Leib dem Feuer übergäbe, hätte aber die Liebe nicht, nützte es mir nichts.
Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig.
Sie ereifert sich nicht, sie prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf.
Sie handelt nicht ungehörig, sucht nicht ihren Vorteil, läßt sich nicht zum Zorn reizen, trägt das Böse nicht nach.
Sie freut sich nicht über das Unrecht, sondern freut sich an der Wahrheit.
Sie erträgt alles, glaubt alles,hofft alles!
Sie hält allem stand.
Zum Geleit
Was wir sind, ist nicht nur das, was das Leben mit uns macht, was uns widerfährt oder wem wir begegnen.
Was wir sind, ist auch nicht nur das, woher wir kommen, was uns mitgegeben wurde oder wer uns begleitet.
Was wir sind, ist Sein und Werden, ist Wandel und Veränderung und nicht zuletzt ist das war wir sind Verletzung und Heilung.
Was wir sind, ist ein unfassbarer Ozean; ein Ozean voller geweinter und getrockneter Tränen – Tränen der Freude und Tränen der Traurigkeit.
Jeder einzelne Tropfen ist Teil eines unendlichen, unergründbaren Meeres, voller Mysterien, gefangener Energie, dunkelster Tiefen und überschäumenden Lebens.
Am Ende aber ist es ein einzelner Stern in der Finsternis, eine uns leuchtende Sonne in der Dunkelheit unseres Daseins, die den Zauber des Lebens bewirkt, Leben selbst dahin bringt, wo es am Unwirklichsten erscheint - im tobenden Orkan oder in nie enden wollender Flaute.
... und manchmal, genau dann wenn man es am wenigsten erwartet, manchmal taucht genau dann ein solch glühender Stern ein in den unerschöpflichen Ozean unserer phantastischen Existenz.
Inhaltsverzeichnis
Das erwachende Rheinland bei Aachen am frühen Morgen des 26. März 2003
Zeitenwende
Zeit zu wenden – Zeitenwende
Araber
Es wäre nichts
Vom 26.März 2015
Ahnung
Freundschaft
Muttererde
Was Leben wäre
Was ich nicht bin
Wegen Dir
Danse mon Esmeralda
Tanz meine Esmeralda
Schmetterling
Gottes Geschenk
Komm mit
Ich hatte Bauchkrämpfe vor Lachen.
Wunder
Du kennst mich
Königin
In dunkelster Stunde
Pass auf Dich auf
Zweifle nicht
Anmut
Zauberwesen
Du kennst den Weg
Schlusswort
Mein schönster Stern
Wegzehrung
Das erwachende Rheinland bei Aachen am frühen Morgen des 26. März 2003
Der nahende Tag vertrieb mit seinen kaltfeuchten Nebelschwaden, die schüchtern vom kalten Wasser des Blausteinsees aufstiegen und zäh seine seichten Böschungen emporklommen, eine weitere kühle Vorfrühlingsnacht. Ein leichter Windzug wehte über die eisigen Wellen durch das Schilf hinüber zu den Feldern, Weiden und Auen. Noch war es nicht recht Frühling geworden und ganz vorsichtig zeugten nur vereinzelte Knospen, die dem morgendlichen Frost trotzten, davon, dass die düstere Jahreszeit langsam zu Ende ging. Nur noch an vereinzelten Tagen vermochte es der nasse Winter seine Kälte und Blässe in die sich räkelnde Atmosphäre auszusenden. Eine friedliche Stille lag über der Ebene. Lediglich das Rascheln des Windes in den übrig gebliebenen spröden Blättern der Bäume und Hecken störte das lautlose Erwachen der Morgendämmerung. Jene spätwinterliche Melancholie war mir vertraut. Diese Gegend war mein Zuhause, meine Heimat gewesen. Hier hatte ich auf wackeligen Beinen zu laufen gelernt; hier war ich aufgewachsen, war zur Schule gegangen und hier wurde ich als kleiner Junge, wie alle meiner Schulkameraden Messdiener in einem katholischen Dekanat. Land und Leute hatten mich in meiner Kindheit nicht weniger geprägt als die unzähligen fürsorglichen Mahnungen und Ratschläge meiner Eltern. Mit vielen Orten, Plätzen und Wegen verbanden mich zahllose Erlebnisse und Geschichten vom ersten Schultag bis zum ersten Kuss und dem bittersüssen Schmerz der Ungewissheit einer ersten Verliebtheit. Hier war ich verwurzelt. Hier steckte ich fest im tiefen Morast rheinischer Erde und einer heiteren, aber von Missgunst getränkten Mentalität.
Anders als sonst kämpfte der Winter dieses Jahr scheinbar vehementer und hartnäckiger gegen die stetig stärker werdende Kraft der Frühlingssonne. Dieser Winter hatte sich lange, fast bis Mitte März, mit Eis und Schnee gegen das Erwachen der Natur aufgebäumt und verabschiedete sich nun nur zögerlich und unwillig für die nächsten Monate. Scheu und vorsichtig öffneten die ersten Krokusse ihre violetten-blauen Blütenblätter nach einem langen, düsteren Winterschlaf. Sie stachen wie vereinzelte Farbtupfer aus den von Raureif versilberten, blassgrünen Wiesen heraus und hoben sich dadurch deutlich ab in ihrer farbigen Freundlichkeit vom blassen, braungrünen Einerlei der Weiden und Felder. Aus den Vorgärten der uniformen Neubausiedlungen versprühten spärliche Büschel Schneeglöckchen ebenso einen Hauch von Frühling wie die flauschigen Triebe der Weidenkätzchen. Schwere Duftwolken aus Erde und frischem Gras wehten über die unbestellten Felder zu den hügeligen Ausläufern der Nordeifel hinüber. In tausend Farbnuancen eroberte das gleissende Licht des neuen Morgens das weichende Grau der Nacht. Vom tiefsten Schwarzblau über Lila, Rosa, Indigo und Azur bis hin zum leuchtenden Purpur erstrahlten am Saum des erwachenden Morgens die Federwolken am Firmament in atemberaubenden Farben und Formen.
Weit in der Ferne sah man die charakteristischen Silhouetten der unentwegt aufsteigenden Wasserdampfsäulen, die aus den breiten Schloten der Braunkohlekraftwerke Weisweiler, Niederaussem und Frimmersdorf in den pastellfarbenen Himmel emporwuchsen. Ich hasste diese wolkenspeienden Schlote, die mir mein Vater als Kind als wunderbare Wolkenfabriken schöngeredet hatte. Braunkohle hatte dieses hügellose Fleckchen Erde am Rande der rheinischen Tiefebene zwischen Inde und Rur seit Jahr und Tag landschaftlich durch tiefe Wunden geprägt, die die gewaltigen Schaufelradbagger des Tagebaus über Jahrzehnte hinweg in die Kulturlandschaften der Region hineingefrässt hatten. Kubikmeter für Kubikmeter hatten sich die stählernen Kolosse tiefer und tiefer abwärts ins Mark der Heimat gegraben, um das braune Gold der Kohle unter Lösböden, Sedimenten und Kiessohlen heraus zu schürfen. Unzählige Höfe, Burgen, Denkmäler aber auch ganze Dörfer, deren Friedhöfe und mit ihnen ihre Erinnerungen wurden weggebaggert, ausradiert von den gigantischen Baggern mit ihren mächtigen Schaufelrädern zum Wohle des Energiehungers und zum Nachsehen der ohnehin schon kohlendioxydschwangeren Luft. Auch wenn sich die RWE Aktiengesellschaft und ihre Tochter Rheinbraun für die Betroffenen der Umsiedlungen um wirtschaftliche Kompensation, emotionale Sensibilität und ökologische Verantwortung mühte, so war dieses ‚Wegbaggern’ gewiss nicht das, was man hinlänglich als einen chirurgischen Eingriff in die Landschaft bezeichnen würde. Denn neben Gebäuden und Strassen wurden auch viele Traditionen, Bindungen und Verwurzelungen im wahrsten Sinne des Wortes vom Erdboden verschluckt und nicht wenige der hier tief verwurzelten Menschen, vor allem die Alten, waren seelisch dem Rohstoffhunger der Industriegesellschaft und dem Profitstreben des grossen Energiekonzerns zum Opfer gefallen. In vielen Familien zerstörte die organisierte Umsiedlung in neue, am Reissbrett entworfene Retortenorte nicht nur Kirchen, Gassen und Häuser, sondern auch Gewohnheiten, Bräuche, Lebensentwürfe und Beziehungen. Trotz allem zeichnete sich der hier ansässige, rheinische Menschenschlag durch Humor, Toleranz und einer beachtlichen Portion Pragmatismus aus. Viele Frauen und Männer aus dieser Region lebten von den Einkommensmöglichkeiten, welche ihnen der Braunkohletagebau und die sich in dessen Umfeld hier niedergelassenen Industrie- und Handelsgeschäfte eröffneten. So lebte der ein oder andere in einer sonst strukturschwachen Region zwar innerlich entwurzelt und seelisch verwundet aber wirtschaftlich abgesichert.
Das Leben war für die meisten sicher und geordnet. Die permanenten Veränderungen in den Kulturlandschaften der Region trugen gewiss bei einigen Einheimischen und so auch bei mir dazu bei, an einer unerklärlichen Rast- und Ruhelosigkeit zu leiden. Etwas Unstetes war meiner Heimat eigen geworden. So war auch ich ein Geschöpf dieser sich ständig verändernden Gegend; die ganze Region war mir mein Stückchen „Zuhause“, auch wenn sich Landschaft und Natur jahraus jahrein einem permanenten Wandel zu unterziehen hatten. Gelegentlich verlor ich die geographische Orientierung, manchmal sogar die Erinnerungen an Plätze und Orte.
In den vergangenen Wochen aber war mir meine Heimat noch fremder geworden, als es die Schaufelradbagger der Braunkohletagebau und alle Radlader der Welt je hätten bewirken können. Mein ganzes Leben war in den letzten Tagen aus den Fugen geraten und wirkte auf mich wie weggebaggert, wie weggefräst.
Eine schmerzhafte Kälte durchzog meinen Körper. Es war jene Art von bitterer, eisiger Kälte, die von aussen bis tief in mein Herz hineindrang, gegen die es kein Mittel gibt, um sie zu vertreiben und die Seele zu wärmen. An jenem späten Märzmorgen schien der Winter nach so vielen eis- und schneereichen Wochen nun alsbald sein braun-blasses Kleid ablegen zu wollen. Doch mich fröstelte es und ich fror bis ins Mark hinein in jener Stunde. Zwar war es noch einigermassen kühl an diesem sehr frühen Morgen, aber es schien sich deutlich wärmer anzufühlen für meine Haut als in den vergangenen Tagen, auch wenn ein zäher Nebel die Natur hartnäckig in einer grauen Tristesse gefangen hielt. Es war jene mir geläufige Tristesse, deren traurige Melancholie allenfalls durch die bunte und ausgelassene Zeit des Rheinischen Strassenkarnevals ein wenig von ihrer lähmenden Betrübnis genommen wird. Doch die karnevalistischen Farbtupfer waren längst wieder verschwunden, die fröhlichsentimentalen Schunkellieder verstummt und der kindlichen Ausgelassenheit und ausschweifenden Zügellosigkeit war jetzt die dumpfe Schwermut einer freudlosen Fastenzeit gefolgt. Eine blütenarme Fauna war mir wie ein Sinnbild für meine eigene seelische Verfassung durch ihre lähmende Trostlosigkeit, die sie verbreitete. Noch war die Natur nicht vollends zu neuem Leben erwacht und noch waren auch die Schwalben nicht aus dem Süden zurückgekehrt. Noch sassen die Menschen nicht in den Strassencafes oder auf den Bänken in den Parks und noch erreichte die wärmende Kraft der Sonne weder meine Heimat noch mein Herz. Meine Seele kannte keine Sonne mehr. Sie war spröde und frostig. Ich war müde, sehr müde. Vieles war mir so fremd geworden in den letzten Wochen. Viele Begrifflichkeiten hatten sich verändert und eine neue Bedeutung, eine andere Wertigkeit bekommen: Freundschaft, Liebe, Treue, Achtsamkeit, Erfolg und Geld. Was war mir noch Zeit ausser einem dauerhaften Zustand nicht heilen wollender Wunden? Was war mir noch Gesundheit und Unversehrtheit ausser einer trügerischen Sicherheit, die uns das Leben in Sekunden aus der Hand zu reissen vermag? Was war mir noch Lebendigkeit ausser einem Moment fortwährender Seelenqualen? Mein Dasein war sinnlos geworden, wertlos und ohne Bedeutung. Die eine, die mir alles war, gab es nicht mehr für mich. Schlimmer.
Es durfte sie nicht mehr geben für mich. Ich war so erschöpft, so unendlich müde. Ich war müde vom Leben, müde vom Leiden. Mein warmer Atem kondensierte in einem milchig kalten Dunst bei jedem meiner heftigen Luftstösse, die keuchend meine Lunge verliessen. Stolprig waren meine letzten Schritte über die feuchten Gräser und Büsche den kleinen, aber steilen Abhang hinab. Ich hielt mich an den vereisten Zweigen der Kettensträucher fest, um nicht auszurutschen. Aus dem Kopfhörer meines Diskman klang Musik in meinen Ohren. Es war ihr Lied für mich. Hunderte Male hatte ich sie diesen Song für mich singen hören. Tausende Male hatte ich die Töne und Worte aus ihrem Mund gehört. Doch heute bekam jenes von ihr für mich eingesungenes Lied einen anderen, einen neuen Sinn. Ihre Stimme drang in diesem Augenblick noch viel tiefer in meine Seele hinein als je zuvor, wissend, dass ich sie heute ein allerletztes Mal hören würde:
“No I can't forget this evening, or your face as you were leaving, but I guess that's just the way the story goes…. No I can't forget tomorrow, when I think of all my sorrow, how I had you there, but then i let you go....
It's only fair that I should let you know, what yo should know….
I can't live, if living is without you. I can't live, I can't live any more.”
Nein, ich konnte nicht leben ohne sie. Sie war mein Leben, mein Pulsschlag und mein Atem. Sie war mein gestern, mein heute und mein jetzt. Sie war immer meine Hoffnung, mein Trost, meine Zukunft gewesen. Ohne sie gab es keine Hoffnung und kein Morgen mehr für mich.
Am Saum der Böschung musste ich kurz inne halten. Ich legte meinen Kopf in den Nacken und starrte in den langsam heller werdenden Frühlingshimmel. Die Sterne verblassten einer nach dem anderen und ein einsamer Mäusebussard zog ahnungslos seine einsamen Kreise über mir. Ich rang nach Luft. Es waren nur noch wenige Schritte. Nur noch ein paar Tritte bis zur Heilung meiner Wunden, ein kurzer Weg bis zu meiner Erlösung. Mein Herz bebte und mein Puls schlug wild und ungezähmt in meinen pochenden Arterien. Es waren wohl kaum mehr als acht überschaubare Meter, um endlich, endlich all dieses Leid von mir abzuwenden. Ich sah hinab auf die braunen Spitzen der Budapester Lederschuhe, die aus den dunkelblauen Hosenbeinen meines Business-Anzuges hervorlugten und doch wie festgeklebt in der modrigen, nassen Erde feststeckten. Tief versanken meine Schuhe mit mir darin im weichen gewächslosen Lehmboden. Jeder Schritt war schwer wie Blei und doch federleicht; jede Bewegung meines Körpers war unspektakulär und langsam und dennoch souverän und wie selbstverständlich. Was ich hier vorhatte, war so ganz gegen meinen bis vor kurzem noch so tief verwurzelten katholischen Glauben. Mein Vorhaben war ein Frevel gegen meine wertkonservative Erziehung und meine vielen eigenen Wahrheiten. Es war ein Verrat an alles, was mir meine Eltern mit auf den Weg gegeben hatten. Und doch – ich war beseelt. Ich hatte aufgehört zu glauben. Ich hatte aufgehört zu wünschen, zu fühlen und zu hoffen. Das Lied aus dem Diskman war zu Ende und ich drückte die Repeat-Taste:
„No I can’t forget this evening …“ .
Mir liefen die Tränen übers Gesicht. Fürwahr, ich konnte jenen Augenblick nicht vergessen, indem ich sie um ihrenwillen verlassen hatte. Ich hatte uns voneinander gehen lassen, um sie nicht zu zerbrechen. „Mutig ist der, der weiterlebt, trotz allem was das Schicksal uns auferlegt!“ So oder so ähnlich hatte ich selber immer dahergeredet, als sich vor einigen Wochen ein Bekannter im Keller seiner Eltern mit einem Strick das Leben nahm. Was für ein Dummschwätzer war ich noch vor ein paar Wochen gewesen, nicht wissend, was das Leben mit einer geschändeten Seele anzurichten vermag! Ich hasste mich für mein dämliches Geplapper von damals über Mut und Verantwortung, über Tapferkeit und Zuversicht. Was bleibt dem Menschen, wenn er aller Hoffnung und Zuversicht beraubt ist? Zu jener Zeit damals hatte ich gewiss nicht den Hauch einer Ahnung davon gehabt, wie sehr das Schicksal einen Menschen bis in seine Grundfesten erschüttern kann. Und nun stand ich selber am Rande einer Bahnstrecke, bereit meinem sinnentleerten, elenden Leben ein dramatisches Ende zu setzen. Mag sein, dass es mutig war, was ich tat, besonders tapfer war es nicht und heldenhaft ganz gewiss nicht. Ich war nie ein Held gewesen. Nie war ich ritterlich. Ich beendete jäh den Gedanken, als ich von irgendwoher hörte, wie eine schwere Autotür zuschlug. Mir stockte abrupt der Atem. Dann startete ein Motor, heulte kurz auf, um dann leiser werdend zu verstummen. Ich atmete auf. „Gott-sei-Dank! Ich war unentdeckt geblieben. Nur noch ein paar Minuten der Entschlossenheit, nur wenige Schritte der Bewusstheit und du hast es geschafft!“, redete ich mir Entschlossenheit zu. Dann hörte ich es. In der Ferne erklang deutlich das metallische Summen und das schrille Surren, auf das ich gewartet hatte. Es war der Klang des Todes. Es war für mich wie einen Lockruf der Verheissung auf Schlaf und Leere, oder dann doch auf einen wie auch immer vorzustellenden Himmel? „Gott, wenn es ihn geben sollte, erwartet mich hoffentlich mit offeneren Armen und ehrlicherem Herzen als die Menschen hier“, dachte ich. Während mein Herz das siedende Blut immer wilder durch meinen zitternden Körper pumpte, waren meine Schuhe noch tiefer im weichen Modder des Bahndamms eingesunken. Mein Blick haftete fest an den beiden stählernen Spuren und den hölzernen Wirbeln zwischen den beiden Trassen direkt vor meinen Augen. Ich war ganz klar, ganz bei mir in diesem Augenblick trotz aller Anspannung. Nein, es gab keinen Zweifel, keine Angst, keine Befürchtungen. Ich war vollkommen im Moment, erfüllt von einem Gefühl grenzenloser Freiheit und gleichzeitig berauscht von der unstillbaren Sehnsucht nach Stille, Schlaf und Zeitlosigkeit. Ein kühler Luftzug wehte lautlos zu mir herüber und der vertraute Duft von Forsythtien, die wild entlang der Bahntrasse wuchsen, erreichte zärtlich meine Sinne. Tief in mir fühlte ich, wie sich mein Schicksal in wenigen Augenblicken hier an diesem Bahngleis erfüllen sollte. Ein ewiger leidloser Frieden näherte sich mir mit seinen ausgebreiteten Armen und wartete darauf, mich fest an sich zu drücken wie eine Mutter, die ihr Kind inbrünstig umarmt, wenn es gesund von der Schule heimgekehrt ist.
Meine inzwischen aufflackernde Erregung rührte mehr aus der Dramaturgie des Augenblicks und der sich in Höchstgeschwindigkeit nähernden Gewissheit auf die Befreiung von aller Lebenslast als aus irgendeiner vermeintlichen Todesangst. Es war erschreckend, aber da war keine Spur von Furcht in mir. Die unaufhaltsame Urkraft des heranrasenden Zuges wimmerte immer lauter werdend in meinen Ohren. „Komm schon. Nur ein weiterer kleiner Schritt hin in Richtung Frieden“, sprach ich mir Mut zu. Nun waren es noch sieben Meter, dann sechs. Ohnmächtig meinen Beinen noch Befehle zu erteilen, vernahm ich grollend und schnaubend wie der Thalys mit seinem mächtigen bordauxfarbnen Triebwagen auf mich zuraste. Ich atmete das Leben in seiner ganzen Fülle ein. Ich atmete seinen Zauber und seine Tragik wie noch nie zuvor und ich spürte es in jeder Zelle meines Organismus; ich ahnte jetzt was es wirklich heisst, lebendig zu sein. Doch sehnte sich meine geschundene Seele nach all dem Leiden der Lebendigkeit den schmerzlosen Frieden der Vergänglichkeit entgegen.
Kurz hielt ich inne. Noch fünf wenige Meter. Vorsichtig ertasteten die Ledersohlen die spitzen, scharfen Kanten der Basaltsteine im grauen Schotterbett der Bahnlinie Aachen-Köln. Ich glaubte, eine laute Warnsirene zu hören. Oder auch nicht? Das Signal hielt mich nicht auf, bremste mich nicht eine Sekunde in meiner Bewegung. Die meist blattarmen Büsche und Sträucher spielten mit einem aufflackernden Wind und ein erster Sonnenstrahl durchdrang in diesem Augenblick die pastellfarbenen Schleierwolken und wärmte kurz mein Gesicht.
Sekunden vergingen wie Stunden, Momente waren wie Ewigkeiten. Ich war apathisch und doch fokussiert, betäubt und doch konzentriert.
Wie in einem Panoptikum jagten tausende Bilder durch die zum Bersten angespannten Synapsen in meinem Kopf und zeigten in wirrer Folge Fotos von Fremden und Freunden, Orten und Momenten, Instrumenten und Körpern. Nur noch gute vier Meter. Nicht mehr als ganze dreihundertachtzig Zentimeter bis zur Wahrhaftigkeit. In mir brannte das Feuer der Sehnsucht nach einem langen endlosen Schlaf. Übersättigt von Gedanken, ertrunken in Selbstzweifeln gebot ich meine Seele in Gottes Hände. Jeder Augenblick war wie betäubt und besinnungslos; jede Körperfaser fühlte sich gedemütigt und verleumdet. Es war an der Zeit. Es war an der Zeit hinüberzutreten in eine andere, eine bessere Welt. Ich war bereit zu gehen. Eine winzige Entfernung nur bis zur Unendlichkeit. Immer lauter, immer bedrohlicher näherte sich donnernd auf gerader Strecke der Hochgeschwindigkeitszug auf seiner Fahrt von Köln in Richtung Paris.
Schrill quietschte Metall auf Metall; das Getöse des Alarmsignals drohte mir das Trommelfell zu zerreissen. Seltsam und makaber - aber ein erwartungsvolles, befreites Lächeln schlich sich in dieser nicht zu beschreibenden Erregung auf meine Gesichtszüge. Meine Schlagadern drohten vor Aufregung zu bersten unter meinem heftigen Herzschlag. Und doch war ich mir jeder meiner Schritte bewusst, nüchtern und immer noch angstfrei. Das Ende aller Lügen. Das Ende allen Verrats. Das Ende aller Peinigung, Demütigung und Perspektivlosigkeit. Vor allem aber ein Ende der Hoffnungslosigkeit und Leere. Wozu noch leben, wenn mir das Liebste daraus entrissen worden war? Wozu noch atmen, wenn ich nicht mehr wusste für wen und was?
In knapp drei Metern, in wenigen Augenblicken würde alles vorbei sein und alles wäre überstanden. Schon sah ich in nicht mehr allzu grosser Entfernung die Scheinwerfer und die schlanke, bordeauxrote Silhouette des Thalys rasend schnell auf den singenden Gleisen auf mich zukommen. Nur noch etwas Mut. Jetzt nur noch zwei Schritte und stehen bleiben!
Dann tauchte es auf.
Wie aus dem Nichts stand es da. Es erhob sich aus dem Nichts und entschwand sofort wieder dorthin. Es blendete auf, dieses eine Bild in meinem Hirn, das alles zerstören sollte und alle Hoffnung auf Erlösung begraben sollte. Ich sah vor meinem geistigen Auge genau das Bildnis, das ich jetzt nicht sehen wollte.
Ich sah Anna, meine Gefährtin, mein Hafen, mein Zuhause.
Es war nur das unscharfe Fragment ihrer Augen. Es war nur der Bildfetzen ihrer Lippen, ein schemenhaftes Fresko ihres Lächelns, das ausreichte, um mich sanft aber kraftvoll aus dem sich mir nähernden Paradies herauszuzerren. Es riss mich heraus aus meiner Hoffnung auf den Tod. Es schleuderte mich hinfort aus allen Träumen auf die Verheissungen des Jenseits und hinein in eine trostlose, düstere Wirklichkeit. Ihr Antlitz stand da, vor mir wie in einem unwirklichen Schattenbild und doch war es kein Trugschluss, keine Erscheinung. Sie war gegenwärtig und hielt mich zurück. Ich erschrak. Meine Augen waren aufgerissen und mein Körper schwankte. Mein Herz schien still zu stehen. Plötzlich wich ich zurück und nur Millisekunden später raste die mächtige Lokomotive des Hochgeschwindigkeitszuges mit schrillem Bremsgeräusch und heulendem Signalhorn um Haaresbreite an mir vorbei. Der ohrenbetäubende Lärm der jaulenden Aggregate und das quietschende Metall der bremsenden Radreifen zerfetzten mir alle meine Sehnsucht nach Heilung. Ein schwarzer Schatten der Vergänglichkeit streichelte kalt meine Wange bevor mich ein gewaltiger Luftzug brutal rücklings bis an den Rand des Gleisbettes zu Boden warf. Mit einem gewaltigen, rhythmischen „DuDumDuDum“ flogen die einzelnen Wagons und Abteilwagen in gefühlter Lichtgeschwindigkeit donnernd an mir vorbei und ich hatte alle Mühe Luft zu bekommen.
„Neiiiiiiiiiiiiin!!!!“, kreischte ich in einem endloslangen Schrei dem Zug entgegen. „Annnaaaaaa!!!! “, schrie ich unter heftigen Tränen den mich passierenden Waggons hinterher. „Annaaaaaaa!!!“
Dieser Tag ist jetzt zwölf lange Jahre her.
Wider aller Wahrheiten atme ich.
Gegen alle Zuversicht lebe ich.
Und trotz allem hofft mein Herz.
Zeitenwende
Wind von Hügeln über Meere
Wind aus höchster Atmosphäre
Wind von Ebenen und Feldern
Wind aus Höhlen und aus Wäldern
Wind von Bächen und von Wegen
Wind aus Wolken und aus Regen
Wind von Dächern und von Türmen
Wind aus Wüsten und aus Stürmen
Wind vom Mond und von Gestirnen
Wind aus Eis von Gletscherfirnen
Alle Winde strömen hin
Zu dem, der ich gewesen bin
Jeder Wind streift meine Hände
Zeit zu wenden – Zeitenwende
Zwölf Jahre später und fünfhundert Strassenkilometer weiter südlich
Nein, ich atme noch. Entgegen aller Zuversicht und wider alle Vernunft hofft mein Herz. Noch immer schlägt es und trotz allem Geschehenen pumpt es ohne Unterlass das Blut durch meine spröden Adern. Heute bin ich ein anderer als damals vor zwölf Jahren. Und auch morgen werde ich gewiss ein anderer sein als derjenige, der ich heute noch bin. Immer noch und mehr denn je bin ich ein leidenschaftlich Zweifender. Immer noch und mehr denn je bin ich ein sehnsüchtig Suchender. So bin ich auf der Reise meines Lebens noch nicht sehr weit gekommen und stecken geblieben im Strudel des Erlebten. Wie in einem Moor umklammert der modrige Morast des Schicksals meine Gebeine und hält mich gefangen in einer Welt jenseits der Gegenwart und diesseits der Vergangenheit. Vor vielen Jahren hatte ich aufgehört an etwas zu glauben und ich habe seither auch nicht wieder angefangen es zu tun. Ich glaube nicht mehr. Wie könnte ich auch? Woran hätte ich denn noch glauben können? Sollte ich trotz allem was mir widerfahren ist, was Menschen mir angetan haben wieder naiv und vorbehaltslos wie ein Kind an das Gute im Kern eines jeden menschlichen Wesens glauben? Sollte ich tatsächlich noch ein letztes Mal auf etwas Besseres hoffen, als das, was ich jetzt hatte oder etwa dafür beten, dass alles wieder gut werden möge? Wie hätte ich nach den tosenden Stürmen meines Lebens jemals wieder an einen Gott, an einen Allah oder das Universum glauben können? Wo war er denn damals, dieser barmherzige Gott, dieser liebende Vater? Wo war er gewesen, mein Erlöser, mein Heiland? Wo war er in meinen dunkelsten Stunden? Er hatte sich in sicherem Abstand zur Tragik meines Lebens aufgehalten. Er hatte sich verpisst, versteckt in der Dunkelheit einer nie wieder enden wollenden Nacht.
Gott!?! Er hatte mich nicht verlassen, er war nie da gewesen. Wie waren noch die letzten Worte Jesu? Eli, Eli, lama asabthani! Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen! Und das war keine Frage des Messias.
Es war Verzweiflung und Angst. Und genau diese Verzweiflung und Angst war auch gegenwärtig in mir. Damals hatte dieser grosse Gott der Christenheit all meine verzweifelten Gebete, meine Hilfeschreie und mein sehnlichstes Flehen erbarmungslos überhört. Er hatte gefühlslos geschwiegen und tatenlos distanziert zugesehen.
All mein inbrünstiges Rufen, all mein jammerndes Betteln und bedauernswertes Winseln zu ihm war ungehört geblieben. Meine beharrliche Suche nach göttlichem Beistand und spiritueller Hilfe war naiv, infantil und völlig vergebens gewesen und nichts hatte mir meine Hoffnung inzwischen erkennbar wiedergeben können, bis heute nicht. Weder bewusstseinserweiternde Drogen noch Alkohol, weder alternative Religionen noch mittelalterliche Esoterik oder gar meine eigene Lebenswirklichkeit hatten neue Antworten auf alte Fragen für mich bereitgehalten. Erst recht hatte mir in den letzten Jahren niemand die mich umtreibenden Fragen beantworten können. Wer und warum? Nun war es nicht so, dass ich jemanden danach gefragt hätte. Ich hatte mittlerweile gelernt, dass es nicht für alles, was auf Erden geschieht, eine Antwort gibt. Es gibt vielleicht auch nie eine Antwort auf das, was mir widerfahren ist. Genauso wie es keine Antworten gibt auf Ebola, Krebs, Vulkanausbrüche, Hunger, Glaubenskriege, Erdbeben oder Tsunamis.
In all den Jahren habe ich voller Inbrunst so viele Gebete gebetet, so viele Hoffnungen gehofft und so viele Träume geträumt. Ich habe zu meinem Schöpfer gefleht und mein Karma angebettelt. Ich habe nach Antworten und Wahrheiten gesucht, aber es blieb stumm in mir und um mich herum. Keine innere oder transzendentale Stimme hat mir etwas offenbart. Gefunden habe ich nichts, ausser der Gewissheit, dass es keine Gewissheiten für uns in dieser Welt gibt. Das Leben ist wie Sand in unseren Händen. Und doch haben mich das Leid und alles Übel nicht gesucht, es hat mich nicht per Zufall gefunden. So ehrlich muss ich sein. Nein, ich habe das Leid und alles Übel selber angelockt. Ich habe ihnen, naiv wie ich war, die Türen zu meiner Existenz ganz weit aufgehalten und es ist zu mir gekommen und hat mich heimgesucht. Schlüssige Antworten finde ich kaum auf meine Schicksalsfragen, aber ein paar Erkenntnisse haben sich dann doch herauskristallisiert. Mit ein paar Lebensweisheiten hatten meine Eltern sicher Recht. Tatsächlich ist eines Menschen Gutheit zugleich auch seine Dummheit. Vielleicht ist seine grösste und edelste Gabe auch seine Achillesferse.Vielleicht hatte ich aufgrund meiner christlichen Erziehung in der Tat den Blick immer nur auf das Gute gerichtet. Meine Gutheit, nein meine Gutgläubigkeit hat mein Leben und meinen Glauben zerstört. Was der Mensch dem Menschen sein kann, habe ich selbst durchlitten und hätte es doch viel früher wissen müssen. Trotz aller Verzweiflung hatte ich mich an jenem Märztag vor zwölf Jahren nicht an einem Bahngleis im Rheinland umgebracht. Seither habe ich es auch nicht wieder versucht.
So lebte ich vor mich hin, orientierungslos wie Treibgut im Fluss eines willkürlich dahinplätschernden Lebens, auf einer Reise ohne Ziel. Meine eigene kleine Welt, aber auch die Welt draussen vor der Tür hat sich in ihrem Lauf seit jenem Tag vor zwölf Jahren fühlbar verändert. Für die Menschen hat Materialismus anscheinend noch mehr an Bedeutung gewonnen, noch mehr Priorität bekommen und gewiss ist unsere Zeit noch ungleicher, noch ungerechter geworden. Reiche wurden reicher, Arme wurden ärmer im neoliberalen Glauben an die Allmacht des Marktes in einem entfesselten, menschenverachtenden Kapitalismus und den ich-zentrierten Geistern der Gegenwart. Die Verwirtschaftung der gesamten menschlichen Existenz hat beängstigende Ausmaße angenommen und das Gefühl der egomanischen Entmenschlichung unserer Gesellschaft treibt mich um.
Doch viel gravierender als all diese fühlbaren Veränderungen in unserm Leben ist für mich persönlich im kleinen Kosmos meiner Existenz etwas ganz anderes. Es ist neben dem Ballast der Vergangenheit, die Gewissheit, dass ich mit der Gegenwart nicht mehr mitkomme, dem Fortschritt nicht mehr folgen kann. Mit jedem Jahr spüre ich es regelrecht körperlich, dass eine weitere exponentielle Beschleunigung sämtlicher Betriebsamkeiten mich immer schneller vor sich her treiben will. Ich halte diesem rastlosen Vorwärtsstreben nicht mehr Stand. Mein Intellekt schafft es nicht mehr, sich allen Neuerungen und Trends in einer viel zu schnell drehenden Welt zu stellen und ihren Hypes zu folgen. Ich kann kaum noch filtern, was wichtig ist und was nicht. Natürlich habe ich ein Smartphone, ein Tablet und ein Notebook. Ich bin kein Neanderthaler des Informationszeitalters. Aber die Verdigitalisierung meiner kompletten menschlichen Existenz bereichert mich nicht, sie bedroht mich und macht mir Angst. Ich habe Angst zu ertrinken in algorithmischen Sintfluten der Moderne. Es ist mir alles zu viel geworden. Zu hektisch, zu verfügbar, zu abstrakt und viel zu kalt. Mit dieser immensen Beschleunigung erlebe ich subjektiv aber auch eine wachsende Entsolidarisierung unserer Gemeinwesen und ein Absterben von Mitmenschlichkeit und Warmherzigkeit. Nicht eine einzige wahrhaftig kostbare Utopie ist Wirklichkeit geworden - nicht einmal meine eigenen; mir ist es nicht gelungen meinen Frieden zu finden mit meinem Schicksal und der Vergangenheit. Und auch die Welt hat ihren Frieden mit sich und den exponentiell schnellen Veränderungen im Dasein der Menschen noch nicht gefunden; weder ist es den Wissenschaftlern gelungen Krebs zu heilen, noch den Hunger zu besiegen oder Kriege und Terror zu beenden. Auch die unstillbare Gier des Turbokapitalismus wurde nicht in seine Schranken gewiesen.
Im Gegenteil. Wieder wird dereguliert zum Wohle des Geldes und noch immer gibt es menschen-gemachte Not und unerträgliches Leid auf unserem Planeten, trotz unserer weltumspannenden Vernetzung. Es scheint inzwischen noch sachlicher, noch ungerechter und noch unmenschlicher zuzugehen auf Mutter Erde. Und Gott? Nein, ich habe keinen Anlass mehr zu glauben, auch nicht an den lieben Gott, der mir einst so sehr am Herzen lag. Und doch bete ich jeden Tag zu irgendetwas, weil ich in den letzten Fasern meines Körpers hoffe. Nur auf was weiss ich nicht mehr. Beten kann sicherlich auch nicht schaden. So bete ich, weil es trotz allen Zweifels meiner Seele gut tut, mich jemandem anzuvertrauen und mit jemandem zu reden, selbst wenn es nur ein imaginäres Pendant ist, das mir ohnehin nicht zuhört. Ich glaube nicht mehr an allzu viel Gutes auf diesem Planeten und doch rufe ich ihm, diesem barmherzigen Heiland zu. Und trotz allem was mir widerfahren ist, trotz dessen, dass ich an nichts mehr glauben kann, obwohl ich
so gerne glauben würde…. trotz alledem schlägt mein Herz, trotz allem hofft es. Dieses wunde Herz schlägt zu meiner eigenen Verwunderung immer noch kraftvoll und rhythmisch in meiner achtundvierzig Jahre alten Brust.
Und auch zwölf lange Jahre danach schlägt es jeden Tag, ohne zu wissen, wozu es das tut.
Ein herber Geruch von Rauch kriecht zäh aus dem gusseisernen Kaminofen zu mir herüber. Das trockene Eichenholz knackt und knistert hinter der verrusten Glasscheibe und ist sichtlich bemüht, die eisige Kälte des Vorfrühlings aus dem kaum isolierten Mauerwerk zu vertreiben. Das dort lodernde Feuer wärmt mich nur wenig, aber es sprüht unablässig seine glimmenden, goldweissen Funken das Ofenrohr empor. Nur spärlich hilft der gelb flackernde Schein einer einsamen Glühbirne, die verloren in einer schlichten Fassung von der offenen Holzdecke herunterbaumelt dem Feuer im Ofen dabei, mein kleines Zimmer zu erhellen. Draußen vor dem leicht trüben Fensterglas zerrt in der Dunkelheit der frühen Nacht eine kühle Windbö an den kleinen Astern auf meinem Austrittsbalkon und ein kühler Wind, der scheu vom Rhein herüberweht, rüttelt wieder einmal knarzend an den weißen, seit vielen Jahren nicht mehr behandelten Holzfenstern, während durch einen breiten Schlitz unter der Balkontüre ein frischer Luftzug in meine Wohnung dringt. Trotz des züngelnden Kaminfeuers sitze ich fröstelnd auf meinem grünen Stoffsofa, eingehüllt in einer alten Patchwork-Tagesdecke, mein aufgeklapptes Notebook auf dem Schoss und wehre mich mit einem Glas Whiskey gegen die um sich greifende Kühle. Gedankenverloren schweifen meine müden Augen durch mein kleines Reich, keine fünfzig Quadratmeter groß und doch ein Hort des Friedens und der Ruhe. Hier ist meine Festung. Hier ist mein sicherer Hafen. Mein Blick wendet sich den Instrumenten und Fotographien an der Wand zu, wandert über den Boden auf geleerte Glasflaschen und wirren Stapeln von Papieren, Magazinen und Ordnern zurück zum flimmernden Monitor des Computers vor mir.
Ich lebe nun schon seit gut elf langen Jahren im ersten Stockwerk eines alten Stadthauses in der Oberen Rheingasse in Basel unweit der Mittleren Rheinbrücke.
Das schmale Häuschen mit seinen drei Mietparteien ist kaum breiter als viereinhalb Meter aber ein Kleinod an Historie und Gemütlichkeit. Die hell verputzte Fassade, die hölzernen Sprossenfenster und die alten Dachschindeln geben diesem Schmuckkästchen eine pittoreske Note und dienen dem ein oder anderen Touristen bei ihren Streifzügen durch die Baseler Altstadt als hübsches Fotomotiv. In den Sommermonaten zieren rote Hängegeranien die kleinen Fenstersimse und schenken dem Antlitz des Häuschens ein paar farbige Tupfer. Was für ein Kontrast zum Leben seines ältesten Bewohners, mir! Das enge Treppenhaus stellt jeden hier ein- und ausziehenden Mieter beim Möbeltransport vor besondere Herausforderungen. So werden seit Generationen Schränke und Sessel ausschliesslich über Seilwinden durch die flussseitigen Fenster hinab- und hinaufgeschafft. Der eingeschränkte Komfort des Gebäudes wird mehr als wett gemacht durch die heimelige Atmosphäre des uralten Gemäuers und die exklusive Lage direkt am großen Strom. Ich mag mein bescheidenes aber einladendes Heim, inmitten meiner inzwischen liebgewonnenen neuen Heimat in der Schweizer Grenzstadt.
Außer mir wohnt noch eine ältere Dame im Haus. Die kleine Wohnung im Erdgeschoss beherbergt Pierrette, eine ehemalige französische Journalistin. Früher war sie beim renommierten ´Figaro` verantwortlich für die kulturelle Berichterstattung aus der Schweiz und trägt trotz eines an dieser Stelle zu verheimlichenden, aber gewiss bemerkenswerten Alters selbst daheim meist einen eleganten Hosenanzug und auffallenden Modeschmuck.
Die elegante und gemessen an ihrem geschätzten Alter sehr jugendlich aussehende Dame schminkt sich täglich mit einer Akribie und Selbstverständlichkeit als würde sie sogleich in ihre Redaktion oder zu einer Recherchereise für eine neue Story aufbrechen müssen. Doch ihre aktiven Tage als Kulturreporterin sind schon lange Vergangenheit. Nur noch selten betätigt sie sich als Schreiberin von Leserbriefen an die Basler Zeitung oder die NZZ. Ihre dunkelbraun gefärbten Haare trägt sie in einer mädchenhaft kurzen Frisur und gönnt sich jeden Monat einen ausgiebigen Besuch bei ihrer Kosmetikerin am Spalentor, die ihr die Augenbrauen und den sich ausweitenden Damenbart zupft. Pierrette lebt in ihren zwei Zimmern gemeinsam mit ihrer schon fast vollständig erblindeten Mischlingshündin Jeanne inmitten eines hübschen Ensembles aus alten Möbeln, Bildern, Skulpturen und sonstigen Devotionalien ihres gesamten Lebens, von denen jedes einzelne eine unendlich lange und bewegte Geschichte zu erzählen hat. Neben den teils kitschigen, teils sehr avantgardistischen Gemälden sind die Wände mit so unzähligen Fotos vollgehangen, dass ich nicht beschreiben könnte, welche Tapete sich dahinter verbirgt.
Vor allem die vielen, teilweise schon verblassten schwarz-weiß Aufnahmen zeigen Menschen und Orte, die ihr ganz besonders am Herzen liegen und viel bedeuten müssen. Sie hängt sehr an ihren „Devotionalien“, wie sie die Dinge selber gern bezeichnet. Gelegentlich beobachte ich sie beim Blick durch ihr Fenster, wie sie unbewegt und gedankenverloren vor einem der Bilder steht. Ein Bild scheint es ihr besonders angetan zu haben. Es ist das Bild eines jungen Mannes mit einem Barett auf den lockigen Haaren und einer Flinte in der Hand. Es ist wohl das Bild ihrer großen Liebe, der in Frankreich, während der Nazi-Zeit in der Resistance gekämpft hat und bei La Rochelle aufgegriffen und standrechtlich hingerichtet worden war. Ab und an sieht es so aus als wüsche sie sich eine Träne aus den Augenwinkeln. Jeden Morgen, wenn die Mischlingshündin Jeanne und ihr Frauchen zu einem kurzen Spaziergang das Haus vorderseitig verlassen, bleibt zu hoffen, dass die beiden den Weg auch wieder zurückfinden. Pierrette hat die Alzheimer-Krankheit, allerdings erst in einem sehr frühen Stadium. Sie spricht nicht darüber, aber vor ein paar Monaten, es waren die letzten Tage vor Weihnachten, hatte sie mir bei einem Glas Punsch mit ihrem reizenden französischen Akzent gesagt: „Ich bin dabei die Gegenwart zu verlieren, Monsieur Pierre. Ich verliere das Heute und das Morgen und verirre mich im Gestern. Ich habe das ungute Gefühl, dass sich meine Dimensionen von Zeit und Raum verändern, sich aufblähen und schrumpfen, sämig werden wie heißer Teer und dann wieder strömen wie ein Wasserfall. Irgendetwas passiert da in meinem Kopf, Pierre. Ce qui se passe avec moi, mon Pierre? Die Vergangenheit wird immer grösser und die Gegenwart immer kleiner. Ich werde alt, Pierre. Nein.
Ich bin alt.“, hatte sie damals lächelnd hinzugefügt.
Ich hatte ihr da nur sagen können: „Nein, für mich sind sie jung, Madame. Jünger als sie denken. Bei mir ist das übrigens auch so mit der Zeit. Mir ist die Gegenwart viel zu schnell, als dass ich mir noch irgendetwas merken könnte. Und meine eigene Geschichte, meine Vergangenheit ist so gross, so gewaltig gegenwärtig, dass sie die Gegenwart übertüncht, überlagert und verdrängt. Meine Vergangenheit war aufregend und lebendig, aber meine Gegenwart ist bedeutungsleer, belanglos und langweilig.“ Pierette hatte mich ein weiteres Mal angelächelt und meinet nur: „Ach, was soll’s. Ich habe gelebt, geliebt, gelitten und gelacht. Ich habe gekämpft und verloren, ich habe gestritten und gewonnen. Ich war dem Himmel ganz nah und blickte unzählige Male in den Abgrund. Was darf man mehr erhoffen, als dies? Aber Sie Monsieur Pierre, Sie sind noch jung. Werden Sie lebendig. Leben Sie, Pierre! Lieben Sie! Und bitte, erinnern sie mich bitte jeden Tag- chaque jour - an meine Gegenwart und Zukunft, bitte! D’accord?“. Wieviel Weisheit lag in ihren Worten. Wieviel Lebensfreude und Gnade wohnte in ihrem Herzen. Trotz des spürbaren Fortschreitens ihrer Erkrankung ist mir Pierrette ans Herz gewachsen, ohne dass ich sagen könnte, dass wir uns besonders nahe stehen. Ich bin seit jenen Tagen damals vorsichtig geworden mit Begriffen wie Freund, Kamarad, oder Vertrauter. Aber diese an Demenz leidende und dennoch inspirierende, aktive und mich intellektuell überragende Dame ist für mich ein beneidenswertes Wunder an Energie, Intuition, Wissen und Klugheit. Sie ist mir eine Kameradin geworden, oder wie es die Schweizer sagen würden: eine ´Kollegin`. Obwohl Pierette immer grössere Gedächtnislücken vor allem bezüglich Ereignisse aus der jüngsten Vergangenheit hat, ist ihr Erinnerungsvermögen im Langzeitgedächtnis enorm. Sie hat beispielsweise noch genaue und sehr detaillierte Kenntnisse vom großen Baseler Chemieunfall am ersten November 1986 unweit des Industriegebietes Schweizerhalle, bei dem der ganze Rhein durch kontaminiertes Löschwasser verseucht wurde und der Fluss zu einem so gut wie toten Gewässer verwandelt wurde.
Damals hatte sie sich bei der Recherche zu den Vorgängen als investigative Journalisten einen Namen gemacht, obwohl sie ja eigentlich nur aus dem kulturellen Leben berichten sollte. Sie hatte sich in jenen Tagen aus Betroffenheit über die Weisungen ihrer Vorgesetzten hinweggesetzt und die Unbill einzelner Schweizer Industriekapitäne der Chemiebranche auf sich gezogen. Manch einer hat ihr dieses Engagement zur Sensibilisierung für den Umweltschutz bis heute nicht verziehen. Pointiert kennt sie noch heute Geschichten und Gerüchte aus Politik, Wirtschaft und Kultur in Basel, Bern und Zürich und den anderen dreiundzwanzig Kantonen vom Tessin bis zum Jura, von Graubünden bis ins Waadtland. Sie ist fürwahr eine faszinierende, eine außergewöhnlich Frau, trotz und wegen ihrer Bildung. Wenn sie auch in ihrer Attitüde manchmal etwas eigenwillig, distanziert und teilweise überheblich auf mich wirkt und auch sie nicht ganz ohne die typischen Allüren einer stolzen Pariserin auszukommen scheint, so ist sie mir doch eine angenehme Gesprächspartnerin. In meinen einsamen Stunden lade ich mich gerne selber mit einer Flasche Bordeaux und etwas französischem Käse zu einer ihrer Geschichten ein, auch um mein Versprechen einzulösen, sie an ihre ihre Gegenwart und Zukunft zu erinnern’. Auch wenn sie in den Kriegsjahren mit ihrem Verlobten in der französischen Widerstandsbewegung gekämpft hatte, so ist ihr Widerstand heute gegenüber einem Glas Roten weniger ausgeprägt. So lässt sie sich immer mal wieder gerne auf einen Plausch mit mir ein, was wohl mehr dem Bordeaux und dem Käse zu verdanken ist, als einer besonderen Zuneigung zu mir. Ihr kühle Art ist weniger ein Ausdruck von Überheblichkeit, sondern eher eine bewusste Provokation, die vielen französischen Frauen zu eigen ist. Gelegentlich fällt mir dann beim Wein und den zweifelnden Blick in ihre braunen Augen auf, dass sie angestrengt darüber nachdenkt, wer wohl dieser Fremde ist, der da gerade bei ihr am Küchentisch sitzt.
Schnell helfe ich ihr dann bei ihrer Suche und erzähle etwas von einem tropfenden Wasserhahn, einem neuen Riss im Putz oder einer knarrenden Holzdiele in meiner Wohnung über ihr, um sie nicht bloß zu stellen oder zu beschämen. Madame, wie ich Pierrette meist nenne, hat trotz ihrer auftretenden Gebrechlichkeit und ihrer Alzheimer-Erkrankung nichts von ihrer koketten, unnahbaren und manchmal provozierenden französischen Art eingebüßt. Einmal führte sie mir einen neuen Sommerhut vor, den ihr eine alte Schulfreundin aus Paris als Geschenk geschickt hatte. Es war wundervoll zu sehen, wie sie mir tänzelnd ihre neuste Errungenschaft so mädchenhaft verspielt und doch so elegant und nobel präsentierte, auch wenn sie beinahe über ihre verwirrte und halbblinde Hündin gestolpert wäre. Madame ist mir eine lieb gewordene Bekanntschaft geworden, ohne dass ich hätte sagen können, dass ich dies auch für sie bin.
Außer Pierrette und mir wohnt im Haus oben unter dem Dach noch ein Student aus Berlin, der an der Baseler Universität Graphik und molekulare Biologie studiert, eine spezielle Kombination, wie ich finde. Er ist vor viereinhalb Jahren in die Maisonette Wohnung eingezogen. Unser Kontakt ist eher distanziert, aber freundlich und oberflächlich. Er weiß wahrscheinlich nicht so recht, was er mit diesem kauzigen Rheinländer aus der Wohnung unter ihm anfangen soll. Unsere Welten sind wohl auch zu verschieden und von daher bleiben wir beide stets reserviert. Nur selten höre oder sehe ich David, der wohl Anfang dreißig ist und neben dem Studium scheinbar hauptsächlich laute Computerspiele zu seinem Lebensinhalt erkoren hat. Freitags- und Samstagsnachts frönt er regelmäßig einer weiteren Leidenschaft, nämlich ausschweifenden und vor allem geräuschintensiven Geschlechtsverkehr mit wechselnden Partnern oder Partnerinnen. David gilt sicher hinlänglich als äußerst gutaussehend soweit ich das als Mann beurteilen kann mit seinem sportlichen Körper, den markanten Gesichtszügen und dem stets perfekt frisierten, vollen blonden Haar. Unter der steilen Stirn erstrahlen stahlblaue Augen und auch bei seiner Garderobe überlässt er nichts dem Zufall. Er pflegt einen eigenen Modestil, der auf mich elegant und doch rockig wirkt.
Schwarz scheint seine Lieblingsfarbe zu sein. Zu jugendlichen Jacketts mit Schal oder Tuch trägt er meist lässige feingestreifte Stoffhosen, manchmal mit Hosenträgern und darunter auffällig lässige Westernstiefel. Er schmückt sein Äußeres mit Ringen und Ketten von Thomas Sabo und ähnelt etwas dem Stargeiger David Gerret, wenn er sein schulterlanges Haar zu einem Zopf zusammenbindet. Zufällig hat er auch noch den gleichen Vornamen wie der berühmte Violinist. David ist vom Typ her eher eine Rampensau, den ich mir aufgrund seines Charismas als Lead-Gitarrist in meiner alten Rockband gewünscht hätte. Das ein oder andere Mal fragte mich Madame nach den vielen jungen Männern und Frauen, die am Wochenende im Haus ein und ausgingen. Ich hatte Pierrette von Davids Studien im Bereich Biologie berichtet, ohne mich damit in gewisser Weise vollends schuldig zu machen, die Unwahrheit zu sagen.
David erarbeitet seine biologischen Feldversuche und Echtzeit-Studien Gott-sei-Dank zumindest meistens nur an den Wochenenden, so dass mir Zeit genug bleibt, mich auf meine Arbeit zu konzentrieren, ohne von lautem Gestöhne, Gekreische, Gelächter und Gequietsche abgelenkt zu werden. Ich mag ihn nicht besonders, obwohl er mir keineswegs unsympathisch ist. Im Gegenteil, irgendwie beneide ich ihn um vieles. Vielleicht liegt es eben genau an seiner Vitalität und Unbeschwertheit.
Es wurmt mich sicher irgendwie im Unterbewusstsein, dass er sein Leben so unbekümmert und unverletzt leben kann, frei von Konventionen und allem Ballast des Erlebten. Im Grunde ist er das Gegenteil von mir: offen, zugewandt, lebensfroh und Spaß orientiert. Er lebt im Jetzt, in der Gegenwart. Er ist lebendig, sehr lebendig und mir ist eigentlich insgeheim auch bewusst, dass es nicht David ist, den ich nicht mag. Ich mag mich nicht.
So kreist meine Welt vor allem um sich selbst. So lebe ich ein aufgeräumtes und unaufgeregtes Leben in chronischer Sentimentalität und Melancholie ohne grössere Freuden oder Glücksmomente zu empfinden. Ich bin tot, auch wenn ich lebe und die wenigen belebenden Augenblicke schenken mir meine beiden besten Freunde Jim Beam und Fender Stratocaster, meine alte 72er E-Gitarre. Meinen Lebensunterhalt bestreite ich mit dem Verfassen von Texten. Ich betätige mich erfolglos als Schriftsteller, was mich zwangsläufig nicht ernährt, so dass ich inzwischen freiberuflich in der Werbung als Texter oder sagen wir neudeutsch besser in der abenteuerlichen Welt der Marketingkommunikation und public relations tätig bin. Das klingt spannender als es ist, denn hauptsächlich erarbeite ich einfache Werbetexte, wortspielerische Slogans, und Claims sowie Rundfunkwerbungen als Auftragsarbeiten. Hin und wieder platziere ich sogar mal bei einem Kunden eine ganze Kommunikations-Kampagne, eine eigene musikalische Werbekomposition oder ein Jingle. Dabei verdiene ich sicher nicht üppig wie ein Charlie Harper in der US-
Kultserie ‚Two and a half man’, aber es ernährt mich. Es ist ein hartes und oft undankbares Brot und der Wettbewerb ist auch in der Welt der Kreativen angekommen, aber es sichert mir ein bescheidenes Einkommen, um meinen Lebensunterhalt zu bestreiten und verhilft mir sogar gelegentlich zu so etwas wie beruflicher Zufriedenheit. Eine tiefere Erfüllung oder gar Sinnhaftigkeit in meinem Tun entdecke ich dabei kaum. Nur manchmal in meinen vielen schlaflosen Nächten - und das sind gewiss wohl meine kreativsten Phasen - dann berührt mich etwas, dass mein Herz mit Freude erfüllt. Es ist immer dann, wenn ich das Gefühl habe, meine Seele bei einer Arbeit öffnen zu können. Es sind die Augenblicke, wo ich etwas nicht für meine Auftraggeber schreibe, sondern für mich selbst, für meine Geschichte, für dieses Buch, für meine Seele oder für Anna. Meine Anna. Wo sie wohl gerade sein mag? Inzwischen ist es still geworden vor dem Haus am Oberen Rheinweg. Man hört zu dieser späten Stunde kaum etwas von draußen, außer dem unablässigen Rütteln des Windes an den Fensterläden und Türen und nur ganz leise vom Fluss her das unablässige Fließen des Wassers.
Auch unten auf dem breiten Trottoir ist das Gemurmel der bei Tage so zahlreich hier flanierenden Passanten verstummt. Von meinem Küchenfenster kann ich im Winter, wenn die Lindenbäume ihr dichtes Blattwerk abgelegt haben, hinüber auf die Altstadt von Basel sehen, mit dem imposanten Münster und der fast sechshundert Jahre alten Universität. Doch mein Lieblingsblick gilt dem Fluss. Stundenlang kann ich ihm zusehen, wie seine Wogen und Wellen dem Meer entgegenziehen. Ich mag es den vorbeifahrenden Schiffen hinterherschauen und den permanenten Wandel des Stroms zu folgen. Mal strömt er majestätisch und breit durch die Enge zwischen Groß- und Kleinbasel. Dann ist er satt und träge, gemütlich und zufrieden wie nach einem Festtagsmenü. Wiederum gibt es auch Tage, da zeigt der Fluss ein ganz anderes Gesicht. Dann ist er abweisend und missmutig, fließt braun und bissig unter den fünf innerstädtischen Brücken hindurch. An diesen Tagen wirkt er eher rastlos, ungeduldig und wie ein Getriebener. Ein paar hundert Meter weiter in Höhe von St. Johann wendet sich das Flussbett des Rheins in einem breiten Bogen dem Norden zu, passiert im Industriehafen vor Weil am Rhein das Dreiländereck Schweiz-Deutschland-Frankreich, um dann über zahlreiche Staustufen und durch meine alte Heimatregion rund um Köln zu strömen, um von dort aus majestätisch und erhaben dem Meer entgegen zu fließen. Mit dem Fluss sind oft und viele meiner Gedanken und Erinnerungen in Richtung Aachen und der rheinischen Hauptstadt Colonia Claudia Ara Agrippinensum flussabwärts geflossen. Die eine oder andere Träne ist gelegentlich mit in seinen Wassern unterwegs gen Norden, wenn ich abends auf den Uferstufen sitzend gedankenverloren und weinend in das Wasser starre.
Basel, diese bezaubernde, kleine Schweizer Stadt am großen Fluss ist mir ein gutes, liebevolles Zuhause geworden. Sie ist ein gütiges und freundliches Zuhause für einen Heimatlosen geworden. Für dieses Gefühl bin ich unendlich dankbar. Ich fühle mich sicher und geborgen hier. Einige Wissenschaftler behaupten, Basel sei wohl oder übel eine der gefährlichsten Städte Europas, aber das ist nicht kriminalistisch gemeint. Die Erbebenwahrscheinlichkeit im Rheingraben zwischen Schaffhausen und Saint Louis ist Forschern zufolge enorm hoch und das Stadtgebiet von Basel vermutlich im Epizentrum eines demnächst zu erwartenden gewaltigen Bebens. Nach allem was mir wiederfahren ist, sind diese Aussichten für mich persönlich jedoch keine beunruhigenden Expertisen und Angst einflößende geotektonische Analysen. Ich habe mein eigenes Erdbeben schon gehabt; ich hatte bereits den Boden unter den Füssen verloren, lebe noch immer in den Ruinen meines Schicksals und seine Nachbeben erschüttern mich noch bis in die Gegenwart hinein.
In einer Zeit, in der es keine Verlässlichkeiten und Wahrheiten mehr zu geben scheint, in einer Zeit ohne Rücksicht und Respekt sind die Menschen einander mehr Bedrohung geworden als es die höchsten Amplituden einer nach oben offenen Richterskala jemals sein könnten. Vielleicht genau darum war mir auf meinen Reisen kein Ort am großen Fluss mehr ans Herz gewachsen wie diese historische Stadt, die lange Zeit die deutsche und europäische Geistesgeschichte geprägt hat und die von allen Schweizer Städten wohl die weltoffenste ist, weniger dekadent und fremdenfeindlich als sonst irgendeine im Land der Eidgenossen. Seit Jahrhunderten leben hier Migranten aus aller Herren Länder friedvoll miteinander, dulden einander, tolerieren einander und lernen voneinander. Im doppelten Sinn hat Chemie diese Region reich werden lassen, sowohl die industrielle als auch die zwischenmenschliche. Mein privater Vergleich hinkt gewiss, aber mir war Basel immer ein kleines Köln nur heimeliger und weniger laut und dreckig. Diese idyllische Sicht hatte ich von Beginn an nicht nur wegen der ausgeprägten Fastnachtskulturen ob nun rheinisch-katholisch oder alemannischprotestantisch sondern auch der besonderen Lage am Rhein. Ausserdem entspringt diese Vertrautheit dem friedfertigen, multikulturellen Lebensgefühl, der überall spürbaren Internationalität, einer erlebbaren Toleranz und einer allgegenwärtigen, den Menschen zugewandten Freundlichkeit. Zürich hingegen war mir stets eher ein übersteigertes Düsseldorf, ein suspekter, voyeuristischer Ort, wo es weniger um Sein als um Schein geht, mehr um Materie als um Seele und Geist. So fühle ich mich angekommen in einem bescheidenen Leben in meiner Heimstadt Basel, in meinen kleinen vier Wänden mit den drei keinen Sprossenfenstern. Täglich beobachte ich während der gelegentlichen Arbeitspausen mit einer Tasse Kaffee in der Hand am Küchenfenster stehend die vielen Menschen, die unten auf dem Oberen Rheinweg entlangspazieren. Ich betrachte, wie die Münsterfähre „Leu“ mit ihrem Fährmann Jacques Thurneysen nur die Kraft des Wassers nutzt, um am langen Seil treibend ganz ohne Motorkraft zwischen den beiden Ufern hin und her zu pendeln. Mit einem gönnenden Lächeln und manchmal auch einem Tränen getrübten Auge betrachte ich junge Liebespaare, die unten vor dem Haus Händchen haltend auf einer der Holzbänke verweilen und miteinander schweigen, andere wie sie miteinander kokettieren und hin und wieder andere miteinander streiten oder sich küssen. Jogger und Velofahrer, die sicher nicht ganz uneitel hier ihre körperliche Fitness herzeigen passieren mein Fenster ebenso wie die Alten, die Gebrechlichen und Kranken, die sich überall auf eine der vielen Bänke in einem kleinen Schwätzchen verlieren. In den Sommermonaten, wenn Vater Rhein frisches, klares Wasser durch sein Flussbett schiebt, nutzen viele Baseler aber auch Gäste der Region die Fliesskraft des alten Stroms und lassen sich beim Rheinschwimmen von der Schwarzwaldbrücke an am Klein-Basler-Rheinufer entlang, an den sich sonnenden Studenten auf den Uferterrassen vorbei bis hin zur Dreirosenbrücke treiben. So mancher Unerschrockene stolziert dann in knapper Badehose oder im provokanten Bikini mit einem wasserdichten Schwimmsack für die allerwichtigsten Utensilien ( man nennt diesen Beutel hier ortsüblich nur „s`Fischli“ ) unter den Arm geklemmt an den Restaurants der Promenade vorüber zurück, um sich dieses Vergnügens ein zweites oder auch drittes oder gar viertes Mal zu erfreuen. Dieses legendäre Rheinschwimmen hat eine mehr als tausendjährige Tradition und wird im „Baselbiet“ ebenso gepflegt wie der Pontonier-Sport mit den schweren hölzernen Übersetzbooten, den langen Weidlingen und ihren kraftraubenden Manövern.
Und immer wieder betrachte ich vom kleinen Austrittsbalkon die unentwegten Passagen der kleinen, motorlosen Holzboote über den Rhein. Sie sind mir ganz besonders ans Herz gewachsen, die pittoresken Fähren, die unablässig ihren regelmäßigen Pendelverkehr an vier Stellen zwischen den beiden Stadthälften Klein- und Groß Basel aufrechterhalten solange Strömung und Wasserstand des Flusses es ihnen erlauben. Bis in die späten Abendstunden bringen die „Fährlis“ Touristen und Einheimische, Fremde, Freunde und Liebende in romantischer Langsamkeit von einem Ufer zum anderen.
Auch mich entschleunigt diese kurze Fahrt über den Rhein immer wieder, wenn ich von meinem Domizil aus nach Gross-Basel übersetze. Doch jetzt war es Nacht.
Die Fährleute hatten ihren Betrieb für diesen Tag eingestellt und der noch ungemütliche Wind hüllt die Stadt in eine dunkle Decke der Müdigkeit ein. Ich setze mich wieder hin und starre auf das Display des offenen Notebooks. Auf dem Sofa sitzend blicke ich auf die weiße, unberührte Seite des Word-Dokuments, das darauf wartet meine ersten Buchstaben aufzusammeln. Aber…mir fällt nichts ein. Mein Kopf ist leer, wie so oft in den letzten Wochen. Keine Inspiration, keine Idee, nicht einmal ein Fetzen an sprachlicher Kreativität lässt sich aus meinen Gehirnwindungen herausquetschen. Zu sehr beschäftigt mich meine bevorstehende Reise, zu sehr lenken mich meine Erinnerungen und meine Gefühle ab von der Aufgabe, die ich heute noch vollenden muss.
Dringend sollte ich jetzt mal etwas Brauchbares an den Marketingleiter meines Auftraggebers schicken, aber keine Intuition, kein Einfall will das Weiß vor mir mit schwarzen Lettern füllen.