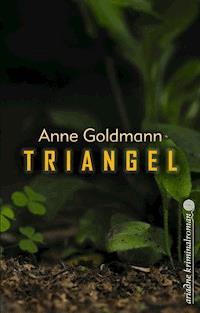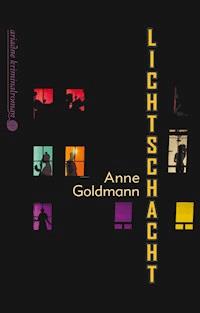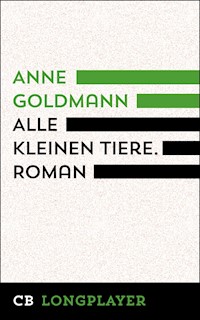
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: CulturBooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Rita fürchtet sich vor Hunden. Ela fürchtet ihre Alpträume. Marisa fürchtet alles Mögliche, aber am meisten ein Leben ohne Liebe. Und Tom fürchtet sich davor, erneut am Pranger zu landen. Vier Menschen, die nicht ganz ins Räderwerk passen, getrieben von Sehnsucht, ertasten sich ihren Weg – bis sie die Bugwelle skrupelloser Akteure erfasst. In Anne Goldmanns neuem Thriller ist die Kälte unserer Welt zu spüren, doch ihre Figuren glühen vor Leben. »Goldmann verdichtet Gedanken und Gefühle zu einem spannenden Plot, einem Gewebe wie Spinnenseide, zart, aber stark.« BücherMagazin
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 397
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Über das Buch
Rita fürchtet sich vor Hunden. Ela fürchtet ihre Alpträume. Marisa fürchtet alles Mögliche, aber am meisten ein Leben ohne Liebe. Und Tom fürchtet sich davor, erneut am Pranger zu landen. Vier Menschen, die nicht ganz ins Räderwerk passen, getrieben von Sehnsucht, ertasten sich ihren Weg – bis sie die Bugwelle skrupelloser Akteure erfasst.
In Anne Goldmanns neuem Thriller ist die Kälte unserer Welt zu spüren, doch ihre Figuren glühen vor Leben.
»Goldmann verdichtet Gedanken und Gefühle zu einem spannenden Plot, einem Gewebe wie Spinnenseide, zart, aber stark.« BücherMagazin
Über die Autorin
Anne Goldmann, geboren 1961, wuchs in einer Kärntner Großfamilie auf. Sie jobbte als Kellnerin, Küchenhilfe und Zimmermädchen, um sich die Ausbildung zur Sozialarbeiterin zu finanzieren. Einige Zeit arbeitete sie in einer Justizanstalt, dann betreute sie viele Jahre lang Straffällige nach der Haft. Sie begann schon früh zu schreiben, gewann zwei Literaturwettbewerbe, veröffentlichte ein paar Texte, verwarf dann alles für längere Zeit und entdeckte erst viel später das Schreiben wieder neu. Für ihre literarischen Thriller Das Leben ist schmutzig, Triangel, Lichtschacht und Das größere Verbrechen erhielt Anne Goldmann hymnische Kritiken, Alle kleinen Tiere
Anne Goldmann
Alle kleinen Tiere
Roman
Impressum
eBook-Ausgabe: © CulturBooks Verlag 2021
Gärtnerstr. 122, 20253 Hamburg
Tel. +4940 31108081, [email protected]
www.culturbooks.de
Alle Rechte vorbehalten
eBook-Herstellung: CulturBooks
Printausgabe: © Argument Verlag 2021
Lektorat: Else Laudan
Erscheinungsdatum: April 2021
ISBN 978-3-95988-194-4
Vorwort von Else Laudan
Eine Krise, hatte Ela irgendwo gelesen, wirkt wie eine Lupe. Sie zeigt dir alles mit übergroßer Deutlichkeit. Das Gute wie das Schlechte.
Unter der Lupe sind hier vier Menschen, die auf unterschiedliche Art in Krisen geraten. Und mit ihrem Ringen im Alltag vergrößert die Lupe das Leben am Rand und inmitten der Großstadt Wien mit ihren Rhythmen und Gesichtern, ihren Institutionen und Traditionen, ihrem scheinbar anonymen Druck.
Anne Goldmann seziert ihre Romanfiguren mit unglaublicher Empathie. Sie legt bloß, wonach sie sich sehnen, was sie aus dem Tritt bringt und wovor sie insgeheim Panik haben. Sie zeigt Narben, die das Leben in Selbst- und Weltwahrnehmung hinterlassen hat. Diese literarische Autopsie ist liebevoll, ohne Blut und Skalpell, völlig frei von Voyeurismus. Sie fällt keinerlei Urteil über die strampelnden, sich im Hamsterrad der modernen Gesellschaft abrackernden Figuren. Figuren, die mir unter die Haut gehen, weil sie so echt sind, brüchig, unzulänglich, vertraut, lebendig, und so intim. Sodass ich mitfiebere, wenn sie sich verstricken, an ihre Grenzen geraten, in die Enge getrieben von einer feindlichen oder auch nur unachtsamen Umgebung.
Anne Goldmanns spezielle Kunst: Die Spannung entsteht nie aus der Frage, wer etwas getan hat, sondern aus der Ungewissheit, was als Nächstes folgt und ob die jeweilige Erzählfigur es schafft, da durchzukommen. Ein Moment des Wartens an der Bushaltestelle kann voller Hoffnung wie voller Schrecken sein.
War da was? Sie wirbelte herum. Ein kleines Tier mit braunem Fell wieselte vorüber und verschwand im Gestrüpp. Ein Marder? Ein Hamster? Ihr Herz klopfte laut. Tom! Sie atmete auf. Trotz der Hitze trug er Jeans und ein weißes Hemd mit langen Ärmeln. Sie winkte. Er ging schneller und hob die Hand. Er geht wie jemand, der sich versteckt, er macht sich klein, dachte sie.
Im Wechselspiel des Erzählten zeigt sich nicht Gut oder Böse, sondern die widersprüchliche, akute Wirklichkeit – subjektiv, mehrdeutig und hochgradig spannend. Das ist für mich Thriller.
Der Hund lag mitten auf dem Gehsteig. Er war weiß-gelb gefleckt, nicht allzu groß, aber kompakt. Es schien, als äugte er zu ihr herüber. Sie sah seine spitzen Zähne und sah ihn grinsen. Hunde waren so. Erst taten sie harmlos, dann schnappten sie zu.
Die Luft sirrte, ihre Wangen brannten. Der Flieder duftete wie verrückt. Sie blieb stehen – gespannt, bereit loszurennen, sobald er den Kopf hob, aber nichts dergleichen geschah. Mit dem Handrücken wischte sie sich den Schweiß von der Stirn und sah sich um. Die Straße lag ruhig da. Rechterhand duckten sich kleine verwitterte Häuser mit selbstgebauten Veranden zwischen kraftlose Sträucher.
Wenn er sie anfiel … Ihr Blick lief die verwilderte Buchsbaumhecke entlang, sprang über den schmalen, von Autos zugeparkten Weg und tastete die gegenüberliegende Seite ab: schlichte, ein Stück von der Straße zurückgesetzte Einfamilienhäuser, blendendes Weiß, Kunststofffenster, die Rollläden geschlossen. Die Fassaden waren, anders als herüben, kühl und zurückhaltend. In den winzigen Gärten verdorrte der ordentlich rasierte Rasen. Einzig das Grün ein Haus weiter hatte die Hitze der letzten Tage überlebt. Das Gartentor war angelehnt, Kinderspielzeug lag herum. Unter dem Giebel gähnte ein offenes Fenster.
Sie atmete aus. Der Hund rührte sich nicht. Er glich einem großen Stofftier, das jemand – ein Kind, dachte sie – verloren hat. Oder über den Zaun gepfeffert im Streit. Schlaff lag er da. Abgefeimt. – Aber nicht mit mir! Sie schob sich näher an die Hecke heran. Ohne ihn aus den Augen zu lassen, bückte sie sich nach einer abgebrochenen Schneestange, die zwischen allerlei angewehtem Unrat lag, begutachtete sie und schwang sie probeweise durch die Luft. Das eine – orangefarbene – Ende war dunkel vor Schmutz.
Abgefeimt. Sie mochte solche Wörter. Tom kannte eine Menge davon. Er erklärte ihr ganz genau, was sie bedeuteten, und wenn er sich nicht sicher war, sahen sie im Internet oder in einem seiner Bücher nach.
Nicht mit mir, Hund! Entschlossen packte sie den Stock fester und zwängte sich zwischen zwei parkenden Autos durch auf die Straße. Sie hörte sich selber atmen und spürte den Schweiß die Wirbelsäule entlang und zwischen ihren Brüsten rieseln. Jetzt war sie mit ihm auf einer Höhe. Aber da kam kein Knurren, kein Fiepen, kein Gebell. Sie linste zwischen zwei Autos durch: Er lag unverändert da.
Hier stimmte etwas nicht! In sicherem Abstand trat sie wieder auf den Gehsteig. Jetzt sah sie ihn von vorn. Unter seinem Kopf hatte sich eine dunkle Pfütze ausgebreitet. Vielleicht war ihm schlecht? Kreislaufprobleme! Es war brütend heiß. Oder ein Auto hatte ihn angefahren …
Auch wenn sie Hunde aus gutem Grund nicht mochte – man konnte ihn unmöglich hier in der prallen Sonne liegen lassen. Sie nagte an ihrer Unterlippe und nahm allen Mut zusammen. Er war matt, geschwächt. Das Risiko hielt sich in Grenzen.
»Hund!«
Nichts.
Fliegen summten.
Langsam ging sie auf ihn zu. Sie blieb stehen und zog die Unterlippe zwischen die Zähne, hob schließlich die Stange und stupste ihn vorsichtig an. »Hund?«
Aus der Nähe betrachtet war er dreifarbig. Er hatte Locken wie sie. Weiße Pfoten, als trüge er kurze, schief sitzende Söckchen. Zögernd, wie in Zeitlupe, schob sie den rechten Fuß vor. Die Schuhspitze berührte sein Fell. Das Bild brannte sich ihr ein: Ein kleines Gesicht mit verspanntem Kiefer, struppige weiße und hellgraue Haare auf dem schlaffen Bauch, darunter das babyblaue Lackleder ihrer Ballerinas, darunter der Asphalt.
Unvermittelt kam Wind auf. Er fuhr ihr unter den Rock, bauschte ihn und schlug ihn ihr gegen die Brust. Energisch strich sie den Stoff nach unten. Marilyn, hatte Tom gesagt, aber sie hieß Rita und sah auch ganz anders aus.
Die gellenden Schreie, der Stoß, die Schläge und Tritte, das Folgetonhorn, Türenschlagen und weiteres Gebrüll – all das geschah innerhalb von Sekunden. Hart schlug sie auf dem Boden auf. Sie riss die Arme vors Gesicht und krümmte sich zusammen. Ein Tritt traf ihre Hüfte. Wimmernd versuchte sie sich wegzudrehen. Dann Staub, Getrampel, blaues flackerndes Licht, schmutzige Schuhe, Uniformhosen – und die trüben, toten Augen des Hundes ganz nah. Die Fliegen summten. Alles tat ihr weh. Der Hund roch aus dem Mund und der Mann über ihr, von zwei Uniformierten nur mit Mühe zurückgehalten, schrie und schrie: »Du Schwein! Du Schwein! Ich bring dich um!«
***
Es war nicht das erste Mal, aber diesmal war alles anders. Die Bestatter hatten rote Gesichter, der Mund der Grabrednerin bewegte sich unablässig, die Sonne brannte herab. Es waren nur wenige, durchwegs ältere Leute gekommen. Sie standen mit gleichmütigen Mienen nebeneinander und wischten sich von Zeit zu Zeit mit ihren Stofftaschentüchern über die Stirn. Ein gelbgesichtiger Mann in einem viel zu weiten dunkelgrauen Sommeranzug lehnte an seinem Rollator. Die Frau hinter ihm, deutlich jünger als er, aber auch schon weit in den Sechzigern, blondiert, mit stumpfen Haarspitzen, schaute verstohlen auf ihre Armbanduhr. Schweißtropfen rollten ihr ins faltige Dekolleté. Ela kannte keinen von ihnen. Der Mann, dessentwegen sie hier zusammengekommen waren, hatte nie jemanden eingeladen und war zuletzt nur noch selten ausgegangen. Auch sein Sohn, der ganz vorne am Grab stand und alle anderen überragte, war in all der Zeit, die sie bei ihm in der Wohnung gelebt hatte, nur zweimal aufgetaucht. Es hatte beide Male mit Streit geendet.
Als hätte er ihren Blick gespürt, wischte er sich jetzt über den Nacken. Wie man Spinnweben wegwischt, dachte sie. Oder ein lästiges Insekt. Er beugte sich zur Seite und flüsterte dem neben ihm Stehenden etwas ins Ohr. Sie sah ihn im Profil: ein attraktiver Mann, gut gekleidet und, wie sich gezeigt hatte, genauso stur wie sein Vater. Er war buchstäblich in letzter Minute in die Aufbahrungshalle gekommen, hatte sich in der ersten Reihe ganz links neben ein älteres Paar gesetzt, sich zweimal nach ihr umgedreht und dann die meiste Zeit auf die Kerzen geschaut, die zu beiden Seiten des Sarges brannten. Die Angehörigen sitzen während der Verabschiedung immer auf der Herzseite des Toten, hatte ihr einmal eine Bestatterin erzählt. Verstohlen zupfte sie ihr Kleid zurecht und wechselte die Blumen, einen kleinen Strauß gekräuselter lilafarbener Nelken, in die andere Hand. Sie roch ihren eigenen Schweiß und presste die Arme eng an den Körper. Der süßliche Geruch der weißen Lilien, der müden gelben Rosen, die an den Rändern bereits bräunten, kam in Wellen. Sie spürte Übelkeit aufsteigen, schluckte mehrmals und befeuchtete sich mit der Zunge die Lippen. Ich sollte nicht hier sein, dachte sie. Es war ein Fehler! Aber wenn sie heute fehlte, würde man sich bestimmt fragen … Das Herz klopfte ihr im Hals. Seit Tagen, seit er tot war, hörte sie ihn jede Nacht durchs Haus gehen, näher kommen, sich wieder entfernen. Hörte ihn atmen. Das war das Schlimmste.
Sie schrak auf. Die Rednerin hatte geendet und war zur Seite getreten. Jetzt kam Bewegung in die kleine Gruppe. Die Trauergäste wichen zurück, die Bestatter schoben den Sarg langsam auf das offene Grab zu. Ela starrte auf die Bretter, die es begrenzten, auf die Rücken der Männer in den grauen Talaren, ihre behandschuhten Hände. Von irgendwoher kam Musik. Sie fühlte sich wie betäubt. Wieder hatte sie den grau-weiß gefliesten Küchenboden vor sich, seine weit aufgerissenen Augen und seine Hand, die … Sie fuhr sich an die Kehle, keuchte und rang nach Luft. Die Fliesen – übersät von dicken Flocken. Wie Schnee … Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zu Staub. Ich sollte nach vorne gehen. Aber sie verharrte reglos, sah den Sarg auf einem Gestell über dem Grab stehen, einen der Bestatter sich nach vorne beugen und an einer Kurbel drehen, sah, wie die schwere Eichentruhe sich langsam senkte und schließlich verschwand. Sie biss sich auf die Knöchel und wimmerte. Schlurfende Schritte pflügten durchs trockene Gras. Gesichter wandten sich ihr zu, verschwammen. Jemand hustete. Wieder und wieder prasselte Erde auf den Sargdeckel hinab. Der Liliengeruch hob ihr den Magen. Sie wankte. Sah seine Augen, weit aufgerissen, starr, die rotblauen Lippen, hörte die Fliegen, das Ticken der Küchenuhr, ein Gurgeln – und schrie.
***
Der kürzeste Weg vom Studio nach Hause führte über den Friedhof. Marisa nickte ihrer Instruktorin, einer sehnigen Mittdreißigerin, zu und warf sich die Sporttasche über die Schulter. Geschafft! Seit sie hierher gewechselt hatte, klappte es wieder mit dem Training. Sie mochte die puristische Ausstattung der Räume, den Verzicht auf jeglichen Schnickschnack wie Sauna, Shop und Saftbar, das konzentrierte Arbeiten an den Maschinen, genau nach Plan. Man kam zwei-, dreimal die Woche, um etwas für seine Fitness zu tun, duschte, grüßte und ging seiner Wege.
Als sie vor die Tür trat, glühte der Asphalt. Sie kniff die Augen zusammen und angelte nach ihrer Sonnenbrille. Überquerte den Parkplatz, eilte die Friedhofsmauer entlang und öffnete das schmiedeeiserne Tor. Der Straßenlärm blieb zurück. Sperlinge tschilpten. Zwischen den Gräbern bewegten sich träge ein paar ältere Frauen. Ein greises Paar saß auf einer der Bänke unter der Linde. Beide waren sorgfältig, aber viel zu warm gekleidet und hielten einander an den Händen. Als Marisa näher kam, blickten sie auf. Die Frau grüßte, der Mann neigte sein Haupt ein wenig zur Seite, als prüfe er das Geräusch ihrer Schritte auf dem Kies. Er lächelte versonnen. Seine Augen waren von einem ganz hellen wässerigen Blau.
Auf Höhe der Aufbahrungshalle bog sie in den asphaltierten Hauptweg ein. Das Tor zum Andachtsraum, in dem die Verabschiedungen stattfanden, war bereits geschlossen. Unter den Bäumen standen drei Bestatter neben einem Leichenwagen. Der vierte, jünger als die anderen, ging leise telefonierend auf und ab. Niemand nahm Notiz von ihr.
Weiter vorne, unter den Birken, war eine kleine Trauergemeinde im Begriff sich aufzulösen. Eine Frau war allein zurückgeblieben. Marisa hätte nicht zu sagen vermocht, ob sie hässlich war – oder schön. Sie trug ein dünnes schwarzes Kleid mit langen Ärmeln, aber keine Strümpfe. Ihre hellen Beine wirkten in ihrer Nacktheit in dieser Umgebung geradezu obszön. Die schmale Gestalt krümmte sich wie unter Krämpfen. Ihre Züge waren vom Heulen dermaßen verzerrt, dass Marisa ein leichter Ekel ankam.
Sie hielten Abstand. Niemand kam zurück, trat zu ihr, legte ihr den Arm um die Schultern. Keiner spendete ihr Trost. Fast unwirsch wandten sich die letzten Trauergäste ab und hasteten auf den Ausgang zu.
Marisa verhielt den Schritt. Wie damals auf der Autobahn – quietschende Bremsen, Glassplitter, ineinander verkeilte Fahrzeuge, die blutende Frau auf der Fahrbahn, die gellend schreit – starrte sie auf die Szene vor sich wie auf ein Naturereignis, das seinen Lauf nimmt und auf eine Katastrophe zusteuert.
Warum hilft denn keiner?
Autos waren vorübergefahren. Gesichter an den Seitenfenstern. Offene Türen, Hupen, Stau. Ein Pulk von Schaulustigen, der rasch anwächst, dichter wird, näher rückt, sich weiter und weiter nach vorne drängt, von der Feuerwehr, den Rettungssanitätern schließlich mit Gewalt beiseitegeschoben werden muss. Und sie, Marisa, inmitten der Gaffer, selber gaffend, ohne was zu tun.
Ihr Atem ging schneller, die Hand fuhr an den Mund.
Was zum Teufel … die war doch gestört! Jetzt lag sie auf den Knien im vertrockneten Gras, neben den Lilien, den Rosen, dem Grün, seltsam verdreht, das Gesicht zur Seite gewandt, als wollte sie sich zu dem Toten legen. Hysterisch! Total hysterisch!
Aber was, wenn ihr übel geworden war?
Ich sollte hingehen.
Und dann? – Ihr aufhelfen? Sie stützen? Von ihrem Elend überschwemmt werden?
Entschlossen packte sie den Griff ihrer Sporttasche fester. Mochte einer der Trauergäste, der sie kannte … Sie drehte sich um. Oder die Bestatter! Der Leichenwagen hatte sich in Bewegung gesetzt und kam langsam auf sie zu. Über der flimmernden Hitze des Asphalts schien er zu schweben. Sie trat zurück ins Gras und ließ ihn passieren. Der Jüngste telefonierte noch immer. Sein Gesicht leuchtete.
Dann ging alles ganz schnell: Der neben dem Fahrer wies nach vorne, der Wagen beschleunigte, bremste, stoppte, die Türen flogen auf. Zwei Männer beugten sich über die Frau, die verwirrt um sich schaute. Einer hob sein Handy ans Ohr und wandte sich ab. Der Jüngste stand da mit hängenden Armen. Als sie ihn ansah, errötete er und senkte den Kopf.
Eine leichte Brise streifte Marisas Nacken. Sie stand wie gebannt, während die Bestatter auf die Fremde einredeten, zu zweit neben ihr in die Hocke gingen, sie stützten und ihr aufhalfen. Ihr Haar hatte sich gelöst und verdeckte das Gesicht. Sie schwankte, strauchelte. Der Fahrer fing sie auf. Jetzt nahmen sie die Männer in die Mitte und führten sie zu einer nahegelegenen Bank. Kurz davor sackte die Frau erneut zusammen. Sie war sehr schlank – Marisa seufzte –, Schlüsselbeine und Hüftknochen stachen deutlich hervor. Das billige schwarze Fähnchen umflatterte ihre nackten Beine.
Eine Staubwolke fegte über den Boden. Der Wind wurde stärker. Er wirbelte Blätter, Plastik und Papierfetzen empor und fuhr ihr ins Gesicht. Das Grüppchen hatte die Bank erreicht, die Frau sank nieder, den Nacken gebeugt. Wieder umringten sie die Männer, ständig die Plätze wechselnd, ein groteskes Ballett in dunklen Uniformen, ganz auf die Fremde konzentriert. Einer kniete sich hin und tastete nach ihrem Puls, ein anderer wedelte mit seinen Handschuhen vor ihrem Gesicht herum.
Der Wind heulte und pfiff in den Zweigen. Er klapperte mit den Türchen der Grablaternen, warf Blumenvasen um und zerwühlte die Baumkronen. Wolken schoben sich ineinander, Vögel taumelten durch die Luft. Der Himmel hatte die Farbe dunkler Tinte. Gleich würde es schütten.
Jetzt hob die Frau den Kopf. Auch die Männer sahen zu Marisa herüber. Hinter ihr, jenseits der Mauer, näherten sich Motorengeräusche. Autos hupten, der unverwechselbare Signalton eines Rettungsfahrzeuges setzte ein. Da endlich riss sie sich los und rannte zum Ausgang. Eine Böe erfasste sie und drückte sie gegen das Gittertor.
***
Rita war den Polizisten dankbar. Sie hatten den Mann mit dem roten Gesicht von ihr weggezerrt, ihn festgehalten, gebändigt und ins Auto verfrachtet. Zu zweit hatten sie auf ihn eingeredet, hatten telefoniert, ihm einen Zettel in die Hand gedrückt, schließlich die hintere Wagentüre wieder geöffnet und ihn weggeschickt. Sie durfte einsteigen. Im Kommissariat hatte eine freundliche Polizistin mit breiten Hüften, deren Atem nach Kaffee roch, notdürftig ihre Wunden versorgt und ein Glas Wasser vor sie hingestellt.
Aber all die Fragen!
»Nein«, bestätigte sie, »ich mag Hunde nicht.« Auf ihrem Kleid war sein Blut. Sie dachte an die Fliegen und an sein trauriges kleines Gesicht und wurde selber traurig. »Aber ich habe ihm nichts getan.« Der Ellbogen war aufgeschürft und brannte, Schulter und Hüfte schmerzten bei jeder Bewegung. »Was geschieht jetzt mit ihm?«
»Dem Mann?«
Sie schüttelte den Kopf. »Dem Hund.«
»Ein bisschen spät, meinen Sie nicht?«, blaffte der hagere Polizist hinter dem zweiten Schreibtisch nahe dem Fenster, der die ganze Zeit abwechselnd aus einer großen Tasse getrunken, in Papieren geblättert und grimmig vor sich hin gestarrt hatte. »Vielleicht fragen Sie sich besser, was jetzt mit Ihnen passiert.«
Rita zuckte die Achseln. Frau Freese würde kommen, ein ernstes Gespräch mit ihr führen und sie in ihrem eigenartig riechenden Auto nach Hause bringen. Aber heute war Samstag und Frau Freese hatte frei! Sie war fast ein wenig erleichtert. »Dauert das hier noch lange?«, wandte sie sich an den dicken Polizisten vor ihr.
Seine Finger verharrten, legten sich wieder auf die Tasten, bewegten sich, zögerten – und tippten weiter. Er schwitzte und roch ein wenig säuerlich. Durch die dünnen Haare konnte sie seine blasse Kopfhaut sehen. Der Scheitel saß knapp über dem linken Ohr. Sie stellte sich vor, wie er schwimmen ging. In einer großen, weiten Badehose, die seinen Bauch bis über den Nabel bedeckte, zögernd und ein bisschen unbeholfen ins Wasser stieg. Sah ihn untertauchen und mit einer Glatze wieder an die Oberfläche kommen, die schlappe Strähne neben ihm treiben wie ein ertrunkenes Tier.
Ihre Mundwinkel zuckten.
»Das kommt ganz auf Sie an.«
Sie schaute in freundliche braune Augen. Sofort hatte sie ein schlechtes Gewissen. Aber es war wie früher in der Kirche: Je mehr sie sich bemühte, ernst zu bleiben, desto stärker wurde der Reiz. Sie nestelte ein Taschentuch hervor und tat, als putze sie sich die Nase. Es half nicht. Die schlappe … Sie prustete los, hielt sich die Hände vor den Mund, krümmte sich … Strähne! Sie röchelte, grunzte, Tränen liefen über ihre Wangen.
»Finden Sie das lustig?« Der dünne Polizist sprang auf und stürzte auf sie zu. Sie wich zurück, fühlte die harte Sessellehne im Rücken – und erstarrte.
»Ein Tier erschlagen! Es totprügeln!«, brüllte er. »Eine säugende Hündin! Das findest du lustig, ja?« Er atmete schwer. »Was bist du nur für ein –«
Rita zog den Kopf zwischen die Schultern. Sie konzentrierte sich auf die Pflanze im Topf direkt hinter den beiden, die ganz neu aussah und glänzte. »Ich habe ihm nichts getan«, flüsterte sie. Ihre Knie zitterten.
»Und die Welpen? Wir haben keine Ahnung, wo die sind. Sollen die jetzt verrecken, oder was? Ohne Milch? Ohne …«
Rita hielt den Atem an. Schnaps! Und ein aggressives Parfum! Der klägliche Versuch zu überdecken, dass er trank. Sie dachte an ihre Mutter. Wie sie sich eingenebelt hatte, jedes Mal, bevor sie aufs Amt gegangen war. Noch einen Schluck getrunken und sich die Zähne geputzt hatte. Riechst du was, Ritalein. Nein, oder? Bei ihrer Rückkehr hatte sie geweint.
»Darauf stehen bis zu zwei Jahre Haft.« Sie starrte auf das Geflecht blauer Linien, das sich von seiner fleischigen Nase über beide Wangen zog. Er hatte mehr und breitere Streifen auf seiner Uniform als ihr Polizist. Das hieß, er hatte hier das Sagen. Ihr Kiefer krampfte.
»Kapierst du das?« Speichel flog von seinen Lippen.
Gleich würde er sie packen und vom Sessel zerren … Sie zog den Hals ein.
»Das heißt Gefängnis!«
»René!«
»Strafdrohung – zwei Jahre. Da kommst du so schnell –«
»René, hör auf!« Die Stimme ihres Polizisten kam von weit her.
»Ich –« Ihre Stimme versagte.
»Da wird dir das Lachen schon vergehen!« Seine Augen waren schmale Schlitze, der Mund hässlich verzogen.
»René!«
Es war sinnlos. Das wusste sie. Wenn einen Säufer erst die Wut packte, schaukelte er sich ohne das Zutun anderer selber hoch und immer höher. Anklagen, Vorwürfe, Selbstmitleid, Drohungen, Hass – all das wechselte sich immer schneller ab. Dann gab es Schläge, Prügel, je nachdem, und dann das heulende Elend, Entschuldigungen, Versprechen – und wieder Schnaps, und … Oma, dachte sie, Oma. Ihre Schultern sanken herab. Sie fühlte nichts.
»Hat er dir nicht leidgetan?«, fragte er jetzt gefährlich leise. »Nein? Wenn dich jemand mit einem Stock …«
Erschrocken riss sie die Arme in die Höhe. Der Schmerz fuhr ihr in die Seite.
Der dicke Polizist sprang auf. »Herrgott, René! Siehst du denn nicht –«
»Dass sie dich verarscht? Die Behinderte spielt? Das Unschuldslamm.« Sein ganzer Schädel glühte. »Ja, Bruno, das sehe ich!«
»Jetzt reiß dich zusammen! Du bist Polizist!«
Aber er war nicht mehr zu halten. »Diese Kreatur! Eine säugende Hündin! Und dann die Unschuld spielen! Ja, genau. Schau nicht so blöd.« Er ballte die Fäuste, sein Brustkorb hob und senkte sich. »Glaub mir, solche wie die stehen mir bis daher!« Er fuhr sich mit der Handkante über den Hals, als wollte er sich die Kehle durchschneiden. »Wenn ich mir vorstelle, dass das mein Arco … Wenn die meinen Schäfer –«
»René, das hat doch …« Der dicke Polizist hob begütigend die Hand, der Hagere schlug sie weg.
Rita wagte nicht zu atmen. Die Männer starrten einander an. Nach einer Weile wandte sich der Rotgesichtige unwirsch ab. Er atmete mehrmals keuchend aus. »Ja, wir sind Polizisten«, knurrte er. »Und keine verdammten Sozialhelfer, die verlässlich auf die Mitleidsmasche hereinfallen« – er wurde lauter – »und den Verbrechern Zucker in den Arsch blasen.« Sie zuckte zusammen, als er mit voller Wucht gegen den Schreibtisch trat. Er schwankte und schrie auf. Einen Moment lang starrte er dumpf vor sich hin, dann humpelte er davon. »Schau, dass du fertig wirst!«, bellte er über die Schulter. Ein Luftzug streifte ihren Nacken, die Tür schlug zu. Jetzt waren sie allein.
Rita hob den Kopf. Ihre Hände bebten.
Der dicke Beamte sah erschöpft aus. »Tut mir leid, Frau Vesely. Der Kollege ist manchmal ein wenig –«
»Er trinkt!« Seltsam, dass einem Polizisten so was nicht auffiel.
Er reagierte nicht. Langsam ging er um den Schreibtisch herum. Sein Sessel ächzte, als er sich niederließ. »Vielleicht …« Er runzelte die Stirn und beugte sich vor. Schweißtropfen rollten über seine Schläfen.
»Ja?«
Er lächelte gequält. »Machen wir weiter! Das Tier ist tot. Der Mann, der uns verständigt hat, sagt, Sie waren allein auf der Straße. Auf der Schneestange ist Blut. Auf Ihrem Kleid auch. Wie soll das da hingekommen sein?« Er redete langsam und sprach jedes Wort übertrieben deutlich aus.
Wahrscheinlich, dachte sie, hört er nicht gut.
»Hatten Sie Angst? Hat er Sie angefallen?«
»Wer?«
»Ob der Hund Sie angefallen hat.«
»Ich war das nicht«, sagte sie sehr laut.
Er musterte sie. Seufzte. »Frau Vesely, so kommen wir nicht weiter. Gehen wir das Ganze noch einmal in Ruhe durch. Sie sagten, Sie wohnen –«
»Ich wohne allein«, unterbrach sie ihn. Sie dachte an ihre schönen Orchideen zu Hause auf der Fensterbank und stellte mit Schrecken fest, dass sie vergessen hatte, sie zu tauchen.
***
Manchmal fragte sich Marisa, ob andere das auch kannten: Das Gefühl, bei fast allem, was man machte, nur so zu tun als ob. Zu schauspielern. Sie saß im Büro über Tabellen, inmitten der Kollegen bei Besprechungen, betrat ein Amtshaus, marschierte mit ihren Unterlagen einen Gang entlang, klopfte an Türen und sah sich dabei zu. Es war ein wenig wie früher als Kind, wenn sie Erwachsensein gespielt hatte. Es hätte sie nicht gewundert, wenn jemand sie lachend enttarnt, ihr die Papiere aus der Hand genommen und sie weggeschickt hätte: Komm, Mädchen, das ist nichts für dich!
Alles war ihr zu groß. Selbst ihr Name.
Auf was für Ideen du immer kommst! Ihre Mutter hatte aufgelacht. Von wem du das wohl hast? Und sich gleich selber die Antwort gegeben: Von mir nicht!
Marisa wusste, dass man sie manchmal für arrogant hielt, weil sie den Kopf hoch trug und immer ein wenig Abstand zu den anderen hielt. Aber die kannten sie nicht. Es gab zwei, drei Ausnahmen. Der Mann, auf den sie gerade wartete, war eine davon.
Die beiden Fenster im noch sparsam möblierten Wohnzimmer standen offen, Vögel lärmten im Innenhof. Irgendwo plärrte ein Fernseher. Sie wanderte durch die Wohnung, setzte sich aufs Sofa, sprang auf und strich ihren Rock glatt. Ging zum Kühlschrank, wieder zurück, verschlang eine halbe Tafel Nussschokolade und putzte sich noch einmal die Zähne. Dann stand sie eine Weile unschlüssig vor dem Kleiderkasten im Schlafzimmer, zerrte sich schließlich den Rock über die Hüften und schlüpfte in das rote Kleid, das sie extra für ihn gekauft, aber noch nie getragen hatte, weil sie sich darin halb nackt fühlte. Als endlich die Klingel der Gegensprechanlage anschlug, läutete auch das Telefon.
Sie öffnete ihm barfuß, das Handy am Ohr. Er trat ein, legte den Kopf schief, machte schmale Augen, lächelte und zog sie in seine Arme. Er verfehlte ihren Mund, weil sie genau in dem Moment den Kopf zur Seite drehte. »Ja, Frau Niedeck, kein Problem.« Mit einer kleinen Drehung löste sie sich aus seiner Umarmung und deutete ihm mit einer Handbewegung, er möge ins Wohnzimmer weitergehen. »Ich kümmere mich darum. Mailen Sie mir die Unterlagen. Ja, klar. Nein, mach ich. Gern. Ja, bis Montag.« Ihr Lächeln fiel in sich zusammen.
»Job?« Er trat hinter sie. Sie wandte sich ihm zu, streckte sich und legte die Arme um seinen Nacken. Sie schloss die Augen. Er roch so gut! Sie duschte nie, nachdem sie zusammen gewesen waren, weil sie es mochte, mit seinem Geruch einzuschlafen und wieder wach zu werden. Er lachte darüber, aber sie wusste, dass es ihm gefiel.
»Ja. – Willst du etwas trinken? Ich habe –«
Er küsste sie. »Komm«, murmelte er mit einer Stimme, ein wenig dunkler und kehliger als sonst, mit einem Hauch von Atemlosigkeit. Damit hatte er sie damals geknackt.
»Ich weiß nicht. Ich …«
Er zog sie mit sich, als hätte sie nichts gesagt, beugte sich zu ihr herunter, küsste sie erneut, fordernder jetzt, und streifte ihr die schmalen Träger ihres Kleids über die Schultern. Seine Hände tasteten nach dem Zipp.
Sie räusperte sich. »Ich habe heute auf dem Friedhof eine Frau gesehen, die hat dermaßen geweint … Sie war ganz aufgelöst. – Noch nie habe ich jemanden so weinen sehen.«
Seine Lippen wanderten über ihren Hals zum linken Ohr, die Hände glitten über ihren Rücken, schoben das Kleid nach oben und kamen auf ihrem Hintern zu liegen. »Hmmmm.« Er presste sich an sie und knetete unter dem Slip ihre Pobacken. »Ich habe dich so vermisst. Schon den ganzen Nachmittag habe ich mir vorgestellt …«
Marisa sah sich zu, wie sie seinen Bewegungen antwortete, sich fügte, und zum ersten Mal dachte sie, dass es ihm gar nicht um sie ging.
Im Schlafzimmer kam er sofort zur Sache. Sie schloss die Augen und bewegte sich mit ihm, dachte an das alte Paar auf der Bank, an die Frau mit dem Gesicht im Gras, die Rosen, die Lilien, das Grün, atmete lauter, als er zu keuchen begann und härter in sie stieß, und wartete darauf, dass er mit einem leisen Grunzen auf sie fiel.
Sie lagen nebeneinander und schwiegen. Sie blickte zur Decke, wo Sonnenkringel miteinander spielten. Er streichelte ihren Arm.
»Du bist heute nicht –«
»Nein.«
Er rückte näher und drängte seine rechte Hand zwischen ihre Schenkel.
Sie schob sie weg. »Die Frau …«, sagte sie nach einer Weile.
»Welche Frau?« Er hatte keine Ahnung, wovon sie sprach.
»Komm her.«
Sie zögerte. »Du, wenn mir etwas zustoßen würde –«
»Was soll dir denn zustoßen?« Sofort rückte er ein Stück von ihr ab. »Es ist doch alles okay, oder? Hast du … bist du krank?« Jetzt war er alarmiert.
»Nein.« Sie verzog den Mund zu einem schmalen Lächeln. »Alles gut. Ich frage mich nur: Würdest du um mich … würdest du mich vermissen?«
»Klar.« Er lachte erleichtert. »Das weißt du doch, Liebes! Alles. Jede einzelne Stunde mit dir.« Seine Augen verengten sich. »Was hast du?«
»Nichts.« Sie machte sich los. Setzte sich auf, bückte sich nach ihrem Kleid und streifte es über.
»Was hast du?«, wiederholte er. »Was ist los?« Er klang genervt.
Der Reißverschluss klemmte. Sie zerrte daran, er ruckte, verbiss sich tiefer in den Stoff, sie gab auf. »Nichts. Ich hol mir was zu trinken. Willst du auch –?«
Die Matratze federte. »Nein danke. Ich gehe duschen.«
Sie erstarrte in der Bewegung. »Jetzt schon? Ich dachte –«
»Ich muss heute früher zu Hause sein. Wir haben Gäste.« Er mied ihren Blick.
»Ach so«, sagte sie. »Verstehe.« Die Enttäuschung mauerte ihr den Hals zu.
Mit zwei, drei Schritten war er bei ihr. »Du machst jetzt kein Drama draus, Liebes?« Wie in einem dieser blöden Filme, die ihre Mutter sich immer ansah, wenn sie nicht schlafen konnte, umfasste er ihr Kinn und zwang sie, zu ihm aufzuschauen. Sein Blick war sanft und besorgt wie damals auf der Autobahn, als er sie aus dem Getümmel zu ihrem Auto gelotst hatte. »Hey … nicht weinen, Kleines. Wir sehen uns ja wieder. Und bald …«
Sie schniefte und hasste sich dafür.
»Mach es mir nicht noch schwerer. Du weißt doch …«
Sie nickte und blinzelte. Er drückte sie an sich und tätschelte ihren Hinterkopf.
Als er ihr später, schon im Auto, eine kurze Nachricht schickte, saß sie mit dem Laptop auf den Knien auf dem Sofa und stopfte die restliche Schokolade in sich hinein.
***
Rita schaute an sich hinab. Ihr schönes neues Kleid war steif vom eingetrockneten Blut. Es stank. Wahrscheinlich musste sie es wegwerfen. Der Beamte korrigierte schon wieder irgendwas, und sie hatte langsam genug. Weil es bei Tom immer Kaffee und Kuchen gab, hatte sie nur eine Kleinigkeit zu Mittag gegessen. Und seitdem, seit mehr als vier Stunden, nichts getrunken als ein Glas Wasser! Entschlossen griff sie nach dem Riemen ihrer Tasche, Lackleder, kaum größer als ein Portemonnaie, und schob den Holzsessel zurück.
Es reicht!
Sie musste dringend aufs Klo. Eine Telefonzelle finden, Tom anrufen. Und etwas essen. Zu dumm, dass sie das Handy zu Hause vergessen hatte! »Ich gehe jetzt«, sagte sie laut. »Auf Wiedersehen.«
Der Polizist hob die Hand. »Frau Vesely, wir sind noch nicht fertig. Sie müssen noch das Protokoll durchlesen. Und dann unterschreiben.«
Sie schob die Unterlippe vor.
»Ich kann es Ihnen vorlesen«, bot er an.
»Nein!« Frau Freese hatte ihr eingeschärft, nichts zu unterschreiben. Auf keinen Fall, nirgends, egal, was die Leute sagen, wie nett sie sind und was sie dir versprechen. Hörst du, Rita, du musst das nicht tun! Das hat Zeit. Du bringst das Papier mit. Ich schau es mir an, und wenn es in Ordnung ist …
In diesem Punkt hatte Frau Freese recht: Jede einzelne Unterschrift in den letzten beiden Jahren, seit sie allein wohnte, hatte ihr Ärger eingebracht. Und das hier sah auch danach aus.
»Frau Vesely, bitte setzen Sie sich. Wir sind gleich fertig.« Der Drucker ratterte.
Sie blieb stehen und verschränkte die Arme vor der Brust. »Sie haben gesagt, ich muss nicht unterschreiben«, sagte sie mit fester Stimme. »Ich darf …« Auch die Tasche hatte etwas abgekriegt. Mit einem einigermaßen sauberen Zipfel ihres Kleides polierte sie die glatte Oberfläche. Schon besser, aber ohne Spucke …
»Warten Sie«, sagte er. Hatte er sie nicht gehört? »Ich gebe Ihnen einen Ausdruck. Sie lesen ihn in Ruhe durch …« Er wedelte mit ein paar Zetteln.
Ihre Blase drückte. Sie presste die Beine zusammen. Wenn sie nicht gleich …
»Frau Vesely!«
Aber da war sie schon bei der Tür, riss sie auf – und rannte dem zornigen Polizisten direkt in die Arme. Er packte sie grob. Sie schrie auf.
»Moooooment! Wohin so schnell?« Er hatte nachgetankt! »Niederschrift fertig?«, bellte er über ihre Schulter. Rita wand sich, aber er war stark. »So. Schluss jetzt mit dem Theater!«
»Lassen Sie mich los. Sie dürfen das gar nicht! Sie sind nicht … befugt.« Sie holte Luft. »Sie überschreiten Ihre … Kompetenzen.«
Der Mann lachte auf. »Nicht befugt! Kompetenzen! – Interessant.« Er löste den Griff und umklammerte Sekunden später ihre Handgelenke. Seine knochige Hüfte presste sich an ihren Bauch. Rita erstarrte.
Niemand darf dich anfassen, wenn du das nicht willst, hörst du, Rita. Niemand hat das Recht, gegen deinen Willen …
Ihr Mund war trocken. »Loslassen! Sofort!«, stammelte sie. »Wenn Sie nicht gleich … Ich muss –«
»Gar nichts musst du!«
Sie versuchte, ihm ihre Arme zu entwinden. »Lass mich los!«
»Das hättest du dir vorher –«
Da hob sie das rechte Bein und holte Schwung. Erwischte ihn mit dem flachen Absatz am Knöchel und rutschte ab. Er brüllte auf und drehte ihr mit einer raschen Bewegung die Hände auf den Rücken. Sie sog die Luft zwischen die Zähne und ging in die Knie. Der Schmerz trieb ihr Tränen in die Augen.
»Das hat sich ausgezahlt«, zischte er an ihrem Ohr. Seine Ausdünstungen hoben ihr den Magen. »Widerstand gegen die Staatsgewalt. Du weißt, was darauf steht?«
»Ich will nach Hause«, flehte sie.
Erst jetzt sah sie ihren Polizisten. Er bückte sich umständlich nach ihrer Tasche und richtete sich schnaufend wieder auf. »Kinderl, was haben Sie sich denn dabei gedacht?«
»Die ist verrückt«, keuchte der andere. »Du mit deinem … Geh weg, Bruno, ich mach das schon.«
Rita schrie auf, als er ihre Arme auf dem Rücken nach oben drückte.
»Wir werden keine Handfesseln brauchen. Aber die – Dame soll sich erst einmal beruhigen. – Nein, die Tasche bleibt hier.« Energisch schob er sie auf den Gang. Ihre Blase war zum Platzen gespannt. Alles, nur das nicht!, dachte sie. Nicht hier vor allen Leuten!
Uniformierte kamen ihnen entgegen, Männer, eine Frau. Irgendeiner musste doch … »Hilfe! Helfen Sie mir! Hilfe!« Niemand reagierte. Einer lachte.
»Iris!«, rief der Polizist, während er sie weiterzerrte. Eine blonde Frau mit Zopf löste sich aus der Gruppe, machte kehrt und ging neben ihnen her. Sie war noch sehr jung. Ihre Schuhe knirschten bei jedem Schritt.
»Bitte«, flüsterte Rita. »Ich habe nichts …« Aber da ging es schon im Laufschritt die Stiege hinunter. Der Schweiß brach ihr aus allen Poren. »Hilfe!« Sie stolperte und wurde hochgerissen. Zwiebel- und Oreganogerüche strömten ihr entgegen. Ein weiterer, jetzt schmälerer Korridor, noch immer kein Mensch zu sehen, an einem leeren Büro vorbei, in dem ein Karton mit Pizzaresten auf dem Schreibtisch lag, Bildschirme flimmerten, dann nach rechts. Ein Schlüsselbund klirrte, sie wurde in einen stickigen Raum geschoben und die schwere Türe schlug hinter ihr zu.
Rita stand wie betäubt.
Sie hätte später nicht mehr zu sagen vermocht, wie lange sie so dagestanden war, die Knie gebeugt, mit dem Rücken an die schwere Stahltüre gelehnt, hechelnd, ein dumpfes Wummern in den Ohren. Irgendwann begannen ihre Knie zu zittern, ihr Mund war wie ausgedörrt, ihre Hände flatterten. Langsam hob sie den Kopf und richtete sich auf. Ihre Blase schmerzte. Sie stieß die Tür zum Nassraum auf und prallte zurück. Pissoirgestank schlug ihr entgegen, die scheußlich warme Luft stand unbewegt wie eine Wand. Sie hob den Rock und zerrte sich den Slip hinunter. Das WC war aus Metall und völlig versaut, der Deckel fehlte. Vorsichtig ging sie in die Hocke und drückte die rechte Hand gegen den Bauch. Nur nirgends anstreifen! Der verschmierte Fliesenboden unter ihr war feucht, dicke Silberfischchen huschten davon. Die Tür war einen Spalt weit offen geblieben. Dahinter lag eine schmutzig graue Wand, übersät mit einzelnen Wörtern und derben Zeichnungen. Sie krümmte sich. In ihrem Becken, dort, wo ihre Blase war, lag eine Kugel aus Beton, die zunehmend größer zu werden schien. Es tat so weh! Draußen ratterte etwas vorbei – sie zuckte hoch –, dann war es wieder still. Ihre Schenkel krampften, Tränen schossen ihr in die Augen. Wie lange hockte sie schon da? Fünf Minuten? Eine Viertelstunde? Ihr Herz raste. Panik fiel sie an. Was, wenn ihre Blase platzte? Konnte man daran sterben? Stöhnend erhob sie sich – und rutschte aus. Sie taumelte, ruderte mit den Armen und knallte gegen die geflieste Wand. Der Schmerz nahm ihr den Atem. Was … war das Blut? Schmutz? Ihre Nasenflügel zogen sich zusammen. Kot? Sie würgte und spreizte den Arm ab.
Das Waschbecken hing neben der Tür. Wasser spritzte hoch und wirbelte in den Abfluss. Hinter der dünnen Wand gurgelte, schmatzte und gluckste es in den Rohren und machte alles nur noch schlimmer. Ein kalter, harter Strahl spülte die bräunliche Paste weg. Sie rieb und schrubbte, bis die Haut nahezu taub war. Dann schüttelte sie das Wasser von den Armen und schloss mit einem Ruck die Tür.
Wieder kauerte sie über der Klomuschel und massierte sich den Bauch. Sie summte, zählte bis hundert und zurück, versuchte an etwas anderes zu denken, aber es half nicht. Oma, dachte sie, Oma! Ihr Kinn bebte. Wie sie mich gehalten hat. Getröstet. Auch, als ich schon groß war: Alles gut, Rita, alles gut. Sie hätte gewusst, was zu tun war. So schnell stirbt man nicht.
Schritte tappten über ihr und stoppten. Die Leitung pfiff, ein Wasserschwall schoss direkt hinter ihr mit einem Donnern in die Tiefe. Sie plumpste auf den Sitz, ihr Atem floss, das Wasser rauschte, spritzte hoch, Uringeruch stieg auf. Und langsam, langsam löste sich der Schmerz.
Nur nicht sitzen, nur nicht denken! Rita bleibt stehen. Trabt wieder los. Sieben Schritte sind es bis zum Fenster. Und knappe fünf von Wand zu Wand. Sie klopft gegen die Tür. Sie weint. Die rechte Seite ist ganz straff und heiß und prall. Sie hebt den Rock, betastet ihre Hüfte. Und wieder klopft sie, lauscht. Sie fleht. Sie schreit. »Der Hund, das war ich nicht!« Und: »Hilfe! Helft mir doch! Ich habe ihm nichts getan!« Die Hitze flimmert, alles tut ihr weh. Sie rennt zum Fenster. »Hilfe! Hört mich denn niemand? Lasst mich raus.«
»He, willst du ficken?«, grölt da einer aus dem Hof. Ein raues Lachen folgt. Ein Echo wiehert laut.
Bestürzt springt sie zurück, macht kehrt. Lehnt an der Wand. Die ganze rechte Seite pocht. Da ist ein Tisch. Ein Sessel, festgeschraubt. Und Gitter. Sichtschutzglas. Ihr Atem fliegt. Und rechts, da steht ein Bett. Ein Bett! Das ist kein Warteraum! Zwei Jahre, hat der Polizist gesagt.Zwei Jahre! Rita keucht. Das kann ich nicht, das halte ich nicht aus! Vor dem gekippten Fenster gurren Tauben. Stimmen steigen aus dem Hof, und einer lacht. Ein Auto startet und fährt los.
Sie sinkt aufs Bett. Steht wieder auf. Erklimmt den Tisch. Hört jemand grölen, gegen Gitterstäbe schlagen. Ein Klatschen hallt. Und Vögel fliegen auf. Dann setzt das Gurren, setzt das Trippeln wieder ein. Und keiner draußen weiß … Frau Freese, Tom … Das Kleid klebt ihr am Körper. Sie steigt vom Tisch. Sie tritt gegen die Tür, rutscht ab und flucht. Sie ballt die Faust und trommelt wild dagegen, wartet, horcht.
Alles bleibt still. Sie schluchzt. Die Tauben girren.
Niemand kommt.
***
Die Sonne stand schon tief und spiegelte sich in den Fensterscheiben, der Himmel leuchtete flammend rot. Der Wind hatte die Wolken verblasen, es war immer noch drückend heiß. Tom Kralik schaltete die Kaffeemaschine aus und schüttete die bitter gewordene Brühe in den Ausguss. Der Raum war wie aus der Zeit gefallen: abgetretenes Linoleum, Vorhänge mit bunten Ovalen auf beigem Grund, ein röchelnder Kühlschrank, die Küchenzeile in sanftem Pastell und viel zu niedrig für ihn. Tief gebeugt spülte er die bauchige Kanne ab und ließ Wasser nachlaufen, bis das Becken wieder glänzte. Rita würde nicht mehr kommen.
Ich hätte es ihr nicht sagen dürfen!
Was zum Teufel hatte er erwartet? Sie hatte ihn angelächelt wie davor, hier in dieser Küche, später im Wohnzimmer, aber es war nicht mehr dasselbe. Er war nicht mehr derselbe. In ihren Augen.
Er stapelte die Tassen und Untertassen, weiß mit gewelltem Goldrand, auf die beiden Kuchenteller, legte die hellen Stoffservietten übereinander und stützte sich auf dem Tisch ab.
Er tat sich schwer mit Menschen. Immer schon. Es war mit den Jahren nicht besser geworden – im Gegenteil: Was anderen leichtfiel – mit jemandem ins Gespräch zu kommen, zu plaudern, Höflichkeiten auszutauschen –, trieb ihm jedes Mal den Schweiß auf die Stirn. Sie kamen ihm viel zu schnell viel zu nahe. Den meisten von ihnen gebrach es an Takt. Er wusste, was man von ihm erwartete. Er bemühte sich, lächelte, nickte, wenn das Gegenüber zu reden anhob, aber ein Teil von ihm war längst anderswo. Früher hatte ihm das Ermahnungen eingetragen. Von Lehrern, von Verwandten. Gelächter und Rippenstöße von anderen Kindern. Prügel auch. Schon als Kind war er ein Einzelgänger gewesen, ein schmächtiges Kerlchen, das mit vierzehn plötzlich in die Höhe geschossen war, oft genug Zielscheibe übler Scherze seiner robusteren Umgebung. Einer, der sich in dicke Wälzer vergraben hatte und am Ende des Sommers so blass gewesen war wie am Beginn der großen Ferien. Dennoch hatte er schlechte Noten nach Hause gebracht, zweimal die Lehre abgebrochen, und es hatte letztlich nur für eine Anstellung als Busfahrer gereicht. Jahrelang hatte er Schulkinder, Lehrlinge, Pensionisten und brave Arbeitnehmer quer durch die Stadt und im Laufe des Tages wieder zurück chauffiert. Hatte mittags ohne große Lust eines der Billigblättchen überflogen, die überall im Pausenraum herumlagen, sein Jausenbrot gekaut und gequält den Mund verzogen, wenn die Kollegen über ihre eigenen derben Witze lachten. Die anderen Fahrer hatten bald das Interesse an ihm verloren. Ein junger Kollege, der mit seinen Frauengeschichten prahlte, war zur Zielscheibe ihrer rauen Scherze geworden, und Tom hatte aufgeatmet, bis dann die Schmierblätter über ihn berichteten. Mit Balkenlettern auf den Titelseiten. Als die Kriminaler ihn in der Dienststelle abholten, war er unter den Blicken der anderen Fahrer durch die Gasse, die sich vor ihnen auftat, hinausgestolpert. Wie ein geprügelter Hund. Mit gesenktem Kopf, als wäre das Urteil bereits gesprochen.
Tom wischte sich über die Stirn. Er sah Rita vor sich, wie sie ihr Kleid, den weiten Rock sorgfältig glattstrich, bevor sie sich niederließ. Die viel zu roten Lippen, die Spange im Haar – ein Versuch, sich für ihn hübsch zu machen, der ihn rührte. Im Supermarkt hatte sie Jeans und Sneakers getragen und viel jünger ausgesehen.
Ich hätte es ihr nicht sagen dürfen!
Und deswegen hast du deine Arbeit …?
Ja. Mit gesenktem Kopf.
Wie sie sich zu ihm herüberbeugt. Ihre Kinderhand auf seiner. Aber du hast …? Eine steile Falte zwischen den verschiedenfarbigen Augen – links blau, rechts grün –, die ihn immer noch irritierten, der leicht geöffnete Mund.
Er schloss die Augen.
Nein. Nein! Rita, du musst mir glauben.
Aber wieso, Tom? Fast flehend. Du hättest doch einfach –
Ja, hätte ich.
Er schlug die Hände vors Gesicht. Sie hatte ihn gemocht. Er hätte Geduld haben, abwarten müssen, bis sie einander besser kannten. Sie hatte ihn angesehen. Genickt. Von etwas anderem gesprochen. Sie war genauso lange geblieben wie sonst auch. Hatte sich am Gartentor noch einmal umgedreht und ihm gewunken, wie sie das immer tat. Er hatte ihr nachgesehen und gewusst: Sie wird nicht mehr kommen. Es war vorbei.
***
Die Sonne war weitergewandert und lag jetzt auf der Fassade. Rita hatte aufgegeben. Mittlerweile glühte der Haftraum wie ein Backofen. Sie fühlte sich matt, ihre Haut glänzte, der Puls wummerte dumpf in ihren Ohren. Sie dachte an die Hündin. Hatten die Polizisten sie dort liegen lassen? Sie weggebracht? Die kleinen Hunde würden sterben. Sie kämpfte mit den Tränen. Wer tat so was? Sie biss sich auf die Knöchel. Aus jetzt! Genug! Das tat nur weh. Vielleicht waren sie ja unter ein Auto gekrochen und suchten jetzt nach ihr … Jemand wird sie gefunden haben. Einer der Ausflügler, ein Nachbar. Ganz bestimmt.
Im Nassraum ließ sie Wasser über ihre Unterarme laufen. Sie trank und kühlte sich den Nacken. Das Kleid war steif vom Blut. Ihr Lieblingskleid! Sie nagte an der Unterlippe, dann löste sie den Gürtel, hob den Rock und beugte sich über das Waschbecken. Sie rieb und wrang und spülte, das Wasser färbte sich und wurde wieder hell. Der Abfluss schluckte widerstrebend. Sie sah an sich hinab. Verzweiflung fiel sie an. Ein knittrig-rauer Fetzen klebte nass an ihren Schenkeln. Die Flecken waren nach wie vor zu sehen, die Ränder flossen ineinander. Der Reißverschluss blockierte. Ratschte. Sie zerrte sich das Kleid über den Kopf, seifte, wusch und spülte, bis ihr Nacken krampfte. Stöhnend richtete sie sich auf. Sie hob das Kleid und schwang es aus. Und jetzt? Im ganzen Raum fand sich kein Haken! Auch in der Zelle – nichts.
Sie legte den Kopf schief und überlegte. Das Fenster! Wenn sie es schaffte, den schmalen Gürtel durch den oberen Spalt außen um ein paar Gitterstäbe zu führen, durch die Armausschnitte – und dann zu verknoten … Das war nicht schlechter als ein Bügel! Entschlossen legte sie das Kleid zur Seite und erklomm den Tisch. Hüfte und Schultern jaulten auf.
Zwei Anläufe scheiterten. Vorsichtig stellte sie sich auf die Zehenspitzen und probierte es erneut. Ihre Finger umklammerten einen der Längsstäbe, die Schulter tobte. Ihr war flau. BH und Höschen klebten ihr am Leib. Mit einer Hand zog sie am Gürtel. Zwei, drei Streben, vier … Geschafft! Die losen Enden baumelten in Schulterhöhe über dem Tisch. Sie zog daran und nahm sie zusammen. Schlüssel klirrten, die Tür flog auf. Rita fuhr herum.
»Nein!«
»Verdammt!« Hektik brach aus. Zwei Polizisten stürmten auf sie zu und holten sie vom Tisch. Sie wimmerte.
»Warum um Himmels willen …?«
»Alles okay?«
Sie stöhnte, hielt sich den Arm. »Ich will nicht –«
»Warum hat sie sich ausgezogen? Und wo ist ihr Kleid?« Die Polizistin mit der dunklen Stimme deutete auf den Gürtel, den sie heruntergerissen hatte und umklammert hielt. »Geben Sie mir das!« Hektisch schaute sie um sich. »Warum zum Teufel ist sie hier? Und wer, verdammt –?«
»Ich glaube, dass René –«
Sie öffnete die Faust. Der Gürtel fiel zu Boden.
»Und warum sagt mir keiner was?« Die Polizistin bückte sich und richtete sich ächzend wieder auf. Zwischen ihren schmal gezupften Brauen stand eine steile Falte. »Ihr könnt sie nicht einfach hier einstellen. Was hat er sich dabei gedacht?« Sie rollte den Gürtel um ihre linke Hand und wickelte ihn wieder ab. Ihre Lippen wurden schmal. »Wo ist er jetzt?«
»Vom Dienst abgetreten. Hat sich krankgemeldet«, sagte eine junge Stimme von der Tür her. »Er sagt, sie hat ihn am Bein verletzt.«
Sie redeten, als wäre sie nicht hier! »Das stimmt nicht«, protestierte Rita, aber niemand beachtete sie.
»Wird wahrscheinlich die ganze nächste Woche im Krankenstand sein.«
Der Polizist inspizierte jetzt das Fenster. »Wieso machst du das?« Er kam näher und starrte ihr auf die Schenkel. Verärgert drehte sie sich weg.
»Du lieber Himmel, da schaut’s aus!« Die mit der dunklen Stimme kam aus dem Nassraum gestürmt. »Alles schwimmt!« Sie hielt Rita das versaute Kleid vor die Nase. »Was soll die Sauerei?«, fuhr sie sie an.
Rita riss die Arme hoch und fror ein. Die Zeit schien stillzustehen. Jetzt sahen sie einander an. Sie atmeten im gleichen Takt. Die Polizistin öffnete den Mund: »Es tut mir leid. Ich wollte nicht …«
»Okay.«
Sie nickte. Dann winkte sie ihren Kollegen zu sich und hielt ihm den tropfenden Fetzen hin. »Leg das ins Waschbecken!«
Widerwillig nahm er das Kleid entgegen. Wasser lief seine Beine entlang, die Uniformhose färbte sich dunkel. Als ob … Rita hielt sich die Hand vor den Mund.
»Lachst du?«
»Nein!« Erschrocken starrte sie ihn an. Ihr Magen krampfte.
»Bist du noch immer da? Jetzt hol ihr was zum Anziehen!«
»Du willst sie gehen lassen? In dem Zustand?«, protestierte er.