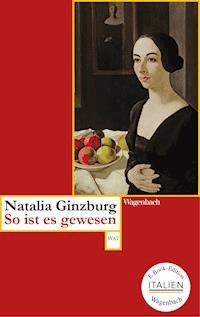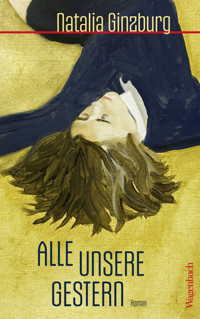
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Klaus Wagenbach
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Keiner nimmt Anna, die Jüngste der Familie, ernst: weder die beiden älteren Brüder, die sich mit Freunden im Wohnzimmer einschließen, um zu diskutieren, noch die Schwester Concettina, die vor allem ihre zahlreichen Verlobten im Kopf hat. Auch Signora Maria, die Haushälterin mit den winzigen Schleifenschühchen, kümmert sich mehr um die Rosen als um das Mädchen. Nur der ein bisschen großmäulige Nachbarjunge Giuma gibt sich mit Anna ab. Sie gehen miteinander spazieren, dann ins ›Pariser Café‹ und später in die Büsche am Fluss. Als einer der Freunde verhaftet wird, müssen die Broschüren gegen Mussolini eilig im Kamin verbrannt werden. Italien tritt in den Krieg ein, der älteste Bruder, ein überzeugter Pazifist, soll eingezogen werden. Concettina verliebt sich in ein Schwarzhemd – und Anna wird schwanger. Natalia Ginzburg erzählt von den kleinen wie großen Ereignissen genau und fast beiläufig: Was, wenn es keinen Stoff für Kleider gibt, und was, wenn man einen Juden in der Familie hat? Bereits hier hat sie den unnachahmlichen Ton des »Familienlexikon« gefunden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 493
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Eine große, immer wieder neu zu entdeckende Autorin
Niemand vermag so scheinbar unbeteiligt und hellsichtig den Beziehungen zwischen Menschen nachzugehen wie Natalia Ginzburg: in der Familie, zwischen Mann und Frau, zu Freunden – und so beinahe weise eine Erzählung hinter der Geschichte auszubreiten.
»Es ist, als ob Ginzburgs Schreiben ein Geheimnis wäre, das ich schon mein ganzes Leben lang enthüllen wollte. Ihre Worte scheinen etwas absolut Wahres über meine eigenen Erfahrungen und über Leben überhaupt auszudrücken.«
Sally Rooney
Natalia Ginzburg
ALLE UNSEREGESTERN
Roman
Von Maja Pflug durchgesehene Übersetzung aus dem Italienischen
Verlag Klaus Wagenbach Berlin
AND ALL OUR YESTERDAYS HAVE LIGHTED FOOLS THE WAY TO DUSTY DEATH.
Macbeth V, V. 22–23
Teil 1
I
DAS PORTRÄT DER MUTTER hing im Esszimmer: eine sitzende Frau mit einem Federhut und einem langen, müden und verängstigten Gesicht. Sie war immer von schwacher Gesundheit gewesen, litt unter Schwindel und Herzklopfen, und vier Kinder waren zu viel für sie. Kurz nach Annas Geburt war sie gestorben.
Manchmal gingen Anna, Giustino und Signora Maria am Sonntag auf den Friedhof. Concettina nicht, sie setzte am Sonntag nie einen Fuß vor die Tür, sie konnte den Sonntag nicht ausstehen und schloss sich in ihr Zimmer ein, um ihre Strümpfe zu stopfen, und trug dabei ihr hässlichstes Kleid. Und Ippolito musste dem Vater Gesellschaft leisten. Auf dem Friedhof betete Signora Maria, die beiden Kinder jedoch nicht, weil der Vater immer sagte, Beten sei etwas Dummes: Vielleicht gebe es Gott, aber es sei nicht nötig zu beten, da er Gott sei und ohnehin wisse, wie die Dinge stehen.
Als die Mutter noch nicht tot war, lebte Signora Maria nicht bei ihnen, sondern bei der Großmutter, der Mutter ihres Vaters, und die beiden verreisten zusammen. Auf Signora Marias Koffern klebten viele Hoteletiketten, und in ihrem Schrank hing ein Kleid mit Knöpfen in Form kleiner Tännchen, das sie in Tirol gekauft hatte. Reisen war die Leidenschaft der Großmutter: Sie hatte es nie aufgeben wollen und ihr ganzes Vermögen damit durchgebracht, weil sie gern in eleganten Hotels abstieg. In der letzten Zeit vor ihrem Tod war sie oft schlecht gelaunt, erzählte Signora Maria, weil sie sich nicht damit abfinden wollte, dass sie kein Geld mehr hatte, und sich nicht erklären konnte, warum; und manchmal vergaß sie es und wollte sich einen Hut kaufen, und Signora Maria musste sie vom Schaufenster wegziehen, während sie mit dem Schirm auf den Boden klopfte und vor Wut in ihr Schleierchen biss. Nun lag sie in Nizza begraben, dort, wo sie gestorben war und wo sie sich in ihrer Jugend, als sie noch munter, schön und reich war, so gut amüsiert hatte.
Signora Maria erzählte sehr gern von dem vielen Geld, das die Großmutter besessen hatte, und prahlte mit den schönen Reisen, die sie gemacht hatten. Signora Maria war sehr klein, und wenn sie saß, berührten ihre Füße den Boden nicht. Deshalb hüllte sie sich in eine Decke, wenn sie saß, denn sie wollte nicht zeigen, dass ihre Füße nicht bis zum Boden reichten. Die Decke war dieselbe, die sie und die Großmutter sich vor zwanzig Jahren über die Knie breiteten, wenn sie in der Kutsche durch die Stadt fuhren. Signora Maria legte ein bisschen Rouge auf ihre Wangen, denn sie mochte es nicht, wenn man sie früh am Morgen sah, bevor sie das Rouge aufgelegt hatte, und so schlich sie ganz leise und gebeugt ins Badezimmer und fuhr zusammen und wurde sehr böse, wenn jemand sie im Flur aufhielt, um etwas zu fragen. Im Badezimmer blieb sie immer ziemlich lange, so dass alle an die Türe klopften, und dann rief sie, sie habe es satt, in einem Haus zu leben, wo niemand sie respektiere, und sie werde sofort die Koffer packen und nach Genua zu ihrer Schwester fahren. Zwei- oder dreimal hatte sie die Koffer unter dem Schrank hervorgezogen und angefangen, ihre Schuhe in Stoffbeutelchen zu stecken. Man musste so tun, als habe man nichts bemerkt, dann nahm sie nach einiger Zeit die Schuhe wieder heraus. Übrigens wussten alle, dass die Schwester in Genua sie nicht bei sich haben wollte.
Signora Maria kam fertig angezogen, den Hut auf dem Kopf, aus dem Badezimmer, lief mit einem Schäufelchen auf die Straße und sammelte rasch etwas Mist, um die Rosen zu düngen, und passte auf, dass niemand sie sah. Dann ging sie mit dem Netz zum Einkaufen und brachte es fertig, die Stadt mit ihren flinken kleinen Füßchen in den schleifengeschmückten Schuhen in einer halben Stunde zu durchqueren. Jeden Morgen suchte sie die ganze Stadt nach der billigsten Ware ab und kam todmüde nach Hause und war immer schlechter Laune nach dem Einkaufen und ärgerte sich über Concettina, die noch im Morgenrock war, und sagte, sie hätte nie geglaubt, dass sie einmal mit einem Netz durch die Stadt hetzen müsse, als sie noch neben der Großmutter in der Kutsche saß, die Knie in die warme Decke gehüllt, und von den Leuten gegrüßt wurde. Concettina bürstete langsam ihre Haare vor dem Spiegel, dann ging sie mit dem Gesicht ganz nahe an den Spiegel heran und betrachtete ihre Sommersprossen, eine nach der anderen, dann betrachtete sie ihre Zähne und das Zahnfleisch und streckte die Zunge heraus und betrachtete auch sie. Sie schlang ihre Haare im Nacken zu einem Knoten und kämmte sich wirre Ponyfransen in die Stirn, und Signora Maria sagte, mit diesem Pony sehe sie wirklich aus wie eine Kokotte. Danach öffnete sie den Schrank und überlegte lange, welches Kleid sie anziehen sollte. Unterdessen lüftete Signora Maria die Betten und klopfte mit hochgekrempelten Ärmeln und einem Tuch auf dem Kopf die Teppiche. Sie verschwand aber sogleich vom Fenster, wenn die Frau vom Haus gegenüber auf den Balkon trat, weil sie nicht gesehen werden wollte, wenn sie ein Kopftuch trug und mit ihren dürren alten Armen Teppiche klopfte. Sie war als Gesellschaftsdame in dieses Haus gekommen, und nun musste sie solche Arbeiten verrichten.
Auch die Frau vom Haus gegenüber hatte Ponyfransen, die aber vom Friseur in anmutige Unordnung gelegt waren, und Signora Maria sagte, sie sehe jünger aus als Concettina, vor allem morgens, wenn sie diese frischen, hellen Morgenröcke trug. Dabei wusste man mit Sicherheit, dass sie fünfundvierzig war.
Es gab Tage, an denen Concettina kein Kleid zum Anziehen fand. Sie probierte Röcke und Blusen, Gürtel und Blumen am Ausschnitt und war mit nichts zufrieden. Dann begann sie zu weinen und jammerte, wie unglücklich sie sei, weil sie kein hübsches Kleid anzuziehen und dazu eine so schlechte Figur habe. Signora Maria schloss die Fenster, damit man im Haus gegenüber nichts hörte. »Du hast keine schlechte Figur«, sagte sie, »du hast nur ein bisschen breite Hüften und einen etwas flachen Busen. Wie deine Großmutter, die hatte auch einen flachen Busen.« Concettina schrie und schluchzte, warf sich halb angezogen auf das ungemachte Bett, und dann kamen alle ihre Sorgen heraus: die Examen, die sie ablegen musste, und die Geschichten mit ihren Verlobten.
Concettina hatte viele Verlobte. Sie wechselte sie ständig. Einer stand immer vor dem Gartentor: Er hatte ein breites, eckiges Gesicht und trug ein mit einer Sicherheitsnadel festgestecktes Halstuch anstelle des Hemdes. Er hieß Danilo. Concettina sagte, sie habe schon lange mit ihm Schluss gemacht, doch er gab noch nicht auf und spazierte vor dem Tor auf und ab, die Hände auf dem Rücken und die Baskenmütze tief in die Stirn gezogen. Signora Maria hatte Angst, er könnte plötzlich hereinkommen und Concettina eine Szene machen, und sie ging zum Vater und beklagte sich über alle diese Geschichten, die Concettina mit ihren Verlobten machte, und zog ihn ans Fenster, damit er Danilo mit der Baskenmütze und den Händen auf dem Rücken sah, und wollte, dass der Vater hinausgehe und ihn fortschicke. Aber der Vater sagte, die Straße gehöre allen, und keiner habe das Recht, jemanden von einer Straße zu verjagen. Dann zog er seinen alten Revolver heraus und legte ihn auf den Tisch für den Fall, dass Danilo plötzlich über das Tor klettern würde. Und er schob Signora Maria aus dem Zimmer, weil er in Ruhe schreiben wollte.
Der Vater schrieb ein dickes Buch, seine Memoiren. Er schrieb seit vielen Jahren daran und hatte seinen Anwaltsberuf aufgegeben, um schreiben zu können. Der Titel lautete: Nichts als die Wahrheit, und es standen schreckliche Dinge über den König und die Faschisten darin. Der Vater lachte und rieb sich die Hände, wenn er daran dachte, dass der König und Mussolini nicht wussten, dass in einer kleinen italienischen Stadt ein Mann schreckliche Seiten über sie niederschrieb. Er erzählte sein ganzes Leben, den Rückzug von Caporetto, wo er auch dabei gewesen war, und alles, was er gesehen hatte, die Versammlungen der Sozialisten und den Marsch auf Rom, all die Leute, die in seiner kleinen Stadt das Hemd gewechselt hatten, Leute, die man für anständig hielt und die dann schwarze Schweinereien gemacht hatten, »nichts als die Wahrheit«. Monatelang schrieb er und klingelte jeden Augenblick, um Kaffee zu verlangen, und sein Zimmer war voll Rauch, und er schrieb auch nachts oder rief Ippolito und ließ ihn schreiben, was er diktierte. Ippolito hämmerte laut auf der Schreibmaschine, und der Vater diktierte, während er im Schlafanzug durchs Zimmer wanderte, und niemand konnte schlafen, weil das Haus dünne Wände hatte, und Signora Maria wälzte sich in ihrem Bett hin und her und zitterte vor Angst, dass auf der Straße jemand die zornige Stimme des Vaters und seine schrecklichen Dinge gegen Mussolini hören könnte. Doch dann verlor der Vater plötzlich den Mut und fand sein Buch gar nicht mehr so schön und sagte, alle Italiener seien korrupt, daran könne kein Buch etwas ändern. Er sagte, er habe Lust, auf die Straße zu gehen und mit seinem Revolver um sich zu schießen oder sich einfach nur hinzulegen, zu schlafen und auf den Tod zu warten. Er verließ sein Zimmer nicht mehr: Er verbrachte die Tage im Bett und ließ sich von Ippolito den Faust vorlesen. Und dann rief er Anna und Giustino zu sich und bat sie um Verzeihung, dass er nie gemacht hatte, was ein Vater normalerweise macht, dass er nie mit ihnen ins Kino oder wenigstens spazieren gegangen war. Und er rief Concettina zu sich und erkundigte sich nach ihren Examen und ihren Verlobten. Er wurde sehr freundlich, wenn er traurig war. Eines Morgens aber wachte er auf und war nicht mehr so traurig, wollte, dass Ippolito ihm den Rücken mit einem Sisalhandschuh massierte, und wollte auch seine weiße Flanellhose. Er setzte sich in den Garten und ließ sich Kaffee bringen, fand ihn aber immer zu dünn und stürzte ihn mit Ekel herunter. Er saß den ganzen Morgen im Garten, die Pfeife zwischen den langen weißen Zähnen, das hagere, faltige Gesicht zu einer Grimasse verzogen, von der man nicht wusste, ob sie von der Sonne, vom Ekel über den Kaffee oder von der Anstrengung, die Pfeife nur mit den Zähnen zu halten, herrührte. Er bat niemanden mehr um Verzeihung, wenn er nicht mehr traurig war, und schlug mit seinem Stock auf die Rosen ein, während er von neuem an seine Memoiren dachte, und dann war Signora Maria bekümmert wegen der Rosenstöcke, die ihr so lieb waren, dass sie jeden Morgen das Opfer brachte, auf die Straße zu gehen und mit dem Schäufelchen Mist zu sammeln, auf die Gefahr hin, von jemandem gesehen und ausgelacht zu werden.
Der Vater hatte keinen einzigen Freund. Manchmal ging er mit einem bösen und verächtlichen Gesicht durch die ganze Stadt und setzte sich in ein Café im Zentrum und betrachtete die Leute, die vorbeigingen, um von denen, die er früher gut kannte, gesehen zu werden und ihnen zu zeigen, dass er noch lebte; er dachte, das würde sie ärgern. Dann kam er ganz zufrieden wieder nach Hause, wenn er einen von denen gesehen hatte, die früher wie er Sozialisten, jetzt aber Faschisten waren und nicht wussten, dass sie in seinen Memoiren vorkamen in der Zeit, als sie noch anständige Leute waren, und später mit all den schwarzen Schweinereien, die sie gemacht hatten. Bei Tisch rieb sich der Vater die Hände und sagte, wenn es einen Gott gebe, so werde er ihn das Ende des Faschismus erleben lassen, damit er sein Buch publizieren und sehen könne, was die Leute dann für ein Gesicht machten. Er sagte, dass man so endlich wissen werde, ob es diesen Gott gebe oder nicht: Er glaube ja eigentlich nicht daran, aber wer weiß, vielleicht gebe es ihn doch, und er halte zu Mussolini. Nach dem Essen sagte der Vater: »Giustino, geh mir die Zeitung kaufen. Mach dich nützlich, wenn du schon nicht ergötzlich bist.« Denn er war gar nicht mehr nett, wenn er nicht mehr traurig war.
Von Zeit zu Zeit erhielten sie große Pralinenschachteln, die Cenzo Rena schickte, einer, der mit dem Vater einmal sehr befreundet gewesen war. Cenzo Rena schickte auch Ansichtskarten aus allen Teilen der Erde, weil er immer reiste, und Signora Maria erkannte die Orte wieder, wo auch sie mit der Großmutter gewesen war, und steckte die Karten an den Spiegel ihrer Kommode. Aber der Vater wollte nichts mehr von Cenzo Rena hören, weil sie Freunde gewesen waren und sich dann furchtbar zerstritten hatten, und wenn er die Pralinen sah, zuckte er die Schultern und schnaubte verächtlich, und Ippolito musste Cenzo Rena heimlich schreiben, um sich zu bedanken und ihm Nachricht vom Vater zu geben.
Concettina und Anna nahmen zweimal in der Woche Klavierstunden. Man hörte ein kurzes, ängstliches Klingeln, Anna öffnete das Tor, und der Klavierlehrer ging durch den Garten und blieb stehen, um die Rosen zu betrachten, denn auch er kannte die Geschichte von dem Mist und dem Schäufelchen, und außerdem hoffte er, dass plötzlich der Vater irgendwo im Garten auftauchen würde. Anfangs hatte der Vater ihm gerne zugehört und sich eingebildet, dieser Klavierlehrer sei ein großer Mann; er führte ihn in sein Zimmer und bot ihm seinen Tabak zum Rauchen an und klopfte ihm fest aufs Knie und sagte immer wieder, er sei ein außergewöhnlicher Mensch. Der Klavierlehrer arbeitete an einer lateinischen Grammatik in Versen, die er in ein kleines Heft schrieb, und jedes Mal, wenn er kam, las er dem Vater ein paar neue Strophen vor. Plötzlich aber war der Vater seiner schrecklich müde und wollte die neuen Strophen der Grammatik nicht mehr hören, und kaum erklang das kurze, ängstlichen Klingeln des Klavierlehrers, sah man den Vater die Treppen hinaufeilen, um sich irgendwo zu verstecken. Dem Klavierlehrer ließ es keine Ruhe, dass er nicht mehr im Zimmer des Vaters empfangen wurde, er sprach laut im Flur und rezitierte ein paar Strophen und sah sich nach allen Seiten um. Dann wurde er traurig und fragte Concettina und Anna, ob er vielleicht, ohne es zu wissen, den Vater beleidigt habe. Weder Anna noch Concettina spielten gut. Beide hatten diese Stunden satt und wollten gerne damit aufhören, aber Signora Maria erlaubte es nicht, weil der Klavierlehrer das einzige fremde Gesicht war, das man im Haus sah. Und ein Haus, in das nicht hin und wieder ein Besuch kommt, ist wirklich zu traurig, sagte sie. Sie saß während der Klavierstunden immer dabei, mit der Decke auf den Knien und einer Häkelarbeit. Anschließend unterhielt sie sich dann mit dem Klavierlehrer und hörte sich seine Strophen an, und er ging bis spät nicht weg, weil er immer noch hoffte, den Vater zu sehen.
Tatsächlich war der Klavierlehrer der einzige fremde Mensch, der ins Haus kam. Auch ein Neffe von Signora Maria ließ sich hie und da blicken, der Sohn ihrer Schwester aus Genua; er studierte Tiermedizin und war in Genua in den Examen immer durchgefallen; so setzte er nun sein Studium in dieser kleinen Stadt fort, weil die Examen hier viel leichter waren, doch auch hier fiel er ab und zu durch. Er war aber nicht wirklich ein Fremder, weil alle ihn schon seit der Kindheit kannten, und Signora Maria saß immer wie auf Kohlen, wenn er kam, aus Angst, der Vater würde ihn schlecht behandeln. Der Vater wollte niemanden im Haus, und auch Concettinas Verlobte mussten vor dem Tor bleiben.
Im Sommer musste man immer auf den Bauernhof ›Le Visciole‹ fahren, und jedes Jahr weinte Concettina, weil sie lieber ans Meer gefahren oder bei ihren Verlobten in der Stadt geblieben wäre. Und auch Signora Maria war verzweifelt, weil sie mit der Frau des Pächters Streit hatte, seit das Schwein einmal Taschentücher gefressen hatte. Und auch Giustino und Anna, die als kleine Kinder ›Le Visciole‹ geliebt hatten, schmollten nun vor der Abreise. Sie hofften, der Vater würde sie im Sommer einmal zu Cenzo Rena fahren lassen, in eine Art Schloss, das er besaß, denn Cenzo Rena schrieb jedes Jahr und lud sie ein. Aber der Vater wollte nicht und sagte, das Schloss sei übrigens sehr hässlich, ein Ding mit kleinen Türmchen, und Cenzo Rena glaube, es sei schön, weil er Geld dafür ausgegeben hatte. Das Geld ist Teufelsdreck, sagte der Vater.
Nach ›Le Visciole‹ fuhr man mit einer kleinen Eisenbahn. Es war nicht weit, aber die Abreise gestaltete sich immer schwierig, weil der Vater in den Tagen, da man die Koffer packte, niemanden in Ruhe ließ; er brüllte Ippolito und Signora Maria an, und die Koffer mussten hundertmal ein- und ausgepackt werden. Und Concettinas Verlobte, die gekommen waren, um sich von ihr zu verabschieden, schlichen um das Gartentor, und sie weinte und hatte eine schreckliche Wut, dass sie so viele Monate auf ›Le Visciole‹ verbringen musste, wo sie vor Langeweile dick wurde und es nicht einmal einen Tennisplatz gab.
Sie reisten früh am Morgen ab, und der Vater war während der ganzen Fahrt schlechter Laune, weil der Zug überfüllt war und die Leute aßen und tranken und er fürchtete, sie könnten ihm Rotweinflecken auf seine Hose machen. Es gab keine Reise, auf der er nicht mit jemandem im Zug Streit anfing. Dann zankte er mit Signora Maria, die immer viele Bündelchen und Körbe dabei hatte und deren Schuhe in den Stoffbeuteln überall herumlagen. Vor allem ekelte es den Vater vor der Flasche mit Milchkaffee, die sie im Gepäcknetz hatte, er fand es scheußlich, den Milchkaffee in einer Weinflasche zu sehen, und sagte zu Signora Maria, es sei ihm unbegreiflich, wie die Großmutter so viel Wert darauf hatte legen können, sie auf alle ihre Reisen mitzunehmen. Doch kaum waren sie auf ›Le Visciole‹ angekommen, war er zufrieden. Er setzte sich unter die Pergola und atmete tief und kräftig und sagte, wie gut die Luft sei, so stark und frisch, jeder Atemzug komme ihm vor wie ein Schluck von einem köstlichen Getränk. Und er rief den Pächter und begrüßte ihn herzlich, und dann rief er Ippolito und fragte ihn, ob der Pächter nicht aussehe wie ein Bild von van Gogh, er bestand darauf, dass der Pächter sich hinsetzte und den Kopf auf die Hand stützte, und setzte ihm den Hut auf und fragte, ob das nicht ein echter van Gogh sei. Wenn der Pächter wieder gegangen war, sagte Ippolito, vielleicht sei er ein van Gogh, aber auch ein Dieb, der Getreide und Wein für sich beiseiteschaffe. Der Vater wurde sehr wütend. Er hatte als Kind mit diesem Pächter gespielt und konnte nicht dulden, dass Ippolito seine Kindheit so in den Schmutz zog, und es sei viel schlimmer, die Kindheit des eigenen Vaters in den Schmutz zu ziehen, als ein paar Säcke Getreide für sich zu behalten, wenn man sie brauche. Ippolito antwortete nichts, er hielt den Hund zwischen den Knien und kraulte ihn an den Ohren. Kaum war er auf ›Le Visciole‹, zog er eine alte Barchentjacke und Stiefel an und blieb den ganzen Sommer über so gekleidet; er sei entsetzlich schmutzig und müsse doch, sagte Signora Maria, vor Hitze platzen. Aber Ippolito sah nie aus, als ob ihm heiß wäre, er schwitzte nicht, und sein Gesicht war immer glatt und trocken, auch wenn er in der Mittagssonne mit dem Hund über die Felder ging. Der Hund zerbiss die Sessel und hatte Flöhe, und Signora Maria wollte ihn wegschenken, aber Ippolito war ganz verrückt nach diesem Hund und hatte ihn sogar einmal, als der Hund krank war, nachts mit in sein Zimmer genommen und war aufgestanden, um ihm Brei zu kochen. Er hätte ihn gern mit in die Stadt genommen, musste ihn aber beim Pächter zurücklassen, der sich nicht um ihn kümmerte und ihm faules Zeug zu fressen gab, und Ippolito war immer sehr traurig im Herbst, wenn er von dem Hund Abschied nehmen musste, aber in dieser Sache war sich der Vater mit Signora Maria einig: Er wollte in der Stadt keinen Hund. Deshalb müsste Ippolito, sagte der Vater, geduldig warten, bis er tot wäre, und wer weiß, vielleicht hoffe er ja sehr, dass er bald sterbe, damit er dann mit seinem Hund auch in der Stadt spazieren gehen könne.
Ippolito hörte schweigend zu, wenn der Vater ihn schlecht machte, er antwortete nie, und sein Gesicht blieb verschlossen und blass, und nachts stand er auf, um des Vaters Memoiren in die Maschine zu hämmern oder Goethe vorzulesen, wenn der Vater nicht schlafen konnte. Weil er eine Sklavenseele habe, sagte Concettina, und kein Blut in den Adern, sondern Kamillentee, und wie ein Neunzigjähriger lebe, ohne Mädchen, die ihm gefielen, und ohne Lust auf irgendetwas, nur fähig, den ganzen Tag mit dem Hund durch das Land zu streifen.
›Le Visciole‹ war ein großes, hohes Haus mit Gewehren und Geweihen an den Wänden, mit hohen Betten und Matratzen, die raschelten, weil sie mit Maisblättern gefüllt waren. Der Garten reichte bis zur Fahrstraße hinunter, ein großer, ungepflegter Garten mit vielen Bäumen, es war sinnlos zu versuchen, dort Rosen oder andere Blumen zu pflanzen, weil der Pächter sie im Winter doch nicht gepflegt hätte und sie eingegangen wären. Hinter dem Haus war der Hof, das Fuhrwerk und das Haus des Pächters, mit der Frau des Pächters, die ab und zu unter die Türe trat und einen Eimer Wasser ausschüttete, und dann rief Signora Maria, der Hof stinke von diesem schmutzigen Wasser, und die Frau des Pächters rief, das Wasser sei sauber, Signora Maria könnte ihr Gesicht damit waschen, und dann stritten die beiden noch eine ganze Weile miteinander. Rundherum breiteten sich, so weit das Auge reichte, Korn- und Maisfelder aus mit Vogelscheuchen in der Mitte, deren leere Ärmel flatterten. Am Fuß des Hügels begannen die Weingärten und die Eichen, und von dort hörte man manchmal einen Schuss krachen, und ein Schwarm Vögel flog auf, und Ippolitos Hund bellte, aber Concettina sagte, der Hund belle nur vor Schrecken und nicht aus Freude, etwas zu fassen. Der Fluss war weit weg, jenseits der Fahrstraße, ein heller Streifen zwischen Büschen und Steinen: Und das Dorf, zehn Häuser, lag noch etwas weiter entfernt.
Im Dorf gab es »die Halunken«, so nannte der Vater den Parteisekretär, den Maresciallo der Carabinieri und den Gemeindesekretär; und der Vater ging jeden Tag ins Dorf, um von den Halunken gesehen zu werden, um ihnen zu zeigen, dass er noch lebte und sie nicht grüßte. Die Halunken spielten hemdsärmelig Boccia und hatten keine Ahnung, dass auch sie in den Memoiren vorkamen, und ihre Frauen strickten auf dem kleinen Platz rund um das Denkmal und stillten ihre Kinder mit einem Tuch über der Brust. Das Denkmal war aus Stein, ein dicker steinerner Junge mit Faschistenfähnchen und Fez; der Vater blieb davor stehen, setzte das Monokel auf und schaute und lachte höhnisch, eine ganze Weile stand er da und schaute und lachte höhnisch, und Signora Maria hatte Angst, die Halunken würden ihn eines Tages verhaften, und versuchte ihn wegzuziehen wie einst die Großmutter vor den Schaufenstern der Hutgeschäfte. Signora Maria hätte gern mit den Frauen der Halunken geplaudert, um neue Strickmuster von ihnen zu lernen und ihnen welche zu zeigen, und sie hätte ihnen auch gerne gesagt, dass sie gut dran täten, sich die Brust vor dem Stillen mit abgekochtem Wasser zu waschen. Aber aus Angst vor dem Vater wagte sie nie, sich ihnen zu nähern.
Im Sommer bekam der Vater Sommersprossen auf dem kahlen und glänzenden Kopf, und an manchen Stellen schälte sich die Haut, weil er sich ohne Hut der Sonne aussetzte; und Concettinas Beine wurden goldbraun, weil man auf ›Le Visciole‹ nichts anderes tun konnte, als in der Sonne zu liegen, und Concettina lag den ganzen Tag im Liegestuhl vor dem Haus, mit einer schwarzen Brille und einem Buch, das sie nicht las; sie betrachtete ihre Beine und achtete darauf, dass sie gleichmäßig braun wurden, und außerdem bildete sie sich ein, dass sie ein bisschen dünner würden, wenn sie in der Sonne schwitzten; denn Concettina hatte nicht nur breite Hüften, sondern auch dicke Beine, und sie sagte immer, sie würde zehn Jahre ihres Lebens dafür geben, um von den Hüften abwärts schlanker zu sein. Signora Maria änderte unter der Pergola ihre Kleider, ihre ungewöhnlichen Kleider, die sie sich aus alten Vorhängen oder Wolldecken zurechtschnitt, und hatte dabei einen Hut aus Zeitungspapier auf dem Kopf und ihre Füße auf einem Schemel gekreuzt. In der Ferne, auf dem Grat des Hügels, sah man immer wieder Ippolito mit dem Gewehr und dem Hund vorbeigehen, und der Vater fluchte über den dummen Hund und über Ippolitos Gewohnheit, durch das Land zu streifen, da er ihn doch brauchte zum Spritzengeben und Maschineschreiben, und er schickte ihm Giustino nach, um ihn zurückzuholen.
II
AUF ›LE VISCIOLE‹ fühlte sich der Vater zum ersten Mal unwohl. Er trank seinen Kaffee, und plötzlich fing die Hand, mit der er die Tasse hielt, zu zittern an, und der Kaffee floss auf seine Hose; und er saß gebeugt und zitternd da und atmete schwer. Ippolito schwang sich aufs Rad, um den Arzt zu holen. Aber der Vater wollte keinen Arzt und sagte, er fühle sich schon wieder besser, er sagte, der Arzt sei ein Halunke, und er wollte sofort in die Stadt zurückkehren. Der Arzt kam, überhaupt kein Halunke, kaum größer als Signora Maria, mit blonden Haaren, die aussahen wie Kükenflaum, weiten Knickerbockern und karierten Kniestrümpfen. Und auf einmal schloss der Vater Freundschaft mit ihm. Denn er entdeckte, dass der Arzt kein Halunke war, sondern den Parteisekretär, den Carabiniere und den steinernen Jungen auf dem Dorfplatz hasste. Der Vater sagte, er sei froh, dass er sich unwohl gefühlt habe, weil er so entdeckt hatte, dass der Arzt, den er für einen Halunken hielt, ein tüchtiger Bursche war, und sie plauderten jeden Tag miteinander und erzählten sich viel, und der Vater hatte fast Lust, ihm ein Stück aus seinen Memoiren vorzulesen, aber Ippolito meinte, besser nicht. Ippolito konnte jetzt nicht mehr über Land gehen; er musste den ganzen Tag im Zimmer des Vaters sitzen und ihm Spritzen geben und Tropfen abzählen und vorlesen: Jetzt wollte der Vater aber nicht mehr Goethe hören, sondern Kriminalromane. Zum Glück kam der kleine Arzt jeden Tag, und der Vater war darüber sehr erfreut: Nur diese karierten Kniestrümpfe solle er nicht mehr anziehen, hatte er ihm gesagt, weil sie ihm nicht gutstanden und ein bisschen lächerlich aussahen.
Sie reisten wie immer Ende September ab: Nur Giustino und Signora Maria fuhren schon früher, weil Giustino seine Griechisch-Prüfung nachholen musste. In der Stadt wurde der Vater von neuem krank, er magerte ab und hustete, und ein Arzt kam ihn besuchen, der ganz anders war als der kleine Arzt mit den Haaren wie Kükenflaum; er plauderte nicht mit ihm, hörte ihm nicht zu und behandelte ihn schroff. Er verbot ihm das Rauchen, und der Vater gab den Tabakbeutel Ippolito und sagte zu ihm, er solle ihn in eine Schublade sperren und den Schlüssel einstecken; aber nach einer Weile wollte er den Tabak wiederhaben, nur ein bisschen, und Ippolito gab nicht nach und stand da, die Hände in den Taschen, und dann sagte der Vater, wie lächerlich sich Ippolito verhalte, er nehme alles wörtlich und habe keinen Verstand, kein bisschen Verstand und keine Phantasie, und die Welt werde verdorben von solchen Leuten, von Leuten, die alles wörtlich nehmen, und er könne es nicht ertragen, einen so dummen und lächerlichen Sohn zu haben, der mit versteinertem Gesicht dastehe und stur den Schlüssel behalte, und der Kummer, einen dummen Sohn zu haben, schade ihm viel mehr als ein bisschen Tabak. Bis Ippolito mit einem Seufzer den Schlüssel auf den Tisch warf: Dann öffnete der Vater die Schublade, nahm den Tabak und fing an zu rauchen und zu husten.
Eines Tages, als sie beim Essen saßen, sahen sie dann den Vater im Schlafanzug und in Pantoffeln mit einem Bündel Blätter unter dem Arm daherkommen. Es waren seine Memoiren, und er fragte, ob der Ofen geheizt sei, und er war geheizt, weil es schon kühl war: Da fing er plötzlich an, die Blätter in den Ofen zu schieben, und alle schauten mit offenem Munde zu, nur Ippolito schien nicht erstaunt. Große Flammen schlugen aus dem offenen Ofen, und die Memoiren brannten, und niemand verstand warum: Doch Ippolito schien nicht erstaunt, er stand auf und betrachtete die Flammen, strich sich langsam über die Haare und schob mit dem Schüreisen die Blätter ins Feuer, die noch nicht verbrannt waren, und der Vater rieb sich die Hände und sagte: »Jetzt bin ich zufrieden. Es muss alles neu geschrieben werden. So ging es nicht.« Aber er war den ganzen Tag über sehr nervös und wollte weder ins Bett zurück noch sich anziehen und ging im Zimmer auf und ab und quälte Ippolito wegen der üblichen Geschichte mit dem Tabak: Er wurde so wütend auf Ippolito, dass er ihn aus dem Zimmer schickte und verlangte, dass Concettina ihm vorlese, und während sie las, hielt er ihre Hand und streichelte sie und sagte, sie habe schöne Hände und ein schönes Profil, ein wirklich schönes Profil: Doch dann sagte er ihr, sie lese schlecht, sie singe beim Lesen und solle aufhören.
Er legte sich ins Bett und konnte nicht mehr aufstehen. Nach und nach ging es ihm immer schlechter, er lag im Sterben, das wussten alle, und er wusste es bestimmt auch, aber er ließ sich nichts anmerken, obwohl er doch früher, bevor er wirklich krank wurde, immer vom Sterben gesprochen hatte; er sagte von Tag zu Tag weniger, er verlangte nur noch, was er brauchte; Giustino und Anna war es verboten, sein Zimmer zu betreten, und sie sahen ihn von der Türe aus lang ausgestreckt im Bett liegen, die mageren, behaarten Arme auf der Decke, und seine Nase wurde immer weißer und schmaler; manchmal machte er den beiden Kindern ein Zeichen, sie sollten eintreten, sagte aber dann nichts, was man verstand, nur wirre Worte, und zerdrückte mit den Armen den Schlafanzug auf der Brust und zitterte und schwitzte. Es roch nach Alkohol im Zimmer, und die Lampe war mit einem roten Tuch verhängt, und unter dem Schrank sahen die langen spitzen Schuhe des Vaters hervor, und man wusste, dass er nie mehr in ihnen gehen würde, weil er im Sterben lag. Anna und Concettina hatten nach dem Sommer ihre Klavierstunden nicht wieder aufgenommen, aber der Lehrer kam immer, um sich nach dem Vater zu erkundigen, nur wagte er nicht zu klingeln und wartete am Tor, bis Signora Maria in den Garten hinauskam und ihm erzählte, ob der Vater ein bisschen geschlafen hatte. Und meistens stand auch Danilo vor dem Tor, mit einem Buch an das Mäuerchen gelehnt, und Signora Maria fand, es sei wirklich frech, Concettina nicht einmal jetzt in Ruhe zu lassen, während der Vater so schwer krank war; und wenn Concettina kurz das Haus verließ, um einzukaufen, klemmte er das Buch unter den Arm und folgte ihr, und Concettina warf ihm ab und zu finstere Blicke zu und kehrte feuerrot und mit wirren Ponyfransen nach Hause zurück.
Der Vater starb am Morgen. Anna und Giustino waren in der Schule, und Signora Maria kam mit einem kleinen schwarzen Tüchlein um den Hals und holte sie ab; sie küsste sie feierlich auf die Stirn und nahm sie mit. Um sie zu küssen, musste sie sich auf die Zehenspitzen stellen, weil beide viel größer waren als sie: Das war im Gang der Schule, und der Rektor stand dabei, doch obwohl er gewöhnlich schroff auftrat, war er an diesem Morgen sehr freundlich. Sie gingen in das Zimmer des Vaters hinauf: Dort kniete Concettina und schluchzte, Ippolito dagegen stand ruhig und schweigend da, und sein Gesicht war wie immer weiß und trocken. Der Vater lag fertig angezogen auf dem Bett, mit Krawatte, mit Schuhen an den Füßen, und sein Gesicht war jetzt sehr schön, nicht mehr zitternd und schwitzend, sondern sanft und bestimmt.
Dann brachte Signora Maria Anna in das Haus gegenüber, weil die Signora von drüben ausrichten ließ, sie könne den ganzen Tag bei ihnen bleiben. Anna hatte Angst, weil es dort einen Hund gab. Nicht so einen dummen Hund mit gelocktem Fell wie der von Ippolito, sondern einen Schäferhund, der an einer Kette angebunden war, und an einem Baum im Garten hing ein Schild: Cave canem. Sie hatte auch Angst, weil es im Garten ein Pingpong gab. Durch die Hecke hatte sie einen Jungen mit einem alten Herrn Pingpong spielen gesehen. Deshalb hatte sie Angst, der Junge würde sie auffordern, Pingpong zu spielen, was sie nicht konnte. Sie nahm sich vor, zu sagen, sie könne spielen, habe aber keine Lust, denn auf ›Le Visciole‹ gebe es auch ein Pingpong und sie machten den ganzen Sommer nichts anderes als Pingpong spielen. Doch wenn sie und der Junge plötzlich dicke Freunde würden, müsste sie ihn vielleicht im Sommer auf ›Le Visciole‹ einladen, und er würde merken, dass es dort gar keinen Pingpong-Tisch gab.
Sie war nie im Haus gegenüber gewesen. Von der Hecke aus hatte sie den Jungen und den alten Herrn und den Hund gesehen. Die Frau mit den Ponyfransen, die manchmal im Morgenrock auf den Balkon trat und so jung aussah, war die Frau des alten Herrn. Dann gab es noch ein rothaariges Mädchen, das die Tochter des alten Herrn und seiner früheren Frau war. Der Junge dagegen und noch ein anderer, größerer Junge, der ungefähr in Ippolitos Alter sein musste, waren die Kinder von der Frau mit den Ponyfransen. Signora Maria sagte, es seien sehr reiche Leute, denn dem alten Herrn gehörte die Seifenfabrik am Fluss, ein langes Gebäude aus roten Ziegelsteinen, dessen Schlote immer rauchten. Es waren sehr, sehr reiche Leute. Sie kochten nie den Kaffeesatz auf, sondern gaben ihn den Mönchen, die darum baten. Das rothaarige Mädchen, die Tochter der früheren Frau des alten Herrn, kam abends mit einem Besen aus dem Haus und fegte den ganzen Garten und brummte dabei zornig vor sich hin. Auch Signora Maria schaute häufig über die Hecke, weil sie neugierig war und sich für reiche Leute interessierte.
Signora Maria überließ Anna dem Dienstmädchen, das öffnete, bat, darauf zu achten, dass Anna den Schal umbinde, wenn sie im Garten spielte, und ging wieder. Das Dienstmädchen führte Anna in ein Zimmer im ersten Stock und sagte, sie solle dort warten, bald komme Signor Giuma, um ihr Gesellschaft zu leisten. Anna wusste nicht, wer Signor Giuma war. Sie sah vom Fenster aus ihr Haus, das von dieser Seite her ganz anders aussah, flach, klein und alt, mit der vertrockneten Glyzinie auf der Terrasse und in einer Dachecke Giustinos kaputten und vom Regen verwaschenen Ball. Bei Vaters Zimmer waren die Läden geschlossen, und sie erinnerte sich plötzlich, wie er die Läden mit viel Lärm aufstieß und sich herauslehnte, um den Morgen zu betrachten, und dann sein Kinn mit dem Pinsel einseifte, dabei den mageren Hals anspannte und sagte: »Geh mir Tabak holen. Mach dich nützlich, wenn du schon nicht ergötzlich bist.« Und ihr war, als sähe sie ihn in den Garten hinausgehen mit dem Monokel, der weißen Flanellhose und den langen Beinen, die etwas krumm waren, weil er in seiner Jugend viel geritten ist. Und sie fragte sich, wo der Vater wohl jetzt war. Sie glaubte an die Hölle, das Fegefeuer und das Paradies und dachte, dass der Vater jetzt im Fegefeuer sein müsse, um die bösen Dinge zu bereuen, die er so oft zu ihnen gesagt hatte, vor allem, wenn er Ippolito wegen des Tabaks und wegen des Hundes quälte, und wer weiß, wie sehr er sich wunderte, dass es das Fegefeuer gab, da er doch so oft gesagt hatte, er sei fast sicher, dass es für die Toten nichts gebe, und das sei besser so, weil man dann endlich schlafen könne, denn er schlief meistens sehr schlecht.
Das Dienstmädchen trat ein und sagte, Signor Giuma sei gekommen. Es war der Junge vom Pingpong. Er kam pfeifend ins Zimmer gelaufen, die Haare in der Stirn, und warf die mit einem Lederriemen zusammengebundenen Bücher auf den Tisch. Er war überrascht, als er Anna sah, und grüßte sie kühl und schüchtern, indem er die Schultern etwas nach vorne neigte. Er begann im Zimmer herumzusuchen und pfiff dabei. Aus einer Schublade zog er ein Heft und einen Leimtopf und fing an, etwas in das Heft einzukleben: große Photographien von Filmschauspielern, die aus Illustrierten ausgeschnitten waren. Es schien eine sehr wichtige und sehr umständliche Beschäftigung, denn der Junge schnaufte und schnaubte und warf sich immer wieder die Haare aus der Stirn. Neben dem Tisch stand ein großer drehbarer Globus, auf dem er ab und zu ein Land suchte und eilig unter die Gesichter der Filmschauspieler schrieb. Dann kam das rothaarige Mädchen. Sie trug ihre Haare ganz kurz und auf eine Weise geschnitten, die in jenem Jahr Mode war und die man »à la fièvre typhoïde« nannte. Doch nur die Haare waren modisch; das Kleid dagegen war weit und ohne Anmut, mit rundem Ausschnitt und von einer hässlichen zitronengelben Farbe. Das Mädchen hatte wie immer einen Besen in der Hand und kehrte wütend den Teppich, dann sagte sie: »Giuma, so langweilt sich das Mädchen. Lass die Schauspieler sein und zeig ihr die Kinderzeitschrift Il tesoro del fanciullo oder geh mit ihr in den Garten Pingpong spielen.«
Sie schauten den Il tesoro del fanciullo an. Es waren viele Bände, und man sah alles Mögliche: Blumen und Vögel und Autos und Städte. Vor jedem Bild wartete Giuma einen Augenblick, und sie schauten beide. Dann sagte er: »Gesehen?«, und sie sagte: »Ja, gesehen« und »ja« waren die einzigen Worte, die sie wechselten. Giumas magere braune Hand blätterte die Seiten um. Anna schämte sich, dass sie gedacht hatte, sie könnten Freunde werden. Plötzlich tönte ein großer Lärm durchs ganze Haus, und sie zuckte zusammen und Giuma lachte – er hatte weiße spitze Zähne wie ein Fuchs. Er sagte: »Das ist der Gong. Wir müssen zum Essen gehen.«
Der alte Herr saß am oberen Tischende. Er war schwerhörig und trug auf der Brust ein schwarzes Kästchen mit einem Draht, der an seinem Ohr befestigt war. Er hatte einen weißen Bart, den er über die Serviette hob, als er zu essen begann, er hatte ein Magengeschwür und konnte nur gekochtes Gemüse und Brei essen. Neben ihm saß das rothaarige Mädchen, das Amalia hieß, und sie legte ihm das Essen auf den Teller und goss Öl darüber und füllte sein Glas mit Mineralwasser. Am anderen Tischende saß die Dame des Hauses mit einem blauen, langhaarigen Pullover und einer kleinen Perlenkette um den Hals; dann kam einer, von dem man nicht recht wusste, wer er war, er war kein Gast, denn er trug Pantoffeln; neben ihm saß Giuma und goss ihm Wasser in den Wein, um ihn zu ärgern, und lachte dann hinter vorgehaltener Hand; der andere achtete nicht auf ihn und unterhielt sich mit dem alten Herrn über die Börse, er musste aber laut schreien, weil das Kästchen ein bisschen kaputt war. Dann begannen alle von Amalias neuer Frisur »à la fièvre typhoïde« zu sprechen, und die Dame des Hauses sagte, sie wolle sich auch so frisieren lassen, weil sie von ihren Ponyfransen genug hatte. Amalia schrie alles, was gesagt wurde, dem alten Herrn ins Ohr. Das Kästchen hieß »Papas Apparat«, und auch der alte Herr sagte von sich selbst »Papa«. Er sagte: »Heute will Papa nach dem Essen ein langes Schläfchen machen. Papa ist sehr alt.« Dann begann die Dame des Hauses sich aufzuregen und zum Fenster hinauszuschauen, weil Emanuele immer noch nicht da war. Emanuele war der, der ungefähr Ippolitos Alter hatte, und er kam erst gegen Ende des Essens. Er hinkte und war ganz rot und verschwitzt von der Anstrengung des Hinkens. Er glich Giuma, nur hatte er keine Fuchszähne, er hatte breite, quadratische Zähne, die über die Lippen vorstanden. Nach dem Essen wickelten sie den alten Herrn auf dem Sofa in eine Wolldecke und legten ihm einen Schal über die Augen, weil er sonst nicht schlafen konnte, und verließen ihn.
Anna und Giuma spielten Pingpong. Sie hatte ihm gesagt, dass sie nicht spielen konnte, denn jetzt wusste sie ja, dass sie keine Freunde würden, und darum war es ihr gleichgültig, was er von ihr dachte. Er sagte, er würde es ihr beibringen, es sei ganz einfach. Während sie spielten, kam der mit den Pantoffeln und sah ihnen zu. Er hieß Franz. Er war klein, hatte helle Augen und ein braungebranntes, zerfurchtes Gesicht. Er und Giuma begannen zu boxen und sich im Garten hinterherzulaufen. Anna blieb sitzen, schaute ihnen nach und spielte mit dem Pingpong-Ball. Als es dunkel wurde, rief Signora Maria vom Fenster aus nach Anna, und sie ging wieder nach Hause.
Der Vater wurde beerdigt. Anna hatte sich eine echte Beerdigung vorgestellt mit Priestern und weißgekleideten Frauen und einem Kreuz. Aber sie hatte vergessen, dass der Vater die Priester nicht leiden konnte. Darum gab es weder Priester noch weißgekleidete Frauen. Ein paar Verlobte von Concettina waren da, nur die wichtigsten: Danilo und zwei oder drei andere. Auch der Klavierlehrer war da und wollte immer noch wissen, womit er den Vater beleidigt hatte, und fragte Concettinas Verlobte und Signora Marias Neffen danach. Während der Vater krank war, hatte er ihm mehrere Briefe geschrieben, in denen er erklärte, er verzweifle fast vor Kummer darüber, dass er ihn beleidigt habe, er wisse zwar nicht wie, aber er bitte ihn auf jeden Fall um Entschuldigung. Doch der Vater hatte keinen dieser Briefe gelesen, weil er schon zu krank war.
Sie begruben den Vater neben der Mutter auf dem Friedhof, und Concettina begann laut zu schluchzen. Dann verabschiedeten sich die, die gekommen waren, geheimnisvoll und feierlich, wie man die Verwandten der Toten zu grüßen pflegt; und sie gingen wieder nach Hause und setzten sich zum Mittagessen, und es gab Pasta und Gemüse, wie an irgendeinem anderen Tag.
Signora Maria ließ nun ihren Neffen zum Duschen kommen, weil er diese Möglichkeit in seinem Untermietzimmer nicht hatte und die öffentlichen Bäder immer überfüllt waren, und Concettina ärgerte sich darüber und sagte zu Ippolito, jetzt würden sie wohl dauernd diesen Neffen von Signora Maria vor der Nase haben. Ippolito musste nun nicht mehr Maschine schreiben und vorlesen: Er lernte für sein Anwaltsexamen, indem er mit einem Buch in der Hand auf der Terrasse auf und ab ging; jeder wusste, dass er jetzt machen konnte, was er wollte; Giustino brachte vier weiße Mäuse in einem Käfig nach Hause, die er von seinem Ersparten gekauft hatte, und sagte, er werde sie zähmen, und Signora Maria beklagte sich, weil sie entsetzlich stanken. Anna glaubte, dass man in einem Haus, wo jemand gestorben ist, sehr lange Zeit nicht mehr lachen dürfe – doch wenige Tage nach dem Begräbnis lachte Concettina wie eine Verrückte mit ihr und Giustino, weil sie sich aus der Wolle einer Matratze einen künstlichen Busen gemacht hatte.
Es herrschte jetzt große Freiheit im Hause, doch war diese Freiheit ein wenig erschreckend. Es gab niemanden mehr, der befahl. Manchmal versuchte Ippolito ein bisschen zu befehlen, aber niemand hörte auf ihn, und er zuckte die Achseln und ging wieder auf die Terrasse und wanderte auf und ab. Er stritt sich mit Signora Maria wegen des Geldes. Signora Maria sagte, Ippolito sei geizig, und außerdem sei er argwöhnisch und misstraue ihr. Jetzt musste man an die Trauerkleider denken. Ippolito wollte dafür aber kein Geld geben, weil, sagte er, nur wenig Geld da war: Er sagte, sie sollten die Sachen zu Hause färben wie viele andere Leute auch. Signora Maria kaufte in der Drogerie Briefchen mit schwarzem Pulver und weichte die Kleider damit in einem großen Topf ein: Es entstand eine Brühe, die aussah wie Linsensuppe. Doch als die Kleider getrocknet und gebügelt waren, ärgerte sich Concettina, weil kein schönes tiefes, sondern ein bräunliches Schwarz dabei herausgekommen war. Wegen dieser Kleidergeschichte schmollte Concettina noch viele Tage mit Ippolito, denn man hätte ja, sagte sie, ohne weiteres ein billiges Stöffchen kaufen können: Und sie setzte sich zum Essen nicht mehr mit an den Tisch, sondern trug die Mahlzeit in ihr Zimmer hinauf.
Anna glaubte, sie würde nie mehr in das Haus gegenüber spielen gehen. Giuma rief sie jedoch wieder. Sie gewöhnten sich daran, miteinander zu spielen, und es verging kein Tag, ohne dass er sie rief. Anna machte es keinen großen Spaß, mit ihm zu spielen. Sie spielte viel lieber mit ihren Schulkameradinnen auf der Straße. Doch wenn Giuma sie rief, traute sie sich nicht, nein zu sagen. Sie wusste nicht genau, warum, aber sie traute sich nicht. Vielleicht, weil sie hoffte, er würde ihr irgendwann einmal den Il tesoro del fanciullo leihen: Darum zu bitten, wagte sie nicht. Ein wenig war sie auch stolz, dass er sie rief. Sie spielten fast nie Pingpong, Giuma wollte immer die Filme nachspielen, die er gesehen hatte. Er band sie mit einem Strick an einen Baum und tanzte mit einem brennenden Papier um sie herum, und ihr taten die Arme weh, weil er sie so fest angebunden hatte. Wenn dieses Spiel aus war, begann er zu reden. An jenem ersten Tag hatte er fast nichts gesagt, aber jetzt redete er so viel, dass es sie sogar langweilte. Er erzählte Geschichten, die er erlebt hatte; doch ihr kam es so vor, als sei fast alles erfunden. Er erzählte von Preisen, die er bei Rugbywettspielen und Ruderregatten gewonnen hatte, goldene und silberne Pokale, die man aber nie sehen konnte, weil er sie verschenkt hatte oder Mammina sie an einem unzugänglichen Ort aufbewahrte. Manchmal kamen Emanuele und Amalia, Giumas Geschwister, auf den Balkon heraus und hörten zu und lachten laut. Emanuele sagte: »Witzbold.« Dann wurde Giuma wütend und lief davon, in sein Zimmer hinauf. Wenn er zurückkam, hatte er gerötete Augen und wirres Haar. Eine Weile saß er schweigend im Gras, aber dann fand er den Strick wieder, und das Spiel mit dem Strick und dem Baum begann von vorn. Wenn Anna abends nach Hause kam, hatte sie den Kopf voll von Giumas Geschichten, von den Rugbywettspielen und den Ruderregatten und seinen Freunden Cingalesi, Pucci, Donadio, Priscilla und Toni. Diese Freunde hatten seltsame Namen, und man wusste nie, ob es sich um Mädchen oder Jungen handelte. Und sie verstand auch nicht, warum er sie nie zu sich in den Garten einlud und lieber mit einem Mädchen spielte, das noch nie im Leben an einer Ruderregatta teilgenommen hatte. Vielleicht konnte er bei diesen Freunden nicht so gut prahlen und erfinden. Er spazierte auf der Wiese auf und ab, zog den Strick hinter sich her und prahlte und erfand. Anna saß im Gras, und der Hals tat ihr weh vom vielen Nicken, und auch die Lippen taten ihr weh vom vielen falschen Lächeln. Ab und zu stellte sie ihm eine Frage. Es waren vorsichtige Fragen, über die sie erst eine Weile nachdachte. Sie fragte: »Ist Rugbyspielen schön?« oder: »War Cingalesi auch dabei?« Von Toni sprach sie lieber nicht, weil sie nie begriffen hatte, ob das ein Junge oder ein Mädchen war.
Dann begann Giuma von der Abreise zu reden. Er verbrachte den Winter in Mentone, wo die Familie eine Villa besaß. Giuma ging nicht zur Schule, er wurde von Hauslehrern unterrichtet, und später würde er vielleicht in ein Internat in der Schweiz gehen, wo man den ganzen Tag Rugby spielte. Beim Gedanken an seine Abreise fühlte sich Anna sehr erleichtert. Sie würde wieder mit ihren Freundinnen auf der Straße spielen: Da gab es zwar auch Jungen, die sie manchmal schlugen. Aber sie banden sie nicht an Bäume. Einmal hatte Giuma sie an den Baum gebunden, als es schon fast dunkel war, und gesagt, er gehe in die Küche und hole ein Messer, um sie zu schlachten und aufzuessen. Sie blieb allein in dem fast dunklen Garten, und plötzlich bekam sie Angst und begann zu rufen: »Giuma, Giuma!«, und es wurde immer dunkler und die Arme taten ihr weh. Da kam Emanuele heraus und zerschnitt den Knoten mit seinem Taschenmesser und führte sie ins Badezimmer, wo er ihre Arme mit Vaseline einrieb, weil sie ganz violett und aufgeschürft waren. Er sagte: »Dieser Schuft von einem Bruder!«
Im Haus wurden die Teppiche eingerollt, und überall standen Koffer und Kisten. Nur Emanuele fuhr nicht mit, weil er an der Universität Vorlesungen besuchen musste. Eigentlich wollte auch Amalia nicht mit, und Mammina sagte, wenn sie wirklich keine Lust habe, so könne sie ja auch zu Hause bleiben, aber der alte Herr sagte, Amalia sei überanstrengt und brauche Meeresluft. Man hörte Amalia weinen, weil sie nicht wegwollte. Da sagte der alte Herr zu Franz, er solle versuchen, sie zu überreden, und Franz sprach mit ihr und kam bald zurück und sagte, sie habe sich entschlossen mitzukommen.
So sah man sie eines Morgens alle ins Auto steigen, Giuma mit dem Hund im Arm und Amalia und Franz, der fahren musste, und Mammina und der alte Herr. Mammina trug einen sehr weiten sportlichen Mantel und eine schwarze Brille: Und Amalia hatte auch einen sportlichen Mantel an, der so ähnlich geschnitten war, aber Concettina, die aus dem Fenster schaute, sagte, sie sehe aus wie das Dienstmädchen. Der alte Herr ließ sich eine Menge Zeitungen bringen und schob sie schichtweise unter seinen Regenmantel, weil es, sagte er, nichts Besseres als Zeitungen gebe, um den Bauch vor Kälte zu schützen. Emanuele blieb allein auf dem Gehsteig zurück und winkte mit dem Taschentuch, er sah Anna am Fenster und sagte ihr, sie könne herüberkommen, wann sie wolle, um Giumas Bücher zu lesen und den Globus zu betrachten, wenn sie Erdkunde lernen müsse. Er wirkte gar nicht traurig, dass er allein war, und ging hinkend und hüpfend ins Haus zurück und rieb sich energisch die Hände.
III
ANNA VERSUCHTE ZWEI- ODER DREIMAL, mit ihren Schulkameradinnen auf der Straße zu spielen; aber das Spielen machte ihnen keinen großen Spaß mehr, sie gingen jetzt lieber Arm in Arm am Flussufer spazieren und schwatzten. Es gab so viel zu erzählen, und Spielen war nicht mehr besonders schön. Auch Giustino ging mit seinen Freunden am Flussufer spazieren, er war nun ein großer Junge, der Ippolitos abgelegte Kleider trug und sich Pomade ins Haar strich. In der Karnevalszeit ging er in die Schaubuden und erzählte Anna dann, er habe mit einem Mann Karten gespielt, der die Karten mit den Füßen hielt. Er brauchte dauernd Geld und verkaufte die weißen Mäuse einem Freund, weil er sie sowieso nicht mehr mochte und immer vergaß, sie zu füttern. Manchmal war er sehr freundlich zu Anna, und zwar immer dann, entdeckte sie, wenn er etwas brauchte, zehn Lire oder Annas grauen Pullover, der ihm sehr gefiel. Er trug ihn so oft, dass er schon ganz aus der Form geraten war. In der Schule war er schlecht, und Ippolito gab ihm abends Griechisch-Nachhilfe und verlor ab und zu die Geduld und prügelte ihn, und Giustino sprang vom Balkon und lief weg. Ippolito zuckte die Schultern und sagte, er pfeife darauf. Einmal blieb Giustino die ganze Nacht fort, und am Morgen wollte Signora Maria die Polizei anrufen. Doch dann kam Giustino zurück. Er sagte zu niemandem ein Wort und ging in die Küche und frühstückte. Seine Hose war mit Kot bespritzt, und seine Hände waren ganz zerkratzt. Er sprach den ganzen Tag nicht, und später sagte er zu Signora Maria, er sei zurückgekehrt, aber er wolle keine Nachhilfestunden mehr bei Ippolito, sonst verschwinde er wieder, und zwar für immer. Ippolito sagte, Giustino solle nur selber sehen, wie er mit dem Griechisch zurechtkomme, ihm sei das ganz gleich, er pfeife darauf.
Plötzlich wurden Emanuele und Ippolito dann Freunde. Das war merkwürdig, weil Ippolito noch nie mit jemandem befreundet gewesen war, man hatte nie gehört, dass er einen Freund gehabt hätte. Emanuele und er begannen sich am Gartentor miteinander zu unterhalten; sie liehen sich Bücher, und eines Tages, als Anna aus der Schule kam, saß Emanuele mit den anderen beim Mittagessen und aß Gemüsesuppe. Er zwinkerte ihr zu und sagte: »Wir sind ja alte Freunde«, und nach dem Essen bestand er darauf, dass sie die Ärmel ihres Pullovers zurückschob, um nachzusehen, ob die Flecken von dem Strick noch sichtbar waren.
Anna glaubte, Emanuele würde einer von Concettinas üblichen Verlobten werden, die ihr Briefe schrieben, Blumen schenkten, mit ihr ins Kino gingen und sich in sie verliebten. Aber nein. Emanuele interessierte sich nicht besonders für Concettina. Er war liebenswürdig zu ihr und brachte ihr Modejournale, die er in Mamminas oder Amalias Zimmer gefunden hatte. Er war liebenswürdig, aber er sagte ihr auch alles, was ihm an ihr nicht gefiel: ihre Art sich anzuziehen, ihre Art zu gehen und ihre Art sich zu schminken. Wenn Ippolito nicht da war, plauderte er mit ihr im Wohnzimmer, sie blätterten miteinander in den Journalen, und er erklärte ihr, wie sie sich anziehen müsste. Concettina sagte, sie habe nicht genug Geld, um sich gut anzuziehen. Er aber fand, das habe nichts mit Geld zu tun, man brauche nur Amalia anzuschauen, um das zu begreifen, sie ging zu einer der teuersten Schneidereien von Turin und lief immer wie ein Dienstmädchen herum. Immer, wenn er von Amalia sprach, seufzte er und kratzte sich am Kopf. Jetzt hatte sie sich das Haar ›à la fièvre typhoïde‹ schneiden lassen und sah abscheulich aus. Sie hatte sich in diesen Franz verliebt. Er, Emanuele, hatte es schon lange bemerkt, außer ihm ahnte aber keiner im Haus etwas. Diesen Franz hatte Mammina in Monte Carlo aufgegabelt und mit nach Hause geschleppt. Er hatte ihr erzählt, er sei der Sohn eines deutschen Barons und wegen der Nazis aus Deutschland geflohen, denn sein Vater sei ein hoher General des Kaisers gewesen und glaube immer noch an die Krone. Mammina war naiv und glaubte alles, und Papa war schwerhörig und sanftmütig und schluckte alles, was Mammina ihm auftischte, so wie er auch den Brei schluckte, den man ihm zum Essen vorsetzte. Aber er, Emanuele, hatte diesem Franz vom ersten Augenblick an misstraut und das Gefühl gehabt, an seiner Geschichte sei irgendetwas faul. Und dass Amalia sich nun in diesen Typ verliebt hatte, war schlimm. Emanuele glaubte, so einer würde sich eine Geldheirat nicht zweimal überlegen. »Es ist besser, kein Geld zu haben«, sagte Emanuele zu Concettina und gab ihr einen Klaps auf die Wange. Doch kaum tauchte Ippolito auf, wollte Emanuele, dass Concettina sie im Wohnzimmer allein ließ, und sie ging mit dem Modejournal beleidigt hinaus.
Emanuele und Ippolito diskutierten unermüdlich, man verstand aber nicht recht worüber, denn wenn jemand hereinkam, begannen sie Deutsch zu reden. Concettina sagte, sie redeten sicher über Schweinereien, sonst müssten sie nicht eine Sprache sprechen, die nur sie verstanden, und allein im Wohnzimmer sitzen. Manchmal blieb Emanuele bis spät in die Nacht, und man hörte, wie sie im Wohnzimmer auf- und abgingen und diskutierten, und plötzlich hörte man auch Emanueles Gelächter: Er hatte eine Art zu lachen, die dem Gurren der Tauben glich. Dann ging Emanuele, und Ippolito blieb noch wach und lernte für seine Examen, weil er nie Schlaf brauchte und seit den Memoiren des Vaters gewöhnt war, nachts wach zu sein. Jetzt aber schien er nicht mehr derselbe Junge, der dem Vater Spritzen gegeben und Goethe vorgelesen hatte, der unterwürfige, müde Junge, den der Vater wegen des Tabaks und des Hundes quälte. Seit er mit Emanuele befreundet war, hatte er leuchtende und unruhige Augen, die immer etwas zu suchen schienen, und sein Schritt war rasch und energisch, wenn er Emanuele ans Gartentor entgegeneilte. Manchmal saß er stundenlang allein im Wohnzimmer, streichelte sich das Gesicht, lächelte und murmelte vor sich hin. Anna fragte ihn, ob er nicht den Hund von ›Le Visciole‹ holen wolle: Sie hatte sich vorgestellt, er würde ihn nach dem Tod des Vaters schnellstens herbringen. Aber er machte ein seltsames Gesicht, als er vom Hund reden hörte. Merkwürdig bitter verzog er seinen Mund, als erinnerte er sich plötzlich an die bitterbösen Dinge, die der Vater immer zu ihm gesagt hatte, als er noch nicht wusste, dass er bald sterben würde, und immer vom eigenen Tod sprach und von dem Tag, an dem Ippolito mit dem Hund in der Stadt spazieren gehen würde. Der Hund blieb auf ›Le Visciole‹ und fraß weiter das faule Zeug des Pächters, das machte er ja seit Jahren und musste sich wohl daran gewöhnt haben.
Eines Abends, als sie mit dem Abendessen fast fertig waren, kam Emanuele zusammen mit Danilo. Es war das erste Mal, dass Danilo einen Fuß ins Haus setzte, und Concettina wurde ganz rot, sie bekam sogar rote Flecken am Hals. Concettina schälte eine Apfelsine und vertiefte sich ganz ins Schälen, sie schaute Danilo nicht an, und Danilo warf ihr nur einen raschen und schlauen Blick zu und redete dabei weiter mit Ippolito, der ihm sagte, er habe ihn schon lange erwartet. Signora Maria war sehr erschrocken, weil Danilo sie immer erschreckt hatte mit seiner schlechten Gewohnheit, ewig vor dem Gartentor zu stehen. Danilo und Concettina hatten sich beim Tanzen kennengelernt und waren dann ein paarmal miteinander spazieren gegangen, aber Concettina sagte, er habe etwas sehr Vulgäres zu ihr gesagt, etwas sehr Vulgäres, und Signora Maria fragte, was, aber Concettina wollte es nicht wiederholen. Er kam aus einer guten Familie, die aber verarmt war, und seine Mutter musste nun als Kassiererin in einer Konditorei arbeiten. Und er hatte eine etwas leichtfertige Schwester. Concettina hatte ihn wissen lassen, dass sie ihn nicht mehr zu sehen wünsche. Er fand sich damit aber nicht ab und stand immer am Gartentor, und wenn Concettina ausging, so folgte er ihr, ohne sie anzusprechen, aber mit einem Ohrfeigengesicht, sagte Concettina. Und nun hatte ihn Emanuele mit ins Haus gebracht, und Ippolito hatte zu ihm gesagt, er habe ihn schon lange erwartet, und da saß er jetzt ruhig am Tisch und schälte eine Apfelsine, die Ippolito ihm angeboten hatte. Doch als er die Apfelsine gegessen hatte, bat ihn Ippolito, mit ihm ins Wohnzimmer hinaufzugehen, Emanuele dagegen blieb sitzen und versuchte Signora Maria davon zu überzeugen, dass Danilo ein guter Junge sei, es könne nicht sein, dass er etwas Vulgäres zu Concettina gesagt habe, das müsse ein Missverständnis sein. Und es stimme auch nicht, dass seine Schwester leichtfertig sei, er, Emanuele, habe die Schwester gesehen, und sie habe einen sehr ernsthaften Eindruck auf ihn gemacht: Danilo habe übrigens eine ganze Menge Schwestern, die zwischen drei Monaten und sechzehn Jahren alt waren. Doch Concettina sagte, es sei kein Missverständnis gewesen, er habe wirklich etwas sehr Vulgäres gesagt, sie wolle Danilo nicht im Haus, und damit rannte sie wütend hinaus und schlug die Tür zu. Emanuele und Ippolito redeten bis spät in die Nacht mit Danilo im Wohnzimmer, und Signora Maria hatte ihre Handarbeit dort vergessen und wollte hinaufgehen und sie holen, aber Giustino sagte, sie solle es bleibenlassen und nicht stören. Von diesem Abend an kam Danilo zu jeder Tageszeit mit Emanuele, und Ippolito schloss sich mit ihnen im Wohnzimmer ein. Und Ippolito sagte zu Concettina, er empfange im Haus, wen er wolle, und Concettina begann laut zu schluchzen, und um sie zu trösten, ging Emanuele mit ihr ins Kino, wo Anna Karenina