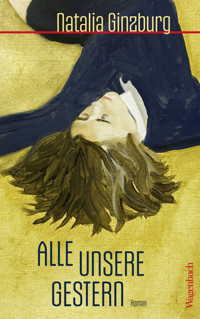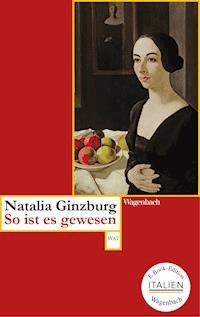
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Klaus Wagenbach
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: E-Book-Edition ITALIEN
- Sprache: Deutsch
Die lakonisch erzählte Geschichte einer klassischen Dreierbeziehung: Liebe, Leidenschaft, Verzweiflung, Eifersucht – und am Ende ein tödlicher Schuss. Mit diesem von Italo Calvino enthusiastisch begrüßten Roman erlebte Ginzburg, die zu den bedeutendsten modernen Autoren Italiens zählt, ihren literarischen Durchbruch.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 157
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Aus dem Italienischen von Maja Pflug
Die italienische Originalausgabe erschien 1947 unter dem Titel E’ Stato Così bei Giulio Einaudi Editore, Turin. Die erste deutsche Ausgabe erschien 1992 im Verlag Klaus Wagenbach.
E-Book Ausgabe 2017
© 1947 Giulio Einaudi, Editore s.p.a., Torino
© 1992, 2003, 2008, 2017 für die deutsche Ausgabe:
Verlag Klaus Wagenbach, Emserstr. 40/41, 10719 Berlin
Covergestaltung: Julie August unter Verwendung des Bildes Portrait Hena Rigotti von Felice Casorati (1924) © Bridgeman Images/VG Bildkunst, Bonn 2016. Das Karnickel zeichnete Horst Rudolph. Datenkonvertierung bei Zeilenwert, Rudolstadt
Alle Rechte vorbehalten. Jede Vervielfältigung und Verwertung der Texte, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Zustimmung des Verlags urheberrechtswidrig und strafbar. Dies gilt insbesondere für das Herstellen und Verbreiten von Kopien auf Papier, Datenträgern oder im Internet sowie Übersetzungen.
ISBN: 978 3 8031 4221 4
Auch in gedruckter Form erhältlich: ISBN 978 3 8031 2773 0
www.wagenbach.de
ICH HABE ZU IHM GESAGT: »Sag mir die Wahrheit«, und er hat gesagt: »Welche Wahrheit?« und zeichnete rasch etwas in seinen Notizblock. Er hat es mir hinterher gezeigt, es war ein langer, langer Zug mit einer großen schwarzen Rauchwolke, und er beugte sich aus dem Zugfenster und winkte mit dem Taschentuch.
Ich habe ihm in die Augen geschossen.
Er hatte mich gebeten, ihm eine Thermosflasche für die Reise fertigzumachen. Ich bin in die Küche gegangen und habe Tee gekocht, Milch und Zucker dazugetan und ihn in die Thermosflasche gefüllt, dann habe ich den Becher fest zugeschraubt und bin ins Arbeitszimmer zurückgegangen. Da hat er mir die Zeichnung gezeigt, und ich habe den Revolver aus seiner Schreibtischschublade genommen und auf ihn geschossen. Ich habe ihm in die Augen geschossen.
Aber ich dachte schon sehr lange, daß ich ihm früher oder später etwas antun würde.
Dann habe ich mir Regenmantel und Handschuhe angezogen und bin gegangen. Ich habe in der Bar einen Kaffee getrunken und bin aufs Geratewohl durch die Stadt gelaufen. Der Tag war recht kühl, und es wehte ein leichter Wind, der nach Regen schmeckte. In den Anlagen habe ich mich auf eine Bank gesetzt, die Handschuhe abgestreift und meine Hände betrachtet. Ich habe den Ehering abgenommen und eingesteckt.
Vier Jahre lang waren wir Mann und Frau. Er sagte mir, daß er mich verlassen wollte, doch dann starb unsere Tochter, und deshalb blieben wir zusammen. Er wollte, daß wir noch ein Kind bekommen, das würde mir guttun, meinte er, so schliefen wir oft zusammen in der letzten Zeit. Aber es gelang uns nicht, noch ein Kind zu bekommen.
Ich kam dazu, wie er Koffer packte, und fragte ihn, wo er hinführe. Er sagte, er führe nach Rom, um mit einem Rechtsanwalt über einen bestimmten Fall zu entscheiden. Ich könnte zu meinen Eltern gehen, dann wäre ich nicht allein zu Haus, solange er fort sei. Er wisse nicht genau, wann er aus Rom zurückkäme, in vierzehn Tagen, in einer Woche, er wisse es nicht. Ich dachte, er käme vielleicht überhaupt nicht wieder. Also habe ich auch Koffer gepackt. Er sagte, ich solle ein paar Romane zum Lesen mitnehmen, damit ich mich nicht langweile. Ich habe den Jahrmarkt der Eitelkeiten und zwei Bücher von Galsworthy aus dem Regal genommen und in meinen Koffer gelegt.
Ich habe gesagt: »Alberto, sag mir die Wahrheit«, und er hat erwidert: »Welche Wahrheit«, und ich habe gesagt: »Ihr fahrt zusammen weg«, und er hat gesagt: »Wer, zusammen?« Und hinzugefügt: »Du phantasierst immer herum und verzehrst dich innerlich, indem du dir dauernd schreckliche Sachen vorstellst, und so hast du keine Ruhe und läßt auch den anderen keine Ruhe.«
Er hat zu mir gesagt: »Nimm den Bus, der um zwei in Maona ankommt«, und ich habe geantwortet: »Ja.«
Er hat zum Himmel geschaut und zu mir gesagt: »Am besten ziehst du den Regenmantel und die Gummistiefel an.«
Ich habe gesagt: »Es ist mir lieber, ich weiß die Wahrheit, wie auch immer«, und er hat zu lachen angefangen und gesagt:
Verità va cercando, ch’è sí cara,
Come sa chi per lei vita rifiuta.*
Ich weiß nicht, wie lange ich dort auf der Bank gesessen habe. Die Anlagen waren menschenleer, die Bänke feucht vom Nebel, und der Boden war mit faulenden Blättern bedeckt. Ich dachte darüber nach, was ich tun sollte. In Kürze würde ich zum Polizeipräsidium gehen, sagte ich mir. Ich würde versuchen zu erklären, wie die Dinge sich in etwa zugetragen hatten, aber es würde nicht leicht sein. Man mußte beim ersten Tag beginnen, als wir uns bei Doktor Gaudenzi zu Hause kennengelernt haben. Er spielte mit Doktor Gaudenzis Frau vierhändig Klavier und sang irgendwelche Liedchen im Dialekt. Er sah mich an. Dann machte er mit Bleistift eine Zeichnung meines Gesichts in seinen Notizblock. Ich habe gesagt, sie schiene mir recht ähnlich zu sein, doch er hat nein gesagt und das Blatt herausgerissen. Doktor Gaudenzi hat gesagt: »Es gelingt ihm nie, Frauen zu porträtieren, die ihm gefallen.« Sie haben mich an einer Zigarette ziehen lassen und sich darüber amüsiert, wie mir die Augen tränten. Alberto hat mich in die Pension zurückbegleitet und gefragt, ob er mich am nächsten Tag besuchen und mir einen französischen Roman mitbringen dürfe, von dem er mir erzählt hatte.
Tags darauf ist er gekommen. Wir sind ein wenig spazierengegangen und haben uns dann in ein Café gesetzt. Er schaute mich mit lustigen, leuchtenden Augen an, und ich dachte, er sei vielleicht in mich verliebt. Da es mir noch nicht passiert war, von einem Mann geliebt zu werden, war ich sehr froh und wäre noch stundenlang mit ihm im Café geblieben. Abends sind wir ins Theater gegangen, und ich habe das schönste Kleid angezogen, das ich besaß, ein granatfarbenes Samtkleid, das meine Cousine Francesca mir geschenkt hatte.
Francesca war auch im Theater. Sie saß hinter uns und winkte mir zu. Als ich am nächsten Tag zu Onkel und Tante zum Mittagessen gegangen bin, hat Francesca mich gefragt: »Wer war denn der Alte?« – »Welcher Alte?« habe ich gesagt. Und sie: »Der Alte im Theater.« Da habe ich zu ihr gesagt, das sei einer, der mir den Hof machte, er sei mir aber ganz gleichgültig.
Als er wieder in die Pension kam, um mich zu besuchen, habe ich ihn genau angesehn, und so alt schien er mir gar nicht zu sein. Francesca behauptet immer von allen, sie seien alt. Aber er gefiel mir nicht, ich war nur sehr froh, wenn er zu mir in die Pension kam, weil er mich mit so lustigen und leuchtenden Augen ansah, und es macht einfach Freude, wenn da ein Mann ist, der einen so ansieht. Ich dachte, er sei vielleicht sehr verliebt in mich, der Ärmste, und stellte mir vor, wie er mich fragen würde, ob ich ihn heiraten wollte, die Worte, die er sagen würde. Und wenn ich dann nein sagte, würde er mich fragen, ob wir Freunde bleiben könnten, und mich weiter ins Theater ausführen, und eines Abends würde er mir einen jüngeren Freund von sich vorstellen, der sich heftig in mich verlieben würde, und den wollte ich dann heiraten. Wir würden viele Kinder bekommen, und Alberto würde uns besuchen und zu Weihnachten einen großen Panettone mitbringen und froh, aber ein wenig melancholisch sein.
Ich stellte mir immer eine Menge Dinge vor, wenn ich in der Pension auf meinem Bett lag, und dachte, wie schön es wäre, wenn ich heiratete und meine eigene Wohnung hätte. Ich stellte mir vor, wie ich meine Wohnung mit tausend eleganten Kleinigkeiten und Grünpflanzen einrichten wollte, und wie ich dann in einem großen Sessel liegend Taschentücher sticken würde. Der Mann, den ich heiraten würde, hatte einmal dieses Gesicht, einmal jenes, aber die Stimme war immer dieselbe, und innerlich hörte ich diese Stimme immer dieselben ironischen und zärtlichen Worte wiederholen. Es war eine finstere Pension mit dunklen Tapeten an den Wänden, und im Zimmer neben meinem wohnte die Witwe eines Oberst, die jedesmal, wenn ich einen Stuhl verrückte oder das Fenster öffnete, mit einer Bürste an die Wand klopfte. Morgens mußte ich früh aufstehen, um zu der Schule zu eilen, an der ich unterrichtete. Während ich mich rasch anzog, aß ich ein Brötchen und kochte mir auf dem Spirituskocher ein Ei. Wütend klopfte die Witwe des Oberst mit ihrer Bürste an die Wand, wenn ich im Zimmer herumlief und meine Kleider zusammensuchte, und die Tochter der Pensionseigentümerin, die hysterisch war, kreischte im Badezimmer wie ein Pfau, weil man ihr heiße Duschen verordnet hatte, die sie angeblich beruhigen sollten. Ich stürzte auf die Straße, und während ich in der eisigen Morgenluft einsam und allein auf die Trambahn wartete, unterhielt ich mich damit, eine Menge seltsamer Geschichten zu erfinden, die mich wärmten; daher kam ich manchmal mit einem so geistesabwesenden und entrückten Gesicht in die Schule, daß es bestimmt recht komisch aussah.
Einem Mädchen bereitet es großes Vergnügen zu denken, daß ein Mann vielleicht in sie verliebt ist, und auch wenn sie selbst nicht verliebt ist, wirkt es dann so, als wäre sie es, und sie wird viel hübscher, bekommt strahlende Augen, einen leichten Schritt und eine heiterere, sanftere Stimme. Bevor ich Alberto kennenlernte, dachte ich oft, ich würde immer allein bleiben, weil ich mich so farblos und unattraktiv fühlte, doch als ich ihm dann begegnet bin, war mir, als sei er in mich verliebt, und daraufhin sagte ich mir, daß ich, wenn ich ihm gefiel, auch einem anderen gefallen konnte, vielleicht sogar dem Mann mit der ironischen, sanften Stimme, der in mir sprach. Dieser Mann hatte einmal dieses, einmal jenes Gesicht, aber er hatte immer breite, kräftige Schultern und rote, etwas plumpe Hände und eine entzückende Art, sich über mich lustig zu machen, wenn er abends nach Hause kam und mich im Sessel liegend fand, wie ich Taschentücher stickte.
Wenn ein Mädchen viel allein ist und ein recht gleichförmiges, mühevolles Leben führt, mit wenig Kleingeld in der Tasche und abgewetzten Handschuhen, geht es in der Phantasie vielen Dingen nach und ist schutzlos den Irrtümern und Gefahren ausgesetzt, die die Phantasie jeden Tag für alle Mädchen bereithält. Schwache, wehrlose Beute der Phantasie, las ich in einem großen, kalten Klassenzimmer achtzehn kleinen Schülerinnen Ovid vor und aß in dem düsteren Speisesaal der Pension, wobei ich aus den gelbgestrichenen Fenstern sah und darauf wartete, daß Alberto mich zum Konzert oder zum Spazierengehen abholte. Am Samstag nachmittag bestieg ich den Bus an der Porta Vittoria und fuhr nach Maona. Am Sonntag abend kam ich zurück.
Mein Vater ist seit über zwanzig Jahren in Maona Landarzt. Er ist ein großer, fetter alter Mann, der leicht hinkt und sich beim Gehen auf einen Stock aus Kirschholz stützt. Im Sommer trägt er einen Strohhut mit schwarzem Band, und im Winter trägt er eine Bibermütze und einen Mantel mit Biberbesatz. Meine Mutter ist eine kleine Frau mit einem großen Kranz weißer Haare. Mein Vater wird kaum noch geholt, weil er alt ist und sich mühsam bewegt, die Leute holen statt dessen den Arzt aus Cavapietra, der Motorrad fährt und in Neapel studiert hat. Meine Eltern verbringen die Tage in der Küche, wo sie mit dem Tierarzt und dem Gemeinderat Schach spielen. Wenn ich samstags in Maona ankam, setzte ich mich an den Ofen und blieb den ganzen Sonntag bis zur Abfahrtszeit dort sitzen. Ich briet dort am Ofen und döste mit Polenta und Suppe vollgestopft vor mich hin, ohne ein einziges Wort zu sagen, und mein Vater erzählte dem Tierarzt zwischen einer Partie Schach und der nächsten, daß die modernen Mädchen keinen Respekt mehr haben und nicht ein Wort darüber verlieren, was sie eigentlich machen.
Wenn ich mich mit Alberto traf, redete ich über meinen Vater und meine Mutter und erzählte ihm, wie ich in Maona gelebt hatte, bevor ich in die Stadt kam und unterrichtete, ich erzählte ihm davon, wie mein Vater mir mit seinem Stock auf die Finger schlug und ich mich in die Kohlenkammer verkroch und weinte, oder wie ich Sklavin oder Königin unter der Matratze versteckte, um nachts darin zu lesen, oder wie wir zum Friedhof gingen, mein Vater und das Dienstmädchen und der Gemeinderat und ich, und mich auf der Straße, die zwischen Feldern und Weinbergen zum Friedhof hinunterführt, eine wahnsinnige Lust, weit fortzulaufen, überkam, wenn ich die Felder und die verlassenen Hügel betrachtete.
Alberto dagegen erzählte mir nie etwas von sich, und ich hatte mir angewöhnt, ihn nichts zu fragen, weil es mir noch nie in meinem Leben passiert war, daß sich jemand so sehr für mich interessierte und mich über alles ausfragte, so als ob es eine große Bedeutung hätte, was ich auf dem Weg zum Friedhof oder in der Kohlenkammer gesagt oder gedacht hatte. Daher war ich sehr froh und fühlte mich nicht mehr so allein, wenn ich mit Alberto durch die Stadt spazierte oder wir zusammen im Café saßen. Er hatte mir gesagt, daß er mit seiner Mutter zusammenwohne, die alt und krank sei. Doktor Gaudenzis Frau hatte mir erzählt, diese Mutter sei eine stinkreiche, verrückte Alte, die ihre Tage damit verbrachte, Sanskrit zu studieren, und mit einem elfenbeinernen Mundstück Zigaretten rauchte und niemanden sah, außer einem Dominikanermönch, der jeden Abend kam, um ihr die Paulusbriefe vorzulesen, seit Jahren gehe sie nicht mehr aus dem Haus, weil sie behauptete, wenn sie Schuhe anzöge, schmerzten ihr die Füße, sie sitze immer in ihrer Villa in einem Sessel, mit einer jungen Köchin, die sie beim Einkaufen bestahl und sie malträtierte. Aber Alberto sprach nicht gern von sich, und am Anfang war es mir egal, doch später bedauerte ich es ein wenig und versuchte, ihn hie und da etwas zu fragen, doch immer nahm sein Gesicht einen selbstvergessenen, abwesenden Ausdruck an, und seine Augen wurden trüb, wie es bei kranken Vögeln geschieht, wenn ich ihn nach seiner Mutter, nach seiner Arbeit oder nach seinem Leben fragte.
Er sagte mir nie, daß er in mich verliebt sei, aber ich glaubte es, weil er mich oft in der Pension besuchte und mir Bücher und Pralinen als Geschenk mitbrachte und wollte, daß wir zusammen ausgehen. Ich dachte, er sei vielleicht schüchtern und wagte es nicht, sich zu erklären, also wartete ich, daß er mir sagen würde, er sei in mich verliebt, um es Francesca zu erzählen. Francesca hatte immer soviel zu erzählen und ich nie etwas. Dann aber habe ich Francesca erzählt, er sei in mich verliebt, obwohl er mir nichts gesagt hatte, weil er mir braune Wildlederhandschuhe geschenkt hatte, und an dem Tag war ich mir sicher, daß er mich liebhatte. Und ich habe ihr gesagt, daß ich ihn nicht heiraten wollte, weil er zu alt sei, ich wußte zwar nicht genau, wie alt, aber er war bestimmt über vierzig und ich damals erst sechsundzwanzig. Doch Francesca hat mir geantwortet, ich solle mir den Typen vom Hals schaffen, der gefalle ihr nämlich überhaupt nicht, ich solle ihm seine Handschuhe um die Ohren hauen, hat sie zu mir gesagt, die seien überhaupt nicht mehr Mode, so mit Reißverschluß am Handgelenk, und gäben mir eine provinzielle Note. Sie hat zu mir gesagt, sie habe das Gefühl, als werde ich mit dem Typen da noch Scherereien kriegen. Francesca war damals erst zwanzig, doch ich hörte immer auf sie, weil sie mir sehr intelligent vorkam. Diesmal jedoch hörte ich nicht auf sie, sondern trug die Handschuhe immerzu, denn sie gefielen mir, auch wenn sie Reißverschlüsse hatten, und es gefiel mir, mit ihm zusammenzusein, also sah ich ihn weiterhin, weil es mir mit sechsundzwanzig Jahren noch nicht passiert war, daß ein Mann mir Geschenke machte und sich um mich kümmerte, und mein Leben erschien mir so trübsinnig und leer, ich dachte, daß Francesca gut reden hatte, sie, die einfach alles besaß, worauf sie Lust hatte im Leben, die reiste und immer viele unterhaltsame Dinge tat.
Und dann kam der Sommer, und ich fuhr nach Maona und wartete darauf, daß er mir schriebe, aber er hat mir nie geschrieben, außer einer Karte, auf der nur sein Name stand, von einem Dorf am See. Ich langweilte mich in Maona, und die Tage waren endlos. Ich saß in der Küche oder legte mich in mein Zimmer und las. Ein Handtuch um den Kopf gewickelt, schälte meine Mutter auf der Terrasse Tomaten und legte sie zum Trocknen auf ein Holzbrett, um sie dann einzumachen, mein Vater saß mit dem Tierarzt und dem Gemeinderat auf dem Mäuerchen am Platz vor unserem Haus und malte mit seinem Stock Zeichen in den Staub. Das Dienstmädchen wusch am Brunnen im Hof und wrang mit seinen roten, kräftigen Armen die Wäsche aus, die Fliegen summten über den Tomaten, und meine Mutter säuberte das Messer mit einer Zeitung und wischte sich die verschmierten Hände ab. Ich betrachtete die Karte, die Alberto mir geschickt hatte, ich kannte sie schon längst auswendig, den See und den Sonnenstrahl und die Segelboote, ich verstand nicht, warum er mir nur eine Karte geschickt hatte und sonst nichts. Jeden Tag wartete ich auf Post. Francesca schrieb mir zweimal aus Rom, wohin sie mit einer Freundin gefahren war, um an der Schauspielschule zu studieren, in einem Brief teilte sie mir mit, sie habe sich verlobt, und im nächsten sagte sie dann, es sei alles wieder aus. Oft dachte ich, Alberto würde mich vielleicht in Maona besuchen kommen. Mein Vater hätte sich im ersten Augenblick gewundert, doch ich wollte sagen, Alberto sei ein Freund von Doktor Gaudenzi. Ich ging in die Küche und trug den Abfalleimer hinaus, weil er stank, ich stellte ihn in die Kohlenkammer, aber das Dienstmädchen brachte ihn wieder zurück, weil sie fand, daß er überhaupt nicht stank. Ein bißchen fürchtete ich, daß er käme, weil ich mich schämte wegen des Abfalleimers und meiner Mutter mit dem Handtuch um den Kopf und den tomatenverschmierten Händen, und ein bißchen wartete ich auf ihn und glaubte immer, ihn zu sehen, wenn ich ans Fenster trat, um nachzuschauen, wer aus dem Bus stieg, und jedesmal, wenn ich einen kleinen Mann im weißen Regenmantel erblickte, bekam ich so etwas wie Herzklopfen und fühlte ein Zittern, doch dann war er es nicht, und ich ging ins Zimmer zurück und las und dachte nach bis zur Mittagessenszeit. Oft versuchte ich, wieder an den Mann mit der ironischen Stimme und den breiten Schultern zu denken, aber dieser Mann rückte in immer weitere Ferne, und sein unbekanntes und wandelbares Gesicht hatte keinen Sinn mehr für mich.