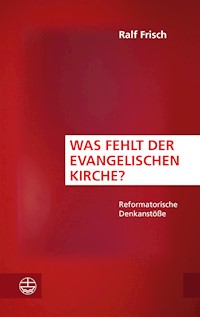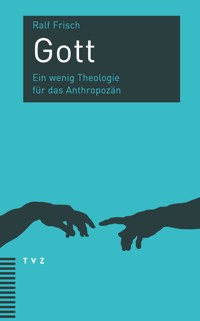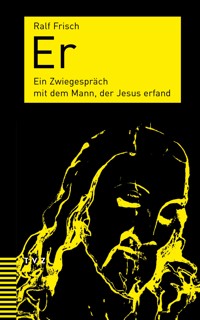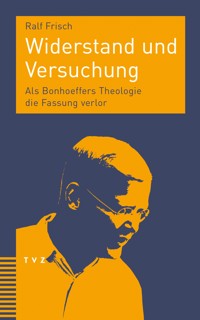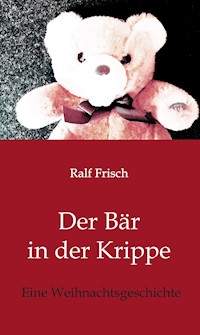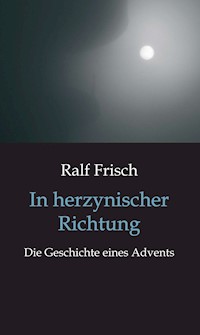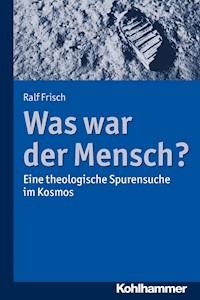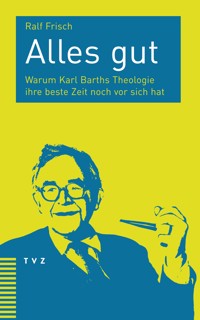
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Theologischer Verlag Zürich
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Am 10. Dezember 2018 jährt sich der Todestag Karl Barths zum fünfzigsten Mal. Seine Theologie gehört aber mitnichten der Vergangenheit an: Sie reicht weit über das 20. Jahrhundert hinaus. Barth wusste, dass Theologie mit den modernen Wissenschaften nicht konkurrieren kann. So setzte er an die Stelle verzweifelter Plausibilisierungsversuche in grosser Freiheit und Frechheit eine fiktionale Gegenerzählung. Diese Gegenerzählung ist zeitlos und zugleich auf der Höhe ihrer Zeit. Als Barth in seinem "Römerbrief" Theologie in expressionistische Literatur verwandelte, war er avantgardistischer als die Kulturprotestanten. Und als er anderthalb Jahrzehnte später seine "Kirchliche Dogmatik" begann, war er moderner als die literarisch Modernen. Ralf Frisch liest in seinem kühnen, glänzend geschriebenen Buch die "Kirchliche Dogmatik" als theologische Science-Fiction. Anhand der Frage nach Barths Aktualität zeigt er die wichtigsten Grundentscheidungen von Barths Dogmatik auf und gibt so eine Einführung in seine Theologie. Nicht zuletzt macht er der evangelischen Theologie Mut zu selbstbewussten, überlebensnotwendigen Erzählungen. Wie aktuell Karl Barths Theologie ist, hat einem selten mehr eingeleuchtet als bei dieser Lektüre.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 264
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ralf Frisch ∙ Alles gut
Ralf Frisch
Alles gut
Warum Karl Barths Theologie ihre beste Zeit noch vor sich hat
Theologischer Verlag Zürich
Gedruckt mit freundlicher Unterstützung der Schweizerischen Reformationsstiftung, der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern, der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Union Evangelischer Kirchen in der EKD und des Reformierten Bundes.
Der Theologische Verlag Zürich wird vom Bundesamt für Kultur mit einem Strukturbeitrag für die Jahre 2021–2025 unterstützt.
Bibliografische Informationen der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
UmschlaggestaltungSimone Ackermann, Zürich
Druckgapp print, Wangen im Allgäu
ISBN 978-3-290-18172-7 (Print)ISBN 978-3-290-18196-3 (E-Book: PDF)ISBN 978-3-290-18752-1 (E-Book: Epub)6. Auflage 2025© 2018 Theologischer Verlag Zürichwww.tvz-verlag.ch
Alle Rechte vorbehalten
Hersteller:TVZ Theologischer Verlag Zürich AG, Schaffhauserstr. 316, CH-8050 Zü[email protected]
Verantwortlicher in der EU gemäss GPSR:Brockhaus Kommissionsgeschäft GmbH, Kreidlerstr. 9, DE-70806 [email protected]
Weitere Informationen bezüglich Produktsicherheit finden Sie unter: www.tvz-verlag.ch/produktsicherheit
Für meine Eltern
Gerda und Lothar Frisch
»Heaven is a large and interesting place.«
FBI Special Agent Dale Cooperin der TV-Serie »Twin Peaks«
Vorwort und Dank
Ich empfinde es als große Ehre, dass der Theologische Verlag Zürich zum 50. Todestag Karl Barths und zum Auftakt des Karl-Barth-Jahres 2019 dieses Buch veröffentlicht – ziemlich genau einhundert Jahre nach dem Erscheinen von Barths erstem Römerbrief-Kommentar.
Es fühlt sich gut an, Autor eines Verlags zu sein, in dem die Gesamtausgabe der Werke des bedeutendsten Theologen des 20. Jahrhunderts erscheint. Zugleich flößt mir die Nachbarschaft der einschüchternd monumentalen Textmassen Karl Barths ein wenig Furcht ein. Ob dieses dürftige Büchlein, dessen Wurzeln bis in meine Studentenzeit reichen, dem kritischen Blick Barths standhalten würde? Ich wage es mir nicht auszumalen, weil ich vermute, dass Barth meine verwegene und durchaus einseitige Interpretation seiner Theologie in der Luft zerreißen würde. Aber wer weiß. Vielleicht würde er ja auch der Frechheit meiner Deutung seines Denkens Respekt zollen und sich köstlich darüber amüsieren. Letzteres wäre das schönste Kompliment für mich. Denn es wäre das Kompliment eines Theologen, der selbst das eindrucksvollste Beispiel dafür war, dass Frechheit siegt und dass unerschütterlicher Humor ein Zeichen großer geistiger Freiheit ist.
Ich beginne dieses Buch, indem ich «Danke!» sage. Vor allen anderen danke ich Lisa Briner, der Verlagsleiterin des TVZ, die von Anfang an ihre Freude an meiner zugespitzten Barth-Interpretation hatte und mir viele inspirierende Anregungen auf dem Weg zur Endfassung gab. Ebenfalls danken möchte ich Prof. Dr. Georg Pfleiderer, der für die Veröffentlichung meines Manuskripts im TVZ nachdrücklich plädierte. Daran, dass er meinen Text überhaupt zu Gesicht bekam, ist meine Kollegin Sandra Bach nicht ganz unschuldig. Auch ihr gilt mein Dank.
Erfreulicherweise haben erhebliche Druckkostenzuschüsse eine Preisgestaltung ermöglicht, die es jenen, die nicht viel Geld für Bücher ausgeben können oder wollen, leichter macht, das Buch zu erwerben – insbesondere Studierenden. Ich danke der Schweizerischen Reformationsstiftung, der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern, der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Union Evangelischer Kirchen in der EKD und dem Reformierten Bund für ihre äußerst großzügige Beteiligung an den Publikationskosten.
Nicht zuletzt danke ich meinem Landesbischof, Prof. Dr. Heinrich Bedford-Strohm, dem Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland, für seine herzliche und engagierte Unterstützung auf der Zielgeraden der Veröffentlichung.
Dieses Buch ist den beiden Menschen gewidmet, ohne die ich nicht wäre, was ich bin: meinen Eltern. Ich verneige mich vor ihnen.
München, im Sommer 2018
Ralf Frisch
Vorwort zur zweiten Auflage
Dass die erste Auflage dieses Buches schon nach kurzer Zeit vergriffen war und bereits nach wenigen Monaten eine zweite Auflage erscheinen kann, freut mich sehr. Offenbar kam meine Deutung der Theologie Karl Barths zur rechten Zeit, und offenbar rührt sie an einen Nerv. Wenn die Lektüre meines Buches die zeitlose Notwendigkeit von Barths großer Liebeserzählung Gottes neu ins Bewusstsein von Theologie und Kirche rücken hilft, vergrößert sich meine Freude noch. Unsere nervöse, überstrapazierte und desillusionierte Welt hat Lichtblicke der Hoffnung bitter nötig. Karl Barths Theologie ist ein solcher Lichtblick. Gott sei Dank. – A propos Dank: Viele anerkennende Rückmeldungen und Rezensionen erreichten mich aus der Schweiz und aus Deutschland. Ich bin dafür sehr dankbar. Dankbar bin ich auch für die wertvollen Korrekturhinweise meiner Berner Kollegin Prof. Dr. Magdalene L. Frettlöh. Alle von ihnen habe ich berücksichtigt, sonst aber nicht viel verändert. Es war schlicht nicht nötig. Mir gefällt das Buch noch immer – und hoffentlich auch Ihnen, die Sie es erstmals zur Hand nehmen!
München, im Advent 2018
Ralf Frisch
1. EinleitungFünfzig Jahre nach Karl Barth
Ich sitze an einem warmen Sommerabend in einem Biergarten im Grünen und blicke um mich. Die Menschen genießen ihr Leben. Sie erzählen sich, was sie für erzählenswert halten. Sie sind guter Dinge – oder verstehen es zumindest gut, die bösen Dinge, die sie vielleicht quälen, für sich zu behalten und in diesem Augenblick keine Rolle spielen zu lassen. Sie prosten einander zu. Sie sehnen sich danach, dass alles gut wird. Und obwohl sie ahnen, dass nicht alles gut wird, geschweige denn gut ist, lassen sie Fünfe gerade und den lieben Gott einen guten Mann sein.
Welche Art von Theologie trifft den Nerv dieses Biergartenabends und den Nerv unserer Zeit? Worauf sind die sogenannten normalen, weltlichen Menschen unserer Gegenwart in religiöser Hinsicht wirklich ansprechbar? Was geht sie tatsächlich unbedingt an? Und womit lässt man sie besser in Ruhe? Warum sollten sie der Kirche, deren Turm im Hintergrund der Szenerie aus dem Dorf in den Himmel ragt, einen Besuch abstatten oder ihr gar die Treue halten? Weil sie zum Dorf und zu seiner Tradition gehört? Weil es gut ist, dass man sie im Dorf lässt? Vielleicht genügt es ja, dass sie da steht, nicht verfällt, sondern beharrlich darauf hinweist, dass es nicht nur den sogenannten Boden der Tatsachen, sondern mehr zwischen Himmel und Erde gibt, als unsere Schulweisheit sich träumen lässt. Vielleicht sogar einen Gott, der ein Auge auf diese Welt hat.
Vor fünfzig Jahren, am 10. Dezember 1968, starb der Theologe Karl Barth (1886–1968) zweiundachtzigjährig in Basel. Sein Freund Eduard Thurneysen (1888–1974) war der Letzte, der zu Lebzeiten mit Karl Barth sprach. Am Abend des 9. Dezember telefonierten die beiden Theologen. Sie redeten über die Weltlage. Und Barth sagte: »Ja, die Welt ist dunkel. Aber nur ja die Ohren nicht hängen lassen! Nie! Denn es wird regiert, nicht nur in Moskau oder in Washington oder in Peking, sondern es wird regiert, und zwar hier auf Erden, aber ganz von oben, vom Himmel her! Gott sitzt im Regimente! Darum fürchte ich mich nicht. Bleiben wir doch zuversichtlich auch in den dunkelsten Augenblicken! Lassen wir die Hoffnung nicht sinken, die Hoffnung für alle Menschen, für die ganze Völkerwelt! Gott lässt uns nicht fallen, keinen einzigen von uns und uns alle miteinander nicht! – Es wird regiert!«1
Ich vertrete in diesem Buch die These, dass es Karl Barths Theologie ist, die den Nerv unserer Zeit und den Nerv ihrer Menschen trifft wie keine andere Theologie davor und seither. Auch fünfzig Jahre nach Barths Tod und ziemlich genau ein Jahrhundert nach Barths Revolution der Theologie seiner Zeit ist Karl Barths Theologie aktuell – immer noch und immer wieder aufs Neue.2 Insbesondere deshalb, weil sie den Menschen mit Theologie, Kirche und Gott in Ruhe lässt und weil sie nicht das Geringste dagegen hat oder daran zu ändern sucht, dass der Mensch in Frieden und von Religion unbehelligt seiner Wege als Mensch mit Stärken und Schwächen und mit Licht- und Schattenseiten geht. Und nicht zuletzt auch deshalb, weil sie je länger, je mehr unbeirrt zur Sprache bringt, wonach sich die Menschen unserer Zeit und aller Zeiten sehnen: dass alles gut wird. Alles, so Barth, ist gut, weil Gott alles gut gemacht hat.
Viele Theologen unserer Gegenwart bestreiten allerdings nachdrücklich, dass Karl Barths Theologie bleibend aktuell ist oder ihre beste Zeit noch vor sich hat. Zwar zählt die Theologie Barths »zu den außereuropäisch am breitesten und vor allem stark kulturübergreifend rezipierten und erforschten Entwürfen des 20. Jahrhunderts«3. Im deutschsprachigen Theologieraum ist Barth jedoch derzeit eher out. Viele halten Barths Denken heute für nicht mehr vermittelbar. Dass es anschlussfähig an die wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Diskurse unserer Zeit sein könnte, gilt als ausgeschlossen. Das Einzige, was an Barths letzten überlieferten Worten jenes Dezemberabends vor fünfzig Jahren aktuell zu sein scheint, ist nicht die Überzeugung des alten Theologen, dass alles gut ist, sondern seine Einschätzung der Dunkelheit der Weltlage.
Die Sehnsucht nach Stabilität und Ordnung, nach Freiheit und Sicherheit war in der europäischen Gegenwart des »Achsenjahr[es]«4 1968, des letzten Lebensjahres von Karl Barth, ebenso ein Thema, wie sie ein halbes Jahrhundert später ein Thema ist – freilich unter ganz anderen welt- und gesellschaftspolitischen Vorzeichen. Den Bewohnern unserer Gegenwart steht innerhalb und außerhalb von Europa in ähnlicher Weise vor Augen, was Terror und irregeleitete Herrschaft in der Welt anrichten können, wie es Karl Barth seinerzeit vor Augen stand. Barth ging in zwei Weltkriegen und an mindestens zwei totalitären Regimen das Licht auf, dass nur auf eine Gestalt der Herrschaft und nur auf ein Regime wirklich Verlass ist: auf das Regiment des freien Gottes, der den Menschen aus Liebe in die Freiheit frührt. Barth wusste, was Feinde der Freiheit und was Autokraten sind. Er wusste, welches Unwesen entfesselte totalitäre Gewalt auf Erden treiben kann. Er wusste, dass die Macht der herrenlosen Gewalten5, die niemandem dienen und als Formen nackter Selbstdurchsetzung auf Kosten anderer nur herrschen, gewaltig ist. Aber er hatte schon früh den menschlichen, den christlichen und den theologischen Respekt vor ihnen verloren.
Die Geschichte der Theologie Karl Barths begann, als Barth um die Zeit des Ausbruchs des Ersten Weltkrieges herum an der Theologie seiner theologischen Lehrer irre wurde, die den Krieg nicht nur begrüßten, sondern theologisch rechtfertigten. Viele von ihnen hatten das sogenannte »Manifest der 93«6 unterzeichnet – jenen Aufruf an die Kulturwelt, der die Vorwürfe bestritt, die die Kriegsgegner und die Alliierten gegen Deutschland erhoben. Das »Manifest der 93«, die den Krieg als Selbstverteidigung und Notwehr rechtfertigten, wurde von der »Erklärung der Hochschullehrer des Deutschen Reiches«7 vom 14. November 1914 noch übertroffen. Der evangelische Theologe Reinhold Seeberg (1859–1935) hatte sie verfasst. 3000 Professoren unterschrieben. Mit ihrer Unterschrift erklärten sie den Ersten Weltkrieg zum Verteidigungskampf der deutschen Kultur, an deren Wesen die Welt genesen sollte – und sei es mit Gewalt.
Wenn man so will, war der junge Schweizer Pfarrer, der sich unter dem Eindruck dieses Sündenfalls der Generation seiner Väter in der Arbeitergemeinde Safenwil im Kanton Aargau eines Tages mit anderen Augen der Theologie zuwandte, eine Art theologischer Achtundsechziger seiner Zeit. Einer allerdings, dessen Revolution der Verhältnisse sich im Denken, anders gesagt: durch ein Andersdenken des Vertrauten ereignete – im Sinne des griechischen Wortes »metanoia«.8Denn »metanoia«heißt Umdenken.
Dieses Umdenken hatte bereits begonnen, als sich Barth in beständigem Austausch mit Eduard Thurneysen an den Versuch machte, »bei einem erneuten Erlernen des theologischen ABC noch einmal und besinnlicher als zuvor mit der Lektüre und Auslegung der Schriften des Alten und Neuen Testaments einzusetzen. Und siehe da: sie begannen zu uns zu reden – sehr anders, als wir sie in der Schule der damals ›modernen‹ Theologie reden hören zu müssen gemeint haben.«9
So wandte sich Barth im Jahr 1916 also dem Römerbrief des Apostels Paulus zu, um die »damals moderne« Theologie durch eine kritische Theorie der Moderne10 aus den Angeln zu heben, die kritischer, fundamentaler und avantgardistischer in Erscheinung trat als die Theologie seiner Zeit. Kulturell gesehen war Barths neue Theologie geradezu state of the art. Wie Isaac Newton (1643–1727), den angesichts eines fallenden Apfels im Jahr 1660 die Idee der Gravitation überwältigt haben soll, revolutionierte auch Karl Barth »unter einem Apfelbaum«11das Weltbild seiner Zunft. Gott wollte ihm auf einmal nicht mehr als Inbegriff der religiösen, ethischen und kulturtechnischen Fähigkeiten des Menschen erscheinen, sondern trat als Kritiker und Richter alles Bestehenden, als Revolutionär von senkrecht von oben auf den Plan. In expressionistischem Pathos erschütterte Karl Barth die schöne Form, die wertstabilen Grundfesten, die humanen Überzeugungen und die kulturprotestantischen Identitätsbildungen der Theologie seiner Zeit. Barths Römerbriefkommentar, insbesondere dessen zweite, drei Jahre nach der Erstauflage von 1919 nochmals radikalisierte Fassung aus dem Jahr 192212, brachte die akademische Theologie ins Wanken. Mit diesem »Römerbrief« brach im zweiten Jahrzehnt des noch jungen Jahrhunderts das 20. Jahrhundert in der Theologie an. Vor allem eine Erkenntnis war für den theologischen Revolutionär Karl Barth dabei leitend: Wenn sich Gott derart leicht, wie dies in der Theologie seiner Väter geschehen war, für menschliche Zwecke und für die Überhöhung menschlicher Macht funktionalisieren und instrumentalisieren ließ, dann konnte das, was Barths theologische Lehrer als »Gott« bezeichnet hatten, nicht der wahre Gott sein. Wenn eine komplette Generation theologischer Hochschullehrer imstande war, sich restlos in »geistige 42 cm Kanonen«13 zu verwandeln, wie Barth am 4. Januar 1915 in einem Brief schrieb, dann konnte es mit der kritischen Zeitgeistesgegenwart der evangelischen Theologie nicht weit her sein.
Barth wurde klar: Falls er theologisch irgendwie dagegenhalten wollte, musste er die Differenz zwischen Gott und Mensch so stark betonen wie nur möglich. »Wenn ich ein ›System‹ habe«, so Barth im Vorwort zu seinem zweiten »Römerbrief«, dann»besteht es darin, dass ich das, was Kierkegaard den ›unendlichen qualitativen Unterschied‹ von Zeit und Ewigkeit genannt hat, in seiner negativen und positiven Bedeutung möglichst beharrlich im Auge behalte. ›Gott im Himmel und du auf Erden‹.«14– Mit dieser Erkenntnis kam die sogenannte dialektische Theologie zur Welt. In Wahrheit war sie eher eine negative Theologie, weil sie Gott als Negation und als Krise aller menschlichen Kultur ins Feld führte. Durch diese Strategie der Negation suchte Barths Theologie der Krise die Gottheit Gottes allen menschlichen Zugriffen und allem menschlichen Missbrauch zu entziehen. Sie stellte also eine konsequente Kritik der instrumentellen theologischen Vernunft dar.
Karl Barths Theologie war von Anfang an auch Machtkritik. Jahrzehnte nach dem »Römerbrief« brachte er diese Machtkritik in der sogenannten Erwählungslehre seiner »Kirchlichen Dogmatik« eindrucksvoll auf den Punkt: »Der Macht als Macht steht der Mensch als Mensch frei gegenüber. Er kann ihr erliegen, er kann von ihr vernichtet werden. Er ist ihr aber keinen Gehorsam schuldig und eben zum Gehorsam kann ihn auch die überlegenste Macht als solche nicht zwingen. Macht als Macht hat keinen göttlichen Anspruch und wenn sie noch so imponierend, noch so wirksam wäre. Gegen die Macht als Macht sich selbst vorzubehalten, und wäre es im eigenen Untergang, ist nicht nur des Menschen Möglichkeit, ist nicht nur die Behauptung seines Rechtes und seiner Würde, sondern die Pflicht, die er mit seiner Existenz als Mensch zu erfüllen hat […]. Prometheus hat nun einmal recht gegen Zeus.«15
Gottes Macht ist Barth zufolge die einzige Macht der Welt, die den Menschen nicht unterwirft, sondern erhebt, aufrichtet und befreit. – Dass Barth Gott als Gegenmacht gegen die totalitären Mächte der Welt zur Sprache brachte, die insbesondere im Dritten Reich ihr teuflisches Unwesen trieben, brachte ihm bizarrerweise den theologischen Vorwurf16 ein, seinerseits totalitär geworden zu sein und den Teufel mit Beelzebub ausgetrieben zu haben. Allerdings trägt die Gegenmacht aller Mächte in Barths Theologie den Namen Jesus Christus, dessen wahre Göttlichkeit sich gerade in seinem Gang in die Fremde, also in das Elend und in die Niedrigkeit des Menschseins zeigt. Gott kann Karl Barth zufolge daher eben gerade nicht via eminentiae als ins Absolute gesteigerte Macht theologisch zur Sprache gebracht werden. Dennoch legt der Vorwurf der Barth-Kritiker einen Finger in die Wunde von Karl Barths Theologie. Denn Barth unterstrich die Autorität Gottes, wo er nur konnte, und argumentierte daher in der Tat zuweilen sehr autoritär. Er wollte Recht haben, was sich an einer drolligen Begebenheit illustrieren lässt, die Barths Freund Thurneysen als typisch empfand und daher überliefert hat. In einem Gespräch begehrte der Theologe Gottlob Wieser (1888–1973) einmal gegen Barth auf und hielt ihm vor: »Du willst immer recht haben, Karl!« Barth entgegnete darauf lachend: »Nein. Ich habe halt immer recht!«17
Weil die Theologie nicht über die Beweis- und Evidenzsicherungsverfahren der sogenannten exakten Wissenschaften verfügt, pochen theologische Fundamentalisten nicht selten auf Autorität und Gehorsam. Auch Barth war davor leider nicht gefeit. An Andersdenkenden ließ er selten ein gutes Haar, weil er offenbar nur so seine Mission der Reinigung der Theologie und der Kirche vom Unglauben erfüllen zu können glaubte. Vom Menschen, insbesondere von den Leserinnen und Lesern seiner »Kirchlichen Dogmatik«, die zwischen 1932 und 1967 entstand, dreizehn Bände auf fast 10 000 Seiten umfasst und dennoch unvollendet blieb, forderte Barth zwar in religiöser und in ethischer Hinsicht nichts – weder Frömmigkeit noch Moral. Oder besser gesagt: fast nichts, außer eben Anerkennung und Gehorsam. Aber dass Barth ebenso wie jener politische »Führer« seiner Zeit, den er zutiefst verabscheute, diesen Gehorsam forderte, macht sein Denken anfällig für jene Kritiker, die seine Theologie für autoritäre, ja totalitäre Theologie halten18, weil sie dem Menschen die Botschaft des seinem Wesen nach antiautoritären und befreienden Evangeliums hinwirft wie einen Stein und zu diesem Menschen sagt: »Friss, Vogel, oder stirb!«19
Dietrich Bonhoeffer (1906–1945) kämpfte in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ebenso wie Karl Barth theologisch und politisch gegen den menschenverachtenden Nationalsozialismus und dessen totalitäre Gewaltherrschaft. Auch Bonhoeffers Theologie artikulierte sich als Macht- und Herrschaftskritik. Deutlicher als Karl Barth stellte er allerdings Gottes Ohnmacht ins Zentrum seines Denkens. In seinen unter dem Titel »Widerstand und Ergebung« veröffentlichten Briefen aus dem Tegeler Gefängnis betonte Bonhoeffer, dass nur der leidende und ohnmächtige Gott helfen könne.20 In den Tagen des missglückten Attentats auf Adolf Hitler (1889–1945) am 20. Juli 1944 floh Bonhoeffer gewissermaßen unter das Kreuz Jesu Christi. Was gute Macht ist und was gute Mächte sind, erkennen wir nach Bonhoeffer nur, wenn wir auf den gekreuzigten Christus blicken. Er, der aus der Welt herausgekreuzigt wird21 und dessen Macht ganz anders ist als die Macht, die die Welt regiert, unterdrückt und zerstört, ist der Einzige, der es mit den Mächten der Welt wirklich aufnehmen kann.
»Es wird regiert.« – Bei Barth, der nie an der Königsherrschaft des auferstandenen Christus zweifelte, sichtlich machtvoller und ungebrochener als bei Bonhoeffer. Und so ist es kein Wunder, dass Bonhoeffers theologische Machtkritik vielen näher ist als Barths siegesgewisse Theologie – vor allem jenen, denen angesichts der Katastrophen des 20. und 21. Jahrhunderts die Kritik des theologischen Dogmas und die Kritik vollmundiger theologischer Metaphysik eher an der Zeit scheint als die Idee, dass Gott siegreich im Regimente sitzt und alles wohl führt.
Dass Gott mächtiger ist als alle Mächte dieser Welt und dass er ganz von oben, vom Himmel her, sein Heilswerk verrichtet und vollendet, wurde aber nicht erst nach dem Zusammenbruch der Humanität in Verdun, Auschwitz, Dresden und Hiroshima fraglich. Seit Beginn der Aufklärung im 18. Jahrhundert ist die Gottesskepsis integraler Bestandteil des gesellschaftlichen und des wissenschaftlichen Diskurses. Vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg und in der revolutionär elektrisierten geistigen Atmosphäre der Sechzigerjahre erfasste sie auch die Theologie zumal in Deutschland mit voller Wucht. Viele Theologinnen und Theologen begannen Theorien zu misstrauen, die starke theologische Behauptungen machten und wie Karl Barth von Gottes Wirklichkeit und Gottes Macht redeten, als wäre nichts geschehen und als stünde eine ungebrochene Theologie der Herrlichkeit des siegenden Jesus22 nicht in eklatantem Widerspruch zum Geist ihrer Zeit. Andererseits waren es gerade die Schüler Karl Barths, die aus Barths Theologie die Legitimation einer sozialistischen Revolution aller gesellschaftlichen Verhältnisse herauslasen. In einer Kurzzusammenfassung von Karl Barths theologischem Ansatz schrieb der Theologe Friedrich-Wilhelm Marquardt (1928–2002) am Ende des Registerbandes der »Kirchlichen Dogmatik« im Gestus des Achtundsechzigers, Barths Theologie wolle der »Vorbereitung« von »dringend für nötig gehaltenen politischen Klärungen dienen. Diese sind ihr erklärtes Ziel.«23 Marquardts Habilitationsschrift über Karl Barth als Sozialist24 geriet zum politischen und theologischen Skandal. An der Kirchlichen Hochschule Berlin wurde sie mit knapper Mehrheit abgelehnt, woraufhin Helmut Gollwitzer (1908–1993), Barths ehemaliger Doktorand und Nachfolger auf dessen Bonner Lehrstuhl, seinen Lehrauftrag an der Kirchlichen Hochschule aus Protest niederlegte. Gollwitzer selbst war der Seelsorger der RAF-Terroristin Ulrike Meinhof (1934–1976) und hielt die Trauerrede für sie.
Über Karl Barth, der immer Recht haben wollte und ganz genau zu wissen schien, wie es um Gott und seine Macht bestellt ist, kursiert ein so liebevoller wie entlarvender Witz. Karl Barth, Paul Tillich (1886–1965) und Rudolf Bultmann (1884–1976) kommen in den Himmel und haben sich vor Gott zu verantworten. Zuerst wird Rudolf Bultmann eingelassen, während die beiden anderen vor der Himmelspforte warten. Nach wenigen Minuten kommt Bultmann heraus, hebt Abbitte leistend die Hände und sagt: »Ich widerrufe alles. Wie konnte ich mich so über Gott und die Welt täuschen!« Als Zweiter tritt Paul Tillich ein. Immerhin eine Viertelstunde nimmt sich Gott für ihn Zeit. Als Tillich gesenkten Hauptes wieder herauskommt, seufzt er kleinlaut: »Ich Idiot! Was habe ich nur für einen Unsinn gedacht und geschrieben!« Schließlich darf Karl Barth vor Gott treten. Eine Stunde vergeht. Zwei Stunden vergehen. Drei Stunden vergehen. Nach sechs Stunden kommt Karl Barth entnervt heraus, schüttelt den Kopf und rauft sich die Haare: »Er versteht es nicht! Er versteht es einfach nicht!« – Wollte also Karl Barth Gott am Ende doch besser verstehen, als Gott sich selbst versteht? Und verstrickt sich seine Theologie des ganz anderen, jeder Theologie gegenüber freien Gottes dadurch nicht in einen tiefen Selbstwiderspruch?
Der romantische Dichter Novalis (1772–1801) bemerkte mehr als einhundert Jahre vor Barths theologischer Wiederentdeckung der Theologie der Reformatoren, dass wir in einer Zeit leben, in der »der unmittelbare Verkehr mit dem Himmel nicht mehr statt[findet]«25. Es sieht nicht so aus, als sei diese Zeit vorüber. Und so scheint eine Theologie, die wissensgewiss und unverblümt vom Himmel kündet, der Vergangenheit anzugehören und nicht wiederbelebt werden zu können. Offenkundig führt kein Weg zurück in das Kinderland des Glaubens, in dem Menschen bereit sind, das Märchen vom starken und lieben Gott für wahr zu halten, das Karl Barth in den dreizehn Bänden seiner »Kirchlichen Dogmatik« erzählt. Barths Gottesstory mit Happy End ist einfach zu schön, um wahr sein zu können. Aber wenn sie nicht so wahr ist, wie natur-, human- oder kulturwissenschaftliche Weltbeschreibungen und theologische Reformulierungen dieser Weltbeschreibungen wahr zu sein beanspruchen, inwiefern ist sie dann wahr? Inwiefern ist sie überhaupt wahr? Inwiefern hielt sie Barth selbst für wahr? Und wie kann ich behaupten, dass Karl Barths Theologie, die auf die modernen Weltbeschreibungs- und Wahrheitsetablierungsverfahren pfeift und einfach theologisch drauflos erzählt, heute noch und vielleicht gerade heute aktuell ist?
Damit meine These von der bleibenden Aktualität Karl Barths wirklich ihre Plausibilität entfalten kann, muss ich Barth ein wenig gegen den Strich bürsten und neu lesen. Denn ich gehe nicht davon aus, dass die einzige gegenwartsaktuelle Pointe von Barths theologischer Kritik aller menschlichen Verhältnisse darin besteht, Theologie als Kritik aller gesellschaftlichen und aller politischen Verhältnisse zu treiben. So sehr diese Kritik auch und gerade heute, fünfzig Jahre nach Karl Barth, nötig und sinnvoll ist, so sehr bin ich doch auch davon überzeugt, dass es in einer anderen Zeit auch andere Pointen von Barths Theologie geben muss.
Natürlich fragt es sich, ob es überhaupt möglich ist, Barth neu zu lesen, da ja eigentlich schon alles über Karl Barth geschrieben wurde. Wer könnte die Frechheit besitzen, mit dem Anspruch daherzukommen, noch etwas Neues über diese alt gewordene Theologie zu Tage fördern zu wollen? – Andererseits hat Karl Barth selbst wie gesagt jahrzehntelang vorgemacht, dass Frechheit siegt und dass man als Theologe manchmal ein Draufgänger sein und das Kind mit dem Bade ausschütten muss, um sichtbar zu machen, was auf dem Grund der Dinge und auf dem Grund des Redens von Gott verborgen liegt. Und so wage ich denn in den folgenden Kapiteln den Versuch einer Relecture der Theologie Karl Barths. Ich weiß, dass sie einseitig ist. Aber weil Überspitzungen oft die interessantesten Diskussionen auslösen, ziehe ich die Überzeichnung der Weichzeichnung und die Zuspitzung der Ausgewogenheit vor.
Ich profiliere Karl Barth in diesem Buch als einen Denker, der die kulturellen Umbrüche des 19. und des frühen 20. Jahrhunderts auf eine theologisch sehr eigentümliche und einzigartige Weise verarbeitet und dabei Ernst gemacht hat mit der conditio moderna, also mit der Verfasstheit der modernen Welt und der modernen Welterkenntnis. Karl Barths Theologie ist mitnichten eine offenbarungstheologische Totalverweigerung gegenüber dem Geist seiner Zeit.26 Sie verweigert sich nur gegenüber einer Theologie, die im zweiten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts ihre Zeit bereits hinter sich hatte.
Ich behaupte ferner, dass Barths Theologie insbesondere als ästhetisches Ereignis von Belang ist. Ich deute den großen Denker vor allem als großen Erzähler. Mit einem Seitenblick auf die Schriftstellerin Ingeborg Bachmann (1926–1973) und auf einen anderen großen Erzähler, den Sprachwissenschaftler John Ronald Reuel Tolkien (1892–1973), werde ich zeigen, worin das besondere theologische Potenzial der erzählenden Fiktionalisierung besteht.
Diese beiden Deutungsaspekte widersprechen der nicht selten vertretenen These, Barth habe geradezu naiv einen übernatürlichen Gott vorausgesetzt und in übernatürlicher und voraufgeklärter Weise von Gott und der Welt geredet. Ich glaube, dass dem mitnichten so ist. Der Schein trügt. Barth war alles andere als ein Supranaturalist. Er nahm den Geist seiner Zeit auf eine höchst realistische Weise in den Blick. Weil er um die Kraft von Narrativen wusste, erzählte er eine große Gegengeschichte zu den Narrativen seiner Zeit. Es ist auch eine Gegengeschichte zu den Narrativen unserer Zeit. Und weil das Anderssehen der eigenen Zeit um einer geistesgegenwärtigen Zeitgenossenschaft willen eigentlich immer an der Zeit ist, ist Barths Gegengeschichte auch heute an der Zeit.
Dass wir Bewohner des 21. Jahrhunderts Barths Theologie allenfalls als schöne Geschichte lesen können, liegt also nicht nur in der Natur des Weltbildes unserer aufgeklärten Gegenwart, sondern auch in der Natur der Theologie Karl Barths selbst. Denn der große Theologe war nicht zuletzt als großer Geschichtenzerstörer27 und als großer Geschichtenerzähler groß. Seine Theologie ist ein Sprachereignis – auch und gerade im literarischen Sinn der Weltschöpfung durch das Wort.
Mein Buch entfaltet aber nicht nur die These der Modernität und der Fiktionalität der Theologie Karl Barths. Es führt auch die wichtigsten Grundentscheidungen von Barths Dogmatik im Licht der Frage nach Barths Aktualität vor Augen. Was ich geschrieben habe, ist also in gewisser Weise auch als Einführung in die unbändige Theologie Karl Barths lesbar. Auch, wenn dieses Buch nicht didaktisch aufgebaut ist, sondern sich eher kreisend vorwärtsbewegt, sollten es Studierende ebenso lesen können wie nicht-akademische und nicht-theologische Leserinnen und Leser, die allen Unkenrufen zum Trotz ja vielleicht auch heute noch an substanzieller Theologie interessiert sind – und zwar an einer Theologie, die sich nicht in Religionsphänomenologie, Kulturtheorie, politischer und ethischer Bildung und auch nicht in reflexionsarmer spiritueller Erbaulichkeit erschöpft.
Nicht, dass ich das erwarten würde: Aber vielleicht fällt dieses Buch ja sogar einem jener Menschen in die Hände, die mich eines sommerlichen Abends beim Bier auf die Idee gebracht haben, mir selbst die Frage zu stellen, wie man Theologie treiben muss, um den Intensitäten und Normalitäten des wirklich gelebten Lebens gerecht zu werden oder diesem Leben zumindest nicht theologische Gewalt anzutun.
2. Radikal modernDie Unbegründbarkeit theologischer Gewissheit
Karl Barths Theologie ist radikal modern – und zwar deshalb, weil sie radikal Ernst macht mit der Unmöglichkeit, Gottes Sein und sein Wesen unter den Erkenntnisbedingungen neuzeitlicher Wissenschaft plausibilisieren zu können. Es gibt keine experimentelle, logische, mathematische, natur- oder humanwissenschaftliche Falle, die man Gott stellen könnte. Es gibt keine Versuchsanordnung, die Gott in ähnlich unzweifelhafter Weise detektieren könnte, wie man Gravitationswellen oder die Ablenkung von Sternenlicht durch die Nähe massiver Körper in der Raumzeit detektieren kann. Ich erwähne diese beiden Vorhersagen der Allgemeinen Relativitätstheorie Albert Einsteins (1879–1955) deshalb, weil dessen weltbilderschütternde physikalische Theorie nahezu zeitgleich mit Karl Barths Erschütterung der Theologie durch seine revolutionäre Auslegung des Briefes des Apostels Paulus an die Römer entstand. Exakt einhundert Jahre, nachdem Einstein vorhergesehen hatte, dass gigantische beschleunigte oder kollidierende Massen Wellen schlagen, die die Raumzeit verformen, als wäre sie eine Wasseroberfläche, auf die ein Stein trifft, wurde seine Vorhersage experimentell bestätigt. Davon können Kulturwissenschaftler, Philosophen und Theologen nur träumen. Üblicherweise dürfen sie höchstens darauf hoffen, dass ihre Gedanken nach einem Jahrhundert noch nicht gänzlich verfallen sind und dass sich Menschen der Zukunft eines Tages nicht nur aus historischem Interesse mit ihnen beschäftigen. Im Blick auf kulturwissenschaftliche Prognosen und Theorien lässt sich allenfalls irgendwann sagen, dass sie sich eine Zeitlang bewahrheitet haben – wie etwa Samuel Huntingtons (1927–2008) Theorie der Konfrontation der Kulturen und Religionen im 21. Jahrhundert28 – oder dass sie fehlgingen – wie etwa die These des US-amerikanischen Politikwissenschaftlers Francis Fukuyama (*1952) vom Ende der Geschichte29 im Kapitalismus. Nur wenige große philosophische Denkgebäude trotzen beharrlich der Erosion und sind von zeitloser Gültigkeit. Gehört Barths Theologie dazu? Oder blüht ihr das Schicksal, das fast alle Avantgarden durch ihr Altern irgendwann ereilt? Was Barth dachte und schrieb, könnte zu seiner Zeit an der Zeit gewesen sein und seine Zeit gehabt haben, aber nach seiner Zeit nicht mehr an der Zeit sein.
Und dennoch: Trotz aller Vergänglichkeit geistiger Theoriebildung steht außer Zweifel, dass nicht nur Gravitationswellen und physikalische Theorien, sondern auch die Kulturwissenschaften und die Theologie die Welt verformen, in der wir leben. Nur tun sie dies anders. Das heißt nicht, dass sie weniger wirkmächtig wären. Theologische Weltbildverformungen sind nur eben weniger spektakulär, weil sie jener direkten und unmittelbaren Nachweisbarkeit entbehren, die wir den mathematischen und naturwissenschaftlich-experimentellen Wahrheitssicherungsverfahren zusprechen. Was ins Netz der Physiker30 und Mathematiker geht, halten viele für wirklicher als jene Wahrheiten, die die Dichtung, der Mythos oder die Spekulation über Gott und die Welt zu Tage fördern. Was durch soziologische oder medizinische Verfahren empirisch messbar, evaluierbar und diagnostizierbar ist, überzeugt die meisten Menschen unmittelbarer als das, was andere glaubend für wahr halten. Was nicht durch Beweise »erhärtet« werden kann, obwohl es vielleicht instinktiv und intuitiv einleuchtet, ist für viele nicht wirklich real. Die theologische und die philosophische Spekulation muss mit dem Vorwurf der exakten Natur- und Humanwissenschaften leben, ein weiches Element zu sein, in das sich – mit dem Philosophen Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770–1831) gesprochen – alles Beliebige einbilden lässt. Einen »harten« Beweis dafür, dass es Gott gibt und dass er so ist, wie irgendein Theologe ihn gedacht hat, muss auch die ausgeklügeltste Theologie bis in alle Ewigkeit schuldig bleiben. Und wenn eine Falle gestellt werden könnte, in der sich Gott einfangen ließe, dann wäre jene Wirklichkeit, die in diese Falle ginge, vermutlich nicht Gott, sondern ein Gottessurrogat, mit dem sich aber ja vielleicht diejenige moderne Theologie abzufinden bereit ist, die es aufgegeben hat, von jenem Gott zu reden, der so schwer zu fassen ist.
Das Credo Karl Barths bestand in jedem Augenblick seiner jahrzehntelangen theologischen Gedankenproduktion in ebendieser Überzeugung, dass kein Mensch Gott eine Falle stellen kann und dass ein Gott, der in eine solche Falle ginge, kein Gott wäre. Genau diese Erkenntnisproblematik führte Barth aber nicht dazu, die Theologie aufzugeben – im Gegenteil: Er machte es sich zur Aufgabe, dennoch von Gott zu reden. Was, wenn nicht das Wort Gottes, sollte die Aufgabe der Theologie sein? In seinem Vortrag »Das Wort Gottes als Aufgabe der Theologie« brachte Barth im Jahr 1922 seine Erkenntnismaxime und deren Konsequenz in seinen vielleicht berühmtesten Sätzen auf den Punkt: »Wir sollen als Theologen von Gott reden. Wir sind aber Menschen und können als solche nicht von Gott reden. Wir sollen beides, unser Sollen und unser Nicht-Können, wissen und eben damit Gott die Ehre geben. Das ist unsre Bedrängnis. Alles Andre ist daneben Kinderspiel.«31
Karl Barth war ein reformierter Theologe. Insbesondere in der Phase seiner radikalen negativ-dialektischen Theologie hielt er sich an eines der zentralen erkenntnistheoretischen Axiome des calvinistischen reformierten Protestantismus:»Finitum non capax infiniti«. Das Endliche kann das Unendliche nicht fassen. Der Unterschied zwischen Gott und Mensch ist kategorial. Man könnte Barths Satz, der das Verhältnis von Gott und Welt grundsätzlich und ewiggültig zu beschreiben beansprucht, natürlich hinterfragen. Woher wussten Johannes Calvin (1509–1