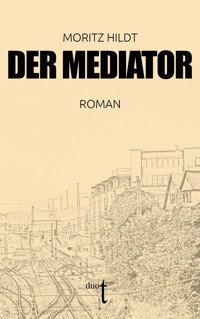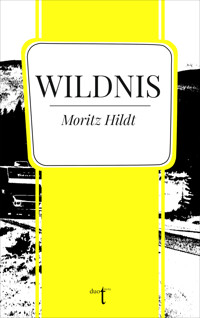Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: duotincta
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein kleines Café an der Ostsee. Eine Insel, die zwar genau genommen keine ist, auf der Lukas Seeger aber mehr als zufrieden ist mit seinem ruhigen, gleichförmigen Leben. Als der totgeglaubte erste Ehemann seiner Frau aus heiterem Himmel im Café auftaucht, nehmen Ereignisse ihren Lauf, die Lukas zwingen, sich auf eine Reise zu begeben, zunächst in die Sümpfe im tiefen Süden der USA und dann in die rote Wüste von Utah. Nach seinem atmosphärischen Debüt "Nach der Parade" erzählt Hildt eine ebenso fesselnde wie erschütternde Geschichte darüber, wie gut man die Menschen, die einem besonders nahe sind, überhaupt kennen kann – und welches Maß an Wahrheit nötig ist, welches gut, und welches gefährlich.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 317
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
verlag duotincta
Moritz HildtAlles
Karoline
PROLOG
Dies ist die Geschichte von Helen, meiner Frau, und von Jeremy, der eigentlich Ferdinand Mosbacher hieß, Helens erster Ehemann war, dann verschwand und für viele Jahre alle glauben gemacht hatte, er sei tot, bis er an einem regnerischen Oktobertag in unserem Café auftauchte und damit das schmucklose, beständige Leben, das Helen und ich uns gemeinsam aufgebaut hatten, durcheinanderbrachte.
Ich nehme an, es ist auch meine Geschichte. Und doch verstehe ich meine eigene Rolle darin am wenigsten. Vielleicht geht einem das immer so, wenn man aufs eigene Leben blickt. Vielleicht könnte Jeremy mehr dazu sagen. Jeremy, der eigentlich Ferdinand hieß. Aber das ist wohl auch egal.
Jetzt, wo er tot ist.
Mein Name ist Lukas Seeger. Ich sage das, obwohl dieser Name hier, so weit weg von allem, kaum noch eine Rolle spielt. Ich weiß nicht, wie lange es her ist, seit ich ihn selbst laut ausgesprochen habe, noch weniger, wann ich ihn zum letzten Mal aus dem Mund eines anderen gehört hätte. Man sagt, der Klang des eigenen Namens sei das, was ein Mensch am liebsten höre. Mich interessiert daran eher die Tatsache, dass Namen verschwinden können, wenn niemand sie mehr ausspricht.
Und manchmal verschwinden die Personen dann einfach mit ihnen.
Wenn ich abends die Türe des alten Wohnwagens öffne, in dem ich hier lebe, und den roten Sand von den Stiefelsohlen klopfe, so gut es eben geht, fällt mein Blick noch immer zuerst auf den Spaten. Als würde sein verrostetes Blatt das Licht der untergehenden Sonne zurückwerfen und mich damit blenden. Das tut es aber nicht. Denn der Spaten steht weit hinten, in der Ecke neben der Spüle, dort, wo der fleckige Linoleumboden aufgerissen ist. Die dunklen Sprenkel am unteren Ende des schweren Holzstiels sind noch gut zu erkennen. Für mich zumindest. Ich kenne ihre genaue Zahl, das Muster, das sie ergeben, die Form jedes einzelnen Tropfens. Vermutlich könnte ich sie sogar aus dem Kopf nachzeichnen. Auch wenn ich nicht wüsste, warum ich das tun sollte.
Manchmal überlege ich, ob jemand, der hier reinkommen würde, sie für Blut halten könnte. Dann sage ich mir immer, dass das aber auch nicht weiter wichtig ist.
Denn warum sollte irgendwer hier reinkommen?
ERSTER TEIL | INSEL
1
Alles begann, bevor die Kraniche kamen. Wobei das so nicht stimmt. Es hatte schon viel früher begonnen, lange bevor irgendwer was merkte. Früher dachte ich, dass das, was wir tun, zumindest im Großen und Ganzen dem entspricht, was wir tun wollen. Heute weiß ich, dass es ein furchtbarer Fehler ist, das anzunehmen. Und ich weiß, dass die Vorstellung, wir könnten einen anderen Menschen wirklich kennen und wüssten dann, wer er ist, die vielleicht größte Lüge ist, die wir uns erzählen können.
In diesem Jahr kamen die Kraniche ungewöhnlich spät. Normalerweise sah man die ersten bereits um die Septembermitte herum. Sie kamen von Norden her über das Meer, in großen, keilartigen Formationen. Am Tag konnte man sie dann auf den Wiesen links und rechts der Landstraße sehen, wo sie dicht beieinanderstanden. So selbstverständlich, als wären sie schon immer da gewesen und nicht nur auf der Durchreise zu einem fernen, wärmeren Ort. Abends flogen sie in großen Scharen auf eine kleine, unbewohnte Insel in der Bucht, wo sie jedes Jahr aufs Neue ihre Schlafplätze fanden, solange sie hier waren. Ihr Kreischen war laut und durchdringend und hallte zwischen den Buchen und Kiefern des alten Waldes. Kraniche haben ihr Leben lang denselben Partner. Sie erkennen einander an der Stimme, an dem, was für uns nur schriller Lärm ist. Das wusste ich von einem Ornithologen, einem glücklosen Autoverkäufer, der jeden Herbst für eine Woche hierherkam und dann morgens, nach einer ersten Tour über die Wiesen, mit leuchtenden Augen bei uns im Café einen Ingwertee trank.
Doch bislang blieb die Luft still. Inzwischen war es schon Anfang Oktober, und noch immer hatte keiner einen Kranich gesehen. Die Vogelbeobachter waren schon seit Tagen auf der Insel. Jedes Jahr kamen sie in die Leere, die die Sommerbesucher zurückließen, und sorgten noch einmal für volle Tische. Es war einer jener Herbstmorgen, an denen der auffrischende Wind von der Ostsee den würzigen Duft der Kiefern ins Dorf hineintrug und ihn in der Luft mit einem feinen Sprühregen vermengte. Die Regentropfen schienen dann selbst nach Kiefer zu riechen, nach eisigem Menthol und frischen Waldkräutern. Als würde ein übermächtiger Saubermacher mit einem feinen Zerstäuber den gesamten Ort mit dem reinigenden Duft überziehen.
Ich stand vor dem Café und machte eine Zigarettenpause, wie jeden Tag um halb elf. Der Regen war so fein, dass er mich nicht störte. Einzelne Tropfen lagen, ohne ihre Form zu verlieren, auf dem Stoff meines weißen Baumwollhemds, das ich beim Kellnern trug. Lauter kleine Punkte, die sich nicht berührten. Die Luft war kühl und es war Salz von der See darin. Ich bewegte meine Zehen in den Schuhen. Unter der Socke waren ein paar Sandkörner, die man hier oben nie ganz loswurde. Irgendwann störten sie nicht mehr, und wenn ich sie einmal doch spürte, so wie jetzt, dann erinnerten sie mich daran, dass es eine Zeit gegeben hatte, in der ich noch nicht hier gelebt hatte.
Auf der Straße war wenig Betrieb. Ab und an kamen Radfahrer vorbei, in Zweier- oder Vierergruppen. In den hautengen neonfarbenen Radlermonturen steckten um diese Jahreszeit meist ältere Leute, von denen kaum einer einen Helm trug. Die elektrischen Motoren ihrer Räder surrten leise. Im Garten des gegenüberliegenden Hauses, einer Fünfsternepension, deren Reetdach gerade erneuert wurde, hatten den ganzen Sommer über Hortensien in einem fahlen, regnerischen Blau geblüht. Keine einzige der buschigen Blüten war mehr zu sehen, obwohl ihre Farbe, dachte ich mir, gut zum Wetter gepasst hätte.
Ein junges Paar schob einen Kinderbuggy auf dem Gehweg. Ich sah, wie sich das Kind, das eine gelbe Regenjacke anhatte, zu seinen Eltern umwandte und etwas sagte. Dabei zeigte der Junge wieder und wieder auf mich. Die Eltern beugten sich zu ihm hinunter. Sie folgten mit ihrem Blick seinem ausgestreckten Arm, sahen sich dann fragend an und schüttelten den Kopf. Als die Mutter erneut zu mir hinsah, veränderte sich etwas in ihrem Gesicht. Sie sagte schnell einige Worte zu ihrem Mann und schob den Kinderwagen dann weiter. Nur das Kind drehte sich noch einmal zu mir um. Ich hob die Hand und der Kleine winkte zurück.
Zwischen der Fahrbahn und dem Gehweg wuchsen Heckenrosen und kleine Kiefernsträucher in schmalen Beeten. An einem vorbeifahrenden roten Nissan quietschten die Scheibenwischer. Ich sah, dass der Kofferraum des kleinen Wagens bis unters Dach voll war mit sorgsam geschichteten Taschen und anderem Gepäck, das passgenau in die Zwischenräume geschoben worden war. Man musste nicht lange hier oben leben, bis man mit einem Blick Ankommende von Abreisenden unterscheiden konnte. Die, die gingen, plauderten beim Fahren und lachten, und das Gepäck war weniger ordentlich verstaut. Die, die kamen, musterten, wie das ältere Paar durch die Windschutzscheibe des Nissans, mit aufmerksamem, erwartungsvollem Blick die Häuser und die abgehenden Seitenstraßen.
Die Waldstraße, an der unser Café lag, war so etwas wie die Hauptader des Dorfes. Sie führte von der Landstraße, die die Insel wie ein umgedrehtes U durchzog, in den Ortskern und weiter bis zum großen Parkplatz am Sandweg, direkt hinter den Dünen. Sie war eine der wenigen Straßen, die neu asphaltiert waren. Viele andere waren noch mit alten Panzerplatten ausgelegt, die der sandige Untergrund mit der Zeit gegeneinander verschoben hatte. Bei einigen hatte man nur die beiden Fahrspuren zementiert, während dazwischen der Boden mehr und mehr auswusch.
Von diesen Straßen führten Auffahrten durch weiß und ockerfarben gestrichene Holzzäune auf Grundstücke, deren Häuser in den vier Jahren, die ich nun schon hier lebte, immer neuer und frischer geworden zu sein schienen. Mehr und mehr der alten, reetgedeckten Häuser bekamen ein neues Dach aus heimischem Schilfrohr, eine sauber glänzende Fassade, einen holzverkleideten Anbau oder einen doppelten Carport. Die Autos auf den Parkplätzen davor, die von Kiefern, Magnolien und Buchen gesäumt waren, wechselten im Frühjahr und Sommer alle ein bis zwei Wochen, und es geschah immer seltener, dass eine Auffahrt für einen längeren Zeitraum leer blieb. Ich fragte mich, ob die beiden ankommenden Urlauber, deren rotes Auto gerade in einer der kleinen Seitenstraßen verschwand, nicht den Eindruck bekommen mussten, dass hier auf der Insel die Zeit verkehrt herum lief.
Helen hatte einmal gesagt, dass es das Versprechen des Ortes war, dass hier nichts Unvorhergesehenes passieren würde. Und so war es: Alles besaß eine klare Form, war sauber, überschaubar und verlässlich und die Entscheidungen, die zu treffen waren, beschränkten sich darauf, ob man den Tag am Strand verbrachte, im Wald wandern ging oder eine Radtour über die Insel machte.
Obwohl Helen und ich immer von der »Insel« sprachen, war es eigentlich gar keine Insel, auf der wir lebten und das Café Strandflucht betrieben. Genau genommen war es eine Halbinsel, die sich klobig ins Meer hineinschob. Auf den Luftaufnahmen, die es an den Postkartenständern zu kaufen gab, sah es so aus, als würde das Wasser beharrlich daran arbeiten, dieses ausgefranste Stück Land mehr und mehr vom Festland loszuwaschen. Aus irgendeinem Grund stellte ich mir immer vor, dass, wenn es der See schließlich gelingen würde, den an der schmalsten Stelle nur wenige hundert Meter breiten Streifen, der die Insel, die keine war, mit dem Festland verband, zu kappen, die gesamte Insel dann einfach davontreiben würde.
Ich nahm einen letzten Zug aus meiner Zigarette und blickte in den Himmel, dessen dichte Wolkendecke den ganzen Morgen über bleiern und schwer gewesen war. Inzwischen ließen sich unterschiedliche Grautöne ausmachen. Es war die Zeit des Tages, um die herum das Wetter oft noch einmal umschlagen konnte.
Ich drückte die Zigarette an einem Laternenpfahl aus, warf sie in den daran angebrachten Mülleimer und ging die wenigen Schritte über den kleinen gekiesten Parkplatz zurück ins Café.
Die beiden Urlauber würden ihren vollgepackten Wagen gerade über eine der unebenen, sandigen und löchrigen Straßen lenken, langsamer noch als die Fahrradfahrer, die müden und engen Augen auf die Hausnummern gerichtet, auf den letzten Metern, die noch zwischen ihnen lagen und ihrem glänzenden, sorgenfreien Domizil für die nächsten zwei Wochen. Mir gefielen sie, die schlechten Straßen. Es war, als würden sie den Ort daran erinnern, dass er trotz alledem eine Vergangenheit hatte. Dass es etwas gab, das ihn wissen ließ, woher er kam und wer er war. Auch wenn es sich dabei nur um den ausgewaschenen Untergrund handeln mochte.
Noch ehe die schwere Holztür hinter mir ins Schloss fiel, spürte ich, wie es passierte, wie meine Wahrnehmung, meine Haltung, mein ganzer Körper zu dem eines Kellners wurde. Es war ein wohliges Gefühl, das diese Veränderung in mir auslöste, und es war noch immer dasselbe wie damals, als ich sechzehn gewesen und das erste Mal in einen Gastraum getreten war, mit einem Block für die Bestellungen, und einem stumpfen Bleistift, da ich mir blind einen aus dem Stapel gegriffen hatte.
Mein Blick richtete sich auf das wenige, was jetzt wichtig war. Auf die Strecke, die ich mit dem Tablett zurückzulegen hatte, auf einen Stuhl, der plötzlich zurückgeschoben wurde, auf einen liegengelassenen Rucksack und den Herrn, der direkt am Gang saß und ausholend gestikulierte. Ohne mein bewusstes Zutun war in meinen Augenwinkeln eine stete Wachsamkeit, auf die ich mich verlassen konnte. Meine Schritte waren zielstrebig und in meinem Gesicht lag ein leises, aufmerksames Lächeln, bereit dazu, jedem neu eingetroffenen Gast das Gefühl zu geben, dass er willkommen war und wir seine Erwartungen nicht nur erfüllen, sondern aller Wahrscheinlichkeit nach sogar übertreffen würden.
Meiner Frau Helen gehörte das Café. Sie war die Chefin und hatte das alte, alles in allem aber gut erhaltene Kapitänshaus vor etwas mehr als vier Jahren gekauft, mit dem Geld, das sie aus den USA mitgebracht hatte. Davor hatte sie, soweit ich wusste, nie in der Gastronomie gearbeitet. Aber sie machte ihre Sache gut, sogar mehr als nur gut. In all den Jahren, die ich als Kellner gearbeitet hatte, war ich wenigen begegnet, die sich mit einer ähnlichen Sorgfalt, Gründlichkeit und, wie man sagt, mit Herzblut ihrer Sache gewidmet hätten, wie Helen es tat, Tag für Tag. Von Anfang an hatte sie sich selbst um die Einrichtung und die Dekoration gekümmert. Wie bei allem, so hatte sie auch hier klare Vorstellungen und war zupackend genug, um sie umzusetzen oder zumindest Mittel und Wege zu finden, die Dinge ihren Vorstellungen anzupassen. Die skizzenartigen Zeichnungen der Zeesenboote, deren weite Segel sich auf dem feinen Büttenpapier im Wind blähten, hatte sie selbst angefertigt und mit kleinen hölzernen Wäscheklammern an Paketschnur aufgehängt, die sie in die Ecken des Gastraumes gespannt hatte, und die wie Miniaturen von Schiffstauen wirkten. Seit diesem Jahr standen auf den kleinen, von Helen handbeschriebenen Schiefertafeln neben Kuchen und Eis auch Matjes mit Bratkartoffeln, ein Tapas-Teller in drei Größen, mit eingelegten Oliven, gegrilltem Gemüse, Manchego-Käse und Chorizo, und eine kleine Auswahl an Salaten.
Während im Sommer mittags und abends viel los gewesen war, kamen die Gäste nun, Anfang Oktober, nicht mehr so zahlreich und eher an den Vormittagen und den Nachmittagen. Zur Zeit waren es vor allem die Vogelbeobachter, deren Finger inzwischen von Tag zu Tag unruhiger auf den Tischplatten trommelten oder an ihrer Ausrüstung herumnestelten, schweigsame Rentner und müde, aber zufriedene Eltern mit kleinen Kindern, die mit ihren Autos und Baustellenfahrzeugen auf dem alten Holzboden spielten oder auf den Eckbänken schliefen. Da die Kraniche, sobald sie gesichtet wurden, jedes Jahr noch einmal Scharen auf die Insel trieben, hatte Helen unsere Saisonkraft noch nicht nach Hause geschickt. Sie selbst arbeitete meist in der Küche, während ich mir mit Nora, einer rothaarigen Studentin aus Greifswald, die dieses Jahr zum ersten Mal bei uns war, den Gastraum teilte.
»Ich habe heute Nacht von dir geträumt«, sagte Helen.
Sie schaute von der Liste auf, mit der sie gerade die Vorräte in den Regalen durchging und die nächste Bestellung fertigmachte. Ich saß bei ihr in der Küche und aß ein frühes, schnelles Mittagessen. Auf dem Teller vor mir hatten die zwei letzten Stücke Weißbrot das Öl des eingelegten Gemüses bereits aufgesogen. Sie schimmerten dunkel, in einem geheimnisvollen Grün. Meine Zunge war pelzig von einer gegrillten Auberginenscheibe. Ich versuchte, den salzigen, erdigen Nachgeschmack mit einem Schluck aus dem Wasserglas loszuwerden. Ich schmatzte ein paar Mal in der vagen Hoffnung, es würde etwas helfen.
Helen lächelte mich an, über die Blätter hinweg, die sie in den Händen hielt. Ihre schwarzen Haare hatte sie, wie sie es bei der Arbeit immer tat, zu einem Pferdeschwanz gebunden. In ihren Augen, deren Farbe je nach Lichteinfall oder Stimmung mal grau, mal grün war, so als könnten sie sich selbst nicht entscheiden oder wollten es nicht, lag die meiste Zeit über etwas Kühles. Und die klaren, fast scharfen Konturen ihres schmalen Gesichts, die durch die zurückgebundenen Haare noch deutlicher hervortraten, gaben ihr einen Ausdruck, der auf den ersten Blick streng und unnahbar wirken konnte. Für den Betrieb war das nicht verkehrt. Helen wirkte wie das, was sie war: eine Café-Inhaberin, der ihr Laden am Herzen lag, und die ihn, sollte es nötig sein, auch verteidigen würde, gegen alle, die ihr oder ihren Mitarbeitern krumm kamen.
Doch wenn sie lächelte, wie sie es jetzt tat, verschwand mit einem Schlag alle Kälte aus ihrem Gesicht, so als wäre sie nie da gewesen. Ihre Augen bekamen dann einen warmen, sanften Ausdruck, der etwas Melancholisches haben konnte, wie von einer Person, die gerade etwas Schönes betrachtet, von dem sie weiß, dass es bald für immer verschwunden sein wird. Die Veränderung in ihrem Gesicht, zwischen der lächelnden Helen und der, die es nicht tat, war größer als ich sie von anderen Menschen kannte. Hätte mich jemand danach gefragt, hätte ich wohl gesagt, dass Helen schöner war, wenn sie nicht lächelte. Und doch war es ihr Lächeln, das mir wie nichts anderes versicherte, dass der Tag und mit ihm alles, was zählte, gut war und gut bleiben würde.
Während der letzten Stunden war ich mehrere Male in die Küche gekommen und hatte gesehen, wie Helen, die sonst stets von einem Handgriff zum nächsten überging, still dagestanden war und aus dem Fenster geschaut hatte, zu den Holztischen im Garten und zu den zusammengeklappten Stühlen, von deren Lehnen das Wasser tropfte.
Ich hatte sie nicht darauf angesprochen. Es war eine unserer festen Regeln, dass die Dinge, die das Leben außerhalb betrafen, nichts im Café verloren hatten. Wenn es etwas gab, das sie mir sagen wollte, dann würde sie das auch tun, irgendwann. Und falls es mich nicht betraf, dann war das auch in Ordnung. Helen war fünfunddreißig und hatte vor vier Jahren ihren ersten Ehemann bei einem Autounfall verloren. Das gab ihr in meinen Augen mehr als alles andere das Recht, ab und an auch einfach nur aus dem Fenster zu schauen. Zwischen ihr und mir lagen nur drei Jahre. Und doch war ich den Eindruck nie losgeworden, dass bei ihr so viel mehr Leben passiert war.
Ich zerdrückte ein Stück eingelegter Karotte am Gaumen und spürte der Süße nach, die in meinen Mund strömte und dabei den Auberginengeschmack letztgültig vertrieb. Helen legte ihre Liste beiseite.
»Ich habe von dir geträumt«, sagte sie jetzt noch einmal, als befürchtete sie, dass ich sie beim ersten Mal nicht verstanden hätte. »Es war eigenartig.«
In der vergangenen Nacht war ich aufgewacht, mit dem seltsamen Gefühl, dass es im Schlafzimmer auf einmal zu ruhig geworden war. Ich hatte die Augen geöffnet und direkt in Helens Gesicht geschaut. Sie hatte sich im Bett aufgestützt und mich angesehen. Ein Träger ihres dünnen Nachthemds war über die Schulter gerutscht. In dem fahlen Weiß um die Pupillen herum waren ihre Augen große, weit geöffnete dunkle Punkte mit einem Ausdruck, als würde sie sich über etwas wundern. Aber ihr Blick, verstand ich dann, ging ins Leere. Ihre Gesichtszüge waren so entspannt wie die einer Schlafenden. Ich fragte mich, ob sie überhaupt wach war. Ich musste dann wieder eingeschlafen sein. Denn das nächste, woran ich mich erinnerte, war das klackernde Rattern des Rollladens, den Helen am Morgen hochgezogen hatte.
»Du kennst doch die Wiese am südlichen Waldrand, hinter der Pferdekoppel«, sagte sie. »In meinem Traum sitze ich dort auf dem Boden. Ich trage nichts weiter als eine dieser alten Schürzen, so eine mit weißen Rüschen.«
»Eine Servierschürze«, sagte ich.
Helen nickte ungeduldig und fuhr dann fort. »Ich spüre den feuchten Tau auf meiner Haut. Der Morgen dämmert gerade. Es ist die Zeit, in der alles blau ist. Auf einmal höre ich etwas im Wald. Ich lausche dem Geräusch, ein Rascheln. Ich warte. Plötzlich tritt ein Vogel aus der Baumreihe heraus auf die Wiese.«
Helen hielt kurz inne und ich meinte, in ihrem Gesicht für einen Moment wieder den seltsamen, verwunderten und zugleich abwesenden Ausdruck zu sehen, wie in der letzten Nacht.
»Es ist ein einzelner Kranich«, sagte sie und drückte mit dem Daumen in rascher Folge auf den Kopf des Kugelschreibers, den sie in der Hand hielt, so dass die Mine mit einem rhythmischen Klacken mehrmals aus- und einfuhr. »Und wie ich ihn sehe, läuft es mir eiskalt über den Rücken. Sie kommen aus dem Süden, sage ich zu mir, aus dem Süden. Plötzlich ist es ganz wichtig, dass ich dir davon erzähle. Ich gehe los, um dich zu suchen. Du bist nicht im Café. Ich gehe weiter, außer mir ist niemand im Dorf. Schließlich erreiche ich den Strand. Und als ich dort auf dem Kamm der Düne stehe, sehe ich: Das Meer ist verschwunden. Der Strand ist noch da, wie immer. Aber dort, wo sonst das Wasser beginnt, ist nur flacher sandiger Boden. Steine liegen darauf, und Reste grünlich-gelber Algen. Weiter hinten fällt der Boden mehr und mehr ab. Aber das Wasser ist weg. Nicht mal Pfützen sind zu sehen. Alles ist trocken.«
Helen hob die linke Hand und legte sie sich an die Wange. Ihr Blick verlor sich in der Tiefe der Spülmaschine, deren Klappe offen stand.
»Und dann sehe ich dich«, sagte sie. »Du bist schon weit, weit draußen, kaum mehr als ein kleiner Punkt auf dem trockenen Meeresboden. Ich rufe deinen Namen, und du drehst dich um. Ich weiß, dass es unsagbar wichtig ist, dir davon zu erzählen, dass die Kraniche dieses Jahr aus dem Süden kommen, dass das etwas ist, das du dringend wissen musst. Aber du verstehst mich nicht, du bist viel zu weit weg. Du winkst mir zu. Dann gehst du weiter. Ich sehe dir nach und höre auf einmal hinter mir ein ohrenbetäubendes Geräusch. Ich weiß, dass es das Flügelschlagen tausender und abertausender Kraniche ist, die von Süden kommen, über den Ort hinwegziehen und in dieselbe Richtung fliegen werden, in die du unterwegs bist.«
Helen fuhr sich mit den Händen über die Oberarme. Dabei schob sie ihre Unterlippe vor und zurück, als würde sie überlegen, wie sie eine wichtige Sache genau auf den Punkt bringen könne.
»So endet der Traum«, sagte sie nach einer Weile einfach und ließ den Kugelschreiber wieder klicken. Ich schaute ihr dabei zu, wie ihre Augen zwischen den Vorräten und der Liste hin und her sprangen, wie sie mit dem Kugelschreiber die zahllosen schmalen Zeilen entlangfuhr, bis sie die richtige gefunden hatte, um dann in ihrer geschwungenen, die Buchstaben und Ziffern biegenden Handschrift eine Zahl einzutragen oder etwas zu notieren. Ich wurde den Eindruck nicht los, dass es noch mehr gab, was sie mir hatte sagen wollen.
Von uns beiden war Helen schon immer diejenige gewesen, die gut mit Worten umgehen konnte. Sie wirkte wie jemand, dem es leichtfiel, das, was er dachte, in Worte zu fassen. Nicht selten geschah es, dass sie etwas sagte und ich darin meine eigenen Überlegungen wiederfand, besser und klarer, als ich sie je auszudrücken vermocht hätte.
Obwohl Helen klare Vorstellungen von dem hatte, was sie wollte, gehörte sie doch nicht zu den Menschen, die gerne glücklich waren. So etwas wie Glück schien für sie immer Anlass zur Sorge zu sein und ließ in ihr den Verdacht aufkommen, dass sie etwas übersah. Etwas, das ihr Glück womöglich beschädige, ohne dass sie es bemerkte. Zu viel Glück machte Helen misstrauisch, mich nicht. Ich war der Ansicht, dass die Dinge für gewöhnlich nicht komplizierter waren, als es die eigene Erfahrung einem sagte, dass es beim Glück keinen doppelten Boden gab. Und dass es für einen selbst nicht gut war, wenn man zu sehr nach Problemen Ausschau hielt. Denn war es nicht auch möglich, dass manche Probleme erst dadurch entstanden, dass man nach ihnen suchte? Helen hatte das einmal die Philosophie eines Kellners genannt.
Man sagt, dass man einen Menschen dann kennt, wenn man weiß, was er will. Was er wirklich, in seinem tiefsten Inneren will. Wenn man das kennt, was ihn in seinem Leben und in seinen Entscheidungen antreibt.
Als ich an jenem Tag in der Küche unseres Cafés saß und Helen dabei zusah, wie sie die Bestellung fertigmachte, war ich noch fest davon überzeugt, das von Helen zu wissen. Dass ich sie kannte, wie man einen Menschen nur kennen kann. Denn ich liebte sie, und meinte, glücklich mit ihr zu sein. Mit ihr und mit dem Leben, das wir uns gemeinsam aufgebaut hatten.
Helen sagte immer, wir hätten zwei gemeinsame Vergangenheiten. Die eine Vergangenheit lag schon weit zurück. Als ich vierzehn war, zog Helen mit ihrer Familie in das kleine Dorf, in dem ich seit meiner Geburt gelebt hatte.
Mein Vater besaß eine kleine Motorradwerkstatt, die spezialisiert war auf Oldtimer, Sondermodelle und Spezialanfertigungen. Es war ein altes Bauernhaus, in dem wir lebten, und mein Vater hatte den hohen Raum im Erdgeschoss, in dem früher wohl der Pflug und der Heuwagen gestanden waren, zur Werkstatt umgebaut. Wir wohnten darüber, im ersten und zweiten Stock. Bis heute weiß ich nicht, ob die Gegend, in der ich groß geworden bin, einen eigenen Namen hat. Das karge Land mit seinem spröden Boden, der jahrhundertelang die Bauern zur Verzweiflung gebracht hatte, war wegen der sanften Hügel, die sich überall hoben und senkten, nur schwer zu überschauen. Die gesamte Region hatte auf mich stets wie etwas gewirkt, das bloß zwischen den Dingen lag. Von dort, wo wir lebten, war es nicht weit bis zum Bodensee, zur Donau oder in den Schwarzwald. Aber es gab nichts, was der Gegend selbst zu eigen, nichts, was auch nur erwähnenswert gewesen wäre.
Mein Vater und meine Mutter waren beide im selben Dorf groß geworden. Und obwohl es bis dorthin nicht weit gewesen wäre, sind wir doch nie hingefahren. Meine Großeltern habe ich nie kennengelernt und auch erst viel später erfahren, dass ein Teil von ihnen bis zum meinem zehnten Geburtstag noch am Leben gewesen war. Meine Eltern waren stille Menschen. Wenn sie einmal lächelten, dann sah es so aus, als würde es ihren Gesichtern große Mühe bereiten. Geredet wurde bei uns zu Hause vor allem dann, wenn es einen Anlass gab, etwas, das besprochen oder geklärt werden musste.
Jeden Morgen nahm ich den Bus mit der Nummer 364. Die Realschule lag im nächsten größeren Ort, der zwar das Wort Stadt im Namen führte, es aber eigentlich nicht verdiente. Die kurvenreiche und schlecht geteerte Straße, auf der jeden Sommer mindestens ein Motorradfahrer sein Leben ließ, fuhr der Bus mit einer Geschwindigkeit, die mir, wenn ich im hinteren Teil saß, in den Kurven den Bauch zusammenzog. (Unter den Verunglückten waren, soweit ich wusste, nie Kunden meines Vaters, sondern meist junge Männer, die ich nicht kannte, aus dem Sportverein oder der Blaskapelle eines der umliegenden Dörfer.)
Als im September das neue Schuljahr begann, saß eine Neue im Bus. Wenn ich einstieg, war sie immer schon da, auf der ersten Zweierbank hinter dem Vierersitz im vorderen Teil des Busses. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wann wir zum ersten Mal miteinander gesprochen haben. Aber bald wusste ich, dass Helen drei Jahre älter war und vor kurzem mit ihren Eltern hergezogen war. Die Schule, auf die sie ging, war das Gymnasium in derselben Stadt, und so fuhren wir von da an die meisten Morgen und auch viele Nachmittage gemeinsam dieselbe Strecke.
Die vierundzwanzig Minuten, die zwischen meinem Zustieg an der alten Dorflinde und ihrem Ausstieg an der Haltestelle des Gymnasiums lagen, wurden zu einem festen Bestandteil der Tage, Wochen, Monate und schließlich sogar Jahre. Ohne dass wir es je festgelegt oder beschlossen hätten, berührten sich unsere Leben nur dort, im Bus. Wenn wir uns doch einmal über den Weg liefen, in der kleinen Fußgängerzone der Stadt oder im Eiscafé, grüßten wir uns wie flüchtige Bekannte oder so, wie ich die große Schwester meines besten Freundes grüßte. Am folgenden Morgen saßen wir wieder beieinander auf der Zweierbank, redeten und erzählten ohne Zögern, ohne Vorbehalte oder Scheu aus unseren Leben, während sich der Bus in den Kurven neigte, was aber hier, im vorderen Teil, wo unsere Plätze waren, nicht mehr so stark zu spüren war.
Kurz nach ihrem einundzwanzigsten Geburtstag ging Helen weg, um zu studieren. Sie schrieb Briefe – zum ersten Mal sah ich da ihre Handschrift –, in denen sie mich einlud, auf Besuch zu kommen. Ich sagte mir damals, dass ich es nicht tat, weil ich im selben Sommer, nach einem zähen und letzten Endes kläglichen Versuch, aufs Gymnasium zu wechseln, die Schule geschmissen hatte und nun fest als Kellner arbeitete, tagsüber in einem Café auf dem Marktplatz der Stadt und an den Wochenendnächten in einer Kneipe im Nachbardorf. Seit mein Vater davon erfahren hatte, musste ich Miete für mein kleines, stickiges Zimmer bezahlen, Geld, das meine Mutter jeden Monatsersten schweigend und mit Augen, die auf die stets blank geputzten Küchenfliesen gerichtet waren, von mir entgegennahm, ohne jemals etwas dazu zu sagen. Irgendwann kamen keine Briefe mehr.
Während meine ehemaligen Schulfreunde nach und nach wegzogen, manche, um zu studieren, andere zur Ausbildung oder um gleich zu arbeiten, blieb ich im Dorf. Ich hörte mit dem Kellnern, das ich als Gelegenheitsarbeit angefangen hatte, nicht mehr auf. Allmählich arbeitete ich mich von den Kneipen und Cafés zu den Restaurants empor.
Wenn die Leute, die ich von früher kannte, herkamen und ihre Eltern besuchten, traf ich mich mit ihnen in derselben Kneipe, in der wir früher gesessen waren. Und wenn sie davon erzählten, was sie nun taten, wo sie lebten und was ihre Pläne waren, dann beschlich mich dabei oft der Eindruck, dass das Weggehen sie nicht glücklicher gemacht hatte. Nicht, dass ich es ihnen nicht gegönnt hätte, aber das Wiedersehen mit denen, die gegangen waren, gab mir keinen Grund, um selbst wegzugehen. Allerdings räumte ich nach einigen Jahren das Zimmer bei meinen Eltern. Die kleine Dachwohnung, die ich mir in der Stadt mietete, hatte einen Balkon, der nach Süden ging, und kostete kaum mehr als das, was mein Vater zuletzt monatlich von mir verlangt hatte. Zu dem Restaurant, wo ich inzwischen angestellt war, waren es von dort nur wenige Minuten.
Ich hatte schon immer gerne Bücher gelesen, und das war es mehr oder weniger, womit ich die Tage füllte, an denen ich nicht arbeitete (viele Tage waren es nicht). Irgendwann, in einem schwülen Sommer, und ohne dass ich verstanden hätte, warum, begann ich plötzlich wieder an Helen zu denken. Ein paar Mal setzte ich mich sogar in den Bus und fuhr auf unserer Zweierbank bis ins Dorf meiner Eltern. Ich stieg nie aus, sondern blieb sitzen, während der Fahrer am Dorfweiher eine Zigarette rauchte und mich mit einer Mischung aus Missmut und Desinteresse nicht aus den Augen ließ.
Da ihre alte Mobilnummer nicht mehr funktionierte, suchte ich im Telefonbuch nach der Nummer ihrer Eltern. Es war das erste Mal, dass ich überhaupt dort anrief. Helens Mutter erzählte mir, dass Helen vor drei Monaten mit einem Amerikaner in die USA gegangen sei, ihn geheiratet habe und offenbar dort bleiben wolle. Nur in einem leisen Halbsatz fügte die Frau hinzu, dass Helen sich seitdem auch bei ihr nur noch selten melde. Von dieser drückenden Julinacht, in der ich mit ihrer Mutter gesprochen hatte, bei weit geöffneten Fenstern, durch die dennoch nicht der geringste Luftzug in meine Dachwohnung gelangt war, dauerte es noch einmal drei Jahre, bis ich wieder von Helen hörte.
Es war ein Ostersonntag. Am Abend zuvor hatte ich mit Kollegen aus dem Restaurant gefeiert und hinter meinen Augen pochte noch immer ein höllischer Schmerz, der inzwischen durch das Bier, das ich beim Mittagessen mit meinen Eltern getrunken hatte, immerhin dumpf geworden war. Seit ich nicht mehr zu Hause wohnte, kam ich mir wie ein Fremder vor, jedes Mal, wenn ich sie besuchte. Als hätte ich selbst nie dort gewohnt und als wüssten sie auch nicht recht, wie mit dem Unbekannten umzugehen war, der nun an ihrem Tisch saß und mit seinen Fingern die gehäkelte Tischdecke nicht in Ruhe lassen konnte.
An jenem Tag schloss ich die Türe meines Elternhauses hinter mir und sah den Bus bereits um die Ecke biegen. Ich rannte die wenigen Meter zur Haltestelle bei der alten Linde, obwohl mein Magen und mein Kopf alles gaben, um mich daran zu hindern. Ich sprang durch die hintere Türe in den Bus, beachtete den tadelnden Blick nicht, den mir der Busfahrer durch seinen großen Rückspiegel zuwarf, und ließ mich auf den erstbesten Platz fallen. Die einzige Person, die außer mir noch im Bus fuhr und vorne saß, auf der ersten Zweierbank hinter dem Vierersitz, nahm ich zunächst kaum wahr.
Mit diesem Wiedersehen im Bus begann das, was Helen unsere zweite Vergangenheit nannte. Die Vergangenheit, die zu unserer Geschichte geworden war und die uns gemeinsam hierhergebracht hatte, an die Ostseeküste, in der Helen zur Eigentümerin des Café Strandflucht geworden war und ich zu so etwas wie ihrem Oberkellner.
Jeder, der wie wir hier oben an den Urlaubsgästen verdiente, hatte allen Grund zur Freude. Unsere Gegend hatte im vergangenen Jahr zum ersten Mal die höchste Touristenzahl der gesamten Republik verbucht und schon jetzt ließ sich absehen, dass es dieses Jahr kaum schlechter ausgehen würde. Die Tische im Café Strandflucht waren den ganzen Sommer über voll besetzt gewesen. Abends waren die Leute lange gesessen, so dass wir unseren Bier- und Weinlieferanten zweimal die Woche hatten kommen lassen. Bislang fehlten zwar noch die endgültigen Zahlen. Aber nach einem ersten Überschlag hatte Helen bereits beschlossen, im nächsten Jahr für den Sommer noch eine dritte Saisonkraft anzustellen. Sie war außerdem im Gespräch mit mehreren Maklern und spielte mit dem Gedanken, eine, vielleicht sogar zwei Ferienwohnungen zu kaufen.
Am frühen Abend machte ich eine Pause. Helen bestand darauf, dass alle Mitarbeiter, und dazu zählte sie auch mich, ihre Pausenzeiten genau einhielten. Später würde ich Nora ablösen und mit Helen zu zweit den Abend bestreiten, da nach neunzehn Uhr inzwischen kaum noch Gäste kamen. Was sich am späten Vormittag angedeutet hatte, war inzwischen geschehen: Der graue Himmel war aufgerissen und die Strahlen der Nachmittagssonne schienen zwischen lockeren Wolkenfetzen warm auf den Ort herab, wo die letzten Spuren des morgendlichen Regens verdampften.
Vor dem Café stand Nora an der großen Tafel mit den Tagesangeboten. Sie hatte die Tafel bis zur Hälfte sauber gewischt und dann ihre Arbeit offenbar unterbrochen. Jetzt hielt sie ihre linke Hand mit gespreizten Fingern schräg nach oben gegen die Sonne.
Als ich zu ihr hintrat, sagte sie, ohne mich dabei anzuschauen: »Meine Großmutter hat immer gesagt, man soll sich die Fingernägel erst dann schneiden, wenn sie über die Kuppe des Fingers ragen, und zwar so.«
Nora drehte ihre Handinnenfläche so, dass ich sie sehen konnte, und fuhr mit dem Zeigefinger der anderen Hand über die mir zugewandten Fingerkuppen, an denen weiße Kreidereste klebten. Dabei legte sie den Kopf schief, als würde sie das selbst zum ersten Mal sehen.
»Das Problem ist«, sagte sie und schnalzte einmal mit der Zunge, »dass meine Fingernägel dann völlig unterschiedlich lang wären. Schau hier, der Abstand von Nagel zu Kuppe ist bei jedem Finger anders.«
Zum Vergleich hielt ich meine Hand neben ihre. Bei mir war es genauso.
»Ich verstehe nicht«, sagte sie dann mit Blick auf die halbgewischte Tafel, »warum Helen noch immer will, dass ich das Abendangebot an die Tafel schreibe.«
Ihre Stimme klang müde. Sie war nicht die Einzige, der man anmerkte, dass die Saison vorüber war. Überall auf der Insel, und ganz besonders in den kleinen Läden, den Andenkengeschäften und den Boutiquen für Wandermode, wurde der Ton um diese Jahreszeit ruppiger, die Verkäufer ungeduldiger und die Gesichter abgekämpfter. Selbst Noras Sommersprossen schienen über die letzten Tage hinweg blasser geworden zu sein, als wären auch sie erschöpft von der Arbeit, die hinter uns lag.
»Es kommt doch eh kaum noch einer am Abend«, sagte sie jetzt, mehr zur Tafel als zu mir, während sie sich daranmachte, mit kleinen, kreisenden Bewegungen die restlichen Kuchenangebote wegzuwischen. »Und das Trinkgeld wird auch rarer.«
»Es wird besser werden, sobald die Kraniche kommen«, sagte ich und klopfte eine Zigarette aus der Packung.
Nora warf mir über die Schulter hinweg einen gespielt zweifelnden Blick zu. Ihre braunen Pupillen zogen sich zusammen, als ein Sonnenstrahl plötzlich hinter einer Wolke hervorkam und ihr aufs Gesicht fiel.
Ohne Eile ging ich die Straße hinab und blies den Zigarettenrauch in die warme Luft, die jetzt, wie manchmal im Herbst, leise zu knistern schien. Es waren mehr Leute unterwegs als am Vormittag, aber die Nachsaison war unverkennbar. Zwei Männer in teuer aussehenden Wachsjacken mit vielen, bereits ausgebeulten Taschen unterhielten sich an der Kreuzung, an der der Supermarkt war und von der aus der gepflasterte Weg zur Seebrücke abging. Um den Hals des einen hing eine Kamera mit einem angeschraubten, grotesk langen Objektiv.
»Das sieht dir ähnlich«, sagte er gerade, als ich vorbeiging. Dann lachten beide.
Ich bog ab und ging die wenigen Meter zum Bücherstand. Frank Nonnenmacher verkaufte hier, am Aufgang zur Seebrücke, gebrauchte Bücher. Er nannte es sein mobiles Antiquariat. Jeden Morgen in der Zeit von April bis Oktober baute Frank die Malertische auf, auf denen seine Kisten standen. Die Bücher, die er verkaufte, waren allesamt in tadellosem Zustand. Er stellte sie mit dem Buchrücken nach oben in die Kisten, die er nach Themen und Verlagen eingeräumt hatte. Ich war schon kurz nach meiner Ankunft auf der Insel das erste Mal an seinem Stand gewesen. Inzwischen war ich so etwas wie ein Stammkunde. Neulich hatte Frank mir dabei geholfen, ein Regal mit einer Auswahl von Büchern zu bestücken, das nun im Gastraum des Cafés stand.
Frank saß die meiste Zeit auf einem Camping-Klappsessel hinter den Büchern. Es war eines jener Modelle, bei denen ein Getränkehalter in die rechte Armlehne eingelassen war. In dem kleinen Netz stand stets eine offene Fanta-Dose, aus der ich ihn aber nie hatte trinken sehen. Wir waren etwa im selben Alter. Frank kleidete sich ausschließlich in Blautönen. Warum, wusste ich nicht. Seine kleinen, aufmerksamen Augen schienen, wenn man mit ihm sprach, um einen herumzuspringen, wie kleine Hunde es taten.
Er war aus Berlin gekommen, wo er in einer kleinen Firma Grußkarten entworfen und mit dem Chef geschlafen hatte. Wenn ich mich recht erinnerte, leiteten die beiden für eine Weile sogar die Firma gemeinsam. Irgendwann hatte sein Partner ihn fallen lassen, von einem Tag auf den anderen, und drei Wochen später eine Frau geheiratet. Mit hochgezogenen Augenbrauen hatte Frank mir einmal erzählt, dass er ihm als Grund für seine Entscheidung genannt hatte, dass er Mitte vierzig war und seit Jahren schon das Gefühl nicht loswurde, etwas Bleibendes hinterlassen zu müssen. Ein Jahr später wurde er Vater. Frank kannte nicht einmal den Namen des Kindes.
Ohne zu zögern hatte Frank damals gekündigt – genauer gesagt war er einfach nicht mehr ins Büro gegangen – und hatte so lange von seinem Ersparten gelebt, bis es vollständig aufgebraucht gewesen war. Durch eine Vermittlungsagentur war er im nächsten Sommer als Saisonkraft hierher auf die Insel gekommen, und war, als die Saison zu Ende ging, nicht mehr weggegangen. Seitdem sammelte er die Bücher ein, die von den Touristen in den Ferienwohnungen und Hotelzimmern der Insel zurückgelassen wurden. Viele der Vermieter und Hotelbetreiber gaben ihm sogar Geld dafür, dass er sie von dem Papiermüll befreite. Frank hatte ein kleines Lager am Hafen angemietet, hinter der Fischräucherei. Dorthin brachte er alle Bücher und sortierte sie nach Zustand, Thema und Verlag. Im Winter verkaufte er sie übers Internet. Und solange es warm genug war, stellte er seine Tische hier am Strandaufgang auf.
Als ich näher kam, sah ich, dass Werner Stockmann bei ihm stand. Frank lehnte an der Kiste mit den Reiseromanen. Wenn Stockmann sprach, beugte er sich zu Frank hin, so als wäre das, was er sagte, nur für dessen Ohren bestimmt. Außer den beiden war niemand zu sehen.