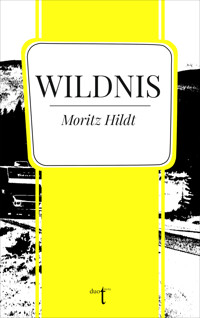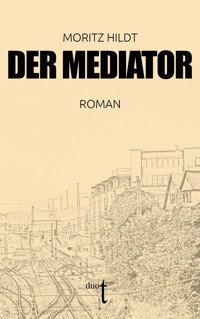
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: duotincta
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sebastian Perler, 37 Jahre, löst als Mediator die Probleme der anderen. Für das Wochenende — der Tag der deutschen Einheit steht bevor — hat er Reisepläne, die ihn von Erfurt über Hamburg bis in die süddeutsche Provinz führen werden. Doch was als Spritztour geplant war, lässt Sebastians Welt aus den Fugen geraten und konfrontiert ihn mit seinen eigenen ungelösten Fragen. Kann es uns gelingen, einen Punkt zu erreichen, an dem unsere Vergangenheit nicht mehr bestimmt, wer wir sind? Bedeutet Liebe Geborgenheit oder Abhängigkeit? Was ist ein gutes Leben? In seiner atmosphärischen Prosa lotet Moritz Hildt die lauernden Abgründe und überraschenden Schönheiten aus, die verborgen liegen in dem, was wir "Alltag" nennen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 246
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
verlag duotincta
Über den Autor
Moritz Hildt, geboren 1985 in Schorndorf, ist Schriftsteller und promovierter Philosoph. Er lebt in Passau.
www.moritzhildt.de
Moritz Hildt
DERMEDIATOR
Roman
Impressum
Die Arbeit an diesem Roman wurde durch ein Arbeitsstipendium des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg gefördert.
Erste Auflage 2025
Copyright © 2025 Verlag duotincta GbR, Wackenbergstr. 65-75, 13156 Berlin
Alle Rechte vorbehalten. Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von §44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Lektorat: Verlag duotincta/Jürgen Volk, Berlin
Satz und Typographie: Verlag duotincta/ Nikko Ray Cotelo, Balanga City
Einband: Jürgen Volk, Berlin
Coverabbildung: Jan Andreas Münster, Tübingen/Berlin
Vignette: Unter Verwendung von ChatGPT
Printed in Germany
ISBN 978–3–946086–96–3 (Print)
ISBN 978–3–946086–97–0 (E-Book)
Bücher haben einen Preis! In Deutschland und Österreich gilt die Buchpreisbindung, was für Dich als LeserIn viele Vorteile hat. Mehr Informationen am Ende des Buches und unter www.duotincta.de/kulturgut-buch.
DERMEDIATOR
It is always an accident that saves us.
– James Salter, Light Years
1
Aufmerksam geworden, halte ich inne. Eine Radfahrerin muss bremsen, schlingert kurz und fährt dann, eine Verwünschung murmelnd, so dicht an mir vorüber, dass mir ihr Parfüm in die Nase dringt. Es ist ein wuchtig süßer Duft, bei dem ich an vergorene Äpfel denken muss, vielleicht auch nur deswegen, weil es so gut zur Jahreszeit passt. Von irgendwoher ertönt das schrille Fiepen eines zurücksetzenden Lasters. Eine Straßenbahn klingelt mit der ihr eigenen Beharrlichkeit. Und im Café, das noch geschlossen hat, wischt ein Kellner so beschwingt über die runden Tische, als würde er zu einer Musik tanzen, die ich nicht hören kann. Es ist ein gewöhnlicher Donnerstagmorgen hier auf dem Erfurter Domplatz – jene Zeit des Tages, in der die Komplexität der Dinge noch überschaubar bleibt und die Toleranz für Uneindeutigkeit etwas ist, das allen leichtfällt.
Das Geräusch, das mich eben hat aufmerken lassen, ertönt noch zwei weitere Male. Dann entdecke ich die einzelne Elster, die in den Zweigen der alten Robinie an der Straßenbahnhaltestelle sitzt. Ihr Rufen klingt heiser und scharrend, wie das Schütteln einer Streichholzschachtel. Und sie hört nicht auf damit. Als wolle sie den jungen Mann im halblangen Wintermantel, der unter dem Baum steht und mit ernstem Blick kurze, eilige Antworten in eine Freisprechanlage nickt, vor etwas warnen, ihn verscheuchen oder dazu ermutigen, mit einem Streichholz ein Feuer zu entfachen, alles hineinzuwerfen, was ihn stört, und ein neues Leben zu beginnen. Der Mann, er ist höchstens Anfang Zwanzig, nimmt keine Notiz von dem Vogel. Stattdessen blickt er mit zusammengezogenen Brauen sorgenvoll ins Leere, während der Kopfhörer in seinem Ohr unablässig blau blinkt. Wen auch immer er da am Telefon hat, es ist offensichtlich, dass der Arme gerade ordentlich zusammengefaltet wird. Ich spiele mit dem Gedanken, dem Jungen, an dessen Hals sich bereits rote Nervositätsflecken abzeichnen, meine Visitenkarte in die Manteltasche zu schieben. Aber das lasse ich natürlich bleiben. Im Weitergehen nicke ich der Elster einen stummen Gruß zu.
Mein Name ist Sebastian Perler. Ich bin ein Mediator. Und während um mich herum ein neuer Tag voll offenstehender Möglichkeiten anbricht, befinde ich mich mit zügigen Schritten auf dem Weg in meine eigene Vergangenheit.
Seit etwas mehr als einem Jahr wohne ich in dieser Stadt, deren beschauliche Unverbindlichkeit mich schon bei meinem ersten Besuch für sie eingenommen hat. Meine Frau Kati und ich waren damals – drei Jahre ist das jetzt her – auf der Durchreise und übernachteten bei ihrer Tante in Jena. Sie nahm uns mit nach Erfurt, auf den großen Weihnachtsmarkt am Domplatz. Damals dachte ich nicht daran, dass ich je wiederkommen, geschweige denn einmal hier leben würde.
Ich weiß noch, dass wir unter der gewaltigen hölzernen Weihnachtspyramide süßen Met tranken und Rostbratwürste aßen, die so heiß waren, dass ich mir den Gaumen daran verbrannte und für den Rest des Tages kaum mehr etwas schmecken konnte. Nur wenige Monate später wollten Kati und ich nach San Francisco ziehen, vielleicht für immer. Kati hatte ihren Reisepass mitgebracht und das frisch eingeklebte Visum funkelte im Schummerlicht wie etwas, das man an den Weihnachtsbaum hängt. Und auch wenn ich es damals noch nicht wusste, war Kati da bereits schwanger.
Gestern war mein Geburtstag. Ich bin jetzt Siebenunddreißig, geschieden und kinderlos, arbeite in einem kleinen Mediationsbüro auf dem Juri-Gagarin-Ring unweit des Erfurter Hauptbahnhofs und treffe mich regelmäßig mit einer Frau, die als Schaffnerin bei der Bahn arbeitet.
Was zwischen damals und heute passiert ist? Es wäre leicht zu sagen, dass ich durch die verheerendste, verwirrendste und niederschmetterndste Zeit meines bisherigen Lebens gestolpert bin. Und das wäre nicht falsch. Aber ebenso richtig ist, dass das, was geschehen ist, letzten Endes nichts anderes war als das gewöhnliche, unspektakuläre Leben, das wir alle kennen. Ich würde nicht mal sagen, dass ich heute unglücklicher bin als damals. Das Gegenteil scheint mir sogar der Fall zu sein. Meistens zumindest.
Auf dem Domplatz, den ich bei meinem ersten Besuch in all seinem vorweihnachtlichen Glanz kennengelernt habe, wird heute keine Adventsstimmung aufkommen. Die Buden und Fahrgeschäfte des Oktoberfests sind zu dieser frühen Stunde noch verrammelt. Ziemlich genau dort, wo wir damals Bratwurst gegessen haben, sitzt jetzt ein massiger Mann im kleinen schwarzen Opel einer Sicherheitsfirma und mampft mürrisch ein Stück Zupfkuchen.
Auf den Schienen davor kreuzen sich die Straßenbahnen und befördern die Pendler dorthin, wo ihr Tagwerk auf sie wartet. Auch den nervösen Jungen hat eine der rot-weißen Bahnen längst eingesammelt. Die Morgensonne wirft einen rötlichen, unverfänglichen Glanz in die Gassen und auf das noch taufeuchte Pflaster.
Die Radiomoderatorin der Morgensendung hat vorhin vergnügt in meine kleine Küche geschnurrt, dass die Aussichten für das verlängerte Wochenende – der Tag der Deutschen Einheit steht bevor – in ganz Deutschland »ziemlich toll« seien. Einen milden Start in den neuen Monat würden wir erleben, mit gelegentlich durchziehenden, aber unbedeutenden Schauern und dem ein oder anderen flüchtigen Frühnebel. In ihrer Wetteransage waretwas Aufforderndes mitgeschwungen, wie eine unausgesprochene Einladung, sie nach Sendeschluss abzuholen und sich mit ihr Hals über Kopf in ein atemberaubendes Feiertagswochenende zu stürzen, fernab aller Sorgen, Verantwortlichkeiten und Regenschirme.
Und warum auch nicht? Das warme Licht der noch tief stehenden Sonne hat zweifellos etwas Verlockendes und die kühle Luft schmeckt nach Aufbruch. Die herbstliche Trübsal, so scheinen sich alle an diesem Morgen fest vorgenommen zu haben, kann uns gestohlen bleiben, zumindest noch für die kommenden Tage. Was die Radiomoderatorin und ihre Einladung angeht, so überlasse ich den Vortritt gern einem anderen Glücklichen. Aber nur, weil ich schon eigene Pläne habe.
Wenn am frühen Abend die Leute in Scharen hierher strömen werden und den Domplatz mit bierseliger Feierabendlaune fluten, werde ich nämlich schon im ICE nach Paris sitzen; in jenem Zug, in dem Sandra heute ihre erste Fahrt als Zugbegleiterin im internationalen Bahnverkehr absolvieren wird. Entgegen meiner sonstigen Gewohnheit habe ich mir sogar einen Sitzplatz reserviert. Am Gare de l’Est werde ich hinter der Bahnsteigschranke auf sie warten und anschließend bei Austern und Baguette gebührend mit ihr anstoßen.
Sandra ist eine kleine Frau mit hellgrünen Augen, einem runden, offenen Gesicht und einem Händedruck, der einen jederzeit wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholt. Mit ihren breiten Schultern könnte man sie gut für eine Ringerin, Footballspielerin oder Rausschmeißerin halten. Ihre Leidenschaft gilt allerdings dem Klettern. Alles an ihr strahlt eine überwältigende Gegenwärtigkeit aus – eine Eigenschaft, die, stelle ich mir vor, sicher nützlich ist, wenn man in einer Steilwand hängt, die unter den eigenen Füßen Hunderte von Metern senkrecht ins gleichgültige Nichts abfällt. Und auch wenn ich wohl niemals mit ihr »in die Wand gehen« werde, wie sie sich ausdrückt, scheint ihr die Zeit mit mir doch – bislang zumindest – nicht langweilig zu werden.
Seit einem guten Dreivierteljahr schon treffen wir uns, in unregelmäßigen Abständen. Die Orte lassen wir uns von ihrem Dienstplan vorgeben. Dort verbringen wir dann, je nach dem, was ihre und meine sonstigen Verpflichtungen hergeben, ein oder zwei Nächte in einem Hotel in Bahnhofsnähe. Unser kleines Arrangement hat uns schon in Reiseführerstädte wie Nürnberg, Lübeck oder Heidelberg gebracht, aber natürlich auch an solche Orte, die auf Empfehlungslisten für romantische Wochenenden üblicherweise fehlen. Mir sind sie sogar lieber, jene unspektakulären Städte wie Magdeburg, Dinslaken oder Karlsruhe, nüchtern, anspruchslos und bar jeder Klischees.
Unser Ziel für den heutigen Tag fällt da natürlich aus der Reihe. Es gibt wohl wenige Städte, die so erwartungsüberfrachtet sind wie Paris. Wohl auch deswegen hat es mich bislang noch nie dorthin gezogen; die heutige Jungfernfahrt meiner Schaffnerin wird auch für mich eine sein.
Sandra hat mit großem Einsatz auf die Zusatzqualifikation hingearbeitet. Schon seit Monaten lernt sie dafür Französisch, mit einer App auf ihrem Tablet, was bei ihr inzwischen, wenn wir uns sehen, zu so etwas wie der »Zigarette danach« geworden ist – ein Grund, warum ich froh bin, dass sie die Prüfung nun hinter sich hat. Ich rechne damit, dass sie heute Abend in prächtiger Feierlaune sein wird; eine Aussicht, die mich ganz und gar nicht stört.
Und während ich anfangs überhaupt nicht begeistert von unserem heutigen Ziel gewesen bin – immerhin widersprechen die Klischees der Stadt der Liebe in so ziemlich allen Hinsichten der Beziehung, die Sandra und ich führen –, merke ich doch, wie seit einigen Tagen die Neugier in mir wächst. Inzwischen freue ich mich richtig darauf, morgen schon mit Sandra durch den Jardin du Luxembourg zu spazieren, wo es offenbar einen Teich gibt, an dem seit hundert Jahren dieselben Spielzeugsegelboote für Kinder ausgeliehen werden können, und danach einen sündhaft teuren Pastis zu trinken, in einer der Traditionsbars am Boulevard Raspail. (Ich bin vorbereitet, bis hin zur Adresse einer Bäckerei gleich am Bahnhof, in der es, für eine erste Stärkung, die besten Olivenbrötchen von ganz Paris geben soll.) Für den nächsten Tag habe ich auf dem Stadtplan einen kleinen, lauschigen und (hoffentlich) nicht zu überlaufenen Platz ausfindig gemacht, an dem wir Crossaints essen, eine Flasche Weißwein trinken und dabei auf die Seine schauen können, bevor wir dann wieder zum Zug müssen. Es steht nämlich noch ein weiteres Ziel an diesem Wochenende auf dem Plan.
Von Paris aus werden wir gemeinsam (diesmal beide als Passagiere) in die schwäbische Kleinstadt unweit von Stuttgart reisen, in der Sandra aufgewachsen ist. Ihr Vater besitzt dort einen recht einträglichen Weinanbau und wird am Sonntag Abend in seinen siebzigsten Geburtstag hineinfeiern. Den freien Feiertag am Montag werden wir dann für die Rückfahrt nutzen.
Als Sandra mich vor einigen Wochen anrief, um mir die Einladung ihres Vaters auszusprechen – ich hatte bis dahin nicht damit gerechnet, dass er überhaupt von meiner Existenz wusste –, klang sie nervös. Sicher, weil sie Sorge hatte, ich könne die Sache falsch verstehen. Und es stimmt ja auch: Eigentlich schließt unsere Art von Beziehung, die auf ungezwungener, ganz dem Hier und Jetzt verpflichteter Unverbindlichkeit beruht, Besuche bei den Eltern aus, übrigens genauso wie sehnsüchtige Textnachrichten mitten in der Nacht oder einen gemeinsamen Besuch der Hochzeit eines guten Freundes. Von Anfang an waren sich Sandra und ich einig, dass alles zwischen uns ganz in der Gegenwart stattfindet und wir nicht mehr, und nicht weniger, tun, als ab und an zusammen eine kurzweilige Zeit an einem Ort zu verbringen, der so wenig wie möglich mit uns selbst und unserem sonstigen Leben zu tun hat.
Und doch habe ich mich über die Einladung ihres Vaters gefreut. Ein Teil von mir fühlt sich sogar geehrt davon, dass er mich kennenlernen möchte. Jedenfalls blicke ich der Begegnung mit Sandras Familie mit Gelassenheit entgegen.
Ich biege um eine letzte Kurve, hinter der die verglaste Fassade des Hauptbahnhofs bereits auftaucht. Am liebsten würde ich gleich in den Zug steigen und Erfurt schon jetzt hinter mir lassen. Aber wie die Dinge nun mal liegen gibt es eine Reihe von Verpflichtungen, die mich noch bis zum frühen Abend hier halten. Um elf Uhr habe ich einen Ortstermin für eine Nachbarschaftsmediation südlich von Erfurt, in einem Mehrgenerationenhaus. Danach werde ich Gereon, meinen Chef, mit dem Dienstwagen abholen und gemeinsam mit ihm etwas tun, dem ich mit gemischten Gefühlen entgegenblicke: Es ist ein Kondolenzbesuch bei der Witwe eines Kollegen, der vor einigen Wochen bei der Kirschernte im eigenen Garten auf denkbar unglückliche Weise von der Leiter gestürzt ist. Man könnte meinen, dass dieser Teil des Tages derjenige ist, den ich am schnellsten hinter mich bringen möchte.
Aber das ist nicht der Fall. Mir macht der Termin, zu dem ich gerade unterwegs bin, mehr zu schaffen. Denn in wenigen Minuten werde ich mich mit Kati treffen, meiner Exfrau, in einem Café am Bahnhof, zum ersten Mal seit unserer Scheidung im vergangenen Jahr.
Um drei Minuten vor neun stehe ich auf dem Bahnhofsvorplatz und begreife, dass ich einen Fehler gemacht habe.
Nachdem Kati mir in ihrer knappen Art geschrieben hatte, dass sie für einige Tage nach Deutschland kommen und dabei auch ihre Tante in Jena besuchen würde, ob wir uns nicht treffen wollten, am besten gehe es vormittags, lag ihre E-Mail über zwei Wochen unbeantwortet in meinem Posteingang. Tag für Tag fiel mein Blick darauf, in der Hoffnung, dass mir irgendwann ein guter Grund einfallen würde, mit dem ich mich aus der Affäre ziehen könnte, ohne auch nur halbwegs als Idiot dazustehen. Schließlich sagte ich mir, dass ich genau das war – ein Idiot –, und setzte mich hin, um ihr zu antworten. Als Treffpunkt habe ich ihr die Starbuck’s-Filiale am Erfurter Hauptbahnhof genannt. Nicht etwa, weil es mein Lieblingscafé wäre. Es war schlicht und ergreifend der einzige Ort, der mir auf die Schnelle in Bahnhofsnähe eingefallen ist, mit dem ich nichts verbinde. Ich war sogar noch nie drin. Und genau das war der Fehler.
Denn jetzt, wo ich vor der Glastür stehe und mir zum ersten Mal die Zeit nehme, in das Café hineinzuschauen, sehe ich, dass es darin überhaupt keine Tische gibt, an denen man gemütlich sitzen und einen zwanglosen Kaffee miteinander trinken könnte, auf die gute alte Zeit (ohne dabei zu erörtern, wie gut sie denn nun tatsächlich war). Dort, wo ich mir einen schummrig-gemütlichen Gastraum vorgestellt habe, ist kaum mehr als eine Mitnahmetheke für Eilige. Die einzigen Sitzgelegenheiten sind ein paar wenig einladende Barhocker mit Blick auf den Bahnhofsplatz. Ich werde also wohl oder übel hier draußen auf Kati warten müssen und dann unser Treffen mit einem Problem beginnen – der Frage, in welches Café wir uns setzen sollen. Natürlich ist das eine ganz und gar banale Entscheidung. Aber es ist eine, die wir gemeinsam fällen müssen. Und das hätte ich gern vermieden.
Am Himmel haben sich dünne Wolkenschlieren von Nordosten her über das fahle Morgenblau gezogen und hüllen den Bahnhofsvorplatz in ein diffuses, milchiges Licht. Neben mir tauchen die Straßenbahnen stoßzeitgetaktet aus der Unterführung auf, die die Altstadt mit dem Stadtpark und den Wohnvierteln im Süden verbindet. Auch meine Linie hält hier; ich bräuchte nur einzusteigen und wäre keine Viertelstunde später wieder zu Hause. Womöglich sogar rechtzeitig, um noch den Schluss der Morgensendung im Radio zu hören. Tatsächlich gäbe ich gerade viel für ein paar verheißungsvoll geraunte Worte meiner Moderatorin.
Während mir die Zehen in den Schuhen allmählich kalt werden, bleibt mein Blick immer wieder an irgendwelchen Passanten hängen. Nicht, weil ich mir nicht sicher wäre, ob ich Kati wiedererkenne. Es ist eher so, dass ich mich gerade jedem Unbekannten, den sein Weg über diesen Platz führt, näher fühle als der Frau, auf die ich hier warte. Die Sonne ist jetzt vollständig hinter den Wolken verschwunden und hat eine klamme, unfreundliche Kälte zurückgelassen.
Ich beschließe, mich drinnen ein bisschen aufzuwärmen. Beim Aufziehen der überraschend schweren Glastür weht mir der heimelige Duft von frisch aufgebrühtem Filterkaffee entgegen. Geflissentlich ignoriere ich den Jungen hinter der Theke, der bei meinem Eintreten hoffnungsfroh aufgeschaut hat, und lasse meine Augen durch den winzigen Innenraum schweifen, als gelte allen Gegenständen hier drin mein tiefstes Interesse, von den Tassen mit der Silhouette des Doms bis hin zu der Armada von Sirupflaschen.
Und da entdecke ich Kati. Sie sitzt auf einem der Hochstühle direkt am bodentiefen Fenster. Unter ihren dichten, zweifelnd hochgezogenen Brauen schaut sie auf den Bildschirm ihres Handys. Auch wenn ich es nicht mit Sicherheit sagen kann, meine ich doch, dass der Eingangsbereich – dort, wo ich mir bis eben noch die Beine in den Bauch gestanden habe – von ihrem Platz aus gut zu sehen gewesen sein müsste.
Kati trägt schwarze Jeans und eine hellgraue Strickjacke mit groben Maschen. Sie hat die Beine übereinandergeschlagen, obwohl sie auf dem Barhocker sitzt. Ihr rechter, frei in der Luft hängender Fuß wippt nervös auf und ab, während sie mit zwei flinken Daumen irgendeine Nachricht in ihr Handy tippt. Kati ist knapp Einsneunzig groß und zieht deswegen fast immer ihre Schultern ein, sogar im Sitzen. Die dunklen Haare, die sie früher lang trug, sind mit einer entschiedenen Kante auf Kinnhöhe geschnitten. Die neue Frisur steht ihr erstaunlich gut.
Nachdem Kati vor zwei Jahren allein in die USA geflogen und ich, anders als geplant, in unserer Zweizimmerwohnung in Saarbrücken zurückgeblieben war, schrieb sie mir mehrere lange E-Mails. Ich war in keinem guten Zustand damals und jedes Mal, wenn eine neue Nachricht von ihr fett hervorgehoben in meinem Posteingang auftauchte, packte mich die Hoffnung, dass sie sich darin endlich entschuldigen, Verantwortung übernehmen und Verständnis äußern würde, für mich und meinen Schmerz. Aber natürlich tat sie das nie. Dafür schrieb sie mir ihre Gedanken, oft ohne erkennbaren roten Faden und meist zu irgendwelchen grundsätzlichen Dingen wie der Frage, ob sich Menschen ändern können oder nicht.
Als Mediator brauche ich mir über diese Frage zumindest nicht den Kopf zu zerbrechen. In den Gesprächen, die ich begleite, ist das Thema, ob sich jemand grundlegend ändert, sowieso tabu. Es ist ein verbreiteter Irrtum, dass Konflikte nur auf diesem Weg aus der Welt geschafft werden können. Tatsächlich ist es oft genau umgekehrt. Je vehementer eine Konfliktpartei darauf beharrt, dass sich die Gegenseite fundamental ändern müsse, desto vertrackter wird die ganze Angelegenheit. Was es braucht, ist in den meisten Fällen kaum mehr als die Bereitschaft, den anderen ausreden zu lassen und seinen Bedürfnissen und Sorgen mit Offenheit zu begegnen. (Ich sage nicht, dass das leicht ist.) Es mag also stimmen, was man häufig hört, dass man einen anderen Menschen nicht eher verstehen kann, als man in dessen Haut geschlüpft und für eine Weile darin herumgelaufen ist. Die gute Nachricht ist, dass ein solches Tiefenverständnis zwar der hehre Traum von Frischverliebten und schlechten Psychotherapeuten sein mag, für die Beilegung der allermeisten zwischenmenschlichen Konflikte aber keine nennenswerte Rolle spielt.
Es sind nur wenige Schritte, die mich von Kati trennen. Dennoch remple ich irgendwie gegen einen freien Barhocker, der mit einem grotesk lauten metallischen Scharren reagiert. Der Lärm lässt Kati aufsehen. In ihren großen italienischen Augen, die das satte, violette Schwarz von Auberginen haben, leuchtet freudige Überraschung. Als wäre es einer jener rätselhaften Zufälle des Lebens, dass wir uns hier über den Weg laufen.
Jetzt bin ich mir fast sicher, dass sie mich schon gesehen hat, als ich draußen vor der Tür gewartet habe. Aber ich nehme ihr das nicht übel, sondern beschließe, es als ein Zeichen zu sehen, dass unser Wiedersehen für sie genauso ambivalent und unsicherheitsbehaftet ist wie für mich. In einem Moment der Klarsicht erkenne ich, dass genau hierin eine Möglichkeit liegen könnte, wie wir einander auf eine neue Weise begegnen könnten – nicht über unsere gemeinsame, so katastrophal zu Ende gegangene Vergangenheit, sondern in ebendieser Unsicherheit, die wir beide gerade empfinden. Aber dafür müsste einer von uns beiden mutig genug sein, diesen Brückenschlag tatsächlich auch zu wagen.
»Wie geht es dir?«, fragt Kati ohne weitere Begrüßung. Bevor ich einen Blick auf den Bildschirm ihres Handys werfen kann, schaltet sie ihn auf schwarz und legt das Telefon mit dem Display nach unten auf die schmale Ablage vor sich. Ihre dunklen Augen glänzen und sie lächelt noch immer.
Sie macht keine Anstalten, aufzustehen. Und so setze ich mich einfach auf den freien Barhocker neben ihr, froh, dass mir die Entscheidung erspart bleibt, ob ich sie zur Begrüßung umarmen soll.
Neben ihrem Handy steht eine leere Espressotasse. Am Daumen ihrer rechten Hand glänzt derselbe Silberring, den sie trägt, seit ich sie kenne. Was mir allerdings sofort auffällt, ist der dünne Streifen an ihrem linken Ringfinger. Der dunkle Hautton, den sie von ihrem umbrischen Vater hat, ist dort ein ganzes Stück heller. Ich nehme mir vor, mich nicht davon ablenken zu lassen.
Auf meine Frage, wie lange sie schon hier ist, hebt Kati die eingezogenen Schultern, die unter den groben Maschen der Strickjacke breiter aussehen als sie sind, schiebt die Unterlippe vor und sagt: »Ich bin nach dem Frühstück zum Bahnhof gegangen und in den nächsten Zug gestiegen.«
Sie trommelt mit den Fingerspitzen leicht auf das Holzimitat. Da ist er wieder, der schmale, helle Streifen an ihrem Ringfinger.
»Gut«, sage ich etwas dümmlich. »Ich hole mir eben mal etwas zu trinken.«
Als ich den Stuhl zurückschiebe, um zur Theke zu gehen, schenkt Kati mir ein amüsiertes Lächeln, das mich irritiert. Der Junge am Kaffeeautomaten ist damit beschäftigt, Ciabatta-Brote zu belegen. Seine Einmalhandschuhe bewegen sich flink über die Zutaten, die in Plastikdosen mit verschiedenfarbigen Deckeln nebeneinander aufgereiht sind. Ich bestelle bei ihm einen großen Filterkaffee, ohne Platz für Milch.
Die Frage, ob wir uns ein anderes, bequemeres Café suchen, hat sich erübrigt. So schlecht ist es hier vielleicht auch gar nicht. Und sollte uns der Gesprächsstoff ausgehen, können wir die Menschen draußen auf dem Bahnhofsvorplatz beobachten, bis Katis nächster Zug nach Jena geht. Die Regionalbahnen, weiß ich, fahren im Halbstundentakt.
»So eine Menge Kaffee könnte ich nicht trinken«, sagt Kati mit einem skeptischen Blick auf meine Tasse. »Nicht einmal bei meinem Jetlag.«
Ich schlürfe einen vorsichtigen ersten Schluck. In ihrer Tasse ist nur noch ein letzter Bodensatz Espresso in bitterem Schwarz, der sicher schon lange kalt geworden ist.
»Hm«, mache ich und schlucke den Kaffee hinunter, obwohl er noch viel zu heiß ist. »Wenn es anständiger Filterkaffee ist, dann geht das schon.«
Kati verzieht das Gesicht und mustert mich, als wüsste sie nicht, ob ich einen Scherz mache. Das ist etwas, fällt mir ein, das ihr auch früher schon schwergefallen ist. Dabei glaube ich eigentlich nicht, dass ich einen besonders ausgefallenen oder hintergründigen Humor habe. Generell halte ich mich nicht für jemanden, der ungewöhnlich schwer zu durchschauen ist.
»Das ist mir der liebste«, sage ich schulterzuckend. »Schwarzer Kaffee, den ich in rauen Mengen trinken kann.«
»Aber dabei gehen doch all die« – Kati sucht nach dem richtigen Wort – »was auch immer es eben ist, das da verloren geht. Geschmackstoffe?«
»Mag sein«, sage ich und lächle aufmunternd.
Sie setzt zu einer Erwiderung an, hält dann aber inne und scheint zu überlegen, ob sie es aussprechen soll. Natürlich interessiert mich jetzt brennend, warum sie abwägt. Handelt es sich womöglich um eine Anekdote, die jemanden beinhaltet, den ich noch nicht kenne, einen Kaffee-Gourmet vielleicht, der einen kleinen hochpreisigen Vollautomaten für Espresso mit perfekter Crema besitzt und nebenbei auch noch für den Bräunungsstreifen an ihrem linken Ringfinger verantwortlich ist?
»Ist das so eine Art weniger-ist-mehr-Philosophie von dir?«, fragt sie dann.
»Nein«, sage ich. »Es ist nur so, dass er mir einfach schmeckt. Ganz gewöhnlicher Kaffee.«
»Vielleicht kommst du mit der Komplexität nicht klar, die der Geschmack von wirklich gutem Kaffee nun einmal hat.«
Katis Stimme hat plötzlich einen Unterton angenommen, den ich nicht zuordnen kann. Ganz sicher war er eben noch nicht da. Ich frage mich, ob wir gerade überhaupt noch über Kaffee sprechen.
»Vermutlich ist es so, wie du sagt«, gebe ich vorsichtig zurück. »Ich sehne mich nach harmlosem, bedeutungsarmem Kaffee.«
Ich lächle mit Nachdruck, um zu signalisieren, dass jeder Ernst, den unser Gespräch gerade anzunehmen droht, fehl am Platze ist.
Plötzlich hängt der beißende Geruch von angebranntem Schmelzkäse in der mollig warmen Luft. Der Junge hinter der Theke flucht. Dann rauscht der Wasserhahn.
»Übrigens: Nachträglich noch alles Gute zum Geburtstag«, sagt Kati und blinzelt.
Sie hebt ihre Arme vom Tisch und für einen Moment scheint sie nicht zu wissen, was sie damit tun soll. Dann greift sie mit beiden Händen meine Unterarme und drückt sie ein Mal. Ihr schmales Gesicht, das sie von ihrer Mutter hat, ebenso wie die dürre Statur und die Angewohnheit, ihre Unterlippe in schneller Folge unter den Schneidezähnen vor und zurück zu schieben, wenn sie etwas überlegt, ist zurückhaltend geschminkt. Sie sieht aus, als hätte sie in den letzten Monaten viel Sonne abgekriegt. Ihre Haut ist um jenen kaum sichtbaren Ton dunkler, für den ich Jahre gebraucht habe, um ihn überhaupt wahrzunehmen.
Mein Blick wandert wieder zu dem hellen Streifen an ihrem Finger. Ich weiß zwar nicht, wie das Wetter in San Francisco durchs Jahr hindurch ist, aber es scheint mir unwahrscheinlich, dass die Sonne dort lange und kräftig genug scheint, um solche Spuren zu hinterlassen. Die Frage ist also: Mit wem hat sie Urlaub gemacht, und wo?
Ich versuche mir klarzumachen, dass ich mit dieser Person, die hier neben mir sitzt, fünf Jahre lang zusammen war, die letzten zwölf Monate davon mit einem Ring, und zwar an der rechten Hand. Dort, wo jetzt kein Bräunungsstreifen mehr ist, weder bei ihr noch bei mir. Ich weiß das natürlich. Und doch ist sie eine Fremde für mich, für die ich allenfalls ein diffuses Gefühl distanzierter Sympathie empfinde. Die Lachfalten um ihre Augen herum scheinen weniger geworden zu sein, auch wenn so etwas vermutlich gar nicht möglich ist. Kati ist ein paar Jahre älter als ich, im Februar wird sie ihren zweiundvierzigsten Geburtstag feiern. Sie ist Lehrerin für Englisch und Geschichte, an einer deutschen Privatschule in San Francisco.
»Wie läuft’s denn so in Frisco?«, sage ich wohlwollend. »Jaulen die Robben noch immer am Pier?«
Erst als die Frage schon im Raum hängt, kommt mir der Gedanke, ob es denn wirklich eine gute Idee ist, auf unsere gemeinsame Zeit anzuspielen. Denn die Robben haben wir beide beobachtet, damals, als wir für eine Woche nach San Francisco reisten, um uns einen Eindruck von dem Ort zu machen, an dem wir bald leben würden.
Seit ihrem Referendariat hatte Kati in demselben Gymnasium in Saarbrücken unterrichtet. Und während sie gern als Lehrerin arbeitete, wurde ihr irgendwann die Aussicht immer unerträglicher, für den Rest ihres Lebens jeden Tag durch dieselbe Schultür zu gehen. Erst sehnte sie sich nur nach Veränderung. Dann begann sie, unter ihrem Alltag zu leiden.
Ich arbeitete damals als stellvertretender Direktor einer kleinen Kultureinrichtung, die sich auf auf Sprachkurse und das Vermitteln von Austausch- und Au pair-Kontakten in Spanisch- und Englischsprachige Länder konzentrierte. Es war nicht schwer für mich, herausfinden, welche deutschen Schulen in den entsprechenden Ländern gerade Personal suchten. Schon wenige Wochen später stand fest, dass Kati die (überraschend gut bezahlte) Stelle an der Privatschule in San Francisco haben könne, wenn sie wolle.
Zwei Monate nach dieser Nachricht waren wir verheiratet und flogen während ihrer Osterferien über den Atlantik. Nach einem Abendessen im Hafenviertel, während dem wir über einem dicken, sämigen Muscheleintopf, den wir aus ausgehöhlten Brotlaiben aßen, Zukunftspläne geschmiedet und endgültig beschlossen hatten, dass ich meinen Job aufgeben und mit ihr in die USA kommen würde, waren wir durch die neblig-feuchte Abendluft bis zum Ende einer ehemaligen Bootsanlegestelle spaziert, wo eine große Kolonie von Robben lebte. Wir schauten diesen unförmigen Tieren lange dabei zu, wie sie sich mit ihrem durchdringenden, meckernden Bellen übereinanderwälzten, behände aus den Wellen auf die Bohlen sprangen und einander immer wieder mit den Schnauzen ins Wasser stießen.
Nein, denke ich jetzt, es war keine gute Idee, darauf anzuspielen. Man soll keine Brücken an Orte bauen, an die man nicht hinwill.
Kati schürzt die Lippen. »Es sind Seelöwen«, sagt sie nur. »Keine Robben.«
Sie schaut kurz aus dem Fenster, als gebe es etwas an dem verhangenen Himmel, das ihre ungeteilte Aufmerksamkeit erfordert.
»Die Arbeit an der Schule ist ganz okay«, fügt sie dann hinzu. Sie lächelt nicht, während sie das sagt.
Der Junge hinter der Theke hat die Sauerei mit dem angebrannten Käse inzwischen beseitigt. Jetzt drückt er sich untätig an der Kaffeemaschine herum und gibt sich, wofür ich ihm dankbar bin, große Mühe, uns nicht spüren zu lassen, dass er natürlich jedes Wort mithören kann, das Kati und ich in dem kleinen Raum miteinander wechseln.
Drei gut gelaunte ältere Herren im Anzug überqueren draußen den Platz. Der mittlere von ihnen lacht auf und klopft den beiden anderen auf die Schulter. Sie sehen aus, als hätten sie eben das Geschäft ihres Lebens gemacht.
»Ich habe noch was für dich«, sagt Kati.
Der olivgrüne Rucksack, in den sie jetzt greift, ist noch immer derselbe, der früher schon so aussah, als würden die Nähte jederzeit reißen. Sie zieht einen in gemustertes Geschenkpapier eingeschlagenen, fast quadratischen Gegenstand heraus und schiebt ihn über das schmale Bord bis zu meiner Tasse.
»Hattest du denn einen schönen Geburtstag?«, fragt sie. Für einen Augenblick meine ich, ihren warmen Atem spüren zu können, der leicht nach Espresso riecht.
»Es war ein ziemlich gewöhnlicher Tag«, sage ich wahrheitsgemäß. »Außer einem Mediationstermin am Morgen ist nicht viel passiert. Am Nachmittag hatte ich frei und war im Wald spazieren.«
»War es denn ein schwieriger Termin?« Kati schaut mich mit zusammengezogenen Brauen an.