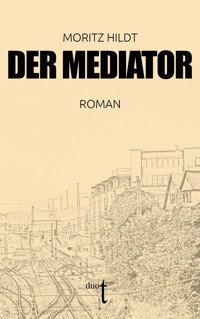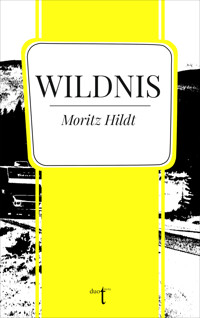Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: duotincta
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
New Orleans. Ein ganzes Jahr ohne Verpflichtungen in einer fremden Stadt, die rätselhaft ist und doch eigenartig vertraut, in deren schwerer, süßlicher Luft die Dinge eine größere Toleranz für Uneindeutigkeit zu haben scheinen. Frank Baumann ist 42 Jahre alt und sicher, das große Los gezogen zu haben, als er seine Frau zu ihrem einjährigen Forschungsaufenthalt nach New Orleans begleitet. Doch im Verlauf von drei Tagen, an deren Ende Mardi Gras steht – Höhepunkt des Karnevals –, wird Baumanns Welt bis auf die Grundfesten erschüttert. Plötzlich wird sein Leben infrage gestellt. Birgt eine Krise wirklich die Chance zum Aufbruch ins Neue?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 207
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
verlag duotincta
e-book
MORITZ HILDT
NACH DER PARADE
ROMAN
Moritz Hildt, geboren 1985 in Schorndorf, ist Schriftsteller und promovierter Philosoph. Er arbeitet als Dozent an der Universität Tübingen und forscht zur Philosophie des guten Lebens. Mit New Orleans, wo er für einige Zeit lebte, verbindet ihn eine nicht enden wollende Leidenschaft. Von ihm sind bereits Erzählungen, philosophische Dialoge und Essays erschienen. 2018 erhielt er ein Arbeitsstipendium des Förderkreises deutscher Schriftsteller in Baden-Württemberg.
Karoline
SONNTAG
1
Frank Baumann war am Morgen mit dem festen Entschluss aufgewacht, sich ein Notizbuch zu kaufen. Ein kleines würde es sein, am liebsten liniert und mit schwarzem Ledereinband. Wichtig war aber vor allem, dass es in seine Hemdtasche passte. Denn von heute an würde er es immer bei sich tragen.
Mit der dampfenden Kaffeetasse in der Hand trat er durch die Wohnungstüre hinaus auf den Hausflur, der sich zum Innenhof des Appartementkomplexes hin öffnete. Baumann stellte sich an das Geländer, dessen blaue Farbe in rissigen Flocken von den Streben blätterte. Ein paar der Flocken lagen verstreut auf dem grauen Betonfußboden. Sie knackten trocken unter seinen cremefarbenen Segeltuchschuhen.
Unten machte der Pool leise gurgelnde Geräusche. Drei Palmen säumten ihn wie vergessene, sich selbst überlassene Wächter. Ihre langen grünen Blätter hoben sich behäbig in der kühlen Brise, die Baumann auch spüren konnte und die ihm zwischen die Knöpfe seines Hemdes drang.
New Orleans gab sich aufgeräumt an diesem Februarmorgen. Als gelte es, auf einen Fremden einen guten Eindruck zu machen. Baumann fand, dass er nach sechs Monaten kein Fremder mehr war. Anders als seine Frau Eva mochte er die feuchte, laszive Trägheit, mit der sich die Luft hier an manchen Tagen schwer auf die Stadt legte. Und er mochte den tiefen, erdigen Geruch des Mississippi, der, wenn das Wetter umschlug, vom Damm her in die Straßen quoll, und dann unter den Baumkronen der gewaltigen Eichen hing und zwischen den eigensinnigen Ästen der Kräuselmyrten. In diesem Geruch war etwas Unergründliches, hatte Baumann schon oft gedacht. Etwas, das er selbst bislang noch nicht so recht in Worte fassen konnte. Einmal, nach einem seiner Spaziergänge, hatte er versucht, es seiner Frau zu beschreiben. Aber die hatte nur gelächelt und den Kopf geschüttelt.
In der Nacht hatte es gewittert. Baumann war aufgestanden, um ein Handtuch unter das Fenster zu legen. Irgendwo am Rahmen war eine undichte Stelle in der Holzwand. Nach dem ersten starken Regen im vergangenen Sommer, nur wenige Tage, nachdem sie eingezogen waren, hatte Baumann am nächsten Morgen über eine Stunde lang das Wasser mit einem löchrigen Stofflumpen, den er in einem der Schränke gefunden hatte, aufgewischt. Auf dem Parkett waren unförmige Flecken zurückgeblieben, ein größerer, zu dem mehrere kleine in einem versprengten Abwärtsbogen hinführten. Wie seine Frau bemerkt hatte, sahen sie in ihrer Größe und Anordnung den Hawaii-Inseln erstaunlich ähnlich. Sie hatten vorgehabt, während des gemeinsamen Jahres in den USA dorthin zu fliegen. An jenem Morgen hatten sie beschlossen, die Flecken als ein gutes Omen zu nehmen.
Wenn Baumann heute die Flecken sah, dachte er nicht an Hawaii und auch nicht daran, wie unwahrscheinlich es inzwischen geworden war, dass sie es noch dorthin schaffen würden. Die Flecken waren ihm auf eine eigenartige Weise lieb geworden. Denn sie erinnerten ihn an jene Unbeschwertheit, die in ihm gewesen war, während der ersten Wochen in New Orleans. Und außerdem würden sie bleiben, lange nachdem er wieder zurück in Deutschland sein würde. Spuren zu hinterlassen, so klein sie auch sein mochten, war Baumann schon immer wichtig gewesen.
Nachdem das mit den Flecken passiert war, war Baumann gleich am nächsten Tag zu Pete gegangen und hatte ihm von der undichten Stelle erzählt. Pete war einer der Hausmeister der Wohnanlage, ein dürrer Mann mit fliehendem Kinn und einer Nase, die irgendwann einmal gebrochen worden war, und die auf eine seltsame Weise zu groß für sein Gesicht zu sein schien. Baumanns Augen blieben jedes Mal an ihr hängen, und er fragte sich, ob es Pete wohl auffiel, wenn er ihm beim Sprechen nicht direkt in die Augen schaute.
Während seiner Schichten war Pete ständig auf dem Gelände unterwegs, mit schnellen Schritten und einem konzentrierten, abwesenden Ausdruck im Gesicht. Ab und an beobachtete Baumann morgens am Geländer stehend Pete bei seinen Gängen. Ihm war dabei aufgefallen, dass der Hausmeister nie etwas bei sich trug und auch nichts räumte. Fast schien es, als wäre er mehr mit den Gängen selbst beschäftigt, als damit, wofür sie gut sein sollten. Als Baumann ihn im letzten Sommer auf das Leck unter dem Fenster angesprochen hatte, hatte Pete ernst genickt und dann gesagt, dass er sich das wohl besser bald mal anschauen sollte.
Der Regen hatte die Schwüle der letzten Tage aus der Luft gewaschen, der Morgen schmeckte frisch und sauber. Etwas Süßes war darin, und Baumann überlegte, ob es wohl von den zahllosen weißen, rosafarbenen und rubinroten Azaleen kam, die seit einigen Tagen überall in der Stadt blühten. Er dachte wieder an das Notizbuch, das er heute besorgen würde, und atmete die Luft in tiefen Zügen ein.
Etwa 20 Grad Celsius wird es heute wohl geben, schätzte er. An die Fahrenheitskala hatte er sich noch immer nicht gewöhnen können. Er kam jedes Mal durcheinander, wenn er versuchte, umzurechnen. In Deutschland hörte er schon seit Jahren beim Frühstück den Wetterdienst im Radio. Hier in New Orleans war er dazu übergegangen, bei seinem morgendlichen Kaffee zu schätzen, wie warm der Tag werden würde. Meist gelang ihm das ganz gut. Inzwischen schienen ihm seine Schätzungen sogar zuverlässiger als die Vorhersagen. Auch deswegen, fand er, war er kein Fremder mehr.
Unten bog jetzt Pete um die Ecke. Mit langen Schritten eilte er am leeren Pool vorbei. Baumann winkte, doch Pete sah nicht nach oben, sein Blick war fest auf seinen Weg gerichtet. Der Kaffee schmeckte rauchig und wurde bitterer, je mehr er an Temperatur verlor.
Insgeheim hatte Baumann gehofft, die Nachbarin mit dem Tattoo zu sehen. Sie schwamm häufig am späten Vormittag. Außer ihm war sie die einzige, die den Pool zu nutzen schien. Sie hatte halblange dunkle Haare und dieses Tattoo auf dem linken Schulterblatt. Es wurde von ihrem roten Badeanzug halb verdeckt und wuchs darunter hervor wie die Ranken einer geheimnisvollen Schlingpflanze.
Baumann hätte gern gewusst, was das Tattoo zeigte. Aber dafür war er ihr bislang noch nie nahe genug gewesen. Wenn sie im Pool schwamm und er gerade Einkaufstüten ins Appartement schleppte, oder die Treppe herunterkam, um spazieren zu gehen, brachte er nicht den Mut auf, stehenzubleiben. Und im Vorbeigehen war es ihm unmöglich, das Ding auf ihrem Rücken lange genug im Blick zu behalten, um herauszufinden, was es war. Er sah dann nur ihre Schultern, die Muskeln, die sich bei jedem Schwimmzug spannten, und wandte den Blick rasch ab.
Vielleicht war es eine Schlange, dachte Baumann. Was auch immer es darstellte, er war sich sicher, dass das Motiv viel über seine Trägerin verraten würde, wenn man es nur richtig zu deuten vermochte. Warum er das dachte, konnte er selbst nicht sagen.
In den ersten Monaten war Baumann regelmäßig geschwommen. Morgens, sobald seine Frau die Wohnung verlassen hatte, für eine knappe Stunde. Manchmal war Pete währenddessen am Pool vorbeigekommen. An einem besonders heißen Tag Anfang September hatten sie zum ersten Mal miteinander gesprochen.
»Muss bestimmt erfrischend sein«, hatte Pete damals gesagt, und Baumann beim Schwimmen zugeschaut. Pete verschluckte beim Sprechen ganze Silben, was es Baumann schwer machte, sein Englisch zu verstehen.
Baumann hatte ihm zugerufen, es doch auch einmal zu versuchen. Pete hatte daraufhin einen prüfenden Blick auf das Wasser geworfen.
»Das werd ich sicher auch bald mal machen. Wenn’s noch ein bisschen wärmer wird.«
Er hatte sich den Schweiß von der Stirn gewischt und dabei geschaut, als versuchte er, sich an etwas weit Entferntes zu erinnern. Dann war er ohne ein weiteres Wort seiner Wege gegangen. Baumann hatte ihm aus dem Wasser nachgesehen.
2
Frank Baumann war mit seiner Frau nach New Orleans gekommen, um hier seinen Roman zu Ende zu schreiben. Mit der Arbeit daran hatte er bereits während seines Studiums begonnen. Inzwischen war er zweiundvierzig Jahre alt und er wusste, dass eine solche Gelegenheit, wie sie sich ihm jetzt bot, nicht noch einmal kommen würde.
Seine Frau Eva war Professorin für Philosophie. Eine Universität in New Orleans hatte sie zu einem einjährigen Forschungsaufenthalt eingeladen und dabei angeboten, auch die Kosten für einen mitreisenden Partner zu übernehmen.
Ein ganzes Jahr an einem anderen Ort. Frei von den täglichen Verpflichtungen, die ihn daheim von Tag zu Tag jagten, immer mit dem Gefühl, nicht hinterherzukommen. Baumann konnte nicht sagen, ob es diese ständige Eile war oder die erdrückende Bedeutungslosigkeit der Verpflichtungen selbst, die alle in ihm verbleibende Energie verklebte und ihn selbst schwer machte.
Es hatte ihn überrascht, wie leicht es gewesen war, für ein Jahr beurlaubt zu werden. Die Arbeit, die er tue, erfordere ja glücklicherweise wenig fachliche Erfahrung und würde für die Dauer seines Fernbleibens einfach auf drei befristete Stellen aufgeteilt werden, hatte ihm der Dekan auf dem Flur gesagt und ihm dabei mit einem Lächeln auf die Schulter geklopft, das Baumann nicht recht zu deuten gewusst hatte.
An einem kalten und regnerischen Donnerstagmorgen war schließlich die Nachricht gekommen, dass alle Formulare unterschrieben, der Antrag bewilligt und die Finanzierung garantiert waren. In seinem kleinen Büro unter dem Dach war er im Anorak gesessen, da die Heizung nicht funktionierte, als Evas E-Mail in seinem Posteingang auftaucht war. Ohne Anrede und nur das Nötigste, wie immer:
»Es klappt.«
Baumann war damals das viel zu enge Treppenhaus des Instituts hinabgeeilt, mehrmals musste er sich dabei zwischen unbeweglichen Trauben von Studenten hindurchzwängen, und war dann lange Zeit ohne Ziel im Regen umhergelaufen.
»Jetzt wird’s«, hatte er dabei immer wieder vor sich hin gesagt, »jetzt wird’s«.
Wenn er heute an diesen Tag zurückdachte, spürte er noch immer ein fernes Echo jenes Gefühls, das damals so stark in ihm emporgestiegen war, dass er nicht anders konnte, als immer und immer weiter durch die schmalen, mittelalterlichen Gassen der kleinen Universitätsstadt zu laufen. Noch immer fand er keinen besseren Namen dafür als Dankbarkeit. Auch wenn er nicht sagen konnte, wem seine Dankbarkeit denn eigentlich gelten sollte. Sicher, es war Eva gewesen, die sich um den Forschungsaufenthalt beworben hatte. Aber er konnte sich des Eindrucks nicht erwehren, dass die Einladung auf einer grundlegenderen Ebene viel mehr mit ihm zu tun hatte. Dass sie eigentlich ihm galt, ihm und seinem Roman.
Baumann schlürfte die letzten Reste des kalt gewordenen Kaffees aus seiner Tasse und blickte zum Wasser hin, das bläulich glitzerte. Für einen kurzen Moment sah er sich selbst dort unten, wie er seine Bahnen zog, kurz nach ihrer Ankunft im letzten Sommer. Damals, als alles noch so einfach ausgesehen hatte.
Das Ankommen in der neuen Stadt war ihnen beiden leichtgefallen. Noch in der ersten Woche hatte Eva ihren gewohnten Arbeitsrhythmus wieder aufgenommen und ging jeden Morgen nach einem kurzen Frühstück ins Büro, das ihr die Universität zur Verfügung gestellt hatte. Dort arbeitete sie an ihrer neuen Studie. Ein Beitrag zur Handlungstheorie, hatte sie ihm erzählt. Baumann unternahm nach seinen morgendlichen Bahnen im Pool lange Spaziergänge.
Er war schon immer gerne zu Fuß unterwegs gewesen, und er spürte, dass auf diesen Spaziergängen etwas mit ihm geschah, das ihn nach und nach für die Arbeit an dem Roman bereit machen würde. Während er beim Gehen seine Aufmerksamkeit zunächst auf die Umgebung richtete und, mit einem Stadtplan in der Hand, durch die Straßen und Stadtteile von New Orleans zog, kam immer irgendwann der Moment, wo sich die Aufmerksamkeit wie von allein nach innen wandte. Er hatte darüber keine Kontrolle, merkte nur, wie es passierte. Dann traten ihm Ideen für seinen Roman vor Augen. Er besah sie im Kopf von allen Seiten, verknüpfte sie probeweise miteinander oder verwarf sie wieder. Wie Teile eines Baukastens. Es würde nur darum gehen, sie auf die richtige Weise zusammenzusetzen. Meist waren es Kleinigkeiten, Feinheiten, Eindrücke, Fragmente. Aber Baumann wusste, dass die Magie seines Romans in den Details liegen würde.
Die besten Tage waren die, an denen er so tief in seinen Ideen versank, dass er irgendwann aufblickte, den Stadtplan aus der Hemdtasche zog, und sich nicht erklären konnte, wie er dorthin gekommen war.
Nach einigen Wochen begann er, seine Spaziergänge kürzer werden zu lassen, damit er am Nachmittag noch Zeit hatte, seine Ideen zu notieren. Er schrieb per Hand, und zwar mit gespitzten Bleistiften auf gelbe linierte Legal-Pad-Blöcke, die er im Dreierpack in der Walgreen’s-Filiale um die Ecke kaufte, einer Drogerie, die auch ein kleines Schreibwarenregal hatte.
Es war ihm schon immer wichtig gewesen, die erste Fassung seines Romans handschriftlich anzufertigen, spätestens seit dem Gespräch mit dem Archivar. Es war auf einem der zahllosen Empfänge gewesen, zu denen Eva ihn immer mitnahm, wenn er sie in der Stadt besuchte, in der sie an der Universität lehrte. Der Mann war groß und drahtig gewesen, mit der Statur eines Langstreckenläufers oder Rennradfahrers, und gar nicht klein und verwachsen, wie sich Baumann Archivare immer vorgestellt hatte.
»Wir stehen da vor einem völlig neuen Problem«, hatte der Mann gerade gesagt, als Baumann zu der kleinen Runde hinzugetreten war.
»Unsere Aufgabe ist es«, fuhr der Archivar fort, »Dinge auszuwählen, die den Stand der Gesellschaft adäquat wiedergeben. Aber jetzt frage ich Sie: Was sollen wir denn bitte in die langen Regale unserer Archive packen, wenn alles nur noch digital existiert?«
Baumann hatte nicht verstanden, wie der Archivar, der kurz darauf ganz unbefangen zu einem neuen Thema gewechselt war, dabei so ruhig bleiben konnte. Die Frage, die der Archivar an jenem Abend in den Raum geworfen hatte, und auf die niemand eine Antwort gegeben hatte, schien Baumann etwas Existentielles zu berühren, und er war sie seitdem nicht mehr losgeworden. Es hatte mit den Spuren zu tun, die man im Leben hinterlassen musste.
Für ein paar Wochen war der Wechsel von Schwimmen, Gehen und Schreiben gut gegangen. Wenn er jetzt auf diese Zeit zurückblickte, war sie vielleicht die glücklichste, die er hier verbracht hatte. Doch irgendwann passierte es.
Nach Baumanns eigenem Dafürhalten war es ein Tag wie jeder andere, und er ging wie gewohnt spazieren. Doch es wollte ihm nicht gelingen, den Punkt zu erreichen, an dem sich seine Aufmerksamkeit nach innen richtete. Zunächst hatte er dem keine Bedeutung beigemessen. Aber als es am nächsten Tag wieder so ging, und dann wieder, wurde er irgendwann unruhig. Er ließ seine Spaziergänge wieder länger werden, vielleicht war alles ja nur eine Frage der Dauer. Und so war er Stunde um Stunde gegangen, bis er sich müde und hungrig in ein Café oder eine Kneipe, manchmal auch einfach auf den Bordstein setzte. Zwei Mal hatte er sich Blasen an den Füßen gelaufen. Aber die Ideen wollten nicht mehr kommen.
Bald darauf begann es, auch an den Nachmittagen zu stocken, an denen er noch die Kraft zum Schreiben fand. Während er am Anfang gut und gerne zehn, manchmal sogar fünfzehn Blätter pro Tag gefüllt hatte, wurden es nach und nach immer weniger. Ihm war, als könnte er dabei zusehen, wie ihm das Schreiben langsam versiegte. Wie eine Quelle, die jeden Tag ein wenig schwächer sprudelte, bis sie irgendwann trockenlag. Und er wurde wütend, weil er nichts daran ändern konnte.
Da er nichts Neues mehr zustande brachte, nahm er sich das vor, was er bereits geschrieben hatte. Doch sobald er las, was dort in seiner leicht nach links gebogenen Handschrift stand, kam es ihm unbeholfen und leer vor. Als hätten die Ideen auf eine rätselhafte Weise dadurch, dass er sie aufgeschrieben hatte, alle Bedeutung verloren.
Da die Wut aus einem ihm unbekannten Grund beim Schwimmen am stärksten in ihm pochte, ließ er es bald sein. Aber mit dem Spazierengehen hörte er nicht auf. Allmählich wurden daraus wieder ganze Tage. Still reihten sie sich aneinander. Baumann hätte auch nicht gewusst, was er sonst mit seiner Zeit anfangen sollte. Und etwas in ihm hörte nicht auf, daran zu glauben, dass die Ideen irgendwann wiederkommen würden. Woher er diese Zuversicht nahm, war ihm selbst nicht ganz klar, wenn er darüber nachdachte. Also dachte er nicht nach, sondern ging weiter. Denn so fühlte er sich den Ideen, die ja noch immer irgendwo sein mussten, am nächsten. Es war nur eine Frage der Zeit, bis sie wiederkommen würden.
3
Mit dem Daumen der rechten Hand fuhr Baumann gedankenverloren über das Geländer. An einigen Stellen brach der spröde Lack ab und er sah den blauen Flocken dabei zu, wie sie taumelnd in den Innenhof schneiten. Er wollte den letzten Schluck Kaffee nehmen. Erst, als er die Tasse schon an die Lippen gehoben hatte, merkte er, dass sie bereits leer war.
Die Frau mit dem Tattoo würde wohl nicht mehr kommen. Er ließ den Blick über die Wohnungstüren auf der gegenüberliegenden Seite streifen. Er wusste nicht einmal, in welchem Appartement sie wohnte.
Die Hälfte seiner Zeit in New Orleans war zwar inzwischen vorbei. Letzten Sommer hatte er sich noch vorgestellt, bis jetzt, Mitte Februar, den größten Teil, vielleicht sogar schon eine erste Gesamtfassung seines Romans fertig zu haben. Aber auf der anderen Seite hieß das auch, dass noch weitere sechs Monate vor ihm lagen. Fünf, um genau zu sein. Wenn er sich Mühe gab, war es noch zu schaffen, dachte er. Auf jeden Fall war es an der Zeit, dass er sich auf den Weg machte.
»Jetzt wird’s«, murmelte er versonnen und musste lächeln.
Er drehte sich um und ging die zwei Schritte zur Wohnungstüre. Seine Hand fuhr in die Tasche der dunklen Leinenhose, um den Schlüssel herauszuholen. Doch er griff nur den groben Stoff. Und noch bevor er versuchsweise die andere Hosentasche ausprobierte, wusste er, dass er den Schlüssel in der Wohnung liegen gelassen hatte. Auch das Rütteln an der Türe, die natürlich gleich bei seinem Hinaustreten ins Schloss gefallen war, war nur etwas, das man eben tat, wenn man den Schlüssel vergessen hatte.
Baumann sah auf seine Armbanduhr. Kurz nach elf. Das Flugzeug seiner Frau würde um sechs Uhr landen, post meridiem. Wenn es keine Verspätung gab, würde sie ungefähr eine Stunde später zu Hause sein. Er hatte also sieben Stunden vor sich, die er nun im Freien verbringen musste.
In der rechten Hosentasche war zwar kein Schlüssel, aber seine Hand förderte neben etwas Kleingeld auch einige zerknüllte Dollarscheine hervor. Er ließ die Münzen zurückfallen, strich die Scheine glatt, so gut es eben ging, und zählte sie. Da die Dollarscheine alle gleich groß waren, ganz egal welchen Wert sie hatten, musste er sich dabei immer ein bisschen mehr konzentrieren.
Er hatte alles in allem vierundzwanzig Dollar und ein bisschen Kleingeld. Die Kosten für das Straßenbahnticket abgezogen blieben ihm also gut zwanzig Dollar für das Notizbuch. Natürlich nur, wenn er das Mittagessen ausfallen ließ.
»Wieder einmal Glück gehabt.« Baumann sprach diesen Satz gegen die geschlossene Wohnungstüre. Er stellte den Kaffeebecher vor die Türe und ging Richtung Treppe.
Beim Hinabgehen überlegte Baumann, ob Pete wohl einen Zentralschlüssel für alle Wohnungen besaß. Er vermutete, dass dem so war. Aber er konnte Pete nirgends sehen und hatte keine Lust, darauf zu warten, dass er irgendwann um eine Ecke biegen würde.
Der Wohnkomplex war von einem drei Meter hohen Zaun eingefasst, durch dessen Tor Baumann hindurchtrat, um auf die Straße zu gelangen. Als es in seinem Rücken schepperte, wurde ihm klar, dass das nun schon die zweite Türe an diesem Tag war, die hinter ihm ins Schloss fiel.
Der Stadtteil, in dem sie wohnten, hieß schlicht Uptown, was Baumann ein wenig bedauerte. Gerne hätte er in einem der Bezirke mit klingenderem Namen gewohnt – Gentily, Faubourg Marigny, River Bend, French Quarter, Tremé, Bywater, Garden District –, die er aus dem Stadtplan und von seinen Spaziergängen her kannte. Doch sie hatten die Wohnung über die Universität vermittelt bekommen, zu der man von hier bequem zu Fuß gehen konnte.
Jetzt schlug Baumann nicht den Weg zur Universität ein, sondern ging die Straße in die andere Richtung hinab. Abgesehen von ihrer Wohnanlage, die einen halben Straßenblock einnahm, standen hier vor allem kleine, eingeschossige Häuser, die im selben Stil gebaut waren. Vom Bordstein aus führten Stufen hinauf zu einer Vorderveranda. Im Vorübergehen sah er, dass auf manchen der Eingangsstufen noch die örtliche Tageszeitung lag. Baumann konnte den Schriftzug Times-Picayune auf der Oberseite der gefalteten Zeitungen lesen, die in einer dünnen blauen Folie steckten.
Vor den eigentlichen Haustüren, die von der Veranda ins Innere führten, waren Fliegengittertüren angebracht, in deren feinmaschigen Netzen oft große Risse klafften. Eva hatte ihm erzählt, dass Häuser dieser Bauweise, typisch für den amerikanischen Süden, Shotgun Houses genannt wurden. Drei Räume reihten sich ohne einen Flur hintereinander, und wenn man alle Türen offen ließ, konnte man mit einer Schrotflinte durchschießen, ohne dass das Haus Schaden nahm. Der Name, und vor allem die dazugehörige Erklärung, waren ihm gut im Gedächtnis geblieben.
Überhaupt, fand Baumann, besaßen die Dinge hier eine größere Anschaulichkeit als daheim in Deutschland. Selbst hinter so etwas wie der Bezeichnung einer Hausbauweise steckte eine Geschichte. Diese Dinge waren überall um ihn herum, und er wünschte sich, er könnte sie alle sehen, verstehen, und die Geschichten kennen, die dazugehörten.
Um ein Haar wäre er, während er diesen Gedanken nachging, in die langen grünen Blätter einer Pflanze hineingelaufen, die durch die Streben eines schmiedeeisernen Gartenzaunes hindurch weit auf den Gehweg ragten. Die Blätter waren dünn und liefen spitz zu, wie Schilfgras. Die staudenartige Pflanze ragte rund drei Meter in die Höhe. Baumann kannte den Namen der Pflanze nicht, und er blieb für einen Moment stehen, um sie sich genauer zu besehen. Mit dem Finger fuhr er die fein gerillten Blätter entlang und stellte überrascht fest, dass sie auf der Oberseite scharf waren, so scharf, dass man sich daran schneiden konnte, wenn man nicht achtgab. Versuchsweise drückte er den Finger an den Blattrand und sah zu, wie das feste Blatt die Haut langsam eindrückte.
Er wollte schon weitergehen, als er ein Eichhörnchen entdeckte, das von einer Spitze des Gartenzaunes aufgespießt worden war. Die kunstvoll gearbeitete Zaunspitze, in die ein florales Lilienmuster eingestanzt war, hatte den Körper des grauen Tieres in der Mitte durchbohrt und ragte mehrere Zentimeter aus dem Rücken heraus. Blut war keines zu sehen.
Baumann hörte ein seltsames Sirren über sich und blickte auf. Zunächst dachte er, es käme aus der großen Weide, deren dichte Blätter im Wind leise raschelten, als würden menschliche Stimmen dort oben wild durcheinander flüstern. Das Sirren, das irgendwie elektrisch klang, wollte dazu nicht so recht passen. Es kam, verstand er dann, von der Überlandleitung, wie es sie hier überall in der Stadt gab, und die neben der Weide in eine Art Verteilerkasten mündete.
Zwei Querstraßen später war er an der St. Charles Avenue. Die große, vierspurige Straße zog sich über viele Kilometer wie ein Gürtel um den Bauch der Stadt. Es war eine Allee, über der die Eichenbäume ihre ausladenden immergrünen Kronen ineinanderschoben. Wegen der Bäume, deren grau-braune Stämme und dicke Äste über weite Teile mit grünen Flechten überzogen waren, war es hier selbst an den heißesten Tagen angenehm kühl. Die kleinen Blätter der Flechten kamen Baumann wie gedrungener, urzeitlicher Farn vor. Er war die Straße bereits, in mehreren Etappen, in ihrer gesamten Länge abgewandert. Jenseits der massigen Bäume, etwas von der Straße abgerückt, konnte man, wenn man die Augen offen hielt, immer wieder herrschaftliche Südstaatenvillen sehen, die Zuckerbarone und Baumwollhändler früherer Zeiten hatten errichten lassen und deren hohe, säulenverzierte Eingänge einladend und abweisend zugleich wirkten.
Als Baumann nun in die Allee einbog, stieg ihm der Geruch von heißem Fett in die Nase. Irgendwo in der Nähe musste ein Restaurant sein, er würde demnächst einmal danach Ausschau halten. Doch nicht heute. Heute war dafür keine Zeit.
Er hatte sich vorgenommen, mit dem Streetcar bis zur Endhaltestelle zu fahren, zur Canal Street, in die Innenstadt. Dort, im French Quarter, gab es viele kleine Geschäfte und Boutiquen. Er war sich sicher, dass er dort auch einen Schreibwarenladen finden würde. Schließlich war New Orleans auch für die Schriftsteller und Künstler berühmt, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts hierhergekommen waren. Das hatte er in einem Buch über Bohemiens des amerikanischen Südens gelesen, das er auf Evas Nachttisch entdeckt hatte. Er hatte sich darüber gewundert, es dort zu finden, denn Eva las üblicherweise nur philosophische Fachliteratur und Magazine. Die Geschichte von einem Schriftsteller war ihm besonders in Erinnerung geblieben.
Er war ein erfolgreicher Geschäftsmann in Ohio gewesen, bevor er mit sechsunddreißig Jahren eines morgens aufgestanden war, seine Firma und seine Familie ohne ein Wort zurückgelassen hatte und in den Zug nach New Orleans gestiegen war, den Sunset Limited, um hier als Schriftsteller zu leben. Womöglich hatte er sich an einem seiner ersten Tage in der Stadt ebenfalls aufgemacht, um ein Notizbuch zu kaufen.
Die Idee mit dem Notizbuch war Baumann heute Morgen im Kopf gewesen, noch ehe der durch die Jalousien verdunkelte Raum des Schlafzimmers wieder seine feste Form angenommen hatte. Wie ein Beschluss, den irgendein Teil in ihm gefällt hatte, der nachts nicht zu schlafen brauchte. Alles, was er noch tun musste, war, den Plan in die Tat umzusetzen.