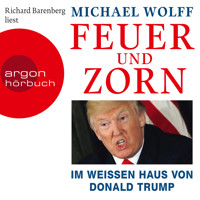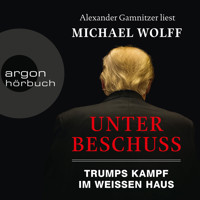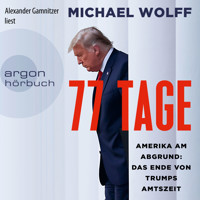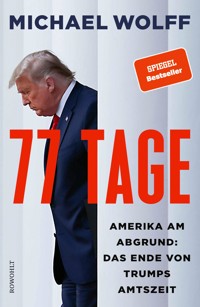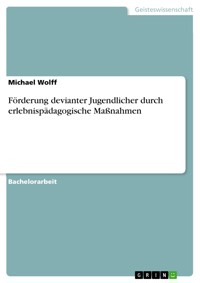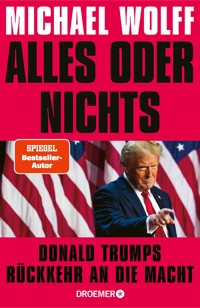
22,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 22,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 22,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
TRIUMPH DES CHAOS: WARUM DONALD TRUMPS WAHLSIEG UNVERMEIDBAR WAR – UND WAS ER FÜR DIE WELT BEDEUTET Donald Trumps zweite US-Präsidentschaft ist eines der größten politischen Comebacks aller Zeiten und erschüttert die Welt. Das beweist schon der Weg, auf dem er zurück ins Weiße Haus gelangt ist. Der Journalist und Bestsellerautor Michael Wolff hat Trump dabei so eng begleitet wie niemand anderes: Wir dringen in die Kitschwelt von Mar-a-Lago ein, sitzen in unterkühlten Gerichtssälen und im Wohnzimmer des Trump Tower in New York; wir beobachten den US-Präsidenten bei seinen Ausrastern, Geistesblitzen und täglich vierstündigen Golfrunden; wir lernen seine schillernde Entourage kennen, die jetzt auf einflussreichen Posten in Washington sitzt. Wolffs Buch ist ein investigativer Politthriller, der in die Abgründe des Trumpuniversums blickt – und liefert damit einen Schlüssel zum Verständnis jener Gesellschaft, die Trump hervorgebracht hat.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 653
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Michael Wolff
ALLES ODER NICHTS
Donald Trumps Rückkehr an die Macht
Aus dem amerikanischen Englisch von Ulrike Strerath-Bolz, Monika Köpfer, Gregor Hens, Thomas Gunkel, Sylvia Bieker, Pieke Biermann und Stefanie Römer
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Zu Beginn der zweiten Amtszeit von Donald Trump liefert Michael Wolff, mehrfach ausgezeichneter Bestsellerautor und bedeutendster Chronist der Trump-Ära, einen fesselnden Insiderbericht aus der Trumpworld. Er zeichnet den wildesten und unvorhersehbarsten Wahlkampf in der Geschichte der USA nach und porträtiert neben Trump das Personal, das sich an der Seite des US-Präsidenten daran macht, erst Washington und dann die ganze Welt auf den Kopf zu stellen.
Schon bald offenbart sich eine gespaltene Realität: Einerseits steckt Trump in einem tiefen Sumpf aus juristischen Untersuchungen, Anklagen und Verfahren, andererseits unterstützt ihn seine Partei bedingungslos, während die Umfragewerte steigen und die Opposition schwächelt. Aber genau das ist der unheimliche Grund für Trumps Erfolg: Auf dem schmalen Grat zwischen Tragödie und Farce zeichnet Wolff das erschütternde Porträt eines Mannes, dessen Verhalten so unkontrolliert und erratisch ist, dass es alle Regeln des politischen Lebens außer Kraft setzt. So ist Alles oder nichts nicht weniger als das eindringliche Zeugnis der Dämonen, des Unfriedens und der Anarchie im Amerika unter Donald Trump.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.droemer-knaur.de
Inhaltsübersicht
Widmung
Anmerkung des Verfassers
Prolog Mar-a-Lago
Erster Teil Recht und Gesetz
Kapitel 1 New York – Bragg
Kapitel 2 E. Jean und die Kartons
Kapitel 3 6. Januar
Kapitel 4 Atlanta
Kapitel 5 Die »fünfte Anklage«
Zweiter Teil Die Vorwahlphase
Kapitel 6 Perry Mason
Kapitel 7 Das Büfett
Kapitel 8 Sieg Nummer eins
Kapitel 9 Gestohlen!
Dritter Teil Nominiert
Kapitel 10 Aufbruch – oder Zusammenbruch
Kapitel 11 Schwebezustand
Kapitel 12 Trumpzeit
Vierter Teil Der Prozess
Kapitel 13 Centre Street 100
Kapitel 14 Verachtung
Kapitel 15 Schnappt Shorty
Kapitel 16 Was treibt Sammy an?
Fünfter Teil Der Weg zum Sieg
Kapitel 17 Verurteilter Straftäter
Kapitel 18 »Fuck City«
Kapitel 19 Jasager
Kapitel 20 Butler
Sechster Teil Ausgerechnet Kamala
Kapitel 21 Umkehr
Kapitel 22 »Weird«
Kapitel 23 Pattsituation
Siebter Teil 50:50
Kapitel 24 Das Duell
Kapitel 25 Der Abräumer
Kapitel 26 Finale
Epilog Wieder da
Danksagung
Für Victoria
Anmerkung des Verfassers
Dies ist mein viertes Buch über Donald Trumps politischen Weg. Es ist eine Geschichte über einen einzigartigen Charakter. Für ein möglichst intimes Porträt in wichtigen, aufschlussreichen Situationen während seiner dritten Präsidentschaftskandidatur stütze ich mich auf Beobachtungen von Leuten, die in persönlichem, oft täglichem Kontakt mit Donald Trump standen. Es ist ein Einblick in das unablässige Kreiseln seiner Launen, Ansprüche, Wutausbrüche, seines Überlebenstriebs und vielleicht auch der genialen Momente. Die Geschichte eines Mannes zu erzählen, der glaubt, eine besondere Stellung und Bestimmung zu haben – der eindeutig anders ist als Sie oder ich –, erfordert idealerweise das Vertrauen seines Butlers, in Trumps Fall seiner vielen Butler. Ich habe jedem, der mir helfen konnte, einen Blick in seine Privatgemächer zu werfen, Anonymität garantiert. Ein derartiger Schutz wird immer wichtiger in dem zu befürchtenden Klima der Vergeltung, in dem eine größere Macht als je zuvor in den Händen von Loyalitätswächtern liegen (und unter denen zunehmende Paranoia herrschen) dürfte. Meine Hoffnung ist, dass die Einblicke in das Wesen des Stars und seiner Wegbereiter, die viele Menschen mir aus persönlicher Sorge gewährt haben und weil das Ganze zu außergewöhnlich ist, um nicht erzählt zu werden, ein anderes Bild von Donald Trumps Charakter und der auf den Kopf gestellten gegenwärtigen Politik bieten als die täglichen Nachrichten.
Prolog Mar-a-Lago
Als Donald Trump am 20. Januar 2021, dem Tag der Amtseinführung Joe Bidens, nach Mar-a-Lago zurückkehrte, nachdem ihn eine verschwindend kleine Schar an der Andrews Air Force Base verabschiedet hatte, war es bestenfalls das Hirngespinst eines Verlierers, dass er nochmals für die Präsidentschaft kandidieren könnte. In seinem Dunstkreis (Familie, Berater im Weißen Haus, Führungsriege der Republikaner, Spender) gab es mit Sicherheit nicht viele Stimmen, die ihn in dieser Hinsicht ermutigten. Wer ihm nahestand, war in seinen Kommentaren zurückhaltend oder wirkte gar peinlich berührt – Niederlage; verrückte, lächerliche Versuche, Bidens Sieg zu leugnen; Sturm aufs Kapitol am 6. Januar; Exil.
Im Senat stand ihm schon bald ein Verfahren wegen Amtsmissbrauchs bevor, und er konnte nur mit Mühe ein halbwegs fähiges Anwaltsteam finden, das seine Verteidigung übernahm – eine zusammengewürfelte Gruppe unbekannter Anwälte, die sich erst nach einem weitreichenden Aufruf zusammenfand. Nur das Mitleid des republikanischen Senatsführers Mitch McConnell und dessen Bestreben, seine Hände in Unschuld zu waschen, rettete Trump seine Berechtigung, ein Amt zu bekleiden. In den Augen normaler Bürger stellte diese Verhandlung einen weiteren Sargnagel dar. (Doch ein Vorteil, den vielleicht nur er sah, war, dass er in den Nachrichten präsent blieb.)
Seine Finanzen waren in Unordnung. Seine Söhne, deren eigene Existenzgrundlage auf dem Spiel stand, bauten auf Ruhe und Zurückhaltung und wollten ihn unbedingt aus den Nachrichten heraushalten, um die Marke wiederherzustellen, in der Hoffnung, dass in ein, zwei Jahren »Trump« Schnee von gestern sein würde. In Mar-a-Lago gab es mehrere offene Auseinandersetzungen zwischen ihnen und ihrem Vater, wobei die Söhne den Ernst der Lage und die erforderliche Disziplin betonten. Ihr Vorschlag, dass er als Botschafter auf den ausländischen Liegenschaften der Familie am wertvollsten sein könne – Donald Trump auf permanenter Golftour –, kam bei ihm nicht besonders gut an.
Es wurde gemunkelt, dass ihm rechtliche Konsequenzen drohten. Ein Grund mehr, auf Tauchstation zu gehen und unter den neuen Verhältnissen nicht aufzufallen.
Gerüchten zufolge bot sein geistiger Gesundheitszustand Anlass zur Sorge. Er schien die Realität des Geschehenen tatsächlich nicht anzuerkennen oder zu begreifen.
Sein engster Berater im Weißen Haus, der Autorität und Einfluss besaß und für ein gewisses Maß an Normalität sorgte, war sein Schwiegersohn Jared Kushner.
Trump erwartete, dass Kushner in Mar-a-Lago weiterhin seine rechte Hand blieb. Doch Kushners eindeutiger und sofortiger Plan für die Zeit nach dem Weißen Haus war es, zwischen sich und seinem Schwiegervater Abstand zu schaffen. Als ein Freund ihn nach der Zukunft seines Schwiegervaters fragte, erwiderte er: »Wie hat Nixons Zukunft ausgesehen?«
Kushner und seine Frau Ivanka zogen aus gesellschaftlichen und steuerlichen Gründen nach Florida – aber nach Miami statt nach Palm Beach – und gaben neue Schulen für die Kinder als Begründung an. Als seine Nachfolger stellte Kushner das Personal des neuen Exilbüros für seinen Schwiegervater zusammen. Doch es war kein großer Mitarbeiterstab: Susie Wiles, eine lokale Politikberaterin im Rentenalter, die einen Anfängerjob übernahm, trat die Stelle eher aus Pflichtgefühl an als aus Ehrgeiz; Nick Luna, ein junger Mann, der mit einer von Kushners Assistentinnen verheiratet war, pendelte mehrmals wöchentlich von Miami nach Palm Beach; Jason Miller, Kommunikationsstratege im Wahlkampf, war ein paar Monate lang auf Abruf in Washington; und Molly Michael, eine seiner Beraterinnen, die alle gleich aussahen, übernahm die Rolle der jungen Frau, die sich um ihn kümmerte (denn Hope Hicks, seine liebste junge Gefolgsfrau, war während seines Versuchs, die Wahl anzufechten, geflohen).
Seine Frau Melania sprach offen darüber, wie sie die Zukunft ihres Mannes sah – oder über die Zukunft, die sie nicht sah. Ihr hatte es im Weißen Haus überhaupt nicht gefallen. Soweit sie eine Ehe geführt hatten (wenn auch zu hart verhandelten Bedingungen), hatte diese durch die Stimmungsschwankungen ihres Mannes und das ständige Gefühl, gekränkt und verletzt zu werden, weiter gelitten. Nach ihrer Einschätzung war das Ganze für ihren Sohn Barron schlimm gewesen, und das hatte die Spannungen zwischen ihr und den übrigen Familienmitgliedern verschärft. Ein Glück, dass es vorbei war. Sie war jung, ihr Mann alt, und sie musste sich um ihr eigenes Leben kümmern – sie war einfach nur erleichtert, dass er mit der Politik fertig war (oder die Politik mit ihm).
Aber Trump erkannte Niederlage und Exil schlicht nicht an. Es gab nicht das geringste Anzeichen, nicht den geringsten Hinweis darauf, dass er das Ausmaß und die Endgültigkeit dessen, was seit der Wahl am 3. November geschehen war, auch nur wahrgenommen hätte. Er war nicht geneigt, in den Geschehnissen eine Bedeutung zu suchen oder die Erfahrung zu überdenken. Und es kannte auch niemand einen Freund oder Vertrauten, mit dem er sich über seine jüngste Vergangenheit und unbekannte Zukunft austauschen konnte. Er wurde nicht, wie viele geschlagene Politiker es geschildert haben, von einer Zeit des Selbstzweifels und der Reflexion übermannt. Eher war er, in jeder Hinsicht und ohne aus der Rolle zu fallen, noch immer der Präsident.
Ein so beharrliches Hirngespinst würde man sich bei dem Despoten eines kleinen Landes vorstellen, der nach Südfrankreich ins Exil geht, wo er sich, von heuchlerischen Schleimern umringt, in einer umgesiedelten, aber unveränderten Welt wähnt. Vielleicht verhielt es sich bei ihm ähnlich. Die meisten Leute, die den früheren Präsidenten in Mar-a-Lago umgaben – seine Familie, seine politischen Mitarbeiter, das Personal und die Mitglieder des Clubs –, versuchten bestimmt, ihn bei Laune zu halten. Aber das war, zumindest anfangs, das leicht durchschaubare Verhalten von Höflingen.
Der zentrale Punkt seines Exils – für alle in seiner Umgebung so besorgniserregend, dass sie jeglichen Blickkontakt mieden – war das ständige Herumreiten auf der gestohlenen Wahl. Ohne Rücksicht auf das Thema, um das es gerade ging, fing er immer wieder davon an. Es gab kaum ein Gespräch, in dem er nicht auf den Sieg zurückkam, der ihm, wie er wütend und voller Überzeugung behauptete, böswillig gestohlen worden sei.
Ja, der Bogen der Geschichte scheint sich seither seinem Irrglauben zugeneigt zu haben, doch im Frühling 2021 und vielleicht bis gegen Ende des Jahres gab es nur wenige Stimmen der Vernünftigen, Sachkundigen und Etablierten jeglicher politischen Couleur (oder wie man die in der Faktenwelt lebenden Leute nennen will), die nicht voll und ganz anerkannten, dass Donald Trump die Wahl verloren hatte. Von seinen Mitarbeitern über seine Anwälte, seine Familie, sein Kabinett bis zur gesamten Führungsriege der Republikaner in Washington, ja sogar Tucker Carlson und Steve Bannon, gab es niemanden, der die Fakten seiner Niederlage nicht akzeptierte. Selbst wenn sie Zweifel zuließen und mögliche Streitpunkte eingestanden, begriffen alle außer dem Ex-Präsidenten und den wenigen ihn unterstützenden Spinnern, dass das Ergebnis sich nicht entscheidend geändert hätte. Das war einfache Mathematik.
Doch Trump steckte in einer Zahlenschleife – wobei sich die einzelnen Zahlen in seiner Darstellung oft änderten, ergänzt durch sonderbare »Informationsblätter«, die er seine Mitarbeiter erstellen ließ, und durch stets griffbereite Artikel der rechten Presse, die er in Gesprächen oder eher Monologen ausführte, und die unter Umständen erst endeten, wenn sein Gesprächspartner sich höflich und verzweifelt entschuldigte oder man Trump von ihm wegzerrte. Wer ihm zuhörte, gewann nicht den Eindruck, dass er auch nur die grundlegendsten Fakten verstand. Oder aber man kam zu dem Schluss, dass er absichtlich und trotz aller gegenteiligen Beweise hartnäckig versuchte, die grundlegenden Fakten unter Schichten von Unsinn zu verbergen.
Er glaubte daran oder redete es sich ein, oder es war ein Bravourstück, ohne die Möglichkeit, dass er je zugeben würde, in Wirklichkeit Theater zu spielen: Es hatte eine Verschwörung gegeben, die das wahre Ergebnis zunichtemachte, und deshalb war er immer noch Präsident. »Eine Gruppe von Leuten in der Demokratischen Partei, die mit Big Tech und den Medien zusammenarbeiteten«, hätten ihm den Sieg gestohlen, erklärte er einem Besucher in Mar-a-Lago. Es sei »ein koordiniertes Vorgehen« gewesen. »Die Namen werden noch enthüllt«, versprach er. Natürlich geschah das nie.
Eine Zeit lang herrschte Pathos. Es gibt kaum jemanden, zumindest unter denen, die etwas Besseres zu tun haben, der die Absurdität des Ganzen nicht erkannte. Aber Gewissheit ist machtvoll. Unerschütterliche Gewissheit. Sogar psychotische Gewissheit. Vielleicht ist auch Schmach machtvoll – wenn man sich weigert, seine Schmach anzuerkennen, wird daraus Rechtschaffenheit. Und vielleicht ist Irrglaube machtvoll. Und je größer der Irrglaube ist, umso machtvoller kann er sein.
Angesichts der Tatsache, dass er nichts geändert hatte, dass er in seiner Vorstellung noch immer der Präsident war, gab es nie den logischen Schritt, sich als Ex-Präsidenten zu bezeichnen, nicht einmal die vorübergehende Möglichkeit, »Präsident« nur als Höflichkeitstitel zu verstehen – der korrekte Titel für einen vormaligen Präsidenten ist »Mister« – oder gar zum Vornamen zurückzukehren. Er blieb, was er war. Folglich hat er vielleicht nie in Betracht gezogen, nicht wieder zu kandidieren. Vielleicht hat er da nie eine Entscheidungsmöglichkeit gesehen, sondern das Jahr 2020 hatte einfach nie aufgehört.
Aber wollte er wirklich weiter Präsident sein? Gab es für einen älteren Mann nichts anderes im Leben?
Seine Frau lebte in sorgfältig balancierter Entfernung, und sein heranwachsender Sohn bei ihr. Seine anderen Kinder waren eher Angestellte als Familienmitglieder. Es gab kein häusliches Leben, zu dem er zurückkehren konnte. (Er wohnte tatsächlich in einem Country Club.) So wie die Dinge lagen, würde er weder ein Buch schreiben noch eine Präsidentenbibliothek aufbauen, weder Geld für eine Stiftung einwerben noch gute Werke tun, um seinen Ruf aufzupolieren, und er würde auch nicht freudig ins Immobiliengeschäft zurückkehren. Außer Golf reizte ihn nichts.
Es gab wohl keine Alternative zu einer erneuten Kandidatur. Was sollte er tun? Wer würde er sein? Um Donald Trump zu sein, musste er Präsident sein, sonst war da ein existenzieller Abgrund.
Angesichts seiner großen Bürde – ein unbeliebter Präsident mit zweifelhaftem Ruf, der einen gescheiterten Staatsstreich durchgeführt hatte – ergab es natürlich keinen Sinn, wieder zu kandidieren. So hätten die meisten Politprofis aus beiden Parteien geurteilt. Wer hätte dies ernsthaft für eine gute Idee gehalten?
Alle denkbaren Präsidentschaftskandidaten führen jahrelang Diskussionen über das Für und Wider. Auf diese Weise gewinnen sie Verbündete: »Ja, Sie sollten kandidieren« – okay, das ist ein Zuwachs an Unterstützung. »Durchaus interessant, aber es gibt folgende Hürden« – okay, keine richtige Unterstützung. Oder »Betrachten wir das Ganze mal realistisch« – eine Abfuhr. Trump hat nie solche Diskussionen geführt. Niemand kam nach Mar-a-Lago und skizzierte die harten Realitäten seiner traurigen Popularität, seine mangelnde Unterstützung bei der Parteiführung, seine juristischen Probleme oder die Schwierigkeit, gegen einen Amtsinhaber anzutreten.
Niemand maß die bekannte Welt für ihn aus.
Mar-a-Lago liegt nicht wirklich im kartesischen Universum.
Abgesehen von den ehrerbietigen Mitgliedern, die dazu neigen, ihren Gastgeber wie einen geliebten, aber in die Jahre gekommenen Rock-’n’-Roll-Star zu behandeln (Elvis, in vielerlei Hinsicht), wurde Mar-a-Lago zur Kulisse einer besonders extremen Gruppe von Schleimern, Opportunisten und Gaunern. In den Monaten nach seiner Niederlage: an einem Tag der Schauspieler Jon Voight, fetischistisch in seiner patriotischen Begeisterung für Trump; an einem anderen Mike Lindell, der Firmenchef von My Pillow, der sein Geschäft und sein Vermögen für Trump opferte; Sean Hannity, dessen von Trump beeinflusste Fernseheinschaltquoten ihn zu einer der mächtigsten politischen Figuren des Landes gemacht hatten; Kurt Olson, der zu Trumps juristischem Tross gehörte und ein Deep-State-Verschwörungstheoretiker war. Ja, auch Kevin McCarthy, der Sprecher des Repräsentantenhauses, tauchte in Mar-a-Lago auf, aber nur in dem opportunistischen Bemühen, Verschwörer auf seiner rechten Flanke abzuwehren. Jede Menge Leute ohne Rang und Namen, die nur das Ziel hatten, Zugang zu Trump zu erhalten, kamen nach Mar-a-Lago mit Schmeicheleien im Gepäck und mit Plänen, wie man schnell reich wurde – darunter eine Gruppe unbedeutender Möchtegern-Unternehmer, die von keinem anderen Ex-Präsidenten empfangen worden wären und ihm vorschlugen, den Vorsitz eines Medien-Start-ups zu übernehmen (das eines Tages zehn Milliarden Dollar wert sein würde, was genauso absurd war wie Trumps eigene Rückkehr).
Mar-a-Lago war, wie ein Trump-Intimus es formulierte, eher Jonestown als Camelot.
Die amerikanische Politik hat sich in ihrer Geschichte immer in der bodenständigen, berechenbaren, aus Ursache und Wirkung bestehenden Welt bewegt. Politik, die Kunst des Möglichen, ist eine erzwungene Rationalität. Sie existiert in einem engen Raum aus festen Regeln und Reaktionen. Das System – ein Geflecht aus Sicherheitsmechanismen und Bürokratie, institutionellem Gewicht, Reputation und rechtlichen Schranken und Verwicklungen – hat es mit irrationalen Akteuren zu tun, die es zerstören wollen. Aber das ist noch keinem gelungen.
Mar-a-Lago und sein Herrscher waren wohl als unnatürliche Ausnahme davon zu sehen.
Jenseits jeglicher Vernunft und Machbarkeit betrachtete Trump sich in der Zeit nach seiner Niederlage weiterhin als verdienstvollen und rechtmäßigen Präsidenten. Seine Standhaftigkeit in dieser Rolle war so beharrlich und gegen jede Logik verstoßend, dass die schiere Darbietung auf viele Leute überzeugend wirkte. Währenddessen rückte niemand nach, der ihn ersetzen oder herausfordern konnte, nicht zuletzt, weil andere logischerweise vor einem Mann zurückschreckten, der sich anscheinend nicht von gewöhnlichen Gewinn-und-Verlust-Rechnungen leiten ließ und in diesem Sinne verrückt war.
Politik ist auch die Kunst des Verlierens – darauf ist die Demokratie aufgebaut. Sogar Gewinner verlieren, deshalb muss man sich stets nach allen Seiten absichern. Seinen Rückzug vorbereitet haben. Sich von seiner besten Seite zeigen. Auch – das ist unerlässlich – wenn man vorhat, es erneut zu versuchen. (In Amerika trägt die Ausbeute von beidem, Sieg wie Niederlage, dazu bei, eine grundlegende Gelassenheit zu bewahren.) Doch die Logik des Systems scheitert, wenn man seine Niederlage weder anerkennt noch akzeptiert, wenn man sie nicht in Betracht zieht. Das ist eine ganz andere Art von Politik – der Mann, der ohne Netz auf dem Drahtseil balanciert. Wer kann den Blick von ihm abwenden? Als Trumps dritter Präsidentschaftswahlkampf in Schwung kam – oder unerklärlicherweise nicht endete – und deutlich wurde, was für ihn auf dem Spiel stand, wurde sein Plan, als Kandidat den Helden und Märtyrer zu spielen, völlig klar. Wählt mich oder vernichtet mich.
Erster Teil Recht und Gesetz
Kapitel 1 New York – Bragg
März/April 2023
An dem Microsoft-Teams-Call nahm Boris Epshteyn, 41, Donald Trumps in Russland geborener Rechtsberater, zunächst mit ausgeschalteter Kamera teil. Dann plötzlich erschien er doch noch auf dem Bildschirm.
Epshteyn war von bärenhafter Statur, glatzköpfig und übergewichtig. Und nun stand er im Zentrum des vielleicht tiefgreifendsten Verfassungskonflikts in der amerikanischen Geschichte nach dem Bürgerkrieg. Zur Verblüffung aller anderen Anwälte, die Trump beschäftigte, war Boris der neueste Kandidat für die Nachfolge von Roy Cohn, dem Anwalt, der Trump einst vertreten hatte und den Trump zu jenem diabolischen Magier erhoben hatte, der ihn aus jeder Klemme herausholen könnte, wäre er nur noch am Leben.
Boris saß in seinem Homeoffice und zeigte seinen nackten, massiven Oberkörper und eine dichte Körperbehaarung – was ein ziemliches kollektives Grausen hervorrief, das im gesamten Trump-Universum widerhallte und den Abscheu vor Epshteyn weiter anwachsen ließ.
Susie Wiles, 65, und Politikberaterin aus Florida, tatsächlich die Einzige, die so etwas wie eine Wahlkampfmanagerin für Trump darstellte, fuhr zurück. »O Gott, Boris! O Gott, Jesus, o mein Gott, ziehen Sie sich ein Hemd an!«
Alle anderen Teilnehmer des Calls brachen in Gelächter aus oder stöhnten und hielten sich die Augen zu.
Epshteyn ähnelte ein bisschen jenem 200-Kilo-Hacker, der im Keller seines Elternhauses sitzt und den Trump oft als modernen Allzweck-Buhmann heraufbeschwor. Oder anders gesagt: Boris war ein Typ aus Jersey Shore, eine Gestalt aus einer Realityshow – übertrieben vulgär und geltungsbedürftig. Ein gängiger Typus im Trump-Universum.
Trumps politische und juristische Mannschaft war schon seit Wochen mehr als nervös, weil ein unvorstellbarer Schlag gegen die Wahlkampagne bevorstand: die erste strafrechtliche Anklage gegen einen Präsidenten in der Geschichte Amerikas. Und jetzt kam es noch schlimmer: Sie waren auf Boris angewiesen. Das gesamte Trump-Universum war abhängig von Boris, dem Architekten der Verteidigungsstrategie und faktischen Leiter des Anwaltsteams. Alle waren darauf angewiesen, dass er sie einigermaßen auf dem Laufenden hielt, damit sie mit dem Chaos zurechtkamen.
Boris bewegte sich seit 2016 in Trumps Orbit. Immer wieder war er, nicht zuletzt, weil er sich danebenbenahm, aus diesem Orbit hinausgedrängt worden. Doch er hatte sich mit Zähnen und Klauen immer wieder zurückgekämpft. Jetzt jedenfalls war er zu ihrer aller Verblüffung die Schlüsselfigur im Umgang mit dem riesigen juristischen Schlamassel, in den Trump sich gebracht hatte.
Man konnte sich über ihn lustig machen, und er war sich auch durchaus der Tatsache bewusst, dass alle das taten. Doch an diesem Tag landete Boris einen Coup.
Ohne tatsächlich darüber informiert zu sein, hatte Trump sich hingestellt und seine eigene Anklage in New York angekündigt. Sollte der Bezirksstaatsanwalt tatsächlich Anklage erheben, dann wäre er ihm zuvorgekommen – und sollte es keine Anklage geben, dann würde Trumps Auftritt ein Schlaglicht auf die Schwäche des Bezirksstaatsanwalts werfen. Kurz gesagt: Trump konnte nur gewinnen. In den Tagen danach, als die Anklage auf sich warten ließ und Politik und Medien nervös auf der Stuhlkante saßen, hatte der Ex-Präsident verschiedene Sprecher losgeschickt, die erklärten, es sähe so aus, als würde der Bezirksstaatsanwalt die Anklage fallen lassen. Und genau diese Nachricht überbrachte ein entzückter Boris an diesem Tag: Die Jury in New York, die die erste Anklageerhebung gegen einen ehemaligen US-Präsidenten hätte befürworten können, hatte sich einen Monat Bedenkzeit verordnet. Und das, so Boris, war praktisch der Beweis, dass der Fall im Sande verlaufen würde.
Boris war schon seit mehr als zehn Jahren nicht mehr als Anwalt tätig. Eigentlich gehörte er auch gar nicht zu Trumps Anwaltsteam in New York. Dort waren vor allem Joe Tacopina – der häufig in schlagzeilenträchtigen Prozessen in Manhattan auftauchte – und Susan Necheles für Trump tätig. Letztere war vor allem dadurch berühmt geworden, dass sie den Mafioso »Benny Eggs« verteidigt hatte. Boris jedoch hatte die Anwälte für jeden Fall persönlich ausgesucht und dann einen Keil zwischen sie und Trump und zwischen die Anwälte und das Wahlkampfteam getrieben. Da die Anwälte im Trump-Universum ständig wechselten, stand er für ein gewisses Maß an Stabilität, selbst wenn er nur als dauerhafter Feind aller anderen Anwälte galt. Wenn man bedachte, wie oft er aus dem Trump-Universum hinausgeboxt worden war, sagte das einiges darüber aus, wie dort Stabilität gemessen wurde.
Nichts würde passieren, versicherte Boris seinem Boss. Sie hatten es geschafft, einstweilen war er in Sicherheit, vielleicht sogar für immer. »Ich meine es wörtlich, es wird nichts passieren«, sagte er zu praktisch jedem Mitglied der Mannschaft. »Jedenfalls nicht, bis die Grand Jury wieder zusammentritt.« Das wäre erst in einem Monat. »Und es besteht eine echt gute Chance, dass es überhaupt nicht zur Anklage kommt«, so Boris weiter. »Jede Verzögerung ist schlecht für sie.« Sie meinte die Strafverfolger in New York City. »Es bedeutet, dass sie versuchen, den Fall mit einer neuen Theorie zu untermauern. Mit anderen Worten, es gibt gar keinen Fall.«
Was Boris damit sagen wollte: Der Bezirksstaatsanwalt von Manhattan, Alvin Bragg, war am Arsch.
»Er feiert schon«, berichtete Boris. Er – damit meinte er den (Ex-)Präsidenten.
Tatsächlich feierte Trump mit Freunden, am Telefon und im Innenhof von Mar-a-Lago, schon seit ihm die geniale Idee gekommen war, die Anklage vorab anzukündigen. Und zwar genau aus dem Grund, weil, wie Boris ihm versprochen hatte, gar keine Anklage erhoben werden würde. Stattgefunden hatte die Ankündigung auf dem Golfplatz, und sie war durch sein eigenes Netzwerk Trump Social verbreitet worden: »Ich werde am Dienstag verhaftet!« Der genaue Tag entsprang einzig und allein Trumps Inspiration und seinem juckenden Social-Media-Finger. Binnen Sekunden wurde eine Nachricht daraus.
Das Wahlkampfteam rief ihn noch auf dem Golfplatz an und versuchte herauszufinden, woher er das mit dem Dienstag hatte.
»Aus all den Fake News«, erklärte er selbstgewiss.
Daraufhin verfassten seine Anwälte und Angestellten pflichtschuldigst eine formelle Ankündigung, die letztlich Trumps Äußerung zurücknahm: »Es gibt keinerlei Hinweise, abgesehen von illegalen Lecks aus dem Justizministerium und dem Büro des Bezirksstaatsanwalts an NBC und andere Fake-News-Organe, dass der von George Soros finanzierte linksradikale demokratische Staatsanwalt von Manhattan beschlossen hätte, seine Hexenjagd auf eine neue Stufe zu heben. Präsident Trump betont mit Recht weiterhin seine Unschuld und die Art und Weise, wie unser Unrechtssystem als Waffe missbraucht wird. Er wird am nächsten Wochenende in Texas einen riesigen Wahlkampfauftritt haben.«
Doch Trump wollte mehr. Schreibt dazu, wies er seine Anwälte an, dass die Leute auf die Straße gehen sollen, um zu protestieren.
»Das könnte Probleme bereiten«, warf einer seiner Anwälte ein. Trump befand sich zum Zeitpunkt dieses Gesprächs immer noch auf dem Golfplatz. Man gab zu bedenken, ein solcher Aufruf könne zum Indiz im Fall des 6. Januar verwendet werden, der nach wie vor untersucht wurde und bei dem es um die Frage ging, ob Trump seine Unterstützer dazu aufgefordert habe, in seinem Namen das Kapitol zu stürmen.
»Scheißegal, schreibt es rein«, wies Trump seine Anwälte vom Golfplatz aus an.
Die Erklärung wurde trotzdem ohne den Aufruf zu Massenprotesten veröffentlicht. Doch gleichzeitig haute Trump Social-Media-Posts raus, in denen er »PROTEST, PROTEST, PROTEST« forderte. Seine Verteidigungsstrategie in Bezug auf seine Rolle am 6. Januar 2021, als das Kapitol angegriffen worden war, beruhte weiterhin auf der Aussage, er sei ein passiver und nachgerade verwirrter Zuschauer gewesen. Gleichzeitig bestimmte die Vorstellung von Menschenmassen in ungeahnter Größe, die sich zu seiner Verteidigung versammelten, aktuell sein gesamtes Denken.
Die Anklage, die er vorhersagte, wurde so über Nacht zum politischen Wendepunkt. Ein Vorgang, der normalerweise einen Kandidaten für ein politisches Amt komplett erledigt hätte, brachte ihm eine Welle der Unterstützung ein. Jede Menge Republikaner (darunter der Sprecher des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, und zwei von Trumps erklärten Mitbewerbern in den Vorwahlen, Vivek Ramaswamy und Mike Pence, die Fraktionsspitze und weitere mögliche Präsidentschaftskandidaten der Republikaner) eilten ihm zu Hilfe und griffen den Bezirksstaatsanwalt von Manhattan an. Nur einer tat das nicht: Ron DeSantis, Gouverneur von Florida, der noch darüber nachdachte, in den Vorwahlen gegen Trump anzutreten, was er dann doch nicht tat. Jedenfalls wurde das die eigentliche Story: Warum verteidigte Ron DeSantis »den Präsidenten« nicht?
Trumps Vorhersage einer Anklage fand unmittelbar vor seinem ersten großen Wahlkampfauftritt statt und verlieh diesem Auftritt ein besonderes Gewicht. Die Anklage (von der Trump inzwischen überzeugt war, dass es sie nicht geben würde) geriet zur Begründung der Wahlkampagne. Und die Kampagne, mit der Trump seinen Gegnern Angst und Schrecken einjagen wollte, wurde zum Grund dafür, dass die Anklage nicht stattfinden würde! Wer wollte es jetzt noch wagen, ihn anzutasten? Und wenn es doch jemand tat, dann nur, weil er zum Präsidenten kandidierte und die Demokraten alles tun würden, um ihn aufzuhalten.
Er hielt sich für unverwundbar, was der hilfreiche Boris ihm auch ständig bestätigte. Nach dem Auftritt in Waco war Trump das Dauerthema auf konservativen Nachrichtensendern. Selbst er fand so viel Weihrauch übertrieben. Vor einer kräftigen Mahlzeit aus Quarter Pounders und Chicken McNuggets sitzend, äffte er die Sprecher nach: »Es ist wie bei Saturday Night Live! Trump ist großartig. Nein, wirklich, Trump ist echt großartig! Tatsache, Trump ist wirklich, wirklich, wirklich großartig!« Diesen Witz – oder etwas in der Art – über sich selbst wiederholte (und wiederholte) er die ganze folgende Woche lang.
Das Problem war nur: Natürlich war und blieb Trumps Unverwundbarkeit die Arbeitshypothese, doch hinter verschlossenen Türen erklärte einer der Anwälte, was auch immer Boris behauptete, es gäbe valide Informationen darüber, dass die Anklage kommen würde.
»Hast du ihm das schon gesagt?«, fragte ein überraschter Kollege.
»Machst du Witze?«
Trump würde am Wochenende Golf spielen, kündigte Boris der Gruppe per Video an. Mar-a-Lago konnte aufatmen. »Entspanntes Wochenende. Nichts wird passieren. Der Präsident ist zufrieden. Keine Sorge.«
Und indem er, mittlerweile im Hemd, den Videocall beendete, sagte Boris noch, er würde sich das Wochenende ebenfalls freinehmen.
Boris wurde 1982 in Moskau geboren und kam mit der großen Einwanderungswelle russischer Juden in den Neunzigerjahren in die Vereinigten Staaten. Er wuchs in einem Vorort in New Jersey auf. Nach dem Jurastudium und einem kurzen Intermezzo bei einer New Yorker Anwaltskanzlei wechselte er in den aufstrebenden Bereich der konservativen Medien, wo sich neue politische Fronten und Karrierechancen auftaten. Ohne allzu großen Erfolg war er 2008 an den Versuchen beteiligt, Sarah Palin für Wahlkampfinterviews fit zu machen. 2016 stieß er als TV-Unterstützer zu Trumps Wahlkampfteam, zu einer Zeit also, als es noch schwierig war, Leute zu finden, die sich für Trump starkmachten, und man so ziemlich jeden nahm, der dazu bereit war.
Die Ablehnung und das Misstrauen, das Boris weckte – nicht zuletzt, als das Theater mit den Russen losging, er hatte ja durchaus Verbindungen dorthin –, beruhte darauf, dass er nach wenigen Wochen »aus Sicherheitsgründen« seinen Job im Weißen Haus verloren hatte. Er blieb dem Trump-Universum aber als TV-Sprecher verbunden, arbeitete kurze Zeit für die konservative Neugründung Sinclair Television und vermarktete im privaten Rahmen den Einfluss, den er im Weißen Haus hatte. Wobei er häufig gerade die zahlreichen Personen ins Feld führte, die er schon so oft irritiert und verwirrt hatte.
Sein dauerhafter Status als Außenseiter brachte ihn in den Tagen nach der Wahl 2020 in eine perfekte Ausgangsposition. Zur allgemeinen Überraschung nahm er es als einer der ersten (wenn auch selbst ernannten) Vertreter Trumps auf sich, nach Arizona zu fliegen, um das Wahlergebnis in diesem Bundesstaat anzuzweifeln und den Versuch einer Anfechtung zu unternehmen. Im nachfolgenden Disput über die Wahl tat er sich mit Rudy Giuliani zusammen und bereiste gemeinsam mit dem ehemaligen Bürgermeister von New York City verschiedene Bundesstaaten mit dem Ziel, neue Wähler zu mobilisieren sowie die offiziellen Wahlergebnisse auf juristischem Wege zu Fall zu bringen. In den Tagen vor dem 6. Januar verschanzte sich Boris zusammen mit Giuliani im Willard Hotel in Washington, in den Augen der Staatsanwälte einer der Kristallisationspunkte bei den Ereignissen rund um den 6. Januar.
Nach dem 6. Januar wurde Giuliani, der auf einmal Geld für seine fruchtlosen Bemühungen verlangte, aus dem engeren Kreis um Trump ausgestoßen. Er erfuhr nicht einmal Trumps neue Mobilnummer, nachdem dieser das Weiße Haus verlassen hatte. Doch Boris machte weiter. Mit seiner Vasallentreue Trump gegenüber während des Wahlkampfs hatte er sich Vertrauen erworben. Und während praktisch alle anderen versuchten, Trump von seiner besessenen Fixierung auf das Wahlergebnis abzubringen, nährte Boris diese Besessenheit mit seinen ständigen Anrufen.
So wurde er irgendwann zu einer Art halboffiziellem Mittelsmann für Trump und ließ sich von einer ganzen Reihe von Klienten für seine Dienste bezahlen. Wer die Unterstützung des Kerls in Mar-a-Lago wollte, tat gut daran, Boris Epshteyn als politischen Berater zu beschäftigen. Boris verkaufte Trumps mögliche Unterstützung, auch wenn Trump die Klienten, die Boris vermittelte, oft brüskierte.
Dem juristischen und politischen Team machten nicht nur die krummen Dinger zu schaffen, die absurden juristischen Ratschläge, das Horten von Informationen und die Tatsache, dass Boris es immer irgendwie schaffte, die letzte Stimme zu sein, die Trump hörte – Sorge bereitete auch, dass Boris in einigen der Gerichtsverfahren selbst betroffen sein könnte. Trump jedoch ließ sich nicht beirren: Boris war sein Mann.
Als Trump die bevorstehende Anklage verkündete, jene Anklage also, die nach seiner Überzeugung niemals erhoben werden würde, lud er zu einer seiner üblichen Versammlungen von Bittstellern, Golfpartnern und Mitläufern im Grill Room des Trump International Golf Club in West Palm Beach ein, eine Viertelstunde von Mar-a-Lago entfernt.
Unerklärlicherweise war ein seltsamer Mischmasch von patriotischen Liedern, der von verhafteten J6-Leuten eingespielt worden war, zur Nummer eins der Apple-Charts aufgestiegen. Dieser Song lief jetzt mit gefühlten hundert Dezibel. In einem Moment, den selbst die größten Schleimer seiner Entourage als »ein bisschen gruselig« bezeichneten, stand Trump plötzlich auf und wandte sich dem Bildschirm und der wehenden Flagge in dem Video zu, die Hand aufs Herz gelegt. Was zur Folge hatte, dass alle anderen ebenfalls aufsprangen. Die echten Flaggen hingen hinter ihm, und genau dorthin drehten sich alle anderen in ihrer Verwirrung um. So ergab sich das Bild einer Gruppe, die Trump die Treue schwor, ein Bild, das nur dadurch gestört wurde, dass Trump auf einmal anfing, zu tänzeln und »Nummer eins, Nummer eins, Nummer eins« zu singen. Als alle wieder Platz genommen hatten, rief Boris an. Trump hielt das Telefon hoch und ließ die anderen mithören, während Boris vor sich hinplapperte, wie großartig alles für den Ex-Präsidenten aussah.
»Ah, hört ihr, das ist Boris, mein Boris. Er ruft mich so etwa zwanzig Mal am Tag an.« Tatsächlich kam es alle paar Stunden zu solchen Anrufen. »Er hat immer gute Nachrichten für mich. Er sagt Sachen wie: ›Sir, Sie liegen in den Umfragen neunzig Punkte vorn. Sir, nächste Woche wird Anklage gegen Sie erhoben, aber machen Sie sich keine Sorgen, das sind gute Nachrichten für Sie.‹«
Selbsterkenntnis und Grausamkeit kamen hier zusammen. Die Erkenntnis, dass er gern Jasager um sich versammelte, und die Neigung, sich über genau diese Jasager lustig zu machen. Und Boris erzählte die Geschichte weiter, als wäre er auch noch stolz darauf.
Ein entscheidendes Merkmal von Trumps politischem Leben sind die Menschen, die daran teilhaben. Seit 2015 war das Trump-Universum eine wilde Show von unmöglichen Gestalten, die dazustießen und in der Regel zu spät wieder verschwanden. Viele gerieten mit Trump über Kreuz und wurden gefeuert. Andere folgten blind seinen Anweisungen und kamen dadurch selbst mit dem Gesetz in Konflikt, darunter sein erster politischer Berater Roger Stone, sein persönlicher Anwalt Michael Cohen, sein zweiter Wahlkampfmanager Paul Manafort und sein dritter Wahlkampfmanager Steve Bannon. Dasselbe galt für Brad Parscale, der 2020 Wahlkampfmanager war, für Rudy Giuliani, der ebenfalls als Privatanwalt fungierte, und für eine große Zahl von Leuten, die das Wahlergebnis leugneten.
Die gemäßigte Haltung der Personen, mit denen sich Trump zu Beginn des Frühjahrs 2023 umgab, konnte angesichts dessen durchaus überraschen. Da gab es Susie Wiles, Tochter von Pat Summerall, dem ehemaligen Footballspieler, der zwei Jahrzehnte lang einer der prominentesten Sportreporter des Landes und damit eine echte Institution gewesen war. Wiles hatte Rick Scotts erfolgreichen Wahlkampf um das Amt des Gouverneurs von Florida 2010 und Ron DeSantis’ Kampagne 2018 geleitet. Trump hatte 2016 angeordnet, sie als Wahlkampfmanagerin in Florida zu feuern, weil er sie zu alt und optisch unpassend fand. Diese Anordnung war jedoch ignoriert worden, sodass sie sowohl 2016 als auch 2020 Trumps Wahlkampf in Florida leitete und entscheidend daran beteiligt war, Florida für ihn zu erobern. Jetzt, vor Ort im Exil in Mar-a-Lago, übernahm sie in der Zeit nach dem Amt allmählich seine operativen politischen Geschäfte. Was dabei nicht ohne Bedeutung war: Durch ihre lange Vorgeschichte mit Ron DeSantis, Trumps einzigem echten Herausforderer in den Reihen der Republikaner, wusste sie um dessen Besonderheiten und Schwächen. Mehr noch: DeSantis hatte sie im Rahmen einer mittlerweile recht berühmten politischen Fehde in Florida rausgeworfen, sie hatte also noch eine Rechnung mit ihm offen.
An zweiter Stelle gleich hinter Wiles ist Chris LaCivita zu nennen, ein Marine, der im Ersten Golfkrieg verwundet worden war, und ein bewährter republikanischer Politikberater, der schon viele Wahlkämpfe bestritten hatte und auf eine lange Karriere als Hinterbänkler zurückblicken konnte. Hinzu kamen verschiedene Politikberatungsfirmen, die davon lebten, dass sie Wahlkämpfe begleiteten, und die verschiedenen Lobbygruppen, die den Wahlkampf unterstützten, darunter das wichtigste Political Action Committee aus dem Trump-Wahlkampf 2020. LaCivita hatte im Jahr 2004 die Kampagne Swift Boat Veterans for Trump geleitet, die für die vernichtenden Wahlanzeigen gegen John Kerry verantwortlich war. Jetzt leitete er den Wahlkampf für die Vorwahlen und die Delegiertenwahlen.
Bemerkenswert war dabei, auf welch subtile Weise sich alle vor dem Titel des Wahlkampfmanagers drückten – Trump war in der Vergangenheit immer und unweigerlich unzufrieden mit der Person gewesen, die diesen Posten innehatte.
Wiles und LaCivita bildeten das professionelle Führungsteam, das die Aufgabe hatte, mit dem launischen Ex-Präsidenten umzugehen. Das war der Presse nicht entgangen – sowohl Wiles als auch LaCivita pflegten herzliche professionelle Beziehungen mit den politischen Medien, auch wenn Trump diese Medien zum Hauptfeind erklärt hatte –, die diesen Umstand zunehmend als Grund für Trumps Aufwärtstrend und die immer besseren Umfragewerte ansah. Das neue Narrativ ging sogar davon aus, dass Trump aus der Vergangenheit gelernt hatte.
Bis zu diesem Zeitpunkt war es eher eine Kampagne gewesen, die auf Unausweichliches reagierte, weniger ein durchgeplanter Wahlkampf. Wollte Trump wirklich und wahrhaftig noch einmal antreten? Er hatte das Weiße Haus zwar verlassen, dabei aber nie die Rolle abgelegt, die er als Präsident gespielt hatte. (Viele behaupteten gar, er habe nie die Rolle abgelegt, die er als Chef der Trump Organization im Trump Tower gespielt hatte.) Mar-a-Lago war ein guter Ersatz fürs Weiße Haus, und Trump verbrachte seine Tage so, wie er es im Westflügel des Weißen Hauses und zuvor im Trump Tower getan hatte: Er traf sich mit Fans, Gefolgsleuten, Schleimern und Opportunisten. Er spielte Golf. Und alle redeten ihn weiterhin, nicht nur ehrenhalber, mit »Mister President« an.
Als König von Mar-a-Lago lebte er womöglich besser denn als Präsident. Jeden Abend, wenn er die Terrasse zum Dinner betrat, erhoben sich zweihundert Gäste, applaudierten lange und ausgiebig und suchten später seine Nähe, um einen persönlichen Gruß auszutauschen und ein paar Augenblicke privater Schleimerei zu genießen. Wohin auch immer er ging, betrachtete ihn seine Machtbasis, die MAGA-Leute, geradezu mit Ehrfurcht. Er verfügte weiterhin über den Schutz durch den Secret Service, zu manchen Zeiten mit bis zu achtzig Personenschützern. Und er war das Schwergewicht der Republikanischen Partei; sein Einfluss überragte den jedes anderen. Er führte ein Leben wie seinerzeit im Westflügel, musste aber nichts mehr tun und war auch für nichts verantwortlich. Eigentlich war das eine ideale Situation – bis auf die Tatsache, dass ihn eines Tages ein anderer Republikaner als Bannerträger ersetzen könnte. Und das hielt er nicht aus.
Der Wahlkampf kam im Sommer 2022 nur schleppend in Gang. Trump war stinkwütend über Ron DeSantis’ offensichtliche Bereitschaft, als Gegenkandidat anzutreten, und fürchtete gleichzeitig weiteren »Hexenjagd-Scheiß«. Am liebsten hätte er sehr früh seine Kandidatur erklärt, doch erst einmal wollte er so viel Golf spielen wie möglich. »Wer weiß, wie viele solche Sommer mir noch bleiben«, sagte er zu Freunden und weckte damit allerlei Spekulationen, ob er von den Anstrengungen redete, die ein Wahlkampf und die Rückkehr ins Weiße Haus mit sich bringen würden, von einer möglichen Haftstrafe oder, was am unwahrscheinlichsten erschien, von seiner eigenen Sterblichkeit.
Tatsächlich markierte der 8. August 2022 den echten Beginn der Kampagne für die Wahl 2024, auch wenn Trump seine Kandidatur erst am 22. November offiziell erklärte. An diesem Tag durchsuchte das FBI mit dreißig Mann Mar-a-Lago und beschlagnahmte 33 Kartons mit Trump-Papieren, ein Teil davon geheime Unterlagen, die der Ex-Präsident bei seinem Auszug aus dem Weißen Haus versehentlich oder in böser Absicht hatte mitgehen lassen. Durchaus möglich, dass Trumps Opferhaltung und Empörung wie auch seine Kraft zum Zurückschlagen während der langen Golfpartien nachgelassen hatten. Doch jetzt waren diese Eigenschaften alle wieder da. Er füllte seine Rolle wieder aus. Wenn sie ihm nachstellten, was konnte er anderes tun als ihnen nachstellen? (Tatsächlich wurde das zur wichtigsten Aussage seiner Verteidigung.) Augenblicklich lebte seine bis dahin eher glanzlose Spendenkampagne wieder auf, sodass im dritten Quartal 202222 Millionen Dollar gesammelt werden konnten. Jetzt hatte die Kampagne auf einmal einen motivierten Kandidaten, eine Maschine zum Gelddrucken und ein emotionales Thema: Sie waren hinter ihm her.
Sämtliche Beziehungen von Trump mit seiner Familie, seinen Ehefrauen, Angestellten und Freunden sind … nun, ungewöhnlich. Alle Menschen in seinem näheren Umfeld sind ihm zu Diensten, indem sie Rollen ausfüllen, die er sich mehr oder weniger selbst ausgedacht hat. Von all diesen Beziehungen die seltsamste und unglücklichste ist wohl die zu seinen Anwälten. Sie gleicht einer Drehtür, durch die über die Jahre hinweg Hunderte gegangen sind. Das Herzstück dieser Beziehung ist ein grundlegender Widerspruch: Trump verlangt von seinen Anwälten, dass sie gerissen, schlau, scharfsinnig und aggressiv sind und ihn aus jedem Schlamassel herausholen, in den er sich selbst hineinmanövriert hat. Doch gleichzeitig legt er Wert darauf, dass sie ihm jeden Wunsch von den Augen ablesen und ihm ständig versichern, dass er recht hat und recht bekommen wird. In diesem Sinne hatte er Roy Cohn zum Mythos eines allmächtigen Verteidigers und Retters hochstilisiert, mit dem sich niemand messen konnte. Und selbst an ihm hatte er irgendwann allerlei auszusetzen und ihn verstoßen. Außerdem betrachtete er Anwälte als Teil des Dramas und nicht als Bühnentechniker und entschied sich bei der Auswahl seiner idealen Kandidaten für Gestalten, wie sie in den Anwaltsserien der Sechzigerjahre gang und gäbe gewesen waren.
Praktisch jede größere Anwaltskanzlei in Washington und New York hatte es abgelehnt, Trump während seiner Jahre im Weißen Haus zu vertreten. So reichte eigentlich schon die bloße Bereitschaft aus (während professionelles Ansehen oder besondere Leistungen keine große Rolle spielten), um ins Trump-Universum aufgenommen zu werden. Und richtig fiesen Anwälten standen die Türen zum inneren Kreis sehr schnell offen. Boris war so ein Anwalt; er war willig und fies. Aber er verfügte über eine weitere hochgeschätzte Eigenschaft: Er war bereit, jeden Verdacht des Chefs zu bestätigen, dass die anderen Anwälte nicht willig und/oder fies genug waren. Dass sie nicht gerissen, schlau, scharfsinnig und aggressiv genug waren. Und schließlich erfüllte Boris noch ein Kriterium, das darüber hinausging, immer zu sagen, was Trump hören wollte: Er sagte es mit jeder Menge Überzeugungskraft und verbreitete dabei jede Menge Misstrauen gegen andere, indem er seinem Boss Gerüchte über Verschwörungen und perfide Pläne einflüsterte. All das führte dazu, dass Trump ihn immer wieder hören wollte. Boris hatte begriffen, dass die wahre Macht, die einzige Macht, darin bestand, Trumps Ohr zu okkupieren.
Es stimmt, dass Trump auf verlässliche und kompetente juristische Beratung und Vertretung verzichtete, als er sich auf den Kampf mit den Staatsanwälten einließ. Daran bestand kein Zweifel. Doch der andere Punkt – oder nennen wir es eine andere Theorie – war, dass er ein starkes intuitives Gespür dafür hatte, wie er mit dem Chaos zurechtkommen konnte, in dem er sich befand; stärker als irgendwer sonst. Und genau deshalb bestand seine ultimative juristische Strategie darin, eben nicht auf seine Anwälte zu hören, die die größere Bühne, auf der er spielte, niemals verstehen würden.
Am 1. Januar 2022 übernahm Alvin Bragg das Amt des Bezirksstaatsanwalts von Manhattan, als erster Schwarzer auf diesem Posten. Seine bisherige Karriere umfasste eine Tätigkeit im Büro des State Attorney General und als Assistant U.S. Attorney im südlichen Bezirk von New York, sodass Bragg mit seinen 48 Jahren eine feste Größe in der New Yorker Justiz und Politik war. Jetzt hatte er gleich zu Beginn seiner Amtszeit die komplizierte und kontroverse Untersuchung der Geschäftspraktiken des Ex-Präsidenten übernommen. Im Einklang mit der allgemeinen Haltung des Establishments – das Leben ist zu kurz, um einen ehemaligen Präsidenten zu verfolgen, und außerdem, na ja, so ist eben die New Yorker Immobilienwelt – beendete er die Ermittlungen fast sofort. Die beiden leitenden Ermittler in dem Fall, Mark F. Pomerantz und Carey R. Dunne, traten daraufhin unter öffentlichem Protest zurück und übergaben ihre bisherigen Ergebnisse an das Büro des U.S. Attorney; mit anderen Worten, an Joe Bidens Justizministerium. Auch dort wurden sie mit der zögerlichen Haltung des Establishments zur Strafverfolgung gegen einen ehemaligen Präsidenten konfrontiert.
Doch die Stimmung sollte bald kippen, da Trumps neue Wahlkampagne immer mehr Fahrt aufnahm und Trump weiterhin mit großer Leidenschaft die gestohlene Wahl beklagte.
Mit der FBI-Razzia hatte sich das Klima gewandelt. Trump trug dazu bei durch seine offensichtlich destruktive und lässig-verächtliche Haltung in Bezug auf die Ermittlungen, die Unverfrorenheit seiner erfolgreichen Spendenkampagne und seine frustrierende, wenn auch erwartbare Unbeugsamkeit. Dann kamen die Midterm-Wahlen 2022, bei denen Trumps scheinbare Schwäche mehr als deutlich wurde: Alle seine Gefolgsleute erlitten Niederlagen. Man hätte meinen können, das Trump-Fieber sei besiegt. Es würde keine rote Welle geben, die ihn rettete. Die Republikaner wandten sich endlich gegen ihn. Ron DeSantis erschien auf der Bühne, nachdem er mit überzeugender Mehrheit als Gouverneur von Florida wiedergewählt worden war, und er schien bereit, Trump wegzufegen, unterstützt durch republikanische Großspender und als klarer Favorit des rechtskonservativen Nachrichtenkanals Fox News. Dann kündigte Trump mit der üblichen empörenden, gedankenlosen Dreistigkeit an, er werde wieder antreten. Für das Establishment hieß das: Er war so schwach, dass man ihn verfolgen konnte. Und er war so stark, dass man ihn verfolgen musste.
Es würde tatsächlich passieren. Das Justizsystem würde einen ehemaligen Präsidenten in einem oder mehreren unausweichlichen Verfahren wegen Wirtschaftskriminalität vor Gericht stellen. Die Frage war nur, welche von den vielen Ermittlungen die erste Anklage hervorbringen würde. Alvin Bragg schob alle seine früheren Bedenken beiseite und vollzog eine Kehrtwende in seiner Argumentation: Es sei nicht problematisch, Trump anzuklagen, es sei das einzig Richtige.
Obwohl Trump weiterhin mit großer öffentlicher Erregung die »Hexenjagd« verdammte, blieb er in Wirklichkeit recht gelassen, was seine Situation anging. Das ließ sich zum Teil darauf zurückführen, dass er von Natur aus immun gegen die Außenwelt war. Oder noch einfacher: dass seine eigene Welt die Außenwelt in den Schatten stellte. Er lebte in einem stark kontrollierten Universum, das ausschließlich von Lakaien, Hofschranzen und Schleimern bevölkert war. Auch die Schwachpunkte gewöhnlicher Sterblicher – Zweifel, Scham und Furcht – suchte man bei ihm vergebens. Konflikte waren sein Lebenselixier und sein Antrieb. Er hatte sein Leben lang Prozesse führen müssen und war jedes Mal – seiner Interpretation nach mithilfe reiner Willenskraft – siegreich daraus hervorgegangen.
Hinzu kam, dass schlechte Nachrichten kaum zu ihm durchdrangen. Es gab keine realistischen Einschätzungen seiner Situation. Boris hielt die Gruppe der ständig wechselnden Anwälte in Schach. Seine juristischen Einschätzungen wurden dem Boss übermittelt, und sie sahen immer rosig aus. Anwälte, die Boris’ Ansichten nicht teilten, fielen rasch bei ihrem Mandanten in Ungnade.
Während bei Trump die Überzeugung wuchs, dass er in New York nicht angeklagt werden würde, kamen Berichte auf, David Pecker sei vor der Grand Jury erschienen, die Alvin Bragg zusammengerufen hatte. Pecker war ein alter Trump-Gefährte, er leitete das Boulevardblatt National Enquirer und hatte sich in einer verdrehten Mischung aus Bewunderung und sanfter Erpressung im Zusammenhang mit einigen Trump-Skandalen hervorgetan. Musste man sich keine Sorgen machen, wenn Pecker jetzt vor der Jury aussagte? Nein, Boris schätzte die Lage so ein, dass Pecker Schnee von gestern war. Dahinter stecke nur Braggs PR-Gerede, alles Bullshit, der lediglich das Ziel hatte, Braggs Namen in die Zeitungen zu bringen. Letztlich würde es niemand wagen, sich gegen Präsident Donald Trump zu wenden.
In Vorbereitung eines langen Wochenendes präsentierte Boris am Telefon beschwingte Aussichten: »Ich nehme an, sie schieben die Sache einen Monat lang auf, um sie dann fallen zu lassen. Mister President, ich verspreche Ihnen, die Sache verläuft einfach im Sande.« Und Trump, der sich sonst vielleicht über Boris’ beständig gute Laune lustig gemacht hätte, verkündete jetzt weit und breit diese Versicherung als Heiligen Gral.
Am Nachmittag desselben Tages, 4. April, um 17 Uhr 30, verkündete der Bezirksstaatsanwalt von Manhattan die erste Anklage gegen einen Präsidenten der Vereinigten Staaten in der Geschichte des Landes. Die genauen Anklagepunkte blieben noch im Unklaren, es wurde auch nicht gesagt, ob es sich um Trumps Geschäftsgebaren handelte (die Ermittlungen in diesem Bereich schwelten ja schon länger vor sich hin) oder um andere Dinge. Möglichkeiten gab es viele.
Trump war zu diesem Zeitpunkt dabei, eine Fernsehsendung aufzuzeichnen, zusammen mit Mark Levin, einem rechten Kommentator und Trump-Gefolgsmann. Danach wollte er mit Levin und dessen Frau auf der Terrasse von Mar-a-Lago zu Abend essen.
Doch das Chaos machte diese Pläne zunichte. Boris, der sich ins Wochenende verabschiedet hatte, war nicht erreichbar. Die New Yorker Anwälte Joe Tacopina und Susan Necheles hörten von der Anklage erst durch das Wahlkampfteam, das seinerseits aus der New York Times davon erfahren hatte. Tatsächlich hatte das politische Team auf eigene Faust eine Krisenreaktion formuliert, doch im Moment war kein Anwalt greifbar, der das Statement abnicken konnte. Trump selbst suchte zwischen TV-Aufzeichnung und Abendessen mit Levin nach einem Schuldigen und entschied sich wie so oft in den kommenden Tagen für seine miserablen Anwälte.
»Warum habe ich so beschissene Anwälte? Wie konnte das passieren? Wie konnten sich meine Anwälte dermaßen irren?« (Tatsächlich war es Boris, der sich geirrt hatte, doch ausgerechnet Boris bekam von Trumps Anschuldigungen nichts ab.) Was zunächst wie eine rhetorische Frage klang, umschrieb ein echtes Problem. Trump verlangte eine Antwort. Warum hatte er so beschissene Anwälte? »Wo ist mein Roy Cohn?« Diese letzte Frage hatte er so oft gestellt, dass sie mittlerweile fast ironisch klang. Aber das war sie nicht. Und er stellte sie weiterhin, immer wieder fast wortgleich, während er den ganzen Abend über ununterbrochen telefonierte.
Es war erstaunlich, wie schnell seine Stimmung wechseln konnte. Kein Wunder, dass man sie oft mit dem Wetter verglich. »Wie sind die Aussichten?« – »Da braut sich ein Sturm zusammen.« – »Es hat aufgeklart, jetzt ist es sonnig.«
An diesem Abend kamen mehr Anrufe herein, als er annehmen konnte. Mehr als 50 Prozent, vielleicht sogar 60 Prozent der Republikaner im Repräsentantenhaus, dazu Senatoren, Gouverneure, Justizminister aus den Bundesstaaten, auch viele von denen, die sich nach dem 6. Januar von ihm abgewandt hatten, unterstützten ihn jetzt. Alle twitterten und veröffentlichten eilige Unterstützungsbotschaften. Er selbst schwankte zwischen wildem Zorn (wirklich furchterregender Raserei) und Genuss. Ständig hing er am Telefon und sprach mit seinen leidenschaftlichsten Unterstützern, stets auf der Suche nach einer Empörung, die noch größer war als seine eigene.
Der Worst Case für einen Präsidentschaftskandidaten war eingetreten: eine Strafanklage. Im üblichen Verständnis der amerikanischen Politik bedeutete dies das Aus. Doch die Reaktion auf einen neuen Spendenaufruf, den das Wahlkampfteam sofort online gestellt hatte, erwies eine vollkommen andere Wirklichkeit: Noch nie war so schnell so viel Geld gespendet worden wie jetzt.
In einem Versuch, diese Realität nicht nur der Öffentlichkeit, sondern vor allem auch sich selbst zu erklären, sprach das Wahlkampfteam von jetzt an von einem »geteilten Bildschirm«. Auf der einen Seite die denkbar schlimmste Situation: ein juristischer Sumpf, aus dem es kein Entrinnen gab, eine bedrohliche und vielleicht, nein, ziemlich sicher tödliche Lage. Und auf der anderen Seite ein ganz und gar positives politisches Bild: überwältigende Unterstützung aus der Partei, immer höher steigende Umfragewerte und blasse Gegner. In den ersten vierundzwanzig Stunden nach der Anklage kamen vier Millionen Dollar an Spenden zusammen, und besonders bemerkenswert war die Tatsache, dass ein Viertel dieser Summe von neuen Spendern stammte.
Trump sitzt hinter seinem Schreibtisch und ruft in bester Laune: »Bringt mir das Gift!« Sofort erscheint ein Korb mit Süßigkeiten – Starburst, Hershey’s Miniatures, Laffy Taffy und Tootsie Rolls. »Okay, bringt es wieder raus«, sagt er, nachdem er sich zwei Hände voll genommen hat.
»Das ist eine große Sache. Sehr groß«, analysiert er die Lage, wobei er gleichzeitig telefoniert und mit den Leuten in und vor seinem Büro spricht. »Sie machen das nur, weil sie Angst vor uns haben. Damit stehen wir vor jeder Kamera auf der Welt.«
Seine Anwälte schlagen eine stufenweise Reaktion in kleinen Schritten vor, was Trump jedoch rundheraus ablehnt. Er hat es seinen Angestellten schon wiederholt gesagt, und jetzt sagt er es seinen Anwälten: »Unsere juristische Strategie ist die gleiche wie unsere Medienstrategie. Und unsere Medienstrategie ist die gleiche wie unsere juristische Strategie.« Diese Prämisse hat er schon so oft geäußert, dass sich niemand mehr erinnert, wann er diese grundlegende Aussage zum ersten Mal gehört hat.
Trumps Leute, jedenfalls viele von ihnen, denken nicht grundlegend anders über ihn als der Rest der Welt. Sie halten ihn für launisch, kapriziös, faul, schlecht informiert und unaufmerksam. Der Unterschied liegt nur darin, dass sie ihn aus der Nähe erlebt haben. Sie haben gesehen, wie er Dinge überlebte, die andere sterbliche Politiker umgebracht hätten. Und deshalb glauben sie inzwischen, dass er etwas weiß, sieht, begreift, eine Art neuer Wirklichkeit wahrnimmt, die wir anderen nicht erkennen.
»Unsere juristische Strategie ist die gleiche wie unsere Medienstrategie. Und unsere Medienstrategie ist die gleiche wie unsere juristische Strategie.«
Nach wie vor weiß niemand, worauf man sich gefasst machen muss. Was heißt das, wenn man zum engsten Kreis eines Angeklagten in einem Strafprozess gehört? Man befragt Steve Bannon, der vor nicht allzu langer Zeit in New York wegen Betrugs verhaftet und verurteilt wurde. Wie fühlt sich das an, wenn man im Gefängnis sitzt? »Sie legen dir Handschellen an, und zwar eng. Du kannst dich nicht bewegen, du sitzt den ganzen Tag allein in deiner Zelle. Ich musste sechs Stunden dasitzen, mit Handschellen so eng, dass man sich nicht mal kratzen kann.«
Auf der normalen politischen Bühne braucht ein Politiker, der derartige öffentliche Schwierigkeiten erlebt, seine Frau an seiner Seite. Jason Miller ist einer der wenigen Angestellten, die alle drei Wahlkämpfe mit Trump erlebt haben. Er opfert sich für das Team (es gibt auch Versionen dieser Geschichte, die besagen, dass man ihn gezwungen habe) und geht zu Melania, um mit ihr zu sprechen. Im Dezember 2016, als er auf Trumps Liste als Öffentlichkeitsreferent in der neuen Regierung stand, hat Miller eine Kollegin geschwängert; seine Ehefrau war zu dieser Zeit ebenfalls schwanger. Der daraus folgende Mini-Skandal kostete ihn den Job im Weißen Haus, doch er blieb ein Trump-Favorit und war auch im Wahlkampf 2020 wieder dabei. Sein Gespräch mit der ehemaligen First Lady vor Trumps erstem Erscheinen bei Gericht soll zu einem viel zitierten Beispiel dafür werden, wie schwierig es ist, die Beziehung der Trumps zu managen. »Netter Versuch«, sagt sie, nachdem Miller ihr erklärt hat, sie müsse jetzt Trump zur Seite stehen.
Letztlich übernimmt Justin Caporale den operativen Umgang mit der Anklage. Caporale gehört zu den Wahlkampfhelfern aus Florida, die Wiles ins Team geholt hat. Er ist für die Logistik zuständig, was bei Weitem nicht nur bedeutet, dass er für pünktliche Reisezeiten sorgt. Tatsächlich inszeniert er den gesamten Eindruck von Trumps Bewegungen, seinem Erscheinungsbild, seiner Botschaft. Caporales wichtigste Aufgabe besteht darin, den Ex-Präsidenten so aussehen zu lassen, als wäre er noch Präsident und kandidiere für seine Wiederwahl. Donald Trump ist kein einfacher Bürger, den man vor Gericht stellt. Er ist Präsident Trump.
Am Montag verlässt die Eskorte Mar-a-Lago. Mehrere Hubschrauber folgen der Reihe von SUVs bis zum Flughafen in West Palm. Ständig wird in den Medien über die Reise berichtet.
Jeder Tag im Trump-Universum erhebt den Anspruch, den Medienhype um den weißen Ford Bronco in den Schatten zu stellen, der mehr als 25 Jahre zuvor um O.J. Simpson entstand. Ein Ereignis, von dem behauptet wird, dass es den Charakter der Nachrichten- und Fernsehwelt grundlegend verändert habe.
Am Montagnachmittag, nach der Landung in LaGuardia, sorgt Trump dafür, dass alle im Flugzeug bleiben. Wie unzählige Menschen auf der ganzen Welt betrachtet er die Maschine mit seinem Namen auf der Seite im Fernsehen. Je länger er sein Aussteigen verzögert, desto länger sind die Kameras auf ihn gerichtet, das weiß er genau.
Dann rollt der Konvoi in die Stadt.
Am Dienstagmorgen, bevor er sich in die Stadt und zum Gerichtsgebäude begibt, trifft sich Trump mit seinen Anwälten – Boris, Joe Tacopina und Susan Necheles – in seinem Wohnzimmer im 60. Stockwerk des Trump Tower.
»Wie läuft es?«, fragt er die Gruppe und stellt ihnen damit dieselbe Frage, die er den ganzen Morgen lang mit Freunden am Telefon besprochen hat, obwohl er ja selbst die Nachrichten und die TV-Berichterstattung genau verfolgt.
»Das ganze Land steht hinter Ihnen«, erklärt Boris. Das scheint die gewünschte Antwort zu sein.
Die Fifth Avenue ist voll mit Menschen, wobei die meisten wohl eher Neugierige sind als echte Unterstützer. Eine Protestversammlung ist es jedenfalls nicht. Er verlässt den Trump Tower, ebenso unversöhnlich wie unbeugsam, und begibt sich zu seinem aus zehn Fahrzeugen bestehenden Konvoi. Die Wagenschlange biegt nach rechts auf die 57. Straße ein und begibt sich zum FDR Drive. Drei Hubschrauber verfolgen den Konvoi in Richtung East River, die Fernsehstationen unterbrechen ihre laufenden Sendungen. Auf dem FDR sieht man einen einzelnen Menschen, der dem Konvoi den Stinkefinger zeigt.
Gegenüber dem Gerichtsgebäude Centre Street 100 herrscht Zirkusatmosphäre. Ein paar Hundert Demonstranten für und gegen Trump bemühen sich um die Aufmerksamkeit der Reporter, die Stimmung ist aufgeregt, aber nicht feindselig. Hubschrauber von Polizei und Presse schweben über der Szenerie. Trumps Konvoi kommt um die Ecke.
Trump hat wie immer das Telefon am Ohr und stellt jetzt eine neue Frage: »Glaubt ihr, so eine Anklage ist größer als das Impeachment?«
Steven Cheung, der sich durch seine Arbeit bei früheren Wahlkämpfen und im Weißen Haus zum Sprecher des aktuellen Wahlkampfs qualifiziert und sich bei Trump nicht zuletzt wegen seiner Flammenwerfer-Attacken gegen die Presse beliebt gemacht hat, begeht den Fehler, die Frage wörtlich zu verstehen und entsprechend zu antworten: Ein Impeachment hat nur politische Implikationen; diese Sache hier hat politische und juristische Bedeutung.
Dabei hat doch jeder verstanden, dass Trump mit »größer« lediglich die Außenwirkung meint: ein größeres Drama, eine größere öffentliche Aufmerksamkeit. Und die Antwort, die er hören will, lautet: Die Anklage ist größer, weil sie größer ist! Doch Cheung hat natürlich recht. Diese Anklage findet in einer anderen Welt statt. Seinem Chef steht ein Strafverfahren bevor. Und sie wissen noch nicht einmal, welcher Vergehen man ihn beschuldigt.
Boris befindet sich bereits im 15. Stock des Gerichtsgebäudes, zusammen mit Tacopina und Necheles, und wartet darauf, dass die Anklage verlesen wird. Trump ist in einem anderen Raum, wo ihm die Fingerabdrücke abgenommen werden. Zum Entzücken der Anwälte gibt es eine Panne, die in die Annalen zu diesem Tag eingehen wird: Der Drucker, der die Unterlagen ausspucken soll, produziert mehrere Papierstaus. »Tut mir leid, Mister President«, witzelt einer der Beamten nervös. »Sie müssen morgen wiederkommen.«
Alle anderen Häftlinge wurden aus dem Flur in andere Gebäudeteile umgeleitet, hier befinden sich jetzt nur noch Polizisten. Der Ex-Präsident sitzt auf einem hölzernen Stuhl und wartet, niemand weiß, worauf, wohl einfach nur darauf, dass der Prozess weitergeht. Ganz egal, wer er ist, ganz egal, dass er eine vollkommen andere Position einnimmt als normale Bürger, ganz egal, wie stark seine Fähigkeit ausgeprägt sein mag, Dinge zu leugnen – jetzt befindet er sich in der Maschinerie »des Systems«.
Kapitel 2 E. Jean und die Kartons
Mai/Juni 2023
Alina Habba weist die Andeutung von einigen anderen Trump-Anwälten heftig zurück, sie sei an den Job als Trump-Verteidigerin gekommen, weil sie im Bikini am Pool von Trumps Bedminster Golfclub herumgelungert hätte, dem sie und ihr Ehemann, Besitzer eines Parkhauses, 2019 beigetreten waren. Sie droht mit einer Anzeige, falls sie je herausfindet, wer so etwas sagt. Allerdings lungert sie durchaus an diesem Pool herum und, nicht ohne Stolz, auch im Bikini. Die Rechtsanwältin, die 2010 an der Widener University Commonwealth Law School ihren Abschluss gemacht hatte, arbeitete in einer kleinen Kanzlei in New Jersey und kam tatsächlich an ihren Job, »den Präsidenten« zu vertreten, aufgrund ihrer Bedminster-Mitgliedschaft, denn, so bemüht sie sich zu erklären, andere Bedminster-Mitglieder hätten sie empfohlen, und so habe sie der Familie Trump ihre Dienste angeboten. Trump ließ Habba 2021 in seinem Namen einige mehr oder weniger schikanöse Klagen einreichen, unter anderem gegen seine Nichte Mary Trump, die ein kritisches Buch über ihn geschrieben hatte, eine der zahlreichen Klagen, die abgewiesen wurden. Als Trumps juristische Probleme zunahmen, schlug er immer wieder vor, Alina miteinzubeziehen. Obwohl sie wenig einschlägige Erfahrung besaß in den Sachverhalten, mit denen er sich konfrontiert sah, schien er überzeugt, und es gefiel ihm – wann immer das Thema seiner anwaltlichen Vertretung aufkam, was häufig der Fall war –, auf dem Handy Alina Habbas Foto zeigen zu können, zusammen mit dem von Lindsey Halligan, einer weiteren attraktiven Anwältin, die er in Palm Beach engagiert hatte. »Ich habe vielleicht nicht das beste Anwaltsteam«, sagte er stolz, »aber das heißeste.«
Mar-a-Lago wurde im Frühling von einer wahren Flut an Vorladungen überschwemmt, adressiert an alle, von Trumps Anwälten und Gewährsleuten über den Mann, der in Mar-a-Lago überall und jederzeit Diet Coke anbot, bis hin zu dem Tischler, der in den Lagerräumen des Clubs die Türen eingebaut hatte. Jack Smith, der Washingtoner Staatsanwalt mit dem starren Blick, war die Personifizierung der Regierungsentscheidung, nach beinahe zwei Jahren Unentschlossenheit nun vor der Wahl 2024 gegen Trump vorzugehen – ihm waren politische Bedenken oder das Händeringen des Establishments vollkommen egal. Fani Willis, Staatsanwältin in Georgia, setzte ihre Karriere auf die Bereitschaft – mit Feuereifer! –, gegen Trump vorzugehen. Der Staat New York und seine ehrgeizig fahndende liberale Staatsanwältin Letitia James waren entschlossen, seine Geschäftemacherei zu vernichten. Das liberale politische und juristische Establishment konzentrierte seine gesamte Macht auf ein einziges Ziel – darauf, Trump dranzukriegen. Und es gab kein Anwaltsteam, das schlechter auf einen solchen Angriff vorbereitet war als das von Trump.
Und dann, völlig überraschend, kam der Fall E. Jean Carroll vor Gericht. Ein Fall, über den sich Trump lustig gemacht hatte, dem er seit vielen Jahren aus dem Weg gegangen war, und nun das.
Ein #MeToo-Regelverstoß. In einem Zeitschriftenartikel und in einem darauf aufbauenden Buch beschrieb die Journalistin E. Jean Carroll, dass Trump sie vor fast dreißig Jahren in einem Kaufhaus in Manhattan vergewaltigt hatte. Diese Anschuldigung war, zusammen mit der Liste weiterer Frauen, die sich seit 2016 gemeldet hatten – und Trumps berühmter Einlassung »Grab ’em by the pussy« –, gelinde gesagt, deutlich belastender als das, was praktisch alle Männer des öffentlichen Lebens, die in den zurückliegenden Jahren des Missbrauchs beschuldigt worden waren, zu Fall gebracht hatte. Trump war vermutlich die einzige Person des öffentlichen Lebens, die Vorwürfe sexueller Natur gesellschaftlich überlebte.
Nicht nur, dass nichts dergleichen je passiert war, er kannte diese Frauen nicht einmal – nicht eine einzige! Die Anschuldigungen, jede für sich, seien nichts als Lügen, und die von Carroll gehöre zu den absurdesten.
Seine Verteidigungstaktik lautete: Unglaube. Ach, das glauben Sie doch selber nicht, der prominenteste Kerl von New York schnappt sich wahllos eine alte Schachtel und zerrt sie in eine Umkleidekabine eines Kaufhauses auf der Fifth Avenue?
Trump war optimistisch. Er meinte, er hatte endlich einen Anwalt, der alles regelte: Joe Tacopina, von Boris ausgesucht – erst später war es Boris, der Tacopina geschickt beiseiteräumte. Tacopina war ein New Yorker Rechtsanwalt, den die Boulevardpresse (sprich die New York Post