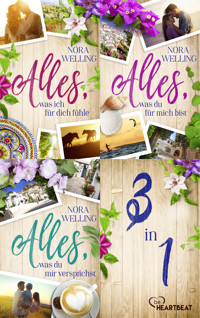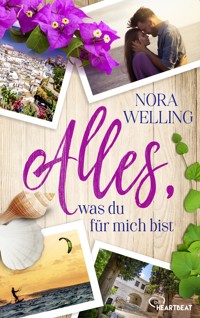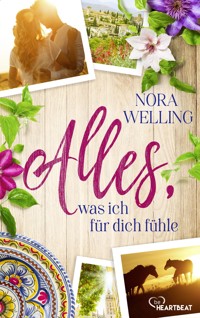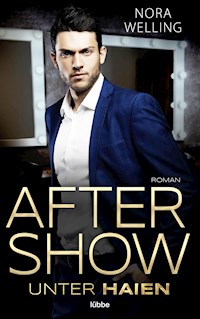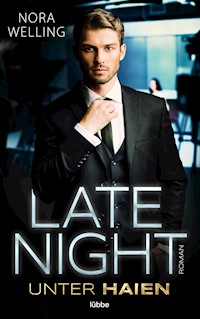4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Everything-for-You-Reihe
- Sprache: Deutsch
Nur die Liebe überwindet alle Hindernisse ...
Ramón, den mittleren der Álvarez-Brüder, trifft es hart, als er erfährt, dass seine Ehe kinderlos bleiben wird. Weil seine Frau Sophia sich ein Leben ohne Kinder nicht vorstellen kann, lässt sie sich scheiden. Ramón stürzt sich daraufhin ganz in die Arbeit als Tierarzt. Dann trifft er auf die Krankenschwester Amelie und ihren fünfjährigen Bruder Ben, die seinen Schutz brauchen, und er merkt, wie nach und nach ganz neue Gefühle in ihm wachsen. Doch Amelie hütet ein Geheimnis, das eine gemeinsame Zukunft unmöglich macht ...
Große Emotionen vor der traumhaften Kulisse Andalusiens - die EVERYTHING FOR YOU-Trilogie von Nora Welling:
Band 1: Alles, was ich für dich fühle
Band 2: Alles, was du für mich bist
Band 3: Alles, was du mir versprichst
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 439
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhalt
Liebe Leserin, lieber Leser,
herzlichen Dank, dass du dich für ein Buch von beHEARTBEAT entschieden hast. Die Bücher in unserem Programm haben wir mit viel Liebe ausgewählt und mit Leidenschaft lektoriert. Denn wir möchten, dass du bei jedem beHEARTBEAT-Buch dieses unbeschreibliche Herzklopfen verspürst.
Wir freuen uns, wenn du Teil der beHEARTBEAT-Community werden möchtest und deine Liebe fürs Lesen mit uns und anderen Leserinnen und Lesern teilst. Du findest uns unter be-heartbeat.de oder auf Instagram und Facebook.
Du möchtest nie wieder neue Bücher aus unserem Programm, Gewinnspiele und Preis-Aktionen verpassen? Dann melde dich für unseren kostenlosen Newsletter an: be-heartbeat.de/newsletter
Viel Freude beim Lesen und Verlieben!
Dein beHEARTBEAT-Team
Melde dich hier für unseren Newsletter an:
Über das Buch
Ramón, den mittleren der Álvarez-Brüder, trifft es hart, als er erfährt, dass seine Ehe kinderlos bleiben wird. Weil seine Frau Sofía sich ein Leben ohne Kinder nicht vorstellen kann, lässt sie sich scheiden. Ramón stürzt sich daraufhin ganz in die Arbeit als Tierarzt. Dann trifft er auf die Krankenschwester Amelie und den fünfjährigen Ben, die seinen Schutz brauchen, und er merkt, wie nach und nach ganz neue Gefühle in ihm wachsen. Doch Amelie hütet ein Geheimnis, das eine gemeinsame Zukunft unmöglich macht …
NORA WELLING
Alles,
was du
mirversprichst
Kapitel 1
Amelie
Das Auto stottert.
Nein, bitte nicht hier! Ich werfe einen Blick auf die altertümliche Straßenkarte, die ich gestern an einer Tankstelle in Frankreich gekauft habe. Das Knäuel aus blauen, weißen und roten Linien sagt mir reichlich wenig. Die Navigations-App meines Handys hätte mich mit Sicherheit längst ans Ziel geführt, aber das liegt in einer Bahnhofsmülltonne in Ingolstadt.
»Was klingt da so komisch, Lili?« In Bens Stimme vibriert Furcht und Ungeduld. Er hat genug. Kein Wunder. Fünfjährige Jungs wollen springen und toben, nicht Tage und Nächte ununterbrochen auf der Rückbank eines altersschwachen Ford Fiesta verbringen.
»Ich weiß nicht, Kumpel.« Ich bemühe mich, mir meine Sorge nicht anmerken zu lassen. Seit bestimmt zwei Stunden halte ich Ausschau nach einer Tankstelle. Nicht einmal an Dörfern sind wir zuletzt vorbeigekommen. Nur Weinstöcke und Olivenhaine und hier und da ein einsamer Bauernhof. Bitte, lass es nicht den Motor sein!
Ich presse die Lippen aufeinander. Als hätte Flehen jemals geholfen. Egal, wie sehr ich das Gaspedal an den Boden nagle, das Auto wird immer langsamer. Dann ertönt ein leiser Knall, und der Motor verstummt. Lautlos rollt der Wagen die letzten Meter, bis er zum Stehen kommt.
»Verdammte Kackscheiße!« Ich schlage mit der flachen Rechten aufs Lenkrad. Anschließend vergrabe ich mein Gesicht in den Händen. Ich mag nicht mehr.
»Verdammt sagt man nicht. Und Kackscheiße auch nicht«, piepst es von der Rückbank.
Seufzend hebe ich den Kopf und werfe einen Blick über die Schulter nach hinten. Es spielt keine Rolle, ob ich mag oder nicht. Ich muss. Ich habe mir diese Suppe eingebrockt, jetzt bleibt mir nichts anderes übrig, als sie auszulöffeln, und dort, auf der Rückbank, sitzt der Grund, der jede beschissene Strapaze wert ist. Ich kann nur hoffen, dass mein Lächeln nicht so gequält aussieht, wie es sich anfühlt. »Manchmal darf man es sagen, Winzling.«
Bens Augen sind groß vor Skepsis. »Warum?«
»Weil es manchmal kein anderes Wort gibt, das die Situation beschreibt.«
»Ich hab Hunger«, jammert Ben. »Und ich will ins Bett. Du hast gesagt, wir machen Urlaub, aber alles, was wir machen, ist, in diesem scheiß Auto zu sitzen.«
»Hey! Hör auf zu fluchen. Scheiß sagt man nicht.« Ich zwinkere ihm zu, um dem Tadel den Biss zu nehmen, aber bei meinem Bruder kommt die Beschwichtigung nicht an. Er wird ganz klein zwischen den Decken und Kissen auf der Rückbank, zieht die Knie an den Körper und schlingt die Arme herum.
»Aber gerade hast du gesagt …«
»Ich weiß, was ich gesagt habe.« Resigniert reibe ich mir die brennenden Augen. Auch ich bin hungrig und müde. Und offenbar gelingt es mir nicht, meinen Frust zu verbergen, denn im nächsten Moment höre ich sein unterdrücktes Schluchzen. Der Blick in den Rückspiegel bricht mir das Herz. Mein kleiner Bruder hält sich die Faust vor den Mund, um sein Weinen zu unterdrücken. Er hat gelernt, was es bedeutet, laut zu sein und die Erwachsenen zu verärgern.
Fuck! Ein Stich fährt mir durch die Brust. Ich atme gegen die plötzliche Enge in meiner Kehle an. »Okay, Winzling. Wir machen das jetzt so. Ich guck, ob ich im Kofferraum für uns was zu essen finde, ja? Ein paar Snacks oder so. Mit denen können wir ein kleines Picknick machen. Mit etwas Glück hat sich der Motor danach abgekühlt, und wir können weiterfahren. Was meinst du? Wie klingt Schokolade zum Abendessen?«
Ben antwortet nicht. Ich kann es ihm nicht verübeln, wenn er mir gerade nicht vertraut. Seine ganze Welt ist in der vergangenen Woche aus den Fugen geraten. Es wird Zeit, dass wir endlich ein Ziel erreichen.
Ich klettere aus dem Auto und mache mich am Kofferraum zu schaffen. Ich weiß ganz genau, dass dort keine Schokolade mehr ist. Im besten Fall finde ich ein paar zerkrümelte Doppelkekse oder einen aufgeweichten Sandwichrest. Für ein anständiges Picknick reicht es auf jeden Fall nicht. Keine Ahnung, worauf ich hier hinten hoffe. Göttliche Eingebung vielleicht. Oder ein Wunder. Weniger bringt mich momentan nicht weiter.
Ich schüttle noch über mich selbst den Kopf, als wie aufs Stichwort ein Auto auf der Hügelkuppe erscheint. Ich kann die Farbe nicht erkennen, denn die Abendsonne taucht die ganze Umgebung in einen senfgelben Schleier. Nur am Himmel mischen sich Töne von Gold, Ocker und Orange in das weiche Licht.
Um besser sehen zu können, schirme ich die Augen mit einer Hand ab. Es ist ein Pick-up-Truck, der die Straße herunterkommt, auf uns zu. Mein Herz klopft vor Aufregung. Der Wagen bleibt direkt hinter mir stehen! Ich habe von Überfällen auf Touristen in Spanien gehört, und niemand kann wissen, dass bei Ben und mir nun wirklich nichts zu holen ist. Dabei wären gemeine Straßendiebe noch das geringste Übel. Dem Schatten hinter der Windschutzscheibe nach zu urteilen, ist der Fahrer ein Mann. Scheiße! Was, wenn Elhans Kumpels uns schon ausfindig gemacht haben? Dann war die ganze Verschleierungstour mit den Zugtickets, dem weggeworfenen Handy und dem Umweg über Italien für nichts und wieder nichts gewesen. Ist irgendwas in diesem Kofferraum, womit ich mich wehren kann? Eine volle Flasche Limo oder ein Föhn, den ich als Waffenattrappe benutzen kann? Nein, da ist nichts, und außerdem, wen sollte bitte schön ein Föhn einschüchtern? Soll ich Fersengeld geben und versuchen zu fliehen? Dann fällt mir ein, dass der scheiß Motor von dem scheiß Auto verreckt ist, und eher würde ich mir das eigene Herz aus der Brust reißen, als Ben allein zurückzulassen. Nein. Meine beste Chance ist, zu bleiben und zu hoffen. Vielleicht ist ja auch alles gar nicht so schlimm, und wer auch immer in dem Pick-up sitzt, hat nur angehalten, um mir zu helfen. Angeblich soll es irgendwo auf der Welt noch Gentlemen geben. So selten wie frei lebende Glitzereinhörner vielleicht, aber es soll sie geben!
Die Fahrertür öffnet sich. Zuerst sehe ich nur die Spitze eines braunen Cowboystiefels, gefolgt von einem Jeansbein. Ich halte die Luft an. Das, was an dem Jeansbein noch so dranhängt, sieht ziemlich gut aus. Ich atme leise aus. Nicht dass es auch attraktive Ganoven gibt, aber der hier hat irgendwas an sich, das in mir ein eigenartiges Gefühl von Vertrauen erweckt.
»Necesita ayuda?« Zuerst mal wirkt er nicht böse. Seine Stimme klingt dunkel und melodisch, und er hat freundliche Augen. Kleine Lachfältchen lassen darauf schließen, dass er öfter lächelt als schimpft. Er ist größer als die meisten Spanier, die ich bisher getroffen habe. Eins fünfundachtzig, mindestens, und er bewegt sich mit der lässigen Eleganz eines Panthers. Dazu passt auch das glänzende Schwarz seiner Haare, die er in einem ordentlichen Kurzhaarschnitt trägt. Nur über den Ohren sind sie etwas aus der Fasson geraten und kringeln sich zu niedlichen Locken. Soweit ich es beurteilen kann, klingt sein spanischer Akzent echt. Der kurze, gepflegte Vollbart macht es schwer, sein Alter zu schätzen. Müsste ich mich festlegen, würde ich auf Mitte bis Ende dreißig tippen. Aber gut in Schuss. Muskulöse Oberarme dehnen den Stoff seines T-Shirts. Die Farbe mochte einmal Blau gewesen sein, jetzt ist sie eher ein ausgewaschenes Blaugrau. Ein grober brauner Gürtel mit schwerer Schnalle lenkt den Blick auf seine schmale Hüfte.
Plötzlich wird mir ganz schwummrig. Ich meine, kein Wunder, ich habe seit gestern Mittag nichts mehr gegessen. Warum sonst sollte mein Körper so reagieren? Aber auf einmal würde ich mich wirklich, wirklich gerne irgendwo anlehnen. An diese feste, breite Brust zum Beispiel. Meinetwegen auch an seinen Rücken.
Noch einmal sagt er etwas auf Spanisch, und erst da wird mir klar, dass ich ihn angestarrt habe.
Ich schüttle den Kopf, um mich zu sammeln. Himmel noch mal, wo kamen diese Gedanken denn her? »Entschuldigung«, stammle ich. »Excuse me. I don’t speak Spanish.«
»No problem.« Wenn er lächelt, blitzen seine Zähne auf. Ganz weiß und gesund. Sein Englisch ist mindestens so gut wie meines. »Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Sieht aus, als hätten Sie ein Problem.«
»Oh Gott, ja!« Nicht nur ein Stein, ein ganzer Geröllhaufen fällt mir vom Herzen. Keiner von denen, die ich fürchte, würden mir so nett Hilfe anbieten. »Ich bin auf dem Weg zu einer Freundin. Aber ich habe mich verfahren. Sie muss hier irgendwo in der Nähe wohnen. Moment, ich kann es Ihnen gleich sagen.« Ich drehe ihm halb den Rücken zu und fische von der Mittelkonsole im Wagen den Zettel, auf den ich die Adresse geschrieben habe. Das Papier ist vergilbt und zerknittert. »Hier. Die Adresse lautet Hacienda de los Caballos Blancos. Sagt Ihnen das etwas?« Meine Zunge stolpert über den spanischen Namen. Laut Google-Übersetzung bedeutet der Name »Landgut der weißen Pferde«. Sehr poetisch. Und ziemlich passend, wenn man bedenkt, dass es sich um ein Gestüt handelt. Weil ich befürchte, dass mein Akzent die Wörter zu einem unverständlichen Brei vermischt, halte ich dem Fremden das Stück Papier unter die Nase und garniere die Geste mit einem Lächeln. Die meisten Männer mögen mein Lächeln. Meine Mutter hat mir früh beigebracht, dass mein Körper so ziemlich das Einzige ist, was Frauen wie sie und ich Vertretern des anderen Geschlechts zu bieten haben. Auch wenn ich es heute besser weiß, sitzen die alten Überzeugungen tief.
Bei meinem Retter verfehlt mein Charme seine Wirkung. Sein Lächeln erstirbt, er runzelt die Stirn. »Ich kenne die Hacienda.« Er reicht mir den Zettel zurück.
»Ist es noch weit? Sehen Sie, es ist so: Ich glaube, mir ist das Benzin ausgegangen. Aber der Motor hat auch so einen komischen Knall von sich gegeben. Knallen Motoren, wenn sie kein Benzin mehr haben? Ich habe keine Ahnung!« Hilflos hebe ich die Schultern. »Und wir sind schon echt lange unterwegs. Ich würde mir ja ein Taxi rufen, aber ich habe kein Handy dabei und …« Den Rest des Satzes lasse ich ins Nichts verlaufen. Es fällt mir nicht einmal mehr schwer, die doofe Blondine zu spielen. Ich weiß nämlich wirklich nicht, was ich sonst noch sagen kann. Je mehr Details ich preisgebe, desto wahrscheinlicher ist es, dass der Typ sich später an mich erinnern wird, und das ist das Letzte, was ich will.
»Sie sagen, eine Freundin erwartet Sie dort?«
»Ja! Sie heißt Linda Grünfelder. Kennen Sie sie? Sie ist so nett! Sie hat uns eingeladen. Und weil wir gerade nichts anderes zu tun hatten, haben wir uns gedacht: Warum diese Ferien nicht einfach in Spanien verbringen? Das Timing war perfekt.«
»Ah.« Er sieht aus, als glaube er mir kein Wort. Doch dann fällt sein Blick auf das Rückfenster des Fiesta. Die Sonne verwandelt die Scheiben in bronzefarbene Spiegel. Nur schemenhaft zeichnet sich im Inneren der Umriss eines kleinen Jungen ab, der verschreckt versucht, in sich selbst zu verschwinden. Einen Moment lang zerquetschen mir Schuldgefühle die Brust. Wenn ich nicht so an ihm hängen würde, wenn ich ihn hätte freigeben können, so wie man angeblich alles freilassen muss, was man wirklich liebt, hätte Ben womöglich niemals lernen müssen, was es bedeutet, um sein Leben zu bangen. Doch was geschehen ist, ist geschehen. Für Reue habe ich keine Zeit.
Ich richte meine Aufmerksamkeit wieder auf den Pick-up-Mann. Auch ihn lässt Bens Anblick offenbar nicht kalt. Meine Geschichte ist löchrig wie ein Schweizer Käse, aber er scheint gewillt, die Sache vorerst auf sich beruhen zu lassen. »Ich kann Sie mitnehmen«, sagt er schließlich knapp. »Das Kind sieht müde aus. Es gehört in ein ordentliches Bett.«
Was du nicht sagst, Sherlock. Nur mit Mühe verkneife ich mir eine bissige Bemerkung. Rein nüchtern betrachtet hat er natürlich recht. Ben gehört in ein Bett. Optimalerweise nach einem vernünftigen Abendessen und einer erfrischenden Dusche. Alle drei Annehmlichkeiten haben wir seit Tagen nicht mehr genossen.
»Das ist wirklich nett von Ihnen. Ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen danken soll.«
»Sie müssen mir nicht danken. Ich mache, was jeder in meiner Situation tun würde. Holen Sie das Kind, und steigen Sie bei mir ein. Ich lege Ihr Gepäck auf die Ladefläche, und dann wollen wir mal sehen, was Linda zu Ihrer Ankunft sagt.«
Ja, darauf bin ich auch gespannt. Linda Grünfelder ist nämlich keineswegs eine supergute Freundin von mir. Realistisch betrachtet ist sie nicht einmal eine Bekannte. Wir haben uns genau einmal gesehen. Vor gut einem Jahr habe ich Lindas Schwester Wiebke während einer gemeinsamen Reise der Schwestern von Deutschland nach Spanien als Krankenschwester betreut. Wiebke ist seit einem Unfall als Kind mehrfach behindert. Mit ihr zu reisen erfordert viel Unterstützung, und um die zu leisten, hatte Linda mich über eine Pflegeagentur engagiert. Damals war sie nett und zugänglich, und ihre Augen blickten auf eine Art wissend in die Welt, die nahelegte, dass auch sie nicht immer auf der Sonnenseite des Lebens gestanden hatte. Das ist alles, was ich über sie weiß. Dennoch bin ich drauf und dran, mein und Bens Schicksal in die Hände dieser Frau zu legen.
Ramón
Irgendwas stimmt nicht mit der Frau, und das liegt nicht nur an ihrem derangierten Äußeren. Sie trägt eine ausgeblichene schwarze Jeans und ein graues T-Shirt. Unter den Armen zeichnen sich Schweißflecken ab. Ihre Haare sind zu einem unordentlichen Knoten auf dem Kopf aufgetürmt. Zahlreiche Strähnen haben sich gelöst und kringeln sich nun in wilden blonden Löckchen ums Gesicht. Wo auch immer sie und das Kind herkommen, sie sind eindeutig schon länger unterwegs. Laut Kennzeichen ist der Wagen in Deutschland zugelassen, und mich würde es nicht wundern, wenn sie von dort in einem Rutsch durchgefahren wären. Und das alles wegen einer Einladung von Linda? Linda und mein Bruder Damián sind vor gerade einmal zwei Wochen Eltern geworden. Seither schwelgen sie im Babyglück. Selbst wir bekommen die kleine Familie kaum zu Gesicht. Und ausgerechnet jetzt soll sie eine Freundin auf die Hacienda eingeladen haben? Eher nicht.
Ich sehe zum Wagen. Der Oberkörper der Frau steckt im Fahrzeuginneren, und es wirkt, als würde sie auf das Kind einreden. Durch die Scheibe kann ich erahnen, wie der oder die Kleine immer wieder den Kopf schüttelt. Die Fremde gestikuliert, tritt von einem Bein aufs andere, und ich kann nicht anders, als zu bemerken, dass das ein ziemlich einladender Hintern ist, der da in der engen Jeans steckt. Rund und prall und groß genug, damit ein Mann die Hände genüsslich darin vergraben kann. Überhaupt ist alles an ihr üppig und rund. Die Brüste, die Beine, die Schultern, der Bauch. Ich habe die Männer ja noch nie verstanden, die zwar nichts gegen volle Brüste und einen runden Hintern haben, aber die Nase rümpfen, wenn Beine und Bauch dann zum Rest des Körpers passen. Proportionen sind wichtig. Und die Proportionen dieser Frau hätten selbst Rubens den Mund wässrig gemacht.
Perversling, schelte ich mich selbst. Sie hat eine Autopanne, und du glotzt ihr auf den Hintern? Sehr nobel. Um mich um das Gepäck zu kümmern, will ich eben den Kofferraum ihres Wagens öffnen, da tut sich etwas an der Hintertür. Die Fremde richtet sich auf. Sie tritt einen Schritt zurück, und ihr folgt ein winziges Persönchen ins Freie. Ein Junge, etwa hüfthoch, mit raspelkurz geschnittenem Haar, das ihm in verschwitzten Stacheln vom Kopf absteht. Das Blond des Kindes ist ein paar Farbtöne dunkler als das der Frau, doch in der herzförmigen Form ihrer Gesichter erkenne ich eine gewisse Ähnlichkeit. Hinter den Gläsern einer runden Nickelbrille wirken die Augen des Jungen riesengroß. Er schaut sich unsicher um. Im Arm hält er ein Stoffpferdchen. Der schwarz-weiße Plüsch ist zerfranst, die gelbe Mähne verfilzt, aber der Kleine drückt das Spielzeug so fest an die Brust, als könnte es ihn vor allem Bösen der Welt beschützen.
Oh Cariño, denke ich, ich weiß Bescheid. Ich kann mich noch zu gut erinnern, wie es sich anfühlt, klein und schüchtern zu sein. Einem Impuls folgend trete ich auf die beiden zu und strecke die Hand nach dem Kleinen aus. »Hola, Amigo. Mi nombre es Ramón. Cuál es tu nombre?«
Den Vorstoß hätte ich mal lieber gelassen. Ein Laut entfährt dem Jungen, wie das Maunzen eines Kätzchens, und er versteckt sich hinter den Beinen seiner Mutter.
Die wirft mir ein entschuldigendes Lächeln zu. »Er meint es nicht böse«, sagt sie auf Englisch.
»Natürlich nicht.« Lächelnd zucke ich mit den Schultern. »Er ist ein Kind.« Am Körper seiner Mutter vorbei will ich ihm ein Zwinkern schicken, aber ich habe keine Chance. Das süße Kindergesicht ist fest in der Seite seiner Mamá vergraben, und trotz meiner Beschwichtigung scheint auch ihr die Situation unangenehm zu werden. In ihr Lächeln mischt sich eine Spur Nervosität.
»Sein Name ist Ben. Und, ach Gott, wo bleiben denn meine Manieren?« Kurz hält sie sich die Hand ans Herz. »Ich habe mich ja auch noch gar nicht vorgestellt. Ich bin Amelie. Nett, Sie kennenzulernen.« Von der Brust wandert die Hand in den Raum zwischen uns. Wie aus dem Nichts schießt mir das Bild durch den Kopf, wo diese Hand gerade gelegen hat und wie gerne ich das für sie erledigt hätte. Vorzugsweise ohne den trennenden Stoff zwischen meinen Fingern und diesen Brüsten. Ein Stöhnen will mir aus der Brust hochsteigen, aber ich schlucke es herunter. Bevor meine Fantasie noch mehr außer Kontrolle gerät, zensiere ich den mentalen Porno und nehme den Gruß an. Ihre Hand verschwindet vollkommen in meiner. Jetzt, von Nahem, fällt mir auf, dass sie jung ist. Verdammt jung. Mitte zwanzig höchstens. Wenn der Kleine ihr Sohn ist, muss sie sehr früh Mutter geworden sein. Ich halte ihre Hand fest und starre auf das Muttermal über ihrem rechten Mundwinkel. Dios mío, diese Frau ist die reinste Versuchung. Wenn mich noch vor einer Stunde jemand gefragt hätte, mein Idealbild einer Frau zu beschreiben, hätte ich genauso gut ein Foto von ihr herzeigen können. Nur dass die Frau meiner Träume mindestens zehn Jahre älter gewesen wäre. Und mit Sicherheit nicht allein mit einem vollkommen verschüchterten Kind unterwegs.
»Danke noch einmal, dass Sie uns helfen wollen.« Ihre Stimme reißt mich aus meinen Gedanken.
»Keine Ursache.«
Nachdrücklich löst sie die Hand aus meiner und tritt einen Schritt zurück. Noch deutlicher könnte sie nicht machen, dass dieser Gruß schon viel zu lange gedauert hat. »Ich mache Ihnen den Kofferraum auf. Ich habe ein bisschen chaotisch gepackt, aber wenn wir wenigstens die große Taschen mitnehmen könnten, wäre das prima. Der Rest kann im Auto bleiben, bis ich einen Pannendienst angerufen habe.« Nervös sprudelt es jetzt aus ihr hervor. Als würde sie versuchen, den Sinn der Worte hinter der schieren Menge zu verbergen. »Ich glaube, es ist nur der Tank. Vielleicht würde auch schon ein Reservekanister genügen, um das Ding wieder flott zu bekommen. Ich habe keine Tankstelle gefunden, und plötzlich ist der Motor ausgegangen. Aber wenn ich ehrlich bin, kann es alles Mögliche sein. Ich kenne mich mit Autos nicht aus.« Während sie spricht, versucht sie, Ben ein wenig zur Seite zu schieben. Beide sind verschwitzt, und obwohl sich der Tag längst dem Abend zuneigt, ist die Hitze im Hinterland der Costa de la Luz noch immer beachtlich. Der Junge will von ihren Bemühungen nichts wissen. Er klammert sich an ihre Oberschenkel und beginnt leise zu weinen. Ich habe genug. In wenigen Schritten bin ich beim Pick-up und öffne die Beifahrertür.
»Machen Sie es sich schon mal bequem«, fordere ich die beiden auf. »Da drinnen haben sie wenigstens eine Klimaanlage. Ich bin gleich bei Ihnen. Um das Auto kümmern wir uns später.«
Sie beugt sich zu Ben hinunter, sagt etwas auf Deutsch, und ich mache mich an die Arbeit. Im Kofferraum erwartet mich ein Chaos aus Klamotten und Plastiktüten. Falls die große Reisetasche unter dem Kleiderberg einmal ordentlich gepackt war, muss das eine ganze Weile her sein. Jetzt ist der Reißverschluss offen, und einzelne Kleidungsstücke quellen daraus hervor. Um die Tasche herum liegen getragene Wäsche, eine Plastiktüte mit leeren Kekspackungen und mehreren geleerten PET-Wasserflaschen. Ich stopfe die Kleidungsstücke zurück in die Reisetasche, schließe den Reißverschluss und angle von der Rückbank die beiden Wolldecken sowie die Kissen, die ich dort finde. Die Tasche werfe ich auf die Ladefläche des Pick-ups, die Decken und Kissen nehme ich mit in die Fahrgastkabine. Amelie sitzt auf dem Beifahrersitz und ist bereits angeschnallt. Mit geschlossenen Augen und einem versonnenen Lächeln richtet sie das Gesicht in den Luftstrom der Klimaanlage. Den Jungen hält sie auf dem Schoß. Er hat aufgehört zu weinen, aber seine Wangen sind noch immer tränennass.
»Die hier werden hinten nur staubig.« Mit dem Kinn deute ich auf die Decken und Kissen auf meinem Arm, ehe ich sie zwischen mich und Amelie auf die Bank quetsche.
»Danke.«
Ben zupft an der Ecke von einer der Wolldecken, verknüllt sie in seiner kleinen Faust und hält sie sich schniefend unter die Nase. Meine Finger kribbeln, so gerne würde ich ihm den Kopf streicheln und ihm versichern, dass alles gut wird. Dass er der Welt nur noch ein bisschen Zeit geben muss, dann wird sie sich auch für ihn öffnen und etwas von ihrer Bedrohung verlieren. Aber wir teilen ja noch nicht einmal eine Sprache, in der ich ihm das sagen könnte, ganz abgesehen davon, dass es ziemlich übergriffig wäre.
Ich starte den Motor, werfe noch einmal einen Blick auf Mutter und Kind. Selbst wenn ich die Story von dem Babybesuch bei Linda geglaubt hätte, das Chaos in Amelies Wagen spricht eine andere Sprache. So packt man nicht für einen geplanten Urlaub. Es gibt hunderttausend Fragen, die ich dieser Fremden stellen sollte. Wer ist sie? Woher kommen sie und das Kind? Was will sie von meiner Familie?
Aber jedes Mal, wenn ich mir eine Frage zurechtlege, fällt mein Blick wieder auf den kleinen Jungen. Auf die großen braunen Augen hinter der verbogenen Brille, auf die hitzeroten Wangen und die dünnen Ärmchen, die sich so verzweifelt um das Stofftier klammern. Auf die Art, wie er Trost und Sicherheit in der Vertrautheit einer geliebten Kuscheldecke sucht, und meine Zunge weigert sich, Amelie zur Rede zu stellen.
»Ist er krank?«, höre ich mich stattdessen fragen. »Er sieht ziemlich mitgenommen aus.«
Amelie schüttelt den Kopf. »Er ist nur müde. Und durstig. Uns sind die Getränke ausgegangen, und …« Sie beißt sich auf die Unterlippe, unterbricht sich. Was auch immer sie sagen wollte, offenbar geht es mich nichts an.
»Hier.« Im Fußraum angle ich nach einer Wasserflasche und reiche sie ihr über den Deckenberg hinweg. »Wenn es Ihnen nichts ausmacht, dass ich auch schon daraus getrunken habe, kann er es haben.«
»Das kann ich nicht verlangen.« Die Flasche schwebt zwischen uns.
»Sie verlangen nicht. Ich biete an.«
Sie fixiert die Flasche, presst die Lippen zusammen. Ich sehe, dass sie etwas erwidern will, aber irgendetwas hält sie zurück.
»Dios mío!«, bricht es aus mir heraus. »Es ist ein Schluck Wasser für ein durstiges Kind! Das würde ich selbst dem Kind meines ärgsten Feindes anbieten.«
Meine Worte zeigen Wirkung. Plötzlich greift sie hastig nach der Flasche, dreht den Schraubverschluss ab und hält die Öffnung an Bens Mund. Wieder spricht sie auf Deutsch mit ihm. Es klingt nach einer Aufforderung, vielleicht auch nach einer Versicherung. Ein paarmal irrt der Blick des Kleinen skeptisch zu mir. Am Ende siegt sein Durst. Er trinkt in hastigen Schlucken. Sogar das Stoffpferdchen lässt er los, um sich die Flasche besser an die Lippen halten zu können. Ein paar Tropfen Wasser rinnen ihm aus den Mundwinkeln. Ohne abzusetzen, leert er gut ein Viertel des restlichen Getränks. Mein Herz zieht sich zusammen. Was auch immer diese beiden nach Spanien führt, kein Kind sollte jemals solchen Durst haben. Es ist schon gut, dass sie ausgerechnet mir in die Arme gelaufen sind.
Kapitel 2
Amelie
Die Fahrt führt uns weiter zwischen Hügeln und entlang von Olivenhainen. Der Mann, der sich als Ramón vorgestellt hat, kurbelt die Fenster ein Stück weit hinunter, und mit dem Fahrtwind dringt würzige Sommerluft ins Wageninnere. Ich atme tief ein. Patienten haben mir erzählt, dass der Sommer im Süden ein eigenes Parfüm hat. Dort riecht er nach Pinien und Zypressen, Rosmarin, Oleander, reifen Feigen und Staub. Ich habe mir nie etwas darunter vorstellen können, und auch die letzten Tage haben mich nicht davon überzeugt, dass das Leben unter südlicher Sonne so viel Gutes zu bieten hat. Es war heiß und stickig, die Straßen eng oder, wenn man auf die Autobahnen ausweichen will, teuer. Die Hostels wirkten verstaubt und wenig vertrauenerweckend, sodass ich es vorgezogen habe, das wenige Geld, das ich noch habe, beisammenzuhalten und mit Ben im Auto zu campieren. Jetzt, in dem Pick-up eines Fremden, der uns nicht nur uneigennützig seine Taxidienste anbietet, sondern auch unglaublich süß zu Ben war, erlaube ich mir zum ersten Mal, die Faszination zu spüren, von der mir so viele vorgeschwärmt haben. Alles ist anders hier als zu Hause. Weiter, wärmer, weicher. Die Häuser kleiner. Die Weiden weiter. Selbst die Farben haben einen anderen Ton. Gedämpft von der Abendsonne wirken Bäume, Sträucher, sogar der Straßenasphalt wie in Gold getunkt. Die Olivenhaine lichten sich, stattdessen prägen jetzt weitflächige Koppeln den Ausblick. Eine Gruppe weißer Pferde steht beisammen und vertreibt mit den Schweifen Fliegen. Einige Tiere knabbern einander gegenseitig am Hals.
Ben zupft an meinem Ärmel. Ich dachte, er sei eingeschlafen, aber sein Blick ist wach aus dem Fenster gerichtet, der Mund steht staunend offen.
»Da«, formen seine Lippen, mit dem Zeigefinger deutet er auf die Pferde. Er war noch nie ein besonders lautes Kind, aber dass ihm noch nicht einmal beim Anblick der Tiere ein Freudenlachen entschlüpft, bricht mir das Herz. Es hätte niemals so weit kommen dürfen.
»Ja. Ich habe dir doch erzählt, dass wir auf einen Pferdehof fahren. Glaubst du mir jetzt?«
Wir erklimmen eine weitere Hügelkuppe, und auf einmal sehe ich sie vor mir. Die Hacienda. Als Linda mir erzählt hat, dass sie auf einem Gestüt lebt, habe ich mir trotz des großspurigen Namens eine Art Bauernhof vorgestellt. Selbst die Fotos, die sie mir auf dem Flug nach Spanien gezeigt und dann später per E-Mail geschickt hatte, konnten meine Vorstellung nicht korrigieren. Wie falsch ich damit lag! Burg trifft es viel eher. Vier Flügel, komplett mit Zinnen und rostroten Dachziegeln, bilden ein perfektes Viereck. Die Wände sind weiß und blenden in der Sonne. Selbst auf die Entfernung wirken sie dick genug, um einer ganzen Armada standzuhalten. Auch das wuchtige Portal, auf das Ramón zuhält, würde hervorragend zu einer Ritterburg passen, ebenso wie die gusseisernen Laternen, die rechts und links des Tors an der Mauer angebracht sind. Einladend wird das Ganze nur durch die großen Terrakottakübel neben dem Portal, in denen kleine Bäumchen gepflanzt sind. Wie kleine Sonnen blitzen Zitronen durch das Grün der Blätter. Ein bisschen weiter Richtung Hausecke rankt eine tiefrote Bougainvillea sich den gekalkten Putz empor. Zwischen Kiefern und Pinien erkenne ich weitere Gebäude. Manche kleiner, manche größer. Ställe, nehme ich an. Vielleicht eine Reithalle. Eines wirkt wie eine Kapelle und eines wie ein Verwalterhäuschen, das durch einen gepflasterten Weg mit dem Haupthaus verbunden ist.
»Wir sind fast da«, meint Ramón und holt mich aus meiner Versunkenheit. Das, was mir jetzt bevorsteht, wäre so viel einfacher, wenn das alles hier nicht so … großartig wäre. Das riesige Holzportal mit den geschnitzten Verzierungen scheint einzig dazu zu dienen, mich auszusperren. Jeder Stein dieses imposanten Anwesens schüchtert mich ein. Was mache ich hier eigentlich? Ich, Amelie Wolters, gehöre nicht auf eine Burg. Mein ganzes Leben lang habe ich in heruntergekommenen Wohnungen gelebt. Das Mosaik meiner Welt setzt sich aus vulgärem Graffiti im Aufzug, streitenden Nachbarn, geplatzten Mülltüten im Hausflur und dem stets herrschenden Geruch nach Speisen aus aller Herren Länder zusammen. Die ganze Zeit, die ganzen letzten Tage, seit ich Ben und unsere gesamte Habe in ein Auto gepackt habe, hatte ich nur ein Ziel vor Augen. Jetzt bin ich hier, und die Nervosität nimmt mir den Atem. Was, wenn Linda mich nicht erkennt? Was, wenn sie nicht mitspielt und mich sofort vom Hof werfen lässt? Was, wenn sie die Polizei ruft? Kurz kneife ich die Augenlider zusammen und versuche, mich zu beruhigen. Für Zweifel ist es zu spät.
»Ist …« Ich schlucke trocken. »Ist Linda zu Hause?«
»Wo soll sie sonst sein?« Er lenkt den Wagen auf einen Parkplatz und fischt ein Mobiltelefon von der Mittelkonsole. »Aber wie es aussieht, erwartet sie euch nicht. Ich rufe an. Dann kommt sie sicher gleich.«
»O…kay.« Nur mit Mühe kann ich es mir verkneifen, auf meinem Daumennagel herumzukauen. Eine Angewohnheit, die ich mir vor Jahren abgewöhnt habe, die aber immer dann zum Vorschein kommt, wenn ich nicht weiß, wohin mit meinen Gefühlen. Falls Ramón meine Unruhe bemerkt, lässt er sich nichts anmerken. Er wischt ein paarmal übers Display, dann hält er sich das Gerät ans Ohr, und schon kurz darauf rasselt ein Schwall spanischer Worte über seine Lippen. Erst jetzt fällt mir auf, dass er mir gar nicht gesagt hat, woher er Linda kennt.
Er beendet das Telefonat und wendet sich mir zu. »Sie ist gleich da. Sie können schon aussteigen.«
»Danke.« Etwas umständlich greife ich an Ben vorbei zur Autotür. Ich will ihn von meinem Schoß schieben, doch davon hält er ganz und gar nichts. Er klammert sich an mich wie ein Äffchen. Kurzerhand nehme ich ihn auf den Arm. Für einen Fünfjährigen ist er zierlich, trotzdem ist er kein Leichtgewicht mehr. Meine geschundenen Muskeln protestieren unter seinem Gewicht, und es kostet mich Mühe, mit ihm auf dem Arm aus dem Wagen zu klettern. Der Pick-up ist ordentlich hoch, und die Tür hätte wahrscheinlich schon vor Monaten geölt gehört. Ehe ich michs versehe, ist Ramón zur Stelle. In Lichtgeschwindigkeit hat er die Kühlerhaube umrundet und hält uns nun die Tür auf.
»Soll ich ihn nehmen?«
Ich schüttle den Kopf. »Besser nicht. Es geht schon.« Halb springe, halb klettere ich aus dem Wagen. Dabei komme ich Ramón nah genug, um die Wärme seines Körpers zu spüren. Ein herber, maskuliner Geruch geht von ihm aus. Männlich und erdig, nicht unangenehm. Mein Instinkt sollte mir raten, Abstand zu nehmen, aber das tut er nicht. Stattdessen muss ich gegen den Drang ankämpfen, mich an ihn zu lehnen und ihm einen Teil meiner Last abzugeben. Wie schön es wäre, Hilfe zu haben. Einmal nicht ganz auf mich allein gestellt zu sein. Himmel! Was denke ich da? Dieser Mann ist ein Fremder! Nicht nur Ben muss sich dringend ausruhen, auch um mich steht es offenbar echt schlecht, wenn mir schon solche Gedanken kommen.
Sicher mit beiden Beinen auf dem Boden angekommen, sehe ich mich ein wenig unsicher um. Was jetzt? Das Wiehern eines Pferdes klingt über das Gut. Irgendwo, weiter entfernt, läuft ein Fernseher. Aus der Richtung, wo ich die Ställe vermute, dringt das Plätschern von Wasser zu mir. Obwohl ich niemanden sehe, habe ich den Eindruck, dass dieser Hof belebt ist. Das hier ist keine stille Postkartenidylle, sondern ein von Leben erfülltes Gestüt.
Ich zeige mit dem Finger auf hübsche Details und benenne sie für Ben. »Schau mal dort, die Keramikfliesen. Da steht 1525. So alt ist das Landgut schon. Und hier, siehst du die hübschen Fensterläden? Solche habe ich zu Hause noch nie gesehen.« In meinem Bemühen, möglichst viel wahrzunehmen, drehe ich mich einmal fast komplett im Kreis, da taucht eine Frau im Tordurchgang auf. Im Halbdunkel bleibt sie stehen, legt eine Hand über die Augen, wahrscheinlich, um mich besser erkennen zu können. Hinter ihr, verborgen in den Schatten, steht ein Mann.
»Hallo?«, fragt sie in meine Richtung. »Mein Schwager meinte …«
Jetzt oder nie. »Linda!« Ich setze Ben auf den Boden, renne auf sie zu und falle ihr um den Hals. Sie versteift sich unter meiner Attacke, doch ich lasse nicht los. Ganz nah bringe ich meinen Mund an ihr Ohr. »Bitte!«, flehe ich so leise, wie ich kann. »Bitte, du musst uns helfen. Spiel einfach mit. Ich heiße Amelie, falls du dich nicht mehr erinnern kannst, und ich erkläre dir später alles.« Tausendmal habe ich mir die wenigen Sätze seit unserem Aufbruch zurechtgelegt. Zehntausendmal die Wörter hin- und hergewälzt. Jetzt kommen sie mir falsch und belanglos vor. Alles Blut rauscht mir aus dem Kopf. Es ist zu spät, es mir anders zu überlegen. Vorsichtig lockere ich die Umarmung, lasse Linda los und trete einen halben Schritt zurück. Wenn sie mich jetzt auffliegen lässt, ist alles vorbei.
Ramón
»Amelie, da bist du ja.« Selbst wenn ihre steife Körperhaltung und der irritierte Blick, der von unserem Neuankömmling zu Damián und zurück zu Amelie wandert, meine Schwägerin nicht verraten hätte, spätestens das Zittern in Lindas Stimme hätte es getan. Nervös tritt sie von einem Bein aufs andere und stößt ein verlegen klingendes Lachen aus. Schon gut, dass Linda Ärztin ist, als Schauspielerin hätte sie keine Karriere gemacht. »Ich habe ganz vergessen, dass ihr heute ankommt. Die Stilldemenz macht aus meinem Gedächtnis ein Sieb.«
Amelies Blick folgt dem von Linda zu Damián. In einem Bündel aus Decken hält mein Bruder den kleinen Ángel vor der Brust. »Du … hast ein Baby?«
»Das habe ich dir doch geschrieben.« Es klingt mehr wie eine Frage. »Sechzehn Tage alt und ganze zweiundfünfzig Zentimeter groß.« Aber sobald Linda über Ángel reden kann, beginnt sie vor Freude und Liebe zu glühen. Selbst in dieser Situation überstrahlt der Stolz auf ihren Sohn alles andere. Ein kurzer, beißender Schmerz fährt mir durch die Brust. Ich versuche, ihn zu ignorieren. Meinen großen Bruder als Papá zu sehen rührt mich. Das ist alles. Mit Eifersucht hat das nichts zu tun.
Amelie hebt den Kopf und macht einen halben Schritt auf Damián und Ángel zu, wie um sich das Baby genauer anzusehen. Der finstere Blick meines Bruders lässt sie jedoch innehalten. Sie weicht zurück. »Entschuldigung, ähm, Keime, ich verstehe. Aber herzlichen Glückwunsch. Ein Baby.«
»Warum gehen wir nicht erst mal rein?«, schlägt Linda vor. »Abendessen gibt es zwar erst in zwei Stunden, aber sicher seid ihr hungrig von der Fahrt. Als ich hier das erste Mal angekommen bin, war ich geradezu ausgehungert. Das heißt …« Sie unterbricht sich, sieht sich um, bis ihr Blick auf Ben fällt. »Ramón meinte, du hast einen kleinen Begleiter mitgebracht.« Der Junge hat sich keinen Zentimeter vom Fleck gerührt, seit Amelie ihn mehr oder weniger abgestellt hat, um auf Linda zuzueilen. Wie eine einzige Person wenden alle Erwachsenen ihm nun ihre Aufmerksamkeit zu. Erschrocken blickt er von einem zum anderen, dann drückt er das Gesicht so fest in das Stoffpony, dass seine Brille verrutscht.
Eine fremde Umgebung kann ganz schön furchteinflößend sein. Vor allem wenn man klein ist und schüchtern und nicht einmal versteht, was über einen gesagt wird. Alles in mir schreit danach, zu ihm zu gehen und ihm zu versichern, dass er keine Angst zu haben braucht. Niemand hier will ihm etwas Böses tun. Aber ich bezweifele, dass mein Freundschaftsangebot willkommen wäre. Noch nicht, protestiert mein Unterbewusstsein. Also gut. Es ist noch nicht willkommen. Manche Dinge brauchen Zeit, und was nicht ist, kann noch werden.
»Das ist Ben.« Mit Linda im Schlepptau geht Amelie zurück zu dem Jungen. Meine Schwägerin sagt etwas auf Deutsch, und ich verspüre einen Hauch Genugtuung, dass er auf sie ebenso zurückhaltend reagiert wie auf mich.
Damián bleibt zurück, als die Frauen mit dem Kind in Richtung Haus verschwinden. Ich will an ihm vorbeigehen, aber er hält mich am Arm zurück.
»Was soll das?«, zischt er. Seine Finger sind verdammt kräftig. Ich spüre jeden einzelnen in meinem Bizeps. »Warum schleppst du eine Fremde ins Haus?«
»Sie ist eine Freundin von Linda.«
»Und ich bin der Papst!«
»Dann solltest du schleunigst deine Sünden beichten, Heiliger Vater, denn das mit dem Keuschheitsgelübde scheint nicht ganz geklappt zu haben, wenn ich mir dein Leben so ansehe.«
Damiáns Mundwinkel zucken, nur kurz. Schnell spreche ich weiter. »Was hätte ich tun sollen, Damián? Sie stand in der Hitze am Straßenrand und hatte eine Panne. Sie und der Junge sehen aus, als hätten sie Tage im Auto verbracht, und sie hatte einen Zettel mit Lindas Namen und der Adresse der Hacienda dabei. Hätte ich sie dort stehen lassen sollen?«
»Sie und das Kind sind keine mutterlosen Kätzchen, Ramón. Du kannst nicht jede verlorene Kreatur retten.«
Ich verdrehe die Augen. Das ist sie, die ewige Leier. Entgegen seinem missratenen Scherz gerade hält mein werter Herr Bruder nämlich nicht sich selbst, sondern in Wahrheit mich für einen Heiligen. Zu gut für diese Welt oder, mit den Worten unseres Vaters ausgedrückt, zu weich. »Als ich dich das letzte Mal überredet habe, eine gestrandete Reisende aufzunehmen, ist das ganz gut für dich ausgegangen, meinst du nicht?« Fragend lege ich den Kopf schief.
Endlich lässt er meinen Arm los, und diesmal macht das Lächeln auch nicht nur eine Stippvisite auf seiner Miene. Mag er sich doch in der Vorstellung sonnen, er sei der harte Kerl unter den drei Álvarez-Brüdern. In Wahrheit ist er auch nur ein Mann, der seine Familie liebt. Wen er einmal ins Herz geschlossen hat, auf den lässt er nichts mehr kommen. Am wenigsten auf seine geliebte Linda.
»Das ist etwas ganz anderes. Linda hat uns nie belogen. Sie hat von Anfang an mit offenen Karten gespielt. Jeder wusste von der ersten Minute an, aus welchem Grund sie hierhergekommen ist. Was weißt du über diese Amelie? Hat sie überhaupt einen Nachnamen? Und wer sagt, dass Amelie ihr richtiger Name ist?«
»Solange wir hier herumstehen und streiten, werden wir gar nichts erfahren.«
Dagegen kann selbst Damián nichts einwenden. Langsam folgen wir den Frauen und Ben ins Haus. Linda hat die Neuankömmlinge in die Küche gelotst. Dort sitzen sie jetzt am Küchentisch, wie zwei Delinquenten auf der Strafbank. Wie eine Glocke aus Smog umhüllt sie Unbehagen.
Linda ist damit beschäftigt, Milch zu erwärmen. Von unserer Haushälterin, Montserrat, fehlt jede Spur. Doch Linda hat kein Problem, ihren Platz auszufüllen. Sie bewegt sich mit einer Selbstverständlichkeit in der Küche, die zeigt, wie zu Hause sie sich längst hier fühlt. Fünfzehn Monate ist es her, da war sie die Fremde in unserem Haus. Seither ist viel passiert. Vieles hat sich zum Guten gewendet. Nicht nur Damián und Linda, auch unser jüngster Bruder, Luís, und Montserrats Tochter Nuria haben ihr Glück gefunden. Nur für mich ist es in letzter Zeit stets bergab gegangen. Nicht dass ich meinen Brüdern ihr Liebesglück nicht gönne, aber manchmal … Ausgerechnet ich, der immer der Bodenständigste von uns dreien war, hat bewiesen, dass er in Liebesdingen ein Verlierer ist.
»Kakao oder Honig?« Lindas Stimme erinnert mich daran, dass wir Gäste haben. Ihre Frage richtet sich an Ben. Der beißt sich auf die Unterlippe und sieht zu Amelie.
Die antwortet für ihren Sohn. »Kakao?« Auch ihre Antwort klingt eher wie eine Frage. Linda scheint das nicht zu irritieren. Sie rührt drei gehäufte Löffel Schokopulver in die warme Milch.
»Sonst noch wer?«
Damián und ich schütteln den Kopf. Auf dem Herd pfeift eine Cafétera. Offenbar hat Linda damit gerechnet, dass wir eher zu Kaffee tendieren. Sie stellt einen Becher Kakao vor Ben ab, gießt Damián und mir je einen Café solo ein und setzt sich mit einem zweiten Kakaobecher zu uns an den Tisch.
»Und deiner Freundin bietest du nichts an?«
»Oh, ich habe schon«, beeilt sich Amelie zu sagen. Vor ihr auf dem Tisch steht ein Glas Wasser. Außerdem hat Linda in Montserrats Vorräten Churros ausgegraben. Die können zwar nicht mehr ganz frisch sein, aber das macht nichts. Kein Kind der Welt kann der Verlockung des süßen Schmalzgebäcks widerstehen. Montserrat bestreut die Gebäckstangen mit einer dicken Schicht aus Zucker und Zimt. Erst knirscht die goldbraune Kruste des Gebäcks beim Hineinbeißen knusprig zwischen den Zähnen, dann entfaltet sich die würzige Süße, und tadaaa: das Paradies.
Um klarzustellen, dass die Süßigkeiten nicht zur Zierde da sind, greife ich mir zwei der Stangen. Dabei zwinkere ich Ben zu. »Eine für jede Hand«, flüstere ich verschwörerisch. Weil er meine Sprache nicht versteht, untermale ich die Worte mit einer Geste.
Als würde ihm das Wasser im Mund zusammenlaufen, leckt er sich mit der Zunge über die Lippen. Doch statt sich auf das Gebäck zu stürzen, blickt er fragend zu Amelie.
Ich schiebe den Teller in seine Richtung und mache eine große Show daraus, einen meiner Churros in den Kaffee zu tunken, ehe ich genüsslich davon abbeiße. Übertrieben verdrehe ich die Augen, ziehe Grimassen beim Kauen und mache laut vernehmlich »Mhhhmm« und »Ahhhh«.
Ben folgt jeder meiner Bewegungen mit den Augen, aber nicht einmal ein Lächeln bekomme ich aus ihm heraus. Mein Ehrgeiz ist geweckt. Ich wiederhole das Prozedere mit dem zweiten Churro. Jetzt habe ich in beiden Händen eine angebissene Süßigkeit. Gespielt erstaunt schaue ich von einer zur anderen, ziehe die Augenbrauen in die Höhe, als wäre mir eine Idee gekommen. Ratzfatz esse ich beide Stücke auf, beiße dabei immer abwechselnd von dem einen, dann wieder von dem anderen ab. Ich kaue übertrieben, schlucke schnell, als hätte ich Angst, ein unsichtbarer Süßigkeitendieb könnte mir die Köstlichkeiten stibitzen. Neben uns erörtern die Erwachsenen in einem Mischmasch aus Spanisch, Englisch und Deutsch die Frage, wo Amelie und Ben für die Dauer ihres Aufenthalts unterkommen sollen. Linda entschuldigt sich mehrfach für ihre Vergesslichkeit. Natürlich hatte sie angeblich vorgehabt, ein Quartier für ihre Gäste vorzubereiten, aber irgendwie sei ihr das vollkommen durchgerutscht. Amelie beteuert mehrmals, dass sie nur keine Umstände machen will. Sie und Ben würden auch mit Schlafsäcken auf dem Boden vorliebnehmen. Damián trägt nicht viel mehr als ein Grunzen hier und da zu der Unterhaltung bei.
Sollen sie planen, so viel sie wollen. Ich habe Spaß mit Ben. Entsetzt blicke ich auf meine leeren Hände und reiße die Augen auf. Da ist kein Gebäck mehr!, beschwere ich mich pantomimisch. Ich lasse Zeige- und Mittelfinger meiner rechten Hand über die Tischdecke in Richtung des Süßigkeitentellers marschieren. Dabei gucke ich mich mehrmals ängstlich um. Beobachtet mich auch niemand?
Und da passiert es. Ben reagiert auf mich. Kaum merklich schüttelt er den Kopf. Meine Finger marschieren weiter. Noch einen Schritt und noch einen, bis zu dem Tellerrand. Nach wie vor hat sich der Junge nicht von dem Gebäck bedient. Ich schnappe mir einen Churro, schirme mit der einen Hand meinen Mund ab, tue so, als müsste ich vor den anderen verheimlichen, dass ich im Begriff bin, mir nun schon den dritten Churro zu genehmigen. Auf halbem Weg zum Mund scheine ich es mir anders zu überlegen. Ich lasse die Stange eine Schleife durch die Luft fliegen, auf das Stoffpferdchen in Bens Arm zu. Ich halte dem Pony die Süßigkeit vor das Maul. Warte. Natürlich passiert nichts. Abwartend blicke ich mich um, dann klatsche ich mir die freie Hand an die Stirn und sage auf Englisch: »Oh nein! Pferde dürfen ja keine Süßigkeiten essen. Sonst bekommen sie Bauchweh. Ob Ben dem Pony helfen kann? Kleine Jungen bekommen kein Bauchweh von Süßigkeiten, oder?«
Beim Klang seines Namens weicht er ein Stückchen vor meiner Hand zurück. Ich werte das als gutes Zeichen. Dass er zurückweichen kann, bedeutet, dass er sich während meiner Aufführung nach vorne gelehnt hat. Geduldig hebe ich eine Augenbraue. Er zupft an Amelies Ärmel, fordert sie auf, sich zu ihm hinunterzubeugen, und flüstert ihr etwas ins Ohr. Sie antwortet. Ich schätze, sie wiederholt meine Worte. Auffordernd halte ich den Churro in Bens Richtung. Langsam, sehr langsam streckt er die Hand aus und nimmt ihn mir ab. Ich ziehe meine Hand zurück, lehne mich auf dem Stuhl nach hinten, gebe ihm Raum. Ich will ihn nicht bedrängen. Manchen fällt es leichter zu essen, wenn sie nicht beobachtet werden. Also wende ich mich meinem Kaffee zu und nehme den letzten Schluck aus der Tasse. Er ist nur noch lauwarm, und aufgeweichte Churro-Brösel schwimmen darin. Angewidert verziehe ich das Gesicht zu einer Grimasse. Aber sei’s drum. Ben beinah zum Lächeln gebracht zu haben ist diese kleine Unannehmlichkeit allemal wert.
»Ich bin der Meinung, am besten wären sie in Nurias Appartement untergebracht«, mischt sich Damián nun doch in das Gespräch der Erwachsenen ein. »Da haben sie zumindest Platz.«
»Du kannst Nurias Wohnung nicht jemand anderem versprechen, ohne sie vorher zu fragen.« Linda schüttelt genervt den Kopf.
»Aber sie ist doch sowieso immer bei Luís.«
»Trotzdem. Und bevor du jetzt den Westflügel vorschlägst: Nein! Die Wohnung von den Bereitern und Pflegern ist kein Ort für ein Kind. Du weißt, wie sie sind. Da wird jeden dritten Tag Party gemacht.«
»Warum quartiert ihr sie nicht in Papás alter Wohnung ein? Da sind sie für sich, haben ein eigenes Bad und etwas Privatsphäre, und jeder der beiden hat ein eigenes Zimmer«, schlage ich vor. Diese Unterhaltung dreht sich schon viel zu lange im Kreis. Es wird Zeit, dass endlich jemand eine Entscheidung trifft. Ich verstehe nicht viel von Kindern, aber so wie ich die Lage einschätze, wird es nach dem Kakao und den Süßigkeiten nicht lange dauern, bis die Müdigkeit Ben übermannen wird. Dann braucht das Kind ein Bett und Ruhe, und seiner Mutter scheint es nicht viel anders zu gehen. Je länger wir hier sitzen, desto mehr verschwindet die Fassade der toughen jungen Frau, und eine verletzliche Seite von ihr kommt zum Vorschein. Ihre Hautfarbe hat einen grauen Unterton angenommen, ihre Augen sind vor Erschöpfung ganz klein.
»Papás alte Wohnung?«, wiederholt Damián.
»Das ist eigentlich keine schlechte Idee.« Linda nickt. An Amelie gewandt erklärt sie: »Damiáns und Ramóns Vater lebt seit einem Sturz vor einigen Monaten im Pflegeheim. Davor hat sich eine Krankenschwester hier um seine Pflege gekümmert. Er hatte vor vielen Jahren einen Schlafanfall. Wir haben uns noch nicht um die Renovierung seiner alten Wohnung gekümmert. Natürlich ist dort alles auf die Bedürfnisse eines alten Mannes eingerichtet, nicht auf eine Mutter mit ihrem Kind …«
»Schwester.«
Wie auf Kommando halten wir plötzlich alle die Luft an. Erst da scheint Amelie aufzufallen, was sie gesagt hat. Sie senkt den Blick und zuckt hilflos mit den Schultern. »Ben und ich sind Geschwister. Halbgeschwister, um genau zu sein. Nicht Mutter und Kind.«
»Wie auch immer.« Linda klopft mit den Händen leicht auf die Tischplatte. »Ob Mutter und Kind oder Schwester und Bruder, in der Wohnung habt ihr es auf jeden Fall bequem für die Nacht. Und wie es weitergeht, besprechen wir am besten morgen.« Ehe irgendwer noch etwas erwidern kann, erhebt sie sich. »Ramón, bist du noch so lieb und holst ihr Gepäck? Und vielleicht kannst du dich auch darum kümmern, dass irgendwer ihr Auto abholt und hierherschleppt. Du weißt als Einziger, wo es ist.«
»Das hatte ich ohnehin vor.«
»Gut.« Sie legt Amelie eine Hand auf die Schulter und drängt sie mit sanftem Druck aufzustehen. »Dann haben wir das auch geklärt. Jetzt aber hopp. Wenn Ángel gleich aufwacht, will er trinken. Und glaubt mir, mein Sohn weiß es lautstark deutlich zu machen, wenn er mit der Schnelligkeit des Lieferservices an der Milchbar unzufrieden ist. Wenn es so weit ist, wollt ihr lieber schon in euren Zimmern sein.«
Amelie erhebt sich. Sie nimmt sich Zeit, jeden von uns einzeln anzuschauen. »Ich … ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ihr …« Sie schluckt. »Ihr habt uns echt gerettet.« Es ist eine Floskel, aber da ist so viel Ehrlichkeit in ihrer Stimme, dass ich mir sicher bin, bei ihr sind es mehr als leere Worte.
Kapitel 3
Amelie
Ich schwanke beim Aufstehen. Das kann kein Hunger sein. Der Kaffee hat meinen Magen beruhigt, und wirklich müde bin ich auch nicht. Noch immer summt Nervosität durch mein System. Linda hat meine drängendsten Sorgen – eine Unterkunft für die Nacht, etwas zu essen und zu trinken – beruhigt, und die Erleichterung gibt mir das Gefühl, als würde mein Körper drei Zentimeter über dem Boden schweben. Linda scheint meine Lage zu bemerken. Sie legt mir eine Hand auf den Rücken. Die Wärme der Berührung erdet mich. Sofort geht es mir wieder besser. Ben drückt sich an meine Seite.
»Von der Küche links und in der Halle dann hoch in den zweiten Stock«, navigiert mich Linda. »Das Haupthaus ist wie ein Viereck angelegt. Im Ostflügel haben die beiden älteren Brüder je eine Wohnung. Das Erdgeschoss gehört Damián und mir, im ersten Stock wohnt Ramón. Der Westflügel ist so etwas wie ein Wirtschaftstrakt. Da wohnen die Bereiter und Pferdepfleger, und unten hat Nuria eine Praxis für Physiotherapie. Nuria ist die Tochter von Montserrat. Montserrat ist unsere Haushälterin. Sie und ihr Mann José …« Sie bricht ab. »Das sind zu viele Namen, oder?«
Trotz meiner Erschöpfung muss ich grinsen. »Ein bisschen. Es gibt also drei Brüder, ja? Deinen Damián, Ramón – der mich heute aufgelesen hat – und?«
»Luís. Er ist der jüngste und neuerdings mit Nuria zusammen.«
»Der Tochter der Haushälterin, wie skandalös!« In gespielter Empörung reiße ich die Augen auf und schlage mir eine Hand vor den Mund.
Linda lacht. »Ja, wir sind ein bisschen wie eine argentinische Daily Soap. Hier geht’s hoch her.«
Wir betreten den Raum, den Linda zuvor als Halle bezeichnet hat. Wie in Küche und Flur besteht auch hier der Boden aus Terrakottafliesen. In einer Ecke steht auf einem gusseisernen Gestell ein Blumentopf, aus dem sich eine fast deckenhohe Kaktuspflanze erhebt. Blumenkästen mit violetten Mittagsblumen bringen Farbtupfer in den sonst eher düsteren Raum.
»Wir halten die Läden tagsüber geschlossen, damit es im Haus schön kühl bleibt«, erklärt Linda, als hätte sie meine Gedanken erraten. Sie dirigiert mich zu einem Mauerbogen, unter dem eine Treppe mit hübsch geschnitztem Geländer ins Obergeschoss führt. Auf Mauersimsen stehen verbeulte Messinggefäße mit Trockenblumensträußen. An der Wand hängen bunte Zierkacheln, die für lang vergangene Stierkämpfe werben. Alles wirkt sehr rustikal, nicht wie die Werbeanzeige für ein südspanisches Landgut, sondern wie die echte Version. Die, in der es auch Staub gibt, Fußabdrücke auf den Fliesen sowie hier und da ein Spinnennetz in der Ecke. Das Einzige, was nicht ins Gesamtbild passt, sind die Treppenliftschienen, die sich an der Wand entlang in den ersten Stock ziehen. Aber dann erinnere ich mich, dass Ramón sagte, bis vor Kurzem hätte hier ein betagter Schlaganfallpatient gelebt.
Die Treppe knirscht unter unserem Gewicht, Ben drückt sich enger an mich. Im ersten Stock angekommen, macht Linda eine ausholende Geste.
»Tadaa, da wären wir also. Euer neues Reich. Rechts vom Flur sind das ehemalige Zimmer von Piedros Krankenschwester und ihr Bad, links das große Wohnschlafzimmer vom alten Padrón. Dort habt ihr auf jeden Fall mehr Platz.«
Im Zimmer angekommen, rümpfe ich die Nase. Es müffelt nach Staub, Alter und Krankheit. Eine Mischung, die entsteht, wenn die Ausdünstungen eines menschlichen Körpers so tief in Matratzen und Decken einsickern, dass sie sich selbst mit ganzen Flaschen von Desinfektionsmitteln nicht neutralisieren lassen. Ich kenne diesen Geruch nur zu gut. Zum Glück ist Linda bereits dabei zu lüften. Womöglich sind es auch die Möbel, die diesen Eindruck bei mir entstehen lassen. Einen Teil meiner Ausbildung habe ich in einem Pflegeheim absolviert. Schon dort haben mich die abgewetzten, beigegrauen Polstermöbel, die Möbel mit strapazierfähigem Fichtenfurnier und langweiligen, feuerfesten Gardinen deprimiert. Müssen Seniorenzimmer wirklich überall auf der Welt so aussehen?
Kaum hat Linda das Fenster geöffnet, stiebt ein Luftzug in das Zimmer und vertreibt meine trüben Gedanken. »Es ist echt nett, dass ihr uns aufnehmt. Ich werde es dir erklären, das verspreche ich. Ich weiß, ich habe dir einiges …«