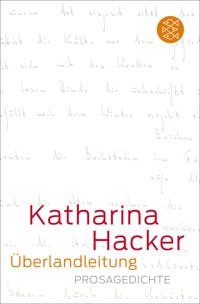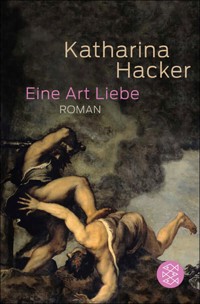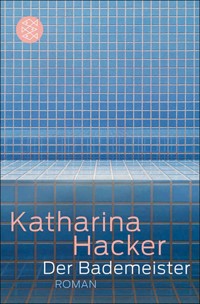9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Kinder- und Jugend-E-Books
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Nie hätte Iris geglaubt, dass Lisa und sie wieder richtige Freundinnen werden. Nie hätte sie geglaubt, dass es einen Jungen gibt, der kein Vollidiot ist. Überhaupt … sie hätte niemandem geglaubt, der behauptet, dass alles wieder gut wird. Doch mit der Schimmelstute Bellina kehrt das Helle in ihr Leben zurück, und Iris erkennt, dass sie nicht alleine ist. Präzise und dicht erzählt Katharina Hacker eine Geschichte von Dunkelheit und Licht. Und von Momenten, in denen Unerklärliches passiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 275
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Katharina Hacker
Alles, was passieren wird
Über dieses Buch
Nie hätte Iris geglaubt, dass Lisa und sie wieder richtige Freundinnen werden. Nie hätte sie geglaubt, dass es einen Jungen gibt, der kein Vollidiot ist. Und vor allem hätte sie nie geglaubt, dass nach dem Tod ihrer Mutter noch irgendetwas Gutes und Schönes passieren kann. Doch mit der Schimmelstute Bellina kehrt das Helle in ihr Leben zurück, und Iris erkennt, dass sie nicht alleine ist.
Präzise und dicht erzählt Katharina Hacker eine Geschichte von Dunkelheit und Licht. Und von Momenten, in denen Unerklärliches passiert.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Katharina Hacker, geboren 1967 in Frankfurt am Main, erhielt 2006 den Buchpreis für »Die Habenichtse«. Seit 2012 lebt sie in Berlin und im Löwenberger Land und teilt ihre Zeit mit ihrer Familie, zwei Hunden, zwei Katzen, einem Pferd, drei Kaninchen und sechs Meerschweinchen.
Weitere Informationen zum Kinder- und Jugendbuchprogramm der S. Fischer Verlage finden Sie unter www.fischerverlage.de
Impressum
Ähnlichkeiten in diesem Buch sind zufällig oder eine Hommage.
Die Geographie und die Architektur der beschriebenen Orte habe ich verändert, wo es für die Geschichte besser passt.
Originalausgabe
Erschienen bei FISCHER E-Books
© 2021 Fischer Kinder- und Jugendbuch Verlag GmbH,
Hedderichstraße 114, D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: Frauke Schneider
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-7336-0413-4
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
[Widmung]
Wenn bei einem Martinsumzug [...]
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
Meinen Eltern gewidmet, die für meine Schwester und mich und für meine Töchter immer einen Garten hatten.
Wenn bei einem Martinsumzug ein Pferd zwischen all den Kindern mitläuft, ist es ein weißes Pferd.
Das Helle sieht man im Dunkeln besser.
Vielleicht hätte ich Belle sonst gar nicht gesehen.
Vielleicht hätte ich auch nicht begriffen, dass Lisa doch noch meine beste Freundin ist und dass Lukas nicht nur der erträglichste von den Jungs in unserer Klasse ist, sondern wirklich nett. Und wenn ich nicht so hungrig gewesen wäre, hätte Seteney mir nicht Essen von ihrer Großmutter mitbringen müssen, von ihrer Großmutter, die in ihrer Kindheit zwei Pferde hatte, eines davon eine Schimmelstute.
Wenn ich an das denke, was passiert ist, bin ich traurig und froh zugleich. Ich werde mich nicht im Dunkeln vergraben. Und meine Mutter wird im Licht ruhen, so wie Seteneys Großmutter es gesagt hat.
1. Kapitel
Die Sommerferien ohne meine Mutter waren ein Albtraum gewesen, und der Anfang der neunten Klasse war auch nicht viel besser. Ich rutschte in drei Fächern auf eine Vier. Lisa vermied es, zu mir zu gucken, wenn Tests zurückgegeben wurden, obwohl ich schriftlich immerhin etwas besser war als mündlich. Ich meldete mich nie. Ein paar andere wurden auch schlechter, unsere Sportlehrerin behauptete, wir seien so was von in der Pubertät, und schließlich hielt sogar unsere Klassenlehrerin, Frau Wild, uns eine Standpauke. Es gebe mehr auf der Welt als unsere miese Laune und unsere privaten Probleme. Ich wusste, dass sie nicht mich damit meinte, aber Wilhelm drehte sich ostentativ zu mir um, und mir wurde fast schlecht vor Wut und vor Traurigkeit.
Irgendwann fingen wirklich alle an, sich um die Klimakatastrophe zu sorgen, und Lisa und die Hälfte aus meiner Klasse gingen zu den Demonstrationen von Fridays for Future. Sie fragten nicht groß, ob ich mitkommen wolle, sie dachten, es sei klar, weil ich immer gegen Plastikbecher und den ganzen Müll war. Ich war auch gegen ansteigende Meeresspiegel und Dürre. Ich hielt den Mund und ging mit, ein Stück weit, dann bog ich ab, um zurück nach Hause zu fahren. Mit der U-Bahn, den Schülerausweis umschloss ich fest mit der Hand, froh, dass wir seit dem Sommer keine Tickets mehr brauchten und ich nicht mit meinem Vater verhandeln musste, wie viele Fahrscheine ich im Monat bekommen konnte.
Einen Antrag auf den Berlinpass für bedürftige Familien wollte er nicht stellen, weil es ihm lächerlich vorkam. Dass wir plötzlich auf so was angewiesen sein sollten.
Schließlich merkten die anderen, dass ich jedes Mal abhaute. Ich erzählte Seteney von einem Jungen aus einer anderen Schule, desMarie-Curie-Gymnasiums, den ich kennengelernt hätte – sie kicherte neugierig – und den ich bei den Demos treffen würde. Keine Verabredung oder so, aber er warte auf mich und lade mich zum Eis ein. Sie nickte und erzählte es weiter, so wie ich es mir gedacht hatte, und gleich wunderte sich keiner mehr, dass ich nicht mit den anderen Mädchen herumzog, sondern irgendwie verschwand. Ich sähe, sagte mir Seteney einmal, ganz schön konfus aus. Konfus war gerade das Lieblingswort von Lisa und so.
Vielleicht hatte Lisa ihrer Mutter etwas Ähnliches erzählt, jedenfalls rief Gesine an und lud mich ein, mal wieder nach der Schule zum Essen zu kommen, und sie fragte, wie es meinem Vater gehe. Gut, sagte ich und ging natürlich nicht hin.
Übers Wochenende nahmen sie mich eh nicht mehr mit, wenn sie aufs Land fuhren, weil ich mit Lisa verkracht war. Es war ein altes Haus mit einem großen Garten. Einmal hatte ich dort einen Igel gefunden und ihm frühmorgens Milch gebracht. Es gab schiefe Apfelbäume und einen Schuppen, und natürlich die beiden Hunde, zwei Irish Terrier, die wir Werwolf und Waswolf nannten, eigentlich hießen sie Alistair und Ivanhoe.
Im Herbst brachen in Brasilien und Australien große Feuer aus.
»Ob beim Wegrennen die Kängurubabys aus dem Beutel fallen können?«, fragte im Biologieunterricht Wilhelm, der bescheuertste Junge aus unserer Klasse, und Herr Retter, unser Biolehrer, hielt das natürlich für eine kluge Frage. Er zeigte uns ein Foto von einem Känguru, das vor dem Feuer in die Stadt geflohen war. Es stand hoch aufgerichtet da und starrte in die Kamera. So fühlte ich mich auch ungefähr.
In Indien oder Indonesien gab es Überschwemmungen, und dann auch in Venedig, daran erinnere ich mich, weil wir drei Mal dort waren, früher, meine Mutter, mein Vater und ich. Mit sechs oder acht war ich einmal weggelaufen, ich hatte mich auf einem Boot, einem grünen Boot, versteckt, das plötzlich ablegte und losfuhr. Ich stand an der Reling und schrie, und Männer in Uniformen kamen zu mir gestürzt, mit aufgeregten Gesichtern. Später erzählte meine Mutter mir, dass es ein Müllboot gewesen war, das nur kurz angelegt hatte, um die Müllcontainer zu leeren. Und sie erzählte mir auch, dass die Müllboote alle denselben Namen tragen, Veritas, was Wahrheit bedeutet.
Es kommt mir manchmal vor, als wäre das eine der letzten Sachen, die sie mir erzählt hat, bevor sie starb, obwohl das natürlich Quatsch ist. Veritas, wiederholte sie, als würde ihr das Wort besonders gut gefallen. Veritas. Dabei können wir gar kein Latein.
An manchen Tagen sah sie aus, als hätte man bei einem Foto den Filter verändert. In Lisas Smartphone kann man Magic auswählen, alles ist dann blass und gleichzeitig überdeutlich, genauso sah Mama aus.
Sie war dann besonders sanft, aber auch so, dass ich Angst hatte, sie könnte wieder einen ihrer Herzanfälle kriegen.
Venedig jedenfalls war auch überschwemmt, schlimmer als je zuvor oder schlimmer als seit hundert Jahren. Alle sagten, dass das zu den Klimakatastrophen gehörte und dass Venedig bald nicht mehr existieren würde. Einmal pro Woche traf sich eine Arbeitsgruppe in der Schulcafeteria, um zu beratschlagen, was man machen könne, außer freitags demonstrieren zu gehen. Viele in der Schule, auch die Älteren, waren mit solchen Sachen beschäftigt, mit Greta Thunberg, mit dem Klimawandel und was aus uns werden würde, und wenn ein Erwachsener eine Bemerkung darüber machte, wie schlecht ich aussah, erwiderte ich, dass ich nicht schlafen könne, weil ich mir solche Gedanken machte und Angst hätte. Dann nickten alle verständnisvoll.
Irgendwann verschwanden die Bilder von den Feuern und dem Hochwasser wieder, ich war froh, wenn etwas Neues kam, Überschwemmungen im Sudan und wieder Hitze in Australien, weil die anderen dann noch nicht anfingen, von Advent und Weihnachten zu reden. Ein paar hatten schon in der achten Klasse so getan, als wären sie zu alt, sich für Advent und Weihnachten zu interessieren, aber das Weihnachtskonzert gab es ja trotzdem, und viele bekamen einen Adventskalender. »Geh doch beim Laternenumzug mit!«, verspotteten sie Clarissa, die schon Anfang November davon schwärmte, wie sie sich auf ihre Adventskette und auf den Weihnachtsbaum und die Lebkuchen freue und überhaupt.
Daran erinnerte ich mich, als ich am elften November in einen Umzug reingeriet, einen richtigen Laternenumzug mit Gesang und gerührten Eltern und heulenden Kindern und einer echten Kerze, die ihre Laterne verbrannte, obwohl der besorgte Vater bestimmt gesungen hatte: Brenne auf, mein Licht, aber nur meine liebe Laterne nicht, und einem weißen, wunderschönen Pferd, auf dem ein Mann saß, ein großes Schwert in der Hand und in einem roten Mantel.
Durch Zufall wurde ich in die Nähe gedrängt, der Mann schaute zu mir herunter, das Gesicht geschminkt und ziemlich nervös. Eigentlich sah er ganz nett aus, und das Pferd beäugte mich aufmerksam. Plötzlich blitzte etwas, und er rief mir zu: »Halte sie fest!«
Ich konnte gerade eben die Zügel packen, da explodierte ein Böller im benachbarten Park, und das Pferd tänzelte und wieherte aufgeregt, es riss mich mit sich, schließlich stieg es sogar ein bisschen, und ich klammerte und klammerte mich an den Zügel.
Vielleicht ist das ein Wunder, dass nichts passiert ist, ich meine, keins von dem kleinen Gewuzzel ist zu Schaden gekommen. Ein paar aufgebrachte Eltern fingen an zu schimpfen und sagten, das sei doch absurd, mit einem echten Pferd, und viel zu gefährlich, und wer nur diesen Mann engagiert habe.
Ich stand neben dem großen Kopf, das Pferd schnaubte, ich streichelte die Schnauze, und dann erinnerte ich mich, was Timo, mein Lieblingspony in den Reiterferien früher, gemocht hatte, und streichelte auch seine Ohren, ganz fest, knetete sie ein bisschen, denn jetzt ließ es den Kopf sinken, und dann seufzte es, gar nicht so tief, wie man von einem Pferd vielleicht erwarten würde, eher mit einer hellen Stimme.
»Danke«, hörte ich plötzlich, »danke dir! Meine Güte, das hätte schiefgehen können!«
Ich schaute hoch und sah das Gesicht des Mannes, schon weniger geschminkt, weil er sich mit dem Mantel darübergefahren war. Er schwitzte, aber lächelte immerhin vage, und er war jünger, als er vorhin ausgesehen hatte. »Es ist eine Stute, oder?«, fragte ich, und er nickte. »Du kennst dich aus mit Pferden, nicht wahr?«
Bevor ich den Kopf schütteln konnte, war er abgestiegen.
»Ich hatte Angst, dass sie austickt und ich sie mit dem blöden Schwert in der Hand nicht zügeln kann. Warte«, fügte er hinzu. »Halte sie einen Moment!«
Der Umzug war ohne uns weitergegangen, die meisten Kinder hatten sich jetzt in dem kleinen Park versammelt und sollten singen. Aber sie wollten nicht, und ihre Eltern sangen falsch und zu laut und wedelten mit den Laternen, die Kinder quengelten nach Süßigkeiten und wollten nach Hause, und ich wollte auch nach Hause. Wo sollte ich sonst auch hin. Nur musste ich mich dazu von der Stute verabschieden, die jetzt ganz ruhig und zutraulich bei mir stand, und natürlich musste der Mann erst wiederkommen, der sich mit zwei Polizistinnen beriet. Ich streichelte noch einmal vorsichtig die Nüstern, und als ich in ihr Auge schaute, in dem sich das Blaulicht des Polizeiwagens spiegelte, passierte es. Es war nicht wie ein Blitzschlag oder eine Erleuchtung, es war nicht hell und hatte nichts mit Wissen zu tun, mit Wissen im üblichen Sinn, auch nichts mit irgendeiner plötzlichen Erkenntnis. Es war wie eine Wärme, die sich ausbreitete, wie eine Gewissheit, die von meiner Hand ausging, während sie Nüstern und Stirn der Schimmelstute streichelte, von dem großen schwarzen Auge aus, das mich anblickte.
Einen Moment dachte ich, dass es wegen des Blaulichts war, das mich an meine Mutter erinnerte.
Aber das Gefühl ging von dieser Erklärung nicht weg, die Wärme und die Gewissheit, dass meine Mutter mich irgendwie aus dieser Stute heraus anschaute, als wäre ein Stück ihrer Seele in das Pferd hineingewandert.
»Ihr braucht mich gar nicht, Belle und du, sehe ich«, sagte der Mann leise, als er zurückkam, jetzt klang er wirklich freundlich. Er streckte mir eine Visitenkarte hin. »Hier, schau, das ist unser Reitstall, da steht auch Bellina, und du hast dir auf jeden Fall eine Reitstunde verdient.«
»Auf Bellina?«, fragte ich verwirrt.
Er lachte. »Wenn du dich traust. Aber wahrscheinlich besser auf einem der Schulpferde, die sind auch nett.«
Er wandte mir den Rücken zu und schwang sich in den Sattel, das Schwert hatte er anscheinend den Polizistinnen gegeben.
»Danke noch mal!« Er schaute zu mir, und sein Blick veränderte sich plötzlich, so als wäre ihm erst jetzt etwas aufgefallen.
Mit einem leichten Kopfschütteln ritt er los, dann drehte er sich noch einmal um und rief mir zu:
»Wie heißt du überhaupt?«
»Iris«, antwortete ich, ich weiß nicht, ob laut genug, dass er es verstehen konnte. Langsam ritt er davon.
Zwei Straßen weiter war alles dunkel und still, wie es in Friedenau halt ist. Ich hätte nie gedacht, dass ich mich irgendwann danach sehnen würde, in einer dieser Straßen zu wohnen. Immer wieder roch ich an meiner Hand, die nach Bellina roch und mich deswegen an meine Mutter erinnerte. Mama hatte Pferde gemocht, und wenn ich sie fragte, ob sie nicht reiten lernen wolle, sagte sie immer, dass sie in ihren Träumen über Wiesen galoppiere, sogar über Gräben würde sie springen, hinter einem Wäldchen ein Rudel Rehe aufstöbern und mit ihnen gemeinsam weitergaloppieren. Wenn sie das sagte, sah sie so aus, als wäre es wahr, nicht im Traum, sondern in Wirklichkeit.
Als sie dann krank war und nicht mehr laufen konnte, sagte sie einmal: Wenn ich gesund werde, lerne ich reiten. Das hätte ich längst tun sollen.
Da war ich selber schon seit einem halben Jahr auf keinem Reiterhof gewesen und wusste nicht, ob ich überhaupt noch würde reiten können. Bestimmt nicht Galopp.
Ich sagte ihr, die Pferde würden sicher nett und rücksichtsvoll zu ihr sein, denn die Pferde und Ponys, auf denen ich geritten war, hatten sie immer gemocht. Sie schnupperten freundlich an ihr, und nie stieß eines sie mit dem Kopf oder bettelte sie aufdringlich an. Dass sie gesund werden würde, glaubte ich keine Sekunde lang.
Dass sie sterben würde, glaubte ich aber auch nicht.
Stattdessen dachte ich, es wären die schlimmsten Zeiten meines Lebens.
Ein Irrtum.
2. Kapitel
Es gibt Sachen, die man niemandem erzählt, und es gibt Sachen, die man nicht erzählen will, aber dann tut man es doch irgendwann. Am nächsten Morgen ging Lisa mit Lucia und Sarina in die Pause, Benjamin kreiste um die beiden herum, und ich sah, aus einiger Entfernung, dass Viktor zu den beiden schlenderte, um mit ihnen zu plaudern, Viktor aus der elften Klasse.
Wir kannten ihn, Lisa und ich, weil wir Klassensprecherinnen waren, keiner der Jungs hatte dazu Lust gehabt, also waren wir zwei Mädchen. Alle paar Wochen trafen wir uns mit den anderen Klassensprechern. Viktor war mit Abstand der netteste. Ich mochte es, dass er nicht so groß war wie die anderen Jungs, jedenfalls die, die Klassensprecher waren, und keine Sneakers trug, sondern irgendwelche Wanderschuhe.
Natürlich merkten sie nicht, dass ich nicht dabei war, ich tat meistens, als würde ich in die Cafeteria gehen, feststellen, dass die Schlange wieder einmal zu lang war, dann drückte ich mich irgendwo herum, bis die Pause zu Ende war. Wieso sollte ihnen auffallen, dass ich fehlte, ich fehlte ja nicht, ich war einfach nicht da.
So lange hatte ich nicht versucht, mich dazuzustellen, dass es mich plötzlich wie ein Stich traf. Ich wusste gar nicht wie. Einfach hingehen? Lächeln? Hallo sagen? Hört mal, ich muss euch was erzählen! Sie wären umgefallen. Alles klar? Eine Zeitlang fand Lisa das cool. Alles klar? Damit begrüßte sie mich jeden Morgen, und ich antwortete: Alles gut. Jetzt vergaß sie manchmal, mich zu begrüßen. Ich antwortete trotzdem: Alles gut! Taten ja alle, egal wie es ihnen wirklich ging. Egal ob sie eine Fünf oder eine Vier bekommen hatten oder eine Drei, ob sie Ärger zu Hause hatten oder nicht. Viele Eltern am Rheingau-Gymnasium machten ziemliches Theater um die Schule. Ich war jetzt immer unter den schlechten Schülerinnen, eine Weile hatte es Ärger mit den Unterschriften gegeben, weil ich sie erst so spät ablieferte. Das hatte ich geändert. Meinem Vater war es völlig gleich, was er unterschrieb, er wollte nur nicht von mir gestört werden.
»Schimpfen deine Eltern nicht?«, hatte mich Lucia ein paarmal gefragt. Aber es gibt Sachen, die man niemandem erzählt. Und ich musste nicht lügen, als ich antwortete: »Nein, die schimpfen nie.«
»Hast du es gut!« Lucia starrte mich an, und Seteney, die zufällig mitgehört hatte, zuckte mit den Achseln. »Meine flippen total aus«, sagte sie dann, und es klang, als wollte sie sagen: Ihr habt es eh leichter. Dabei ist sie eine top Schülerin. Und sie spielt Geige, was sie hasst. Dafür gar nicht mal so schlecht, jedenfalls nicht so brutal schief wie andere. Während ich seit ein paar Monaten immer wieder angemeckert wurde: Du machst überhaupt keine Fortschritte mehr! Ich antwortete dann nicht, das wahre Wunder sei, dass ich die Geige überhaupt noch hätte, es hätte ja auch keiner begriffen.
Einmal hatte sich Lukas aus meiner Klasse neben mich gesetzt, das war viel schlimmer gewesen als das Gemecker. Weil ich ihn nicht beachtete, zupfte er schließlich an meinem Pullover. Wieherndes Gelächter bei Wilhelm und David, die uns beobachtet hatten. Als ich mich genervt zu ihm drehte, sah er so hilflos aus, dass ich Mitleid mit ihm bekam. Na, Kleiner, lag mir auf der Zunge, aber zum Glück konnte ich es noch runterschlucken. Immerhin war er nicht so ein Aufschneider, der Zoten auf den Tisch kritzelte und grölte, wenn wir Mädchen fürs Laufabzeichen trainieren mussten. Und klein war er auch nicht. Er machte eine wegwerfende Bewegung mit der Hand, als er mein Gesicht sah, und wollte aufstehen. »Was gibt’s?«, fragte ich ihn ungeduldig.
»Ich wollte dir meine neue Geige zeigen.«
»Toll. Schön für dich, dass du eine neue Geige hast. Gratuliere. Und warum zeigst du die nicht Frau Wild?« Das ist unsere Musiklehrerin und diejenige, die das große Orchester leitet.
»Weil du am schönsten spielst.« Er sagte es ein bisschen lauter als nötig, vielleicht hätte ich es sonst vor Verblüffung auch gar nicht verstanden.
»Hä?«, fragte ich.
»Mann, du Alge«, kreischte Sarina, die größte Nervensäge unter den Mädchen unserer Klasse. »Er macht dir ein supergeiles Kompliment, kapierst du nicht?« Sie schüttelte sich vor Lachen, bis Lukas aufstand und ganz freundlich zu ihr sagte: »Du Arme, immer hart für die Talentlosen unter uns.«
Da verstummte sie tatsächlich und glotzte nur.
Danke, wollte ich sagen, aber ich bekam den Mund nicht auf, wer weiß, was rausgekommen wäre, irgendein unartikulierter Laut. Zum Glück wartete Lukas nicht auf eine Antwort, sondern zog mit seinem Geigenkoffer ab.
Ich hatte mir früher ausgemalt, dass ich Geigerin werde, und mein Lehrer, Emanuel, hatte mich ermutigt, auch noch, als ich aufhörte, jeden Tag eine gute Stunde zu üben.
Er war überzeugt, dass aus mir was wird, und als ich ihm sagte, dass ich aufhöre mit den Stunden, rief er jeden Tag an und verlangte eine Erklärung.
Eine Erklärung. Witzig.
Er wollte mit meiner Mutter sprechen.
Sehr witzig.
Er wollte mit meinem Vater sprechen. Gar nicht lustig. Meinem Vater sagte ich, er solle Emanuel zurückrufen, und Vater sagte, ja, natürlich, und ich wusste sogar, dass ich es ihm jedes Mal ausrichten konnte, wenn Emanuel es von mir verlangte, denn er würde es eh nicht tun. Was sollte er denn auch sagen? Dass er den Unterricht nicht mehr bezahlen konnte?
Eines Tages stand Emanuel vor der Schule. Nicht direkt vor dem Tor, immerhin, sondern auf der anderen Straßenseite, also auf der vom Paul-Natorp-Gymnasium. Im ersten Augenblick hoffte ich, er habe dort etwas zu erledigen. Aber was er wollte, war mit mir sprechen.
Es gibt Sachen, die man niemandem erzählt, und ich erzählte ihm nichts, gar nichts. Mit einem Unglück können die Leute umgehen, aber wenn noch eins kommt, fällt ihnen nichts mehr ein, und weil sie so trostlos sind, trösten sie dich nicht und gehen dir außerdem sofort aus dem Weg. Deswegen hatte ich auch Lisa nichts gesagt.
Emanuel sah enttäuscht aus.
»Du warst meine beste Schülerin«, sagte er, und ich versuchte zu tun, als wären wir Luft, damit keiner von meinen Mitschülern mich im Gespräch mit einem dreißigjährigen Typ sah, und auch keiner von den Lehrern.
»Ist das nicht eure Dirigentin?«, hellte sich sein Gesicht auf, als er Frau Wild die Straße überqueren sah.
»Wie?«, verhaspelte ich mich, dann tauchte ich ab. Bückte mich, um die Schnürbändel meiner Schuhe neu zu binden. Der schwere Rucksack rutschte mir gegen den Kopf, und ich konnte einen Schmerzenslaut nicht unterdrücken.
»Mein Gott!« Emanuel zog ungläubig den Ranzen weg. »Wie viele Kilo schleppst du da mit dir rum?«
Ein Segen, dass bei allen der Schulranzen zu schwer ist. Trotzdem haben Lisa und die anderen gemerkt, dass ich keinen Spind mehr habe. Eine der Überweisungen, die Papa irgendwann gestoppt hat. Ich konnte von Glück sagen, dass der Hausmeister mir geholfen hat, meine restlichen Sachen rauszuholen.
»Na gut«, sagte Emanuel resigniert. »Wenn du mir wenigstens eine Erklärung geben würdest. Dein Vater ruft nicht an. Und von deiner –«
Ich sprang hoch, bevor er das Wort Mutter in den Mund nehmen konnte, und fauchte: »Is halt so! Gibt genug andere.« Ich drehte mich halb Richtung Tor und machte eine umfassende Handbewegung. Als er seine Augen von mir abwandte, um auch zur Schule zu gucken, sprintete ich los. Soweit das mit dem Schulranzen möglich war, sprinten. Er rief noch, aber nur einmal, meinen Namen, ganz laut, und es klang ein bisschen traurig. Es klang ein bisschen, wie wenn meine Mutter mich gerufen hatte, und ich rannte und rannte, bis ich außer Sichtweite von allen war, die mich hätten rufen können.
Seit diesem Nachmittag ertrage ich meinen Namen nicht mehr. Aber das ist so etwas, was man niemandem erzählt. Immerhin mal was, wo keiner nach fragt, weil keiner darauf kommt. Man muss entweder unsichtbar sein oder den Mund aufmachen, bevor einer auf die Idee kommt, den Namen auszusprechen. Dann geht es. Und Lisa hat mich schon immer Betty genannt.
Nur diesem Besitzer von Bellina hatte ich meinen Namen gesagt, es hatte sich ganz fremd angefühlt.
Von Belle und der geschenkten Reitstunde wollte ich Lisa eigentlich nichts erzählen, das wäre ja die ganze Geschichte gewesen, andererseits wusste ich, dass die Postleitzahl dieselbe wie von ihrem Dorf war. Vorletzten Sommer hatte ich eine Postkarte hingeschickt, nach Gutengermendorf. Vielleicht kannte sie den Hof sogar, sie durfte jetzt manchmal reiten, nicht nur in den Ferien, sondern auch an langen Wochenenden. Das hatte ich mitbekommen, aber nicht, wo das war.
Unser Plan war gewesen, später, wenn wir alt genug waren, ein Pflegepferd zu suchen, irgendwo, wo man mit den Öffis hinkonnte.
Als Lisa dann über den Schulhof gelaufen kam, direkt auf mich zu, winkte ich ihr mit der Visitenkarte zu, die ich seit dem Vorabend kaum losgelassen hatte. Eigentlich wollte sie wohl rasch was aus dem Spind holen, sie bremste aber doch ab und guckte neugierig, ihre Haare wippten, lange dunkelbraune Haare, und weil sie so erwartungsvoll aussah, sagte ich: »Ich habe ein Pferd gefunden, eine Schimmelstute.« Und dann fügte ich noch hinzu: »Ich darf sie vielleicht reiten.«
3. Kapitel
Lisa und Betty, das klang, fand Lisa, irgendwie gut, und ich fand gut, was sie gut fand, seit der ersten Klasse, seit dem Hort vor der Einschulung, wo wir auf einem großen Hof landeten, im Schatten von riesigen Bäumen, zwischen einer alten Wasserpumpe und einem neuen Sandplatz. Wir standen nebeneinander, noch in Kleidern, die anderen rannten alle schon in Badehosen um uns herum, stürzten sich auf die Buddelsachen, und wir waren als Einzige zu spät und ohne Badezeug gekommen.
Einer der Erzieher hat uns gerettet, er hat uns zwei Handtücher rausgesucht, die irgendwelche Kinder vergessen hatten, und ernsthaft mit uns diskutiert, ob wir im Schlüpfer rumrennen können. Und er rief unsere Mütter an, um sie zu bitten, beim Abholen frische Wäsche mitzubringen. Wir hatten beide knallrote Unterhosen mit Erdbeeren drauf an, und der Erzieher, Jonas, versuchte gar nicht, so zu tun, als wäre das nicht lustig, er lachte, bis wir irgendwann mitkicherten.
Also kannten sich auch unsere Mütter gleich und mochten sich, und wir wurden als beste Freundinnen gehandelt, bevor wir irgendeine Meinung dazu haben konnten, aber es passte, und dann waren wir wirklich beste Freundinnen. Meistens ging ich zu Lisa, bei uns war nichts Besonderes, und Lisa hatte die zwei Hunde, Ivanhoe und Alistair, zwei Irish Terrier. Sie waren klein, als wir eingeschult wurden, und jetzt werden sie allmählich alt. Aber weil es Irish sind, haben sie noch genauso viel Spaß daran, herumzurennen und zu springen, wenn wir ihnen Hindernisse aufbauen oder an den Parkbänken mit ihnen trainieren, und sie stürmen auf mich los, wenn ich zu Lisa komme, als hätten sie mich bitter vermisst.
Manchmal übernachtete ich auch oder fuhr am Wochenende mit nach Gutengermendorf, wo sie ihr Haus haben, mit dem großen, alten Garten. Wenn ich dann gleich bis Montag blieb, flochten wir uns gegenseitig am Sonntagabend, nach dem Duschen, das Haar zu kleinen Zöpfen. Ich liebte es, ihr Zöpfe zu flechten, sie hat so schöne glatte braune Haare, wie ich sie auch immer gern gehabt hätte. Meine waren immer widerspenstig und schnell struppig. Seit ich sie ganz kurz geschnitten habe, ist es egal. Ich werde nie den Schock in ihrem Gesicht vergessen, als sie mich plötzlich so sah.
Sie wusste ja nicht, dass meine Mutter gestorben war.
Sie fragte nichts und sagte nichts, sie stand einfach nur an ihrem Platz, so als hätte ich ihr was weggenommen. Weggenommen, ohne vorher etwas zu sagen, ohne Streit oder Androhung, aus dem Nichts heraus, und dann war sie wütend.
Wie konntest du!, fauchte sie.
Frau Wild kam rein, und wir mussten uns setzen, nebeneinander, wie immer, wie seit der ersten Klasse. Und nach der Stunde standen wir auf und gingen in die Pause und kamen zurück und gingen und kamen zurück und setzten uns und gingen jede nach Hause, ohne dass eine noch ein Wort gesagt hätte.
Ich weiß gar nicht, wer ihr dann erzählt hat, dass Mama tot ist.
Irgendwann kam sie und wollte etwas sagen, aber da war es mir schon egal. Alles war mir egal. Ich ging weiter in die Schule, jeden einzelnen Tag, weil ich mir zu Hause den Kopf gegen die Wand gehauen hätte.
Nach der Aufregung und den Tränen und den besorgten Freunden meiner Eltern kam die Stille, wenn wir zu zweit waren. Mein Vater kochte irgendetwas, abends, und wir aßen irgendetwas, zu zweit, und er versuchte, die Küche aufzuräumen und das Frühstück vorzubereiten, den Tisch zu decken, so wie meine Mutter es jeden Abend gemacht hatte. Es ging nicht gut, ich wollte ihm helfen, aber ich ertrug es nicht, mit ihm in der Küche zu sein, und die Zimmer drum herum waren alle schwarz. Und dann zogen wir auch noch um.
Dass Lisa dann nicht mehr mit mir redete, ließ jeden Tag etwas zerbrechen. Etwas zerbrach, ich konnte es richtig hören, so wie wenn die Nachbarskatze einen kleinen Vogel fraß, den sie gefangen hatte. Wir sahen ihr dabei zu, damit die Hunde sie nicht störten und sie den Vogel wenigstens auffraß, wenn sie ihn nun schon getötet hatte, und die Knöchelchen knackten, wenn sie kaputtgingen.
In der Schule wurde ich noch manchmal angesprochen, aber sonst wurde alles immer stiller.
Nach ein paar Wochen fingen wir an, wieder ein paar praktische Sachen zu sagen, hast du das Matheblatt?, Fällt Sport aus?, in der Art, einmal war ich kurz davor, ihr alles zu erzählen, aber dann fragte sie: Nimmst du morgen die Geige mit, Iris? Und in mir erlosch alles.
Meine Mutter hatte mich nie Betty genannt, immer darüber gelacht, nur Lisas Mutter nannte mich manchmal ebenfalls Betty, so wie Lisa. Jetzt war es, als wäre der richtige Name weg, der einzige, der mir noch übrig geblieben war.
»Wo hast du denn plötzlich ein Pferd her?«, fragte sie neugierig und streckte die Hand nach der Karte aus, aber ich hielt sie fest.
»Beim Umzug«, sagte ich. Meine Stimme klang ein bisschen kratzig, besonders viel redete ich ja auch nicht.
»Seid ihr umgezogen?« Sie guckte mich groß an. »In eine andere Wohnung?«
O Mann, dachte ich, umgezogen.
»Vor ein paar Monaten«, entgegnete ich knapp. »Aber ich meine den Martinsumzug.«
»Du wohnst nicht mehr am Südwestkorso?«
Ich schüttelte den Kopf und wedelte mit der Karte, um sie wieder aufs Thema zu bringen.
»Aber wo denn??«
»Bundesallee«, erwiderte ich kurz. »Beim Martinsumzug sind doch manchmal Pferde. Das ist doch eure Postleitzahl?«
»Reiterhof Löblin«, las sie vor und runzelte die Stirn. »16775. Das muss ja ganz in der Nähe sein, wieso kenne ich den nicht?«
Dann schaute sie mich neugierig an und fragte: »Und was für ein Pferd? Das war beim Umzug? Da nehmen sie doch immer irgendeinen trägen, fetten Gaul?«
»Sie war nicht träge und nicht fett und kein Gaul!« Ich dachte an die schwarzen Augen mit den weißen Wimpern und an ihr schönes, kluges Gesicht.
»Sie …«, ich schluckte.
»Wie hieß sie denn?«
»Bellina, aber er hat sie Belle genannt.«
»Bellina!« Lisa guckte mich an. »Ausgerechnet Bellina.«
Da fiel es mir erst auf.
Lisa guckte komisch, als überlegte sie, was zu sagen, aber dann zog sie ihr Handy heraus, um den Ort einzugeben. Hätte ich auch drauf kommen können. Allerdings war mein Guthaben so oft aufgebraucht, dass ich mich dran gewöhnt hatte, kein Handy zu benutzen.
»Muss da irgendwo sein«, murmelte sie, »aber es klingt so komisch, Klevesche Häuser, was soll das denn sein?«
Als sie die Karte mit den Fingern vergrößerte, sahen wir es beide sofort. Klevesche Häuser, das war nicht mehr als zwei Kilometer von Gutengermendorf. Bestimmt waren wir schon durchgefahren, ohne auf das Ortsschild zu achten. Wir guckten uns an, und für einen Augenblick war es wie früher, wir mussten grinsen und hätten uns beinahe in die Seite gepufft.
Dann verzog sich ihr Gesicht plötzlich zu einer Grimasse. »Wenn nur nicht …«, setzte sie an und brach ab.
Ach so, dachte ich. So ist das, wir sind ja nicht mehr Freundinnen, die zusammen das Wochenende verbringen.
Sie schüttelte den Kopf, dann sagte sie lauter: »Erzähl doch, ich platze vor Neugier!«
So sah sie zwar nicht aus, eher etwas trüb, aber ich erzählte trotzdem, von dem Laternenumzug, dem nervigen plärrenden Gewuzzel, wie irgendein Idiot im Park einen Böller gezündet hatte und wie das Pferd gestiegen war, gestiegen, sagte ich, auch wenn das übertrieben war, aber ich sah Belle vor mir, weiß und wunderschön und hoch aufgerichtet, aufgeregt wiehernd.
»Und dann bist du hin und hast sie am Zügel gepackt?«, fragte Lisa, und in ihrer Stimme war etwas von der Bewunderung, mit der sie früher ihrer Mutter von meinen Reitabenteuern erzählt hatte, denn ich war diejenige, die die schwierigen Ponys bekam, und meistens ging es gut, weil ich die Nerven nicht verlor, auch wenn ich oft runterfiel oder irgendein Pony mit mir über den Platz raste.
»Ja«, antwortete ich, und wieder sah ich Belles schwarzes Auge mit dem blinkenden Blaulicht, ihr großes Auge, und darin etwas Geheimnisvolles, etwas, das mit Mama zu tun hatte. Und der Geruch. Ich roch an meinem Jackenärmel, ob noch was übrig war davon, und entdeckte ein paar weiße Haare.
»Guck nur!«, rief ich aus, und Lisa guckte, sie begriff gleich und grinste, und dann machte sie wieder ein komisches Gesicht, aber ich erzählte ihr trotzdem von dem Mann und wie er abgestiegen und mich mit Bellina allein gelassen hatte, mir die Karte gegeben und gesagt, ich habe mir eine Reitstunde verdient.
»Das müssen wir schaffen«, sagte sie dann, und sie wiederholte es: »Das schaffen wir ganz bestimmt, da hinzufahren!«