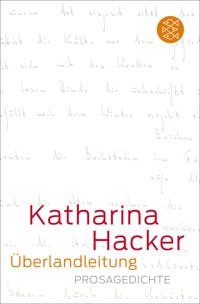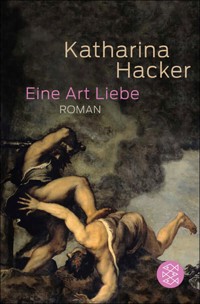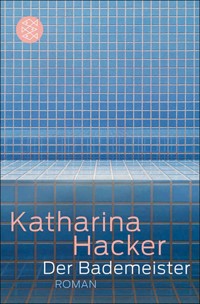8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Dorf im Odenwald, ein Kind, das mit seinen Brüdern, Eltern und Großeltern dort die Sommer verbringt. Doch diese äußerlich noch unversehrte Welt der Sicherheit und stillen Schönheit ist von feinen Rissen durchzogen, aus denen Ängste und Träume steigen. Unheimlich sind die Keller unter den Häusern, das »Teufelsgrab« am Ortsrand, der dunkle Wald, durch den der Jäger geht. Unverständlich sind die Gebräuche und Gespräche der Erwachsenen. Und auch die eigene Familiengeschichte führt tief in eine Zeit der Vertreibung und des Schreckens, wenn die Großmutter erzählt. Katharina Hackers behutsame und eindringliche »Dorfgeschichte« hat ihren ganz eigenen Ton. In der dichten Darstellung der kleinen Welt des Dorfes stellt diese Autorin die Frage nach den großen Dingen – nach Geborgenheit und Einsamkeit, nach Liebe, dem Leben und dem Tod.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 142
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Katharina Hacker
Eine Dorfgeschichte
Über dieses Buch
Ein Dorf im Odenwald, ein Kind, das mit seinen Brüdern, Eltern und Großeltern dort die Sommer verbringt. Doch diese äußerlich noch unversehrte Welt der Sicherheit und stillen Schönheit ist von feinen Rissen durchzogen, aus denen Ängste, Träume und Erinnerungen steigen. Unheimlich sind die Keller unter den Häusern, das »Teufelsgrab« am Ortsrand, der dunkle Wald, durch den der Jäger streift. Unverständlich und oft voller Gewalt sind die Gebräuche und Gespräche der Erwachsenen. Und auch die eigene Familiengeschichte führt tief in eine Zeit des Schreckens, wenn die Großmutter erzählt.
Katharina Hackers behutsame und eindringliche »Dorfgeschichte« hat ihren ganz eigenen Ton. In der dichten Darstellung der kleinen Welt des Dorfes stellt diese Autorin die Frage nach den großen Dingen.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Covergestaltung: Heilmann, Hißmann, HamburgCoverabbildung: Camille Pissarro, Les côteaux de L'Hermitage Pontoise, ca. 1867. Solomon R. Guggenheim Museum, New York. Thannhauser Collection, Justin K. Thannhauser, 1978. 78.2514.67
© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2011
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-401355-8
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Widmung
In dem Sommer, an [...]
Hinter dem Haus wuchsen [...]
Großvater war unablässig da, [...]
Über die meisten im [...]
Die Zeitenfolge bestimmt über [...]
Am Ende gab es [...]
Die alte Frau Trunk [...]
Den alten Leiterwagen fand [...]
Auf dem Dorffriedhof kann [...]
Jeder Baum hat seinen [...]
Wer in den schneereichen [...]
Wenn wir heute, nachdem [...]
Wenn es dämmerte, weitete [...]
Zwischen den Dörfern kann [...]
Die drei Milchfahrer wechseln [...]
Das letzte Haus war [...]
Die alte Hainbuche ist [...]
Irgendwann zu lernen, dass [...]
Was in diesem Buch [...]
Für Philippa und Annabelle.
In dem Sommer, an den ich mich als ersten erinnere, flogen die Schwalben hoch, sie bauten ihre Nester unter unserem Dach; im Dorf gab es ein Gasthaus, in dem wir manchmal aßen, dann wurde es zugemacht, man musste ins Nachbardorf, um Eis zu kaufen. Das Sträßchen, das aus dem Dorf führte, war nicht asphaltiert und nicht begradigt, es schlängelte sich bis zum Wald.
Wir fuhren mit unseren Fahrrädern zu den Drei Seen und fürchteten die Blutegel und Schlingpflanzen. Die Straße wurde verbreitert, führte aber nach wie vor zur Hohen Buche, zur Hainbuche, einem drei- oder vierhundert Jahre alten Baum.
Die ersten Sommer wurde viel gebaut. Das Dach musste neu gedeckt werden. Meine Mutter wünschte sich eine Terrasse. Es gibt Fotos, auf denen meine Großeltern abgebildet sind, meine Eltern sehen so jung und alt aus wie ich heute; die Bäume sind sehr klein.
ANGEBLICH hatten wir einen Onkel. Einen Großonkel, genauer gesagt, aber alle nannten ihn nur Onkel. Keiner von uns hatte ihn je gesehen, doch unsere Mutter und unsere Großeltern, sogar unser Vater, der gar nicht aus der Tschechoslowakei kam, bestand darauf, dass wir einen Onkel hatten. Wir suchten ihn im Gerümpel auf dem Dachboden, wo wir Ahnenpässe fanden, die unsere arischen Großeltern verlegen machten, Ledertaschen voller Dokumente, die sie nicht wegwerfen, nicht anschauen wollten, eine kleine Handtasche – schwarzes Kroko-Imitat, sagte meine Mutter – voller Schmuck fanden wir, den Onkel fanden wir nicht, auch keine Spur von ihm. Wir fanden Zahngold in einem Pappschächtelchen. Wir fanden ein Eisernes Kreuz, ich weiß nicht mehr, welcher Klasse.
In einem Sommer, ich war etwa fünf Jahre alt, gab es einen großen Streit zwischen mir und meiner Mutter um ein zerbrochenes Glas oder einen Zwist mit meinen Brüdern, ich erinnere mich nicht genau. Doch war ich wohl unschuldig, denn meine Mutter wollte mich versöhnen und schenkte mir einen kleinen Sessel, einen Sessel en miniature, gerade groß genug für mich. Mein großer Bruder passte schon nicht mehr hinein, musste sich quetschen, dass das Holz ächzte. Wie für ein Kinderhaus geschnitzt, war es ein echtes Möbel, ein Kindersessel, mit rotem Samt bezogen. Ein Unfug, höhnte Simon, ein Thron, spottete er, der nicht hineinpasste, und bald war ich auch, wie er, zu groß für meinen Sessel – dick wie eine Wurst, sagte er zufrieden – und als mein Sessel mit anderem Spielzeug aussortiert wurde, schleppte er, nur einmal von meiner Mutter dazu aufgefordert, den Sessel auf den Dachboden, die schmale Stiege hinauf. Oben endete alles. Von draußen hörte man die Trecker oder Erntemaschinen, die Kühe auch. Abends sprangen die Melkmaschinen an und brummten von drei Höfen gleichmäßig um uns herum.
Unser Onkel sollte Herbert heißen.
Mein Vater mietete ein Mal im Jahr, zu Weihnachten, einen kleinen Lastwagen, um aufs Land zu bringen, was sich in der Stadt nicht bewährt hatte. Jede Reise verschob eine Fuhre von Gegenständen von einem zum anderen Ort, so wie von Berghängen Steine und Geröll herunterrollen ins Tal. Nur die Richtung war umgekehrt, bergauf.
Fuhren wir los, wurden wir zu nichts als Materie, von den Eltern da- und dorthin platzierten Körpern, an denen Kleider und Bücher und aussortierte Stofftiere hingen wie sperrige Fransen. Meine Mutter packte in tiefstem Schweigen, starrsinnig und konzentriert. Für sie blieb jede Reise eine Verlust- und Todesreise. Sie fahre im Traum, erzählte sie mir einmal in der Nacht vor unserem Aufbruch, als ich zu ihr ins Bett gekrochen war, auf einem offenen Lastwagen, aus dem beständig die Koffer und Taschen und Bündel und sogar kleine Kinder herausfielen. Und abschließend, bevor ich weiterschlief, sagte sie: Entweder es gibt ein Wir oder es gibt kein Wir. Dann fügte sie hinzu: Ich wünschte, es hätte keines gegeben. Und wenn man mir mit den Händen alles nachtragen würde, ich wollte nichts davon, nicht ein Stück.
Dann drehte sie sich weg. Sie konnte schneller einschlafen als jeder andere Mensch, den ich kenne.
Angekommen vor unserem Haus, rissen wir, bevor noch der Motor abgestellt war, die Türen auf und sprangen hinaus, rannten los in den Garten, zur Hütte, zum Schuppen, in dem Geräte und Fahrräder abgestellt waren. Wir verschwanden, auch wenn es eiskalt war, für Stunden, und Mutter rief nicht nach uns, verwehrte auch Vater, uns zu rufen, wenn er Hilfe brauchte beim Ausladen – er grollte, wir waren frei, wie er nie frei gewesen war. Nicht einmal zum Essen mussten wir am Ankunftstag kommen, nur abends zum Schlafen, und dann mussten wir uns nicht waschen, sondern durften wie wir waren ins frisch bezogene Bett.
Von meiner Mutter habe ich gelernt, dass die vergehende Zeit nur quälend ist, wo unsere Großzügigkeit versagt. Streit darüber, dass wir kommen sollten, hatten wir nie, denn wir durften gehen, wir durften sogar wegbleiben. Unser Onkel Herbert war auch weggeblieben. Allerdings glaubten wir nie ganz an seine Existenz.
Mein Sessel stand auf dem Dachboden, zwischen Kinderbetten, Federbetten, Kartons voller Geschirr und Spielzeug. Der Sessel aber stand eines Tages frei und für sich am Fenster, daneben ein Puppentischchen. Anderntags stand auf dem Tischchen ein Glas.
Angeblich hat mein Onkel unser Haus im Dorf niemals gesehen. Angeblich hatte er sowieso nur Verachtung für jede Art Besitz. Angeblich war er, ein junger Mann, gegen die Nazis heimlich in eine tschechische Schule gegangen. Er sprach jedenfalls, als einziger in der Familie, Tschechisch fehlerfrei. Und während es sonst auf einen Fehler mehr oder weniger nicht ankam, in diesem Fall kam es darauf an, auf Fehlerlosigkeit, auf makellose Aussprache.
Jedenfalls trug er auf Fotos, auf denen angeblich auch er zu sehen war – und genau wusste man nie, wer wer war –, weiße, kragenlose Hemden und graue Hosen, etwas flatterte immer, er hatte, wie auch mein Großvater, einen Hut, der Hut war jedoch aus Stroh und nie aus Filz, er saß im Nacken, tief nach hinten gerutscht, ohne je hinunterzufallen. Mein Onkel, behauptete mein kleiner Bruder, als er neue Wörter lernte, mein Onkel hatte Embleme. Keiner von uns Kindern wusste genau, was das war. Wir nickten, denn richtig war es doch. Wer Embleme hatte, gehörte zu den Dingen wie zu den Bildern, wer Embleme hatte, war mutig, als trage er ein Schwert.
Ich erzählte es einmal im Dorf, dass wir noch einen echten Onkel hatten. Jemand war gestorben, ein alter Bauer von einem Hof am obersten Dorfrand. Ich wusste nicht, in welchem Haus der Mann gewohnt hatte, der Leichenwagen hatte ihn abgeholt, den hatte ich gesehen, und in Gedanken versunken hatte zu mir, dem Kind, Frau Brenner mit dem schönen Garten gesagt, früher, als man die Leute noch mit den Pferden abgeholt habe, sei es leichter gewesen für die Seele der Verstorbenen, hinterherzukommen. Ich verstand nicht, was sie sagte, aber da nun einer fehlte, erzählte ich, ich hätte einen Onkel. So?, fragte Frau Brenner und schaute mir in den Augen. Dann nickte sie, und weil sie nickte, fügte ich hinzu, der Onkel sei sehr klein, kaum größer als eine Seele, in meinen Sessel passe er leicht hinein.
Zum letzten Mal versuchte ich, mich in meinen Sessel mit dem roten Samt zu setzen, mit einer Pobacke zumindest, schräg, oder auf der Kante balancierend. Da sah ich das Glas, ein schmales, feines Glas mit einem goldenen Rand, klein wie ein Kinderglas, fein wie ein Glas für einen feinen Menschen.
Später, sagte ich, nachdem ich aufgestanden und einen Schritt zurückgetreten war, später, sagte ich zum Sessel hin, wenn ich größer bin, dann rede ich auch mit dir. Es war das erste Mal, dass ich meinen Onkel Herbert mit eigenen Augen sehen konnte.
Zu dritt standen wir nebeneinander auf der grauen Wiese, es war ein kalter April oder unfreundlicher März, jeder Sommer erschien unausdenkbar weit, wir aber sollten in eine Sandgrube springen, an deren Rand ein primitives Holzbrett eingegraben war, zum Absprung. Der Sand war nass, mein Bruder Simon, daran erinnere ich mich, machte sein finsterstes Gesicht. Wir sollten uns freuen. Es war eines der wenigen Male, die ich meinen Vater redselig erlebte, er hob sogar die Arme, gestikulierte, was er sonst nie tat.
Meine Mutter vermaß währenddessen mit meinen Großeltern das Haus, verteilte fünf oder sieben Leute auf die Zimmer. Dann lief sie durch das Dorf, in dem noch niemand sie grüßen und für sie stehenbleiben wollte, und überlegte, wie sie Handwerker finden sollte, die aus dem alten Schulhaus ein Haus machten.
Ich weiß, dass an den Abhängen noch die Schneezäune standen und dass die Straße mit Stangen markiert war. Immer hatte ich Angst, ich könnte meine beiden Brüder verlieren. Auf meinen jüngeren Bruder Frederik sollte ich aufpassen, er ging leicht verloren, trug meist eine rote Zipfelmütze, damit wir ihn leichter fanden.
An den ersten Sommer erinnere ich mich nicht, im darauffolgenden Winter nahm Simon die alten Ski von meinem Großvater, sie stehen noch immer irgendwo in einem hohen Strohkorb. Er schnallte sie an, ich blieb mit Frederik und einem Schlitten nahe am Haus und schämte mich meiner Furchtsamkeit. Die Dämmerung senkte sich langsam, wenn Schnee lag, er hielt das Licht zwischen Himmel und Erde gefangen.
Wenn man aus dem Tal und aus dem Wald kommt, geht links ein kleiner Feldweg steil bergab, eine kleine Straße steil den Hügel hinauf, gegenüber liegt der erste Hof, dann kommen rechter Hand Gemüsegärten, dann weitere Häuser, Höfe. In der Dorfmitte liegen Löschteich, Brunnen, Kirche, und erst ein weiteres Stück hinauf kann man erkennen, wie hoch über den Tälern und anderen Orten dies Dorf liegt. Es ist nicht so, dass man ins Leere schaute oder in eine erhabenen Landschaft, nur weit kann man schauen.
Die Flurnamen sind nicht eigentümlicher als anderswo, und immer gibt es einen Totenkopf, einen Geiersberg, den Galgenhügel, andere unheimliche Namen. Die Grenzen werden noch immer von den alten Steinen markiert, nicht alle Steine begrenzen aber etwas, manche sind halb versunken in der Erde, und wenn man genau schaut, kann man den Bischofsstab erkennen oder das Wappen der Leiningens.
Es war eine abgelegene und arme Gegend, deswegen hatte sie aber doch ihre Besitzer. Die Grafen von Dürn lebten hier hundertfünfzig Jahre, dann verschwanden sie, und seit den Napoleonischen Kriegen und folgendem Gebietstausch gehören große Ländereien den Fürsten Leiningen, das Kloster in Amorbach wurde aufgelöst, die Abteikirche protestantisch. Die Wälder sind wildreich bis heute.
Unweit und unterhalb des Dorfes gibt es ein Tal, das ein schmaler Bach durchfließt, es heißt das Dörnbachtal, bis vor ein paar Jahren gehörte es auch den Leiningens, jetzt ist es verkauft. Das Tal ist nur über den Feldweg zugänglich, es grenzt an das Breitenbachtal, in dem ebenfalls ein schmaler Bach fließt. Der Breitenbach entspringt nahe der Drei Seen, im 12. Jahrhundert ein einziger, sehr großer Waldsee, der später durch Staumauern in drei geteilt wurde, ein Becken ist längst ausgetrocknet und nicht mehr zu erkennen. Der große See soll bei Wolfram von Eschenbach beschrieben sein, der vielleicht auf Burg Wildenberg den Parzival geschrieben hat. Der ehemalige See, der jetzt zwei Seen ist, die Drei Seen heißen, liegt am Limes, wenn man dem Limes folgt, kommt man zum Römerbad und zu den Resten eines Kastells.
Hinter dem Haus wuchsen einmal Brennesseln, ein alter Stacheldraht hing zwischen den Zaunpfosten, wurde abgeschnitten, dann kamen Beete, zuerst Bohnen, später Rosen; als habe, sagte meine Großmutter, die Erde es beschlossen, dass die Bohnen nicht mehr wachsen, aber die Rosen gedeihen hier.
Meine Großmutter wurde nicht kleiner im Alter, sie wurde nicht größer. Sie schien an etwas festzuhalten, als sie älter wurde, etwas, das in ihr lag, deswegen wuchs sie nach innen hinein; sie beobachtete die Leute im Dorf, wie sie stritten, heirateten. Sie schaute mich freundlich an, an ihrer Liebe habe ich nie gezweifelt. Wenn ich mich zu ihr setzte, hielt sie lange meine Hand.
UNGLÜCK ADELT, davon waren wir Kinder lange überzeugt. Eines Frühlings wurde Simon krank, eine rätselhafte Krankheit war es, so spät erkannt, dass es ihn fast das Leben gekostet hätte, und meine Mutter wurde schmal und blass, wie Simon es war, packte ihn in Decken, ließ ihn nicht aus den Augen, trug ihn sogar, der doch der größte von uns Geschwistern war, auf den Armen durchs Haus.
Simon grinste. Er war, wussten wir Jüngeren, insgeheim längst genesen, womöglich war er nie wirklich krank gewesen, er nutzte nur mit Geschick, was ihm, als Unglücklichem, zufiel: Liebkosungen, Leckereien, Geschenke, sagte, für diesmal überraschend sprachgewandt, mein kleiner Bruder Frederik anklagend zu mir. Und während Simon auf dem Sofa neben unserer Großmutter saß, sich Äpfel schälen ließ und Nüsse knacken, beratschlagten wir im regennassen Garten, wie wir einen Ausgleich schaffen könnten, wie wir ihn piesacken und kitzeln und ärgern würden, wenn nur endlich die Sorge der Erwachsenen um ihn nachgelassen hätte.
Bis er vollständig genesen war, es dauerte lange, hatten wir vergessen, wie wir ihn ärgern wollten, aber es war uns wie Schuppen von den Augen gefallen: Die da kamen, müde Gesichter machten, wurden bewirtet, weil sie gelitten hatten, mit letzter Kraft sanken sie an den Kuchentisch, uns aber bereitete man keinen Kakao, es ging uns ja gut, zu essen gab es Rührei und Kartoffeln, dann wurden wir rausgeschickt, ins Freie, wir sollten draußen spielen.
Wie Heilige wurden die letzten Verwandten und die Freunde meines Großvaters behandelt, bittere Gesichter, uralt. Im Gesicht hatten die Freunde, die zu Verbindungen und Burschenschaften gehörten, Narben, sie kniffen uns in die Backen, als wollten sie das Fett messen, sie redeten ohne Unterlass. Vor allem aber wollten sie, dass wir erfuhren, wovon wir nichts wussten, von all dem Unglück, von der Vertreibung, von all dem Leid, dem Unrecht, von dem Raub. Was wir verloren hatten, was wir geerbt hätten, davon sollten wir wissen, die Güter, Tiere, Höfe, die Fabriken. Großspurig zählten wir es auf, Pferdegespanne, Kutschen, Jagdhunde auch, und mein Bruder Frederik sorgte sich, wie meine Großmutter unglücklich wäre mit all den Tieren, stellt euch vor!, rief er, wie sie verzweifelt, Nummer Fünfundzwanzig und Nummer Zwei! – er benutzte unseren Code, der Großmutter ersparen sollte, dass wir die Tiere beim Namen nannten. All das Viehzeug, wie sie sagte.
Ich dachte, Oma ist ein Findelkind, fragte ich meine Mutter. Sie rührte im Milchreis und war nicht bei der Sache. Ach was, sagte sie.
Dann hätten wir also wirklich was geerbt?
Jetzt fasste sie mich schärfer ins Auge.
Was solltet ihr erben? fragte sie.