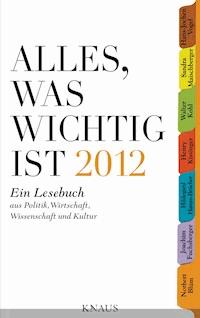
Alles, was wichtig ist 2012 E-Book
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaus
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Das Buch für alle, die mitreden wollen
Henry Kissinger analysiert die zweite Supermacht der Welt, China. Norbert Blüm betrachtet unser Verhältnis zu Geld und Arbeit. Hans-Jochen Vogel und Sandra Maischberger diskutieren, wie wir leben wollen. Margot Käßmann ergründet unsere Sehnsüchte, Walter Kohl sucht die Versöhnung mit seinem Vater. Die brisantesten Themen der wichtigsten Autoren des Jahres. Ein Muss für alle, die wenig Zeit haben zu lesen und trotzdem nichts verpassen wollen.
Hassen Politiker ihre Wähler? Kann man Fleisch essen und Tiere trotzdem lieben? Warum ist unsere Gesellschaft so gewalttätig? Wie demokratisch ist das Internet? Deutsche und internationale Wissenschaftler, Staatsmänner, Meinungsmacher und Philosophen liefern wertvolle Analysen und Positionen zu den wichtigsten Fragen unserer Gegenwart: Hildegard Hamm-Brücher über die Verteidigung der Freiheit, Michail Chodorkowski über ein freies Russland, Julian Nida-Rümelin über humane Ökonomie, Frédéric Martel über Europas Rolle im internationalen Kulturpoker, Bascha Mika über die Feigheit der Frauen, Joachim Fuchsberger übers Älterwerden und viele mehr. Hier erheben sich die unverzichtbaren Stimmen zur Zeit: Alles, was wichtig ist 2012.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 299
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorbemerkung
Verbauen wir unseren Kindern die Zukunft? Wie denken Politiker wirklich über die Bürger? Ist es tatsächlich besser, kein Fleisch zu essen? Wo bleibt die Menschlichkeit in der Wirtschaft? Wie sieht die Zukunft des politischen Liberalismus aus? Warum ist unsere Gesellschaft so gewalttätig? Weshalb müssen Frauen noch mutiger werden? Und wie halten wir es eigentlich mit der Religion?
Dieses Lesebuch versammelt über zwanzig Beiträge aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur zu den großen Themen der Zeit. Die Texte deutscher und internationaler Wissenschaftler, Politiker, Meinungsmacher, Künstler und Philosophen liefern Analysen und Positionen zu den wichtigsten Fragen, die unsere Gegenwart bestimmen.
Alles, was wichtig ist 2012 entstand in Zusammenarbeit mit den Verlagen adeo, C. Bertelsmann, Deutsche Verlags-Anstalt, Goldmann, Gütersloher Verlagshaus, Integral, Irisiana, Karl Blessing, Ludwig, Pantheon und Siedler; dafür sei an dieser Stelle herzlich gedankt.
Alle Texte folgen in Rechtschreibung und Zitierweise ihrer Erstveröffentlichung.
Knaus VerlagMünchen, im November 2011
I. Politik
Über Glanz und Elend des politischen Liberalismus
von Hildegard Hamm-Brücher
Am 22. September 2002, am Wahlsonntag, fuhr ich mittags – also noch vor Bekanntgabe der Wahlergebnisse – zum Postamt am Münchner Hauptbahnhof und schickte um 14 Uhr per Einschreiben meinen Austrittsbrief an die FDP, zu Händen des »Vorsitzenden Herrn Dr. Guido Westerwelle«. Es war das letzte von drei Schreiben, die sich mit bildungspolitischen Versäumnissen und dem neuen Kurs der FDP – dem Wandel zur rechten Spaßpartei – auseinandergesetzt hatten, jedoch ohne vernünftige Antwort geblieben waren. Der Austrittsbrief hat folgenden Wortlaut:
Sehr geehrter Herr Vorsitzender,
nach mehrmonatiger Bedenkzeit erkläre ich heute, am 22. September, meinen Austritt aus der FDP. Diese Entscheidung habe ich bewusst vor dem Wahlausgang und seinen Ergebnissen sowie unabhängig von der politischen Zukunft Ihres Stellvertreters (Jürgen W. Möllemann) getroffen.
Meine Entscheidung, die mir sehr schwergefallen ist, basiert auf der Einsicht, dass ich meine persönlichen und politischen Grundwerte in der heutigen FDP nicht mehr ausreichend vertreten kann und gewährleistet sehe. Aus dieser Entwicklung und insbesondere durch die andauernde rechtspolitische, antiisraelische und tendenziell Antisemitismus schürende Agitation des stellvertretenden Parteivorsitzenden ist eine wechselseitige Entfremdung zwischen der Partei und mir entstanden, die für mich unerträglich und irreparabel geworden ist, weil sie die Fundamente meiner Überzeugungen für mein politisches Engagement infrage stellt.
Nach dem Erleben und den Erfahrungen der Nazidiktatur wollte ich seit 1945 alles in meinen Kräften Stehende dazu beitragen, dass in Deutschland nie wieder Rassen- und Fremdenhass direkt oder indirekt geschürt oder gar geduldet werden darf. Jüdischen und anderen rassischen und/oder religiösen Minderheiten sollte hinfort nicht nur eine angstfreie, sondern auch eine geachtete und gleichberechtigte Existenz gesichert und garantiert werden. Das schließt auch das Existenzrecht des Staates Israel in gesicherten Grenzen ein. Aus diesen Gründen konnte und kann ich diesbezügliche Kursschwankungen und Formelkompromisse, wie sie in der FDP gang und gäbe geworden sind, nicht länger mittragen.
Meine diesbezüglichen Besorgnisse habe ich Ihnen, Herr Vorsitzender, wiederholt mitgeteilt und dabei auf Ihre besondere Verantwortung für absehbare (Fehl)Entwicklungen in der FDP hingewiesen. (Ich erinnere an meine Briefe vom 12. Dezember 2001 und vom 6. Mai sowie 23. Juni 2002.) Ihre Reaktionen auf meine und andere warnende Stimmen, vor allem aber Ihr zögerliches Verhalten hinsichtlich der Eskapaden Ihres Vertreters haben mich in meiner Kritik bestärkt, dass Sie Ihre Führungsverantwortung nicht rechtzeitig und nicht ausreichend wahrgenommen haben. Sie haben zu lange geschwiegen und dem Möllemann-Kurs nicht rechtzeitig Paroli geboten. Für »Last-minute«-Absetzbewegungen ist es nun zu spät. Langwierige Personalquerelen und Turbulenzen sind absehbar.
Mein Resümee: Nach vierundfünfzigjähriger Parteizugehörigkeit (darunter viele Jahre in führenden Parteiämtern) vermag ich in einer zur rechten Volkspartei ä la Möllemann gestylten FDP keine Spuren eines Theodor Heuss, eines Thomas Dehler und Karl-Hermann Flach, eines Ignatz Bubis und vieler anderer aufrechter Liberaler mehr zu entdecken. Damit habe ich meine politische Heimat verloren und muss von heute an, traurigen Herzens, zur liberalen Wechselwählerin werden.
H. Hamm-Brücher
So endete eine Verbindung, die über ein halbes Jahrhundert gehalten hatte, obgleich sie bereits zuvor immer mal wieder auf der Kippe gestanden hatte.
Stationen des politischen Liberalismus
Die Geschichte des politischen Liberalismus in Deutschland war schon seit Bismarcks Zeiten stets wechselvoll: Mal war man links, mal rechts, mal gemeinsam mit anderen, mal getrennt. Bis zu seinem frühen Tod 1919 war Friedrich Naumann die überragende liberale Persönlichkeit; er hatte es mit seiner Politik und Gesinnung geschafft, dass sich »Rechts-« und »Links«-Liberalismus versöhnten, was oft merkwürdig widersprüchlich wirkte. Die Linksliberalen hatten zu Beginn der Weimarer Republik großen Zulauf und herausragende Persönlichkeiten wie Max Weber, Walther Rathenau oder den Schöpfer der Weimarer Verfassung, Hugo Preuß. Damit errang die linksliberale Deutsche Demokratische Partei (DDP) bei den ersten Wahlen im Januar 1919 einen großen Erfolg (18 Prozent) und bildete mit der SPD und der Zentrumspartei die »Weimarer Koalition«, die erste Regierung der Republik. Von Wahl zu Wahl verlor sie jedoch an Stimmen, stattdessen wurde in der zweiten Hälfte der Weimarer Republik die rechtsliberale Deutsche Volkspartei (DVP) stärker und erlebte unter Gustav Stresemann mit Wahlergebnissen zwischen 8,7 Prozent und 10,1 Prozent ihren Höhepunkt. Bei den letzten halbwegs freien Reichstagswahlen am 5. März 1933 erreichte die DVP 1,1 Prozent, die inzwischen in Deutsche Staatspartei umbenannte DDP nur noch 0,9 Prozent. Durch eine Listenverbindung mit der SPD erhielt die Deutsche Staatspartei jedoch fünf Abgeordnetensitze, die DVP nur zwei.
Die fünf linksliberalen Abgeordneten, zu denen auch Theodor Heuss zählte, waren anfangs gegen eine Annahme von Hitlers Ermächtigungsgesetz, stimmten diesem aber am 23. März 1933 letztlich zu, was Heuss bis zu seinem Tode zutiefst bereute, da es die Grundlegung für einen Verfassungsbruch und damit die Festigung der nationalsozialistischen Diktatur bedeutete. Die zwei DVP-Abgeordneten waren sowieso dafür, man vermutete, sie hätten schon das Parteibuch der NSDAP in der Tasche gehabt. Im Juni 1933 wurden beide liberale Parteien verboten, und damit ging eine wenig glanzvolle Zeit des politischen Liberalismus zu Ende.
Nach 1945 gab es nur noch wenige Linksliberale wie etwa Theodor Heuss oder Reinhold Maier, den ersten Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg, oder auch Thomas Dehler – dafür umso mehr Gesinnungs-DVPler, die die neu gegründete FDP jahrelang rechts von der CDU verorten und als Auffangbecken für ehemalige Nazis öffnen wollten. Im Prinzip hat sich die Aufspaltung in Rechts- und Linksliberalismus bis Jürgen Möllemann erhalten. Auch heute schwelt sie noch gelegentlich weiter, einen nennenswerten linksliberalen Flügel gibt es nicht mehr.
Über die sozialliberale Ära (1969–1982)
Mein persönlicher Erfolg im Wahlkampf 1962 hatte zur Folge, dass ich wenig später in den Bundesvorstand der FDP gewählt wurde, in dem ich mit einer kleinen Unterbrechung bis zu meinem Austritt 2002 Mitglied war. Zeitweise saß ich auch im Präsidium, einmal war ich sogar für vier Jahre stellvertretende Bundesvorsitzende. Dabei lernte ich das wechselvolle Innenleben der FDP recht gut kennen.
Anfang der sechziger Jahre war Erich Mende der Bundesvorsitzende der FDP, ein ehemaliger Offizier mit sichtbarem Ritterkreuz, der nie wirklich in dem neuen pluralistisch verfassten Gemeinwesen angekommen war. Zwar gab es zu dieser Zeit eine Art Bundesparteiprogramm, das aber aus lauter Kompromissen bestand, denn die Parteirechten hatten auf dem Emser Parteitag von 1952 ein national-liberales Deutsches Programm proklamiert, und die sogenannten Linksliberalen hielten sich an ihr Liberales Manifest. Dennoch sollte eine neuerliche Spaltung vermieden werden. Es wurde über die Programme nicht abgestimmt.
Wirklich politisch beheimatet fühlte ich mich in der Bundes-FDP erst, als Ralf Dahrendorf Ende der sechziger Jahre auf den Plan trat und mit vielen neuen Ideen ein klares Programm für eine moderne, liberale Partei entwarf, und als der Reformer Hans Wolfgang Rubin, damals stellvertretender Bundesvorsitzender der FDP, mich mit seiner Initiative Stunde der Wahrheit begeisterte, die zum Auftakt unseres Engagements für eine neue Ostpolitik wurde. Desgleichen wirkten in dieser Phase der Bundesrepublik Karl Georg Pfleiderer, der als ehemaliger Diplomat die Notwendigkeit einer Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit Jugoslawien durchsetzte, und Wolfgang Schollwer, der die Entwürfe für eine neue Ostpolitik formulierte.
Endlich wusste ich, dass ich in der richtigen Partei war, und daran änderte sich auch bis Anfang der achtziger Jahre nichts. Die Freiburger Thesen mit den vier großen Themen sozialer Liberalismus, Mitbestimmung, Umweltinitiative und Vermögensbildung wurden 1971 verabschiedet und von mir unterstützt. Nicht zuletzt war es der gerade gewählte Generalsekretär Karl-Hermann Flach, der im selben Jahr mit seiner Streitschrift Noch eine Chance für die Liberalen? den neuen Kurs nicht nur wie Dahrendorf durchdachte, sondern auch durchsetzte.
Mit den Freiburger Thesen waren die liberalen Antworten auf die großen gesellschaftspolitischen Veränderungen der siebziger Jahre überzeugend und weitsichtig formuliert. Etwas später folgten die Stuttgarter Leitlinien zur Bildungspolitik, die von einigen liberalen Mitstreitern und mir entworfen wurden, aber nie als Gesetze realisiert werden konnten. Immerhin waren sie in der öffentlichen Bildungsdiskussion jahrelang so etwas wie ein bildungspolitisches Gütesiegel der Partei.
Alles in allem hatte die FDP ihren wabernden Rechtskurs nach Freiburg durch ein klares sozialliberales Profil ersetzt. Leider sollte das nur etwa eineinhalb Jahrzehnte Bestand haben. Die Abkühlung und Entfremdung zwischen den Koalitionspartnern SPD und FDP begann bereits Anfang der achtziger Jahre. Zum einen entsprang sie der Verschlechterung des persönlichen Verhältnisses zwischen Kanzler Helmut Schmidt und seinem Stellvertreter, Außenminister Hans-Dietrich Genscher. In dem Maße, wie ihre Meinungen voneinander abwichen, wuchs die Affinität zwischen Genscher und seinem Duzfreund Helmut Kohl, der unverblümt und mit verheißungsvollen Avancen um die FDP warb. Hinzu kam, dass Wirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff, dem der sozialliberale Kurs ohnehin nie recht behagt hatte, in der Partei, aber auch bei den FDP-Sympathisanten in der Wirtschaft neuerlich an Ansehen gewonnen hatte. Er attackierte immer hörbarer die SPD.
Kanzlersturz und seine Folgen
Die Vorbereitungen eines Koalitionswechsels begannen im Frühjahr 1982 mit äußerster Vorsicht und Geheimhaltung. Vorausgegangen war Genschers sogenannter Wendebrief vom 20. August 1981, in dem er seine Parteimitglieder auf bestehende Konflikte mit der SPD und eine mögliche Umorientierung einstimmte. Der Brief sorgte für beträchtliche Unruhe, es schien aber zunächst alles wie bisher weiterzugehen.
In den nächsten Monaten bemühte man sich, Zweifler und Zögerer für die Notwendigkeit eines Misstrauensvotums gegen Schmidt und eine Wahl Kohls zum Kanzler zu gewinnen – und man war erfolgreich. Da ich eine ausgezeichnete Meinung von der Persönlichkeit und Kompetenz Helmut Schmidts gewonnen hatte, war ich entschlossen, auf keinen Fall einem Misstrauensvotum zuzustimmen. Daraus machte ich keinen Hehl, wie ich es dann ja auch am 1. Oktober 1982 in einer persönlichen Erklärung zum Ausdruck gebracht habe.
Für uns etwa zwanzig Dissidenten sprach Ex-Innenminister Gerhart Baum sehr überzeugend in der entscheidenden Plenarsitzung des Bundestags am 1. Oktober. In der Nacht vor der Sitzung war mir klar geworden, dass ich mich auch zu Wort melden wollte, um meinen persönlichen Dissens mit dem Gebot des Artikels 38, Absatz 1 des Grundgesetzes zu begründen – nach dem Abgeordnete an »Aufträge und Weisungen nicht gebunden und nur ihrem Gewissen unterworfen« sind. Ein weiterer Grund war das im letzten Wahlkampf 1980 gemachte Wählerversprechen, die Koalition weitere vier Jahre fortsetzen zu wollen und diese Zusage nicht ohne Wählervotum rückgängig zu machen.
Für meine Erklärung hatte ich mir nur Notizen gemacht, und ich war mir nicht im Klaren, ob und was meine Rede unter Umständen bewirken könne. Aber der Aufruhr und die Resonanz waren enorm. Wie die Bundestagsprotokolle ausweisen, hat mich zum Beispiel der damalige Generalsekretär der CDU, Heiner Geißler, bezichtigt, »einen Anschlag auf unsere Verfassung« verübt zu haben, was natürlich nicht der Fall war. Ganz am Rande sei noch vermerkt, dass der schließlich gewählte Bundeskanzler, Helmut Kohl, mich seit dieser meiner Rede nicht ein einziges Mal mehr gegrüßt oder zur Kenntnis genommen hat. Selbst bei der Bundespräsidentenwahl 1994, als ich als Kandidatin der FDP neben dem FDP-Vorsitzenden in der ersten Reihe der Bundesversammlung saß, hat er es nicht für nötig befunden, mir einen Gruß oder wenigstens einen Blick-Gruß zuteilwerden zu lassen – was ich nun meinerseits als »kleinkariert« empfunden habe.
Nach dem dramatischen Kanzlersturz in der zweiten Hälfte des Jahres 1982 traten etliche Abgeordnete aus der FDP-Fraktion aus, darunter Ingrid Matthäus-Maier und Günter Verheugen. Andere kandidierten nicht wieder, und die Abgabe von Parteibüchern an der Basis war enorm. Ich erhielt etwa viertausend Zuschriften, größtenteils mit dankbarer Zustimmung.
Dass die FDP bei der im März 1983 nachfolgenden Bundestagswahl die Fünf Prozent-Hürde mit sieben Prozent übersprang, ist nachweislich nur dadurch zustande gekommen, dass offenkundig viele CDU-Wähler mit ihrer Zweitstimme den Liberalen halfen. (Die FDP hatte nur 2,8 Prozent Erststimmen und sieben Prozent Zweitstimmen; die CDU 41 Prozent Erststimmen und »nur« 38,2 Prozent Zweitstimmen.)
Anschließend konnte die FDP die Koalition mit der CDU/ CSU, nunmehr durch Wahlen bestätigt, fortsetzen. Trotz mancher Nachbeben innerhalb der Fraktion über den Kurswechsel gelang es dem Außenminister, der nach wie vor Hans-Dietrich Genscher hieß, seine bisherige Politik unverändert fortzusetzen, was letztlich 1989 zum Fall der Mauer und zur Wiedervereinigung beitrug. Deshalb halte ich Genschers Verdienste hierfür mindestens ebenso groß wie die des Kanzlers Kohl, der ja mitsamt seiner Partei die bahnbrechende sozialliberale Ost- und Entspannungspolitik jahrelang vehement bekämpft und verunglimpft hatte.
Im Übrigen folgte die FDP der Politik des neuen Kanzlers, die eine »geistig-moralische Wende« bewirken sollte, stattdessen aber etliche Skandale mit sich brachte.
Die Freiburger Thesen wurden kaum noch erwähnt, es kamen keine Anregungen von Dahrendorf mehr, der ebenfalls die Partei verlassen hatte. Es gab keine Umweltpolitik, um die sich zuvor Gerhart Baum große Verdienste erworben hatte, desgleichen wurde der äußerst qualifizierte und integre Rechtspolitiker Burkhard Hirsch auf Jahre isoliert. Insgesamt mutierte die FDP wieder zur traditionellen, angepassten Mittelstandspartei.
Insbesondere war es die Flick-Affäre, bei der es um illegale Zuwendungen in Millionenhöhe ging (»zur besonderen Pflege der Bonner Landschaft«, wie es Flick-Repräsentant Eberhard von Brauchitsch 1984 vor Gericht aussagte), die jede wirkliche »geistig-moralische Wende« verhinderte. In den Parteispendenskandal waren außer Graf Lambsdorff auch andere FDP-Politiker involviert, außerdem prominente CDU-Politiker. Die Affäre offenbarte schlimme illegale Praktiken, was bei den Bürgern eine erste Welle an Politik(er)verdrossenheit auslöste und beträchtlichen Schaden für das Ansehen der Demokratie anrichtete.
Empörung gab es auch 1985 anlässlich der vierzigjährigen Wiederkehr des Kriegsendes, als Bundeskanzler Kohl mit dem damaligen amerikanischen Präsidenten Ronald Reagan zum Zeichen der Versöhnung demonstrativ über den Soldatenfriedhof im rheinland-pfälzischen Bitburg wanderte, auf dem auch viele frühere SS-Leute begraben liegen. Ich beteiligte mich stattdessen zusammen mit jüdischen Veteranen und Organisationen an einer Demonstration, die zu den Gräbern der Widerstandskämpfer der Weißen Rose auf dem Friedhof am Perlacher Forst in München führte.
Gleichzeitig war dieser 8. Mai 1985 aber auch der Tag, an dem Richard von Weizsäcker in seiner Rede ein Bekenntnis zur Demokratie, zum Widerstand gegen den Rechtsextremismus und zur Notwendigkeit der Erinnerung an das Geschehen in der NS-Zeit ablegte.
Die FDP war und blieb nach der »Wende« hin zur CDU/CSU angeschlagen. Trotz vieler Versuche und neuer Programme hat sie selbst nach der Wiedervereinigung kein programmatisches Profil zurückgewinnen können. Heute, in der Fünf-Parteien-Demokratie, haben sich die Grünen – wie häufig zu hören ist – als eine Art sozialliberale Partei etabliert.
Die FDP vor und nach der Wiedervereinigung
Die Vereinigung brachte der FDP ab 1990 zwar dank zahlreicher gebürtiger Ostdeutscher in ihren Reihen wie Wolfgang Mischnick, Hans-Dietrich Genscher oder Gerhart Baum wieder Auftrieb, der aber nur kurz anhielt; wirkliche Wurzeln konnte sie im Osten nicht schlagen. Um die Jahrtausendwende dann versuchten sich die Liberalen als Spaß- und später als Steuersenkungspartei zu profilieren, womit sie 2009 mit 14,6 Prozent den größten Wahlerfolg in ihrer Geschichte einfuhren. Dem glanzvollen Sieg folgte das Elend fast auf dem Fuße, als es mit den versprochenen Steuererleichterungen nichts wurde: Die FDP sackte in der Wählergunst bis auf drei Prozent ab und laboriert seither an der Fünf-Prozent-Schicksalsquote.
Über die Zukunft des politischen Liberalismus
Woran mangelt es der heutigen liberalen Partei? Meinem Eindruck nach fehlen ihr vor allem Persönlichkeiten, die durch Lebensleistung und innere und äußere Unabhängigkeit überzeugend und eigenständig sind. Es fehlen ihr in einer überbordend-liberalisierten Gesellschaft Positionen, die sich vom konservativen und sozialdemokratischen, oft liberalistischen Mischmasch unterscheiden und die dem ausufernden Missbrauch der Freiheit – etwa im Internet, in manchen Medien oder hinsichtlich der Übermacht skrupelloser Banken – klipp und klar eine Absage erteilen.
Und es fehlt an jenem Freimut, mit dem wir seinerzeit als junge Politiker unsere Positionen vertreten hatten, ohne Ärger im eigenen Lager zu scheuen. Wenn ich mich in diesem Zusammenhang an den Parteitag 1967 in Hannover erinnere, bei dem ich mich zum Beispiel unter Beifall, aber auch lauten Protestrufen für die Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze einsetzte, dann waren das noch offene liberale Auseinandersetzungen, die später reiche Früchte trugen. Heute sind Parteitage aller politischen Gruppierungen, ausgenommen die der Grünen, durchgestylte Show-Veranstaltungen, die Geschlossenheit vorführen sollen und nicht der Fortentwicklung und Klärung demokratischer Positionen dienen. Eine lebendige »democracy by discussion« findet öffentlich jedenfalls nicht statt.
Offenbar gibt es beim Parteinachwuchs der Liberalen einige hoffnungsvolle junge Frauen und Männer, aber sie vermitteln (noch) nicht jenes Profil liberaler Eigenständigkeit und Zuversicht, das die FDP braucht, wenn sie erkennbar und unverwechselbar sein will. Ein Christian Lindner allein macht noch keine neue FDP.
Die Partei des politischen Liberalismus müsste sich und ihren Standort im Fünf-Parteien-Spektrum neu begründen. Vor allem müsste sie die Partei sein, die die Defizite und Fehlentwicklungen der repräsentativen Demokratie beim Namen nennt und zur Überwindung der Glaubwürdigkeitsdefizite beiträgt. Damit würde sie Vertrauen zurückgewinnen.
Oft werde ich gefragt, ob ich meinen Austritt bereue und ob es in unserer liberalen Gesellschaft für eine FDP überhaupt noch eine eigenständige Existenzberechtigung gibt, abgesehen von ihrer Rolle als neoliberale Steuersenkungs- und Wirtschaftspartei beziehungsweise als Mehrheitsbeschafferin für die CDU. Die erste Frage beantworte ich mit einem klaren Nein. Mein politischer Standort ist und bleibt der einer freischaffenden Liberalen. Das heißt: Ich unterstütze Politiker und Politik gleich welcher Partei, wenn sie freiheitliche und verantwortungsbewusste Positionen durchzusetzen versuchen, so zum Beispiel Joachim Gauck anlässlich seiner überraschenden Kandidatur für das Amt des Bundespräsidenten. Im Laufe der Jahrzehnte hat sich in mir die Erkenntnis gefestigt, dass ich als »Parteisoldatin« ziemlich unbrauchbar bin und mich mit den Alltagszwängen, die ja nicht nur Kompromisse, sondern andauernd auch Konzessionen verlangen, schwertue. Liberal zu sein, das ist für mich heute eher eine parteiübergreifende Allianz – eine Haltung, die sich nicht in einer Parteiprogrammatik einfangen und auf Hochglanzpapier festschreiben lässt. Auch unter den FDP-Mitgliedern gibt es übrigens solche Liberale – mit denen ich mich nach wie vor verbunden fühle.
Die zweite Frage, die nach der Zukunft einer liberalen Partei in Deutschland, vermag ich nicht zu beantworten. Dazu gibt es zu viele unbekannte Herausforderungen, nicht zuletzt die langfristigen Folgen der elektronischen, digitalen und wissenschaftlichen Veränderungen sowie die drohenden globalen Katastrophen. Es ist sehr zu hoffen, dass es auch auf diese Entwicklungen wieder liberale Antworten geben wird – mit oder ohne eine Partei, die ständig am Existenzminimum laborieren und taktieren muss.
1. Auflage © 2011 beim Albrecht Knaus Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH Gesetzt aus der Adobe Caslon von Buch-Werkstatt, Bad Aibling
eISBN 978-3-641-08428-8
www.knaus-verlag.de
www.randomhouse.de
Leseprobe





























