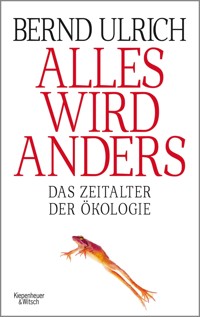
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Alles wird anders - Ein Appell für radikales Umdenken in der Klimapolitik Klimawandel, Artensterben, Ernährung: Die ökologischen Widersprüche verschärfen sich und die politischen Auseinandersetzungen um unsere ganze Lebens- und Produktionsweise werden härter. Die Ökologie ist endgültig kein Thema mehr unter anderem, sie wird zum zentralen Aggregatzustand der Politik. Im nicht enden wollenden Sommer 2018 ist den Bürgerinnen und Bürgern die schwache ökologische Bilanz der Merkel-Jahre ins Bewusstsein getreten. Die Grünen konnten deswegen ihre demoskopischen Werte verdoppeln. Klimapolitisch stehen immer öfter Stunden der Wahrheit an: Verkehrswende, Energiewende, Agrarwende – die Eingriffe, die nötig sind, um die Erderwärmung zu begrenzen, sind tief und werden reale Verlierer und Gewinner haben. Sie bergen Chancen und Schmerzen. Kein Wunder, dass der Streit nun ins politische Zentrum rückt und Themen wie soziale Gerechtigkeit, Demokratie und Menschenrechte neu beleuchtet. Bernd Ulrich zeigt in Alles wird anders, wie es gelingen kann, die Blockade in der Klimapolitik zu überwinden und neue Freiheiten und Zuversicht zu gewinnen. Ein Buch, das zum Umdenken anregt und Lösungswege in der Klimakrise aufzeigt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 210
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Bernd Ulrich
Alles wird anders
Das Zeitalter der Ökologie
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Bernd Ulrich
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Bernd Ulrich
Bernd Ulrich, geboren 1960 in Essen, stellvertretender Chefredakteur und Leiter des Politikressorts der ZEIT. Für seine journalistische Arbeit erhielt er 2013 den Henri-Nannen-Preis und 2015 den Theodor-Wolff-Preis. Bei KiWi erschienen bisher: »Sagt uns die Wahrheit! Was was Politiker verschweigen und warum« (2015) und »Guten Morgen, Abendland – Der Westen am Beginn einer neuen Epoche« (2017).
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Klimawandel, Artensterben, Ernährung: Sind wir radikal genug?
Die ökologischen Widersprüche verschärfen sich, die politischen Auseinandersetzungen um Klimawandel, Artensterben, Ernährung, ja unsere ganze Lebens- und Produktionsweise werden härter. Die Ökologie ist endgültig kein Thema mehr unter anderem, sie wird zum zentralen Aggregatzustand der Politik.
Warum ist das so? Im nicht enden wollenden Sommer 2018 ist den Bürgerinnen und Bürgern die schwache ökologische Bilanz der Merkel-Jahre ins Bewusstsein getreten. Die Grünen konnten deswegen ihre demoskopischen Werte verdoppeln.
Hinzu kommt, dass klimapolitisch immer öfter Stunden der Wahrheit anstehen: Verkehrswende, Energiewende, Agrarwende – die Eingriffe, die nötig sind, um die Erderwärmung leidlich zu begrenzen, sind tief, die anstehenden Veränderungen werden reale Verlierer und Gewinner haben, sie bergen Chancen und Schmerzen. Kein Wunder, dass der Streit nun ins politische Zentrum rückt und alle anderen Themen neu beleuchtet – von der sozialen Gerechtigkeit bis zur Demokratie und den Menschenrechten.
Die politische Kultur des Landes ist darauf nicht vorbereitet. Immer noch wird nicht nach einer Politik für die Probleme gesucht, sondern umgekehrt: Die Probleme werden so zurechtgestutzt, dass sie auf die Politik passen, die wir kennen. Diese Verdrängung der ökologischen Herausforderung aber neurotisiert unsere Gesellschaft. Bernd Ulrich zeigt, wie es gelingen kann, diese Blockade zu überwinden und neue Freiheiten und neue Zuversicht zu gewinnen.
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
Dieses Buch wurde in den bewegten Wochen im Frühjahr 2019 geschrieben. Selten wurde so scharf und so breit über die Klimapolitik gestritten, das hat dieses Buch motiviert und beeinflusst. Geholfen hat mir dabei mein Sohn Fritz Engel, er hat recherchiert, alle Thesen mit mir durchdiskutiert und am Ende einige Passagen formuliert. Auch sein Denken und sein Engagement stecken in den folgenden Seiten.
© 2019, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Covergestaltung: Rudolf Linn, Köln
Covermotiv: © Buiten-Beeld / Alamy Stock Foto
ISBN978-3-462-32050-3
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung dieses Werks für Text- und Data-Mining im Sinne des § 44b UrhG bleibt explizit vorbehalten.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Sorge, Hoffnung, etwas Scham und eine neue Freiheit – zur ökologischen Biografie eines Babyboomers
1. Wissende Ignoranz – wie man das Offensichtliche übersieht
2. Rebellion der Wirklichkeit – warum das Klima den deutschen Konsens sprengt
3. Verlorene Magie der Mitte und Extremismus der Normalität
4. Menschheitsneu – der Unterschied zwischen dem 20. und dem 21. Jahrhundert
5. Radikaler Realismus, mürbe Mythen
6. Leugnen, Tricksen und Verdrängen
7. Freiheit
8. Gerechtigkeit
9. Sinn
10. Auswege
Zum Schluss – Ökologische Aussichten eines Babyboomers
Danksagung
Literatur
Verwendete Quellen (chronologisch)
Meinen Kindern:
Alma, Franziska, Fritz, Luise und Rosa
Sorge, Hoffnung, etwas Scham und eine neue Freiheit – zur ökologischen Biografie eines Babyboomers
Ein Vorwort
»Deutschland hat seine Vorreiter-Rolle beim Klimaschutz verloren« – der Satz, gesprochen von Deutschen, hört sich so an, als wäre Deutschland jemand anders. Dabei wird dieses Land ja gemacht von den Menschen, die darin leben, in den letzten ein, zwei Jahrzehnten insbesondere von einer speziellen Generation, den Babyboomern, jenen Menschen aus den geburtenstarken Jahrgängen um 1960. Wir sind die meisten, wir haben nun lange dominiert, in der Politik, in den Medien, in den Schulen, in der Verwaltung und in der Wirtschaft. Und wir sind in gewisser Weise die erste grüne Generation oder haben uns das jedenfalls eingeredet, weil der Anfang unseres Erwachsenenlebens mit der ökologischen Bewusstwerdung der westlichen Welt in eins fiel, irgendwann in den 70ern war das wohl.
Der Satz »Deutschland hat seine Vorreiter-Rolle beim Klimaschutz verloren« muss also eigentlich heißen: »Wir, die Babyboomer, haben die Vorreiter-Rolle Deutschlands aufgegeben.« Wir haben den Faden verloren, wir waren abgelenkt, wir haben es zugelassen, dass wir selbst nun an einem Punkt angekommen sind, an dem nur noch eine radikale ökologische Wende ein ökologisches Desaster verhindern kann. Es ist ein Problem entstanden, das durch Moderieren, durch Maß und Mitte nicht mehr zu bändigen ist. Schreck lass nach! Dabei war es doch genau das, was wir am besten konnten, wir haben uns an der Generation Schmidt/Kohl und den 68ern vorbei gewissermaßen an die Macht moderiert, weniger biografisch versehrt als die einen, weniger ideologisch aufgedreht als die anderen. Und jetzt das! Ausgerechnet wir, die sanfteste und die grünste Generation, die je in Deutschland an der Macht war, wir haben diese Zuspitzung der Wirklichkeit zugelassen, wenn nicht gar verursacht. Offenbar sind wir nicht nur die erste Generation, die mit der Ökologie aufwuchs, sondern auch die letzte, die das Thema Klima erfolgreich verdrängen konnte. Was war bloß los mit uns, was bleibt jetzt noch zu tun? Wie erklären wir uns unseren Kindern, was geben wir ihnen mit?
Die ökologische Debatte krankt an dem, woran alle großen und wichtigen Debatten in diesem Land, aber auch viele Gespräche von Mensch zu Mensch kranken: Die Schuldfrage wird zu wichtig genommen. Jeder weiß, woher diese Gewohnheit kommt, aber wo sie außerhalb der dunklen deutschen Vergangenheit aufgeworfen wird, da richtet sie viel Schaden an: Der Weg zu den Ursachen wird überlagert von der Frage nach der Schuld. Das gilt nicht zuletzt auch für uns Babyboomer: Wenn wir wegen unserer enttäuschenden Bilanz angeklagt werden oder uns selbst anklagen, so wird die Erinnerung sogleich moralisch abgedichtet, mit einem Satz wie »Wir haben uns doch bemüht« verklebt. Davon wird man nicht klüger.
Auf der anderen Seite krankt unsere Debatte über Ökologie auch daran, dass oft nicht klar ist, wer da spricht, wie er oder sie zu ihren Einsichten gelangt ist. Darum möchte ich dieses Buch, das nicht weniger versucht, als die Voraussetzungen einer grundlegenden Wende zu denken, mit einem kurzen Abriss meiner eigenen Ökobiografie beginnen. In der geht es nicht in erster Linie um meine Schuld oder meinen CO2-Abdruck, sondern um Ursachen und die Genese: Wie sind wir in die ökologische Sackgasse der Gegenwart geraten?
Ich bin am 17. Oktober 1960 in Essen geboren, Mutter Schildermalerin, Vater Landschaftsgärtner, Patentante Wirtin, Patenonkel im Bergbau. Es wäre falsch zu sagen, dass ich mich an die 60er-Jahre genau erinnere. Manches ist mir im Gedächtnis geblieben, anderes sind Fotos, Erzählungen der Verwandten, Filme, nicht zuletzt der Reim, den ich mir im Rückblick mache. Dies vorausgeschickt, erinnere ich mich mit als Erstes an Männer, die Blut in Stofftaschentücher husteten. Diese Männer müssen Bergleute gewesen sein oder Raucher, meistens ja beides, mich haben sie befremdet und schockiert, aber zugleich empfinden Kinder alles als normal, sie haben ja keinen Vergleich. Im Nachhinein ist klar: Diese Männer verkörperten den verrückten Stolz des Ruhrgebiets, weil sie sich aufgeopfert haben, ihre Körper hingegeben haben, um die große Maschinerie anzutreiben, den Fortschritt. Der Fortschritt griff damals ohnehin schwer um sich, ich gehöre zur Generation Contergan, ein damals neues Mittel für Schwangere, das zu Missbildungen bei den Neugeborenen führte. Wenn ich heute Menschen mit verkürzten Armen sehe, weiß ich gleich: Altersgenossen. Als ich anfing fernzusehen, wurde die erste Mondlandung gezeigt, kurz darauf wurde das Fernsehen farbig, und damit die ganze Welt. Auf die Idee, dass Zukunft und Vorne dasselbe sind, brauchte ich also gar nicht selber kommen, sie umgab mich von Anfang an wie die schlechte Luft und das Pitralon-Rasierwasser meines Vaters.
Trotzdem standen erst einmal die Bergleute im seelischen Zentrum, die hustenden Helden des Reviers. Vom Himmel regnete es oft gelb, das war der Schwefel von den Kokereien. In Altenessen, wo meine Oma wohnte, wurde die Wärme noch in Gestalt von Eierkohlen in die Keller gekippt, dann in den vierten Stock geschleppt, eine Plackerei. Die neuen Plastik-Mülleimer trugen die Aufschrift: »Bitte keine heiße Asche einfüllen«. Dass die Wärme nicht nur Asche hinterließ, sondern auch Kohlendioxid, wussten wir damals nicht. Die Kälte für die Konditorei im Parterre kam übrigens noch in riesigen Eisblocks auf den Schultern imposanter Männer (ich war erst 80 Zentimeter groß). Mein Vater war immer auf Baustellen, es wurde unendlich viel gebaut. So viel wie im Krieg zerstört worden war, und dann noch mehr. Meine Mutter malte Leuchtreklamen für Stauder-Bier, alles musste fließen, erst recht das Pils, es war ja sonst nicht auszuhalten.
Man muss sich das Ruhrgebiet zu der Zeit als Austragungsort einer gewaltigen Materialschlacht vorstellen. Wir Kinder spielten in den Brachen und hatten unsere eigenen Schlachten: Wir bewarfen uns mit China-Krachern und schmissen Haarspray-Dosen (mit FCKW, aber auch das wussten wir natürlich nicht) in unsere Lagerfeuer, damit sie explodierten. Als Jugendlicher arbeitete ich auf dem Bau, es wurde viel Material verschwendet, es wurde auch geklaut, Kupferkabel zum Beispiel, auch mal eine Wagenladung Pflastersteine. Das Ruhrgebiet war voller Material, so schien es mir. Es gab aber auch die kleinen Gärten mit Rhabarber und Petersilie von den Tanten, Gerti und Hedwig, die irgendwie alleinstehend waren, zu viele Männer waren im Krieg geblieben, da konnte nicht jede einen haben, vielleicht waren die Tanten aber auch froh darüber.
Leicht schien mir das alles nicht zu sein, aber es gab Belohnungen. Das Essen vor allem. Meine Oma, die im Krieg gehungert hatte, aß Unmengen an Kartoffeln, Fleisch, Kohl, immer alles »mit einem Stich guter Butter«. Für ein Pfund Butter konnte man im Krieg zeitweise einen Perserteppich bekommen. Sie ging immer zu den Billig-Discountern, kaufte Dosen, meist zu viele, aber wenn noch mal Krieg kommt … Belohnungen waren auch die Reisen an den Rhein, Boppard: »Wenn das Wasser im Rhein goldner Wein wär’, möcht’ ich ein Fischlein sein«. Ja, es wurde getrunken, hoch die Pokale.
Für die Jüngeren wie meine Eltern bestand die Belohnung darin, dass es allmählich besser wurde, immer besser. Keine Kohleöfen mehr, sondern Zentralheizung mit Öl. Kein Sonntagsbraten mehr, sondern Alltagsbraten. Und dann zum ersten Mal fliegen, mit einer Propeller-Maschine nach Las Palmas. Wo liegt das? Vor Afrika! Wow! Und die Autos: zuerst ein VW-Käfer, als Nächstes ein Variant 411, dann Opel-Kommodore, endlich: Mercedes, irgendwann sogar zwei Autos. Später wurden die Autos dann wieder kleiner, etwas war schiefgelaufen. Sobald ich 15 war, durfte ich auch mitmachen beim Verbrennen von Benzin, ein Mofa von Zündapp, zwei Gänge, leicht zu frisieren. Bei größeren Familienfeiern standen die Männer zusammen und diskutierten ihre Anfahrtswege, fachmännisch über Karten gebeugt: Die B 1 nehme ich nicht, ist immer Stau, und am Kamener Kreuz? Diese Gespräche waren ein irgendwie kultischer Akt, sie dauerten jedenfalls sehr lange, gefühlt bis zur Abfahrt.
Was ich wohl dabei gelernt habe, ohne es mir recht bewusst zu machen: Fortschritt hat mit Materie zu tun, aber auch mit Ehre, Konsum ist Belohnung, man kann auch große Dinge damit vergessen, den Krieg etwa, und kann es doch nicht. Aufstieg hat mit Autos zu tun, überhaupt mit Produkten. Einmal, da war ich vielleicht neun, bin ich mit meinen Eltern zu einem Edeka-Geschäft gefahren, an einem Sonntag, wir waren die einzigen Kunden und durften so viel nehmen, wie wir wollten, es ging nämlich darum, bei den Ladenbesitzern Außenstände einzutreiben, weil sie sich von meinem Vater einen Garten hatten anlegen lassen und dann nicht bezahlen konnten. Sonntags, Edeka, soviel man will. War das schon das Paradies?
Nein. Spätestens in den frühen 70ern begann eine zweite Geschichte, und in der gab es autofreie Sonntage, weil die OPEC das Öl verknappt hatte. Es war also doch nicht endlos. Und im Fernsehen sah man Vögel, die nach einer Havarie im Schweröl starben. Und plötzlich, so mit 13, 14, merkte ich, dass im Ruhrgebiet nicht nur Bergleute starben, sondern auch Biotope, Vögel, Amphibien. Zwei Freunde von mir waren Ornithologen, sie verstanden wirklich etwas davon, ich lief zwar nur so mit, las aber auch immer mehr über das neue Wort: Ökologie. Oft saßen wir in der Dämmerung an irgendwelchen Obstwiesen und lauschten auf die Steinkäuze, einmal befreiten wir einen Bach aus seinem zu eng gewordenen Bett, um sumpfiges Gelände zu schaffen. Gut, wir waren auf der Schule in einer reinen Jungsklasse, keine Mädchen in der Nähe. Das mit der Ornithologie hatte also womöglich noch andere Ursachen als Tierliebe, aber immerhin, ein Samen war gelegt, ein paar Grundkenntnisse vorhanden.
Unter der Hand war ich als Jugendlicher ein politischer Mensch geworden, Urprägung grün, lange bevor es die Partei gleichen Namens überhaupt gab. Zum Philosophie-Studium wechselte ich nach Marburg, ein Zufallstreffer bei meiner Zukunftsplanung, im Vergleich zum großartigen, großkotzigen Ruhrgebiet eine Märklin-Welt, hier erholte ich mich von meiner Kindheit. Ganz organisch, ohne besonderen Beschluss wuchs ich in die Öko- und Friedensszene hinein. 1980 dann ein erstes prägendes Erlebnis, unvergessen bis heute. Um das geplante atomare Endlager in Gorleben zu verhindern, hatten Aktivisten das sogenannte Bau-Los 1004 besetzt, wo Probebohrungen vorgenommen werden sollten. Ein Hüttendorf war entstanden, um das zu verhindern. Dort wurde Basisdemokratie praktiziert, ökologische Ernährung eingeübt, ein alternatives Leben. Hier lernte ich, was Tante Hedwig aus dem Rhabarber auch hätte machen können: Saft, naturtrüb. Ich war 19 und fasziniert, erstmals schien mir eine ganz andere Art von Leben möglich, gewissermaßen das Gegenteil meiner Kindheit. Zugleich spürte ich nach einer Weile die wachsende Nervosität in unserem Hüttendorf. Die von der niedersächsischen Landesregierung angedrohte Räumung schwebte über allem, und ich wusste damals nicht, ob sie womöglich sogar eine Erlösung sein würde, denn die Spannungen unter den Aktivisten nahmen zu: Alternativ zu leben – wer von uns hatte das schon wirklich geübt? Am 4. Juni 1980 war es dann so weit. Die Staatsmacht rückte an, aber wie: Schützenpanzer, Helikopter, Grenzschützer mit geschwärzten Gesichtern, der Staat spielte Bürgerkrieg, man wollte uns einschüchtern. Und ich war eingeschüchtert. Ohne jeden Widerstand ließ ich mich abtransportieren. Was ich gelernt hatte: Es gibt vielleicht eine Alternative. Und: Was müssen da für Interessen auf dem Spiel stehen, wenn der Staat sich so gebärdet? Die Sache mit der Ökologie ist offenbar richtig ernst. Es hat lange gedauert, bis mir beides wieder so klar war wie an jenem warmen Junitag, als ich mit schlotternden Knien im Gefangenenbus saß.
Ach so, zwischendurch ist eine Delegation der Jusos zu Besuch im Hüttendorf gewesen und hat irgendwas verlesen. Mich interessierte das nicht sonderlich, als Ruhrpott-Kind wusste ich, dass von Sozis (damals) ökologisch nichts zu erwarten war. Und deswegen lernte ich Gerhard Schröder erst zwei Jahrzehnte später, als Journalist, kennen.
In diesen Jahren hatte ich auch meine erste vegetarische Phase, was man sich mindestens so exotisch und auch schwierig vorstellen muss wie heute vegane Ernährung. Politisch stand Anfang der 80er dann aber erst einmal die Friedensbewegung im Vordergrund, nach dem Studienabschluss schließlich Zivildienst. Irgendwo im politischen Gewusel dieser Zeit lernte ich bei einer Podiumsdiskussion Antje Vollmer kennen, und als diese zu einer der Chefinnen der grünen Bundestagsfraktion gewählt wurde, machte sie mich zu ihrem Büroleiter, das war 1988, ich war 27 und überfordert. Die Grünen lagen damals in einem tiefen Streit, zwischen den sogenannten Fundis und den Realos. Wobei allerdings beide Flügel eine gewisse linke Grundskepsis gegenüber ihrem Land in sich trugen, was sich dann wenig später fatal auswirken sollte. Die deutsche Linke hatte traditionell ein prekäres Verhältnis zur Mehrheit der Deutschen, sie schien ihnen aufgrund der Geschichte verdächtig. Natürlich waren den Linken nur die anderen Deutschen verdächtig, sie selbst nicht, sie waren ja links. Und als dann die deutsche Einheit »drohte« und noch einmal 16 Millionen Deutsche hinzukommen sollten, schien den Linken, auch denen bei den Grünen, Realos wie Fundis, die kritische Masse von Deutschen – wieder – erreicht. Darum fanden sie kein positives Verhältnis zur deutschen Einheit. Im Bundestagswahlkampf 1990 versuchten die Grünen dann, mit dem neu entdeckten Klimawandel zu punkten und die eigene verkorkste Deutschlandpolitik zu überdecken. »Alle reden von Deutschland, wir reden vom Wetter« – so lautete damals ein Wahlslogan. Doch natürlich gelang es nicht, die linken Altlasten mit dem neuen Thema Klima im Handumdrehen verschwinden zu lassen. Denn die Wählerinnen und Wähler haben gemerkt, dass da das Klima nur instrumentalisiert wurde – die Grünen flogen aus dem Bundestag, und das Thema Klima wurde auch dank seines Missbrauchs durch die Grünen vorerst vertagt. Ich selber flog mit aus dem Bundestag, zweieinhalb Jahre Parteipolitik, das war’s dann. Für immer. Ich fand mich zum zweiten Mal als Arbeitsloser wieder und musste mich nach einem Job, nach einem Beruf umschauen. Ich schrieb zunächst Artikel in abgelegenen Publikationen zu ökologischen Fragen und landete dann nach einigen Umwegen – unter anderem bei einer Zeitung, der ostdeutschen Wochenpost, die dann dichtgemacht wurde – und einer dritten Phase der Arbeitslosigkeit doch noch im »richtigen« Journalismus.
Hatte ich hier schon meinen Faden verloren? Gewiss nicht, eher wurde er vom Leben noch stärker gewirkt. Dennoch hatte sich noch etwas anderes etabliert, ohne dass ich es zu dem Zeitpunkt schon recht gemerkt hatte, eine zweite Triebkraft neben meinem ständigen Verändern-Wollen und Schreiben-Müssen. Aufstieg, sich etablieren wollen, das war zwar nie meine primäre Motivation gewesen, aber in gewisser Weise etwas noch Gefährlicheres: eine Art Begleitdroge meines Lebens, ein Zusatz, der dann irgendwann auch mal das Eigentliche zudecken sollte.
In meiner Zeit beim Berliner Tagesspiegel fügte sich mein neuer Beruf noch sehr gut mit meinem Lebensthema – unter anderem hatte ich 1997 die Gelegenheit, die damalige Umweltministerin Angela Merkel zur Klimakonferenz nach Kyoto zu begleiten, zur Geburtsstunde der globalen Klimapolitik. Ein Jahr später eroberten die Grünen die Regierungsmacht. Wenn man das so sagen will, tatsächlich waren sie der viel kleinere Partner in der ersten rot-grünen Bundesregierung. Die leitete neben einer moderaten Energiewende und einem allmählichen Ausstieg aus der Atomenergie (Meine Kämpfe in Gorleben, später Wackersdorf, Brokdorf und so weiter hatten sich doch gelohnt!) auch viele andere ökologische Maßnahmen ein. Und so ergab sich eine für mich angenehme Situation: Meine eigene, späte Etablierung als Journalist verlief parallel zu einer ersten zaghaften Ökologisierung der Republik.
Kinder kamen, insgesamt drei, und Kinder sind ja etwas Wunderbares, vor allem auch: eine wunderbare Ausrede. Zum Beispiel dafür, nicht ganz so ökologisch zu leben, wie man sich das vorgenommen hatte. Mit jedem Kind wuchs die Größe des Autos. Schließlich war es ein Volvo V70, das Auto für Leute, die gern ein großes Auto haben, es sich aber zugleich nicht eingestehen möchten. Aufstieg durch Ausdehnung, so hatte ich es in der Kindheit gelernt, und so schlich es sich auch wieder in mein erwachsenes Leben. Privat schwankte ich beständig zwischen vegetarischen Phasen und solchen mit Fleisch, gar nicht so wenig Fleisch, wenn ich mich recht erinnere, aber bio. Was ließ mich so schwanken?
Außerdem Rushhour des Lebens. Sie wissen schon, man war sehr beschäftigt, zu beschäftigt vielleicht, um die beiden nächsten Wendepunkte im Leben mit vollem Bewusstsein anzugehen: für mich persönlich der Wechsel zum Zentralorgan der mittleren Vernunft, in die Mitte der Mitte der Republik, die völlige Etablierung, aber auf die gute Art. Ich ging zur ZEIT, dem Volvo unter den Zeitungen, ganz drin, ganz oben, aber mit einem Schal über der Schulter und einer Tüte skeptischer Fragezeichen in der Jackentasche. Aus Lakritz.
Und dann, 2005, wechselte die Regierung, die Schwarzen kamen an die Macht, die Anti-Ökologen. War man also wieder Minderheit, musste man zurück auf die Straße oder als gewissermaßen geborener Öko wenigstens so schreiben? Aber nein, doch nicht, einerseits war zwar die CDU an der Regierung, andererseits aber auch Angela Merkel. Die Klimakanzlerin, so wurde sie damals tatsächlich genannt, weil sie an ihrer Politik als Umweltministerin festzuhalten schien. Und der Schein trog auch mich ganz angenehm.
Tatsächlich war die Umweltpolitik von Schwarz-Rot, später dann von Schwarz-Gelb in etwa so lasch wie mein Leben als aufgestiegener Mensch und Charlottenburger Bildungsbürger. Wobei ich dann immer noch zu sehr Ökologe und auch zu sehr Ruhrpott-Kind blieb, um mich in all dem rundum wohlzufühlen. Das Unbehagen reichte aber nicht für eine Umkehr, ein bisschen bio und öko genügten mir vorerst. Und ich lernte in meiner neuen beruflichen Rolle etwas, das mir seinerzeit gar nicht bewusst war, nämlich das Betriebsgeheimnis des etablierten Journalismus. Als Journalist ist man ja ein wenig zur Originalität verpflichtet, wegen der Langeweile und so, was mir leichtfiel, weil ich eine für Journalisten ungewöhnliche Biografie hatte. Man sollte und wollte dabei allerdings nicht zu oft und sehr von einer gedachten Mitte abweichen; selbstverständlich gab es keinerlei Zwang, es war eher eine Art vorauseilender Abstiegsangst des Kindes aus kleinen Verhältnissen, ich traf also eine Art unbewusstes Arrangement. Im Grunde besteht die Kunst im Journalismus (neben Fleiß und Talent) darin, die Standardabweichung zu jener imaginären Mitte intuitiv zu ahnen, weit genug weg, um nicht langweilig zu sein, nah genug dran, um nicht marginalisiert zu werden.
Das hört sich jetzt korrupter an, als es war, denn schließlich lief das Konzept der Mitte-Politik recht gut, das Land wurde weiblicher, schwuler, ökologischer, freundlicher, vielleicht nicht sozialer, aber da guckte man nicht mehr so genau hin, bisschen vergessen das Spielen in den vermüllten Brachen der Heimat, die kurzen kleinen Schlägereien an den Sozialbauten, lange nicht mehr in Boppard am Rhein gewesen. Und dann kam auch noch Fukushima, und es geschah das ganz große Wunder: Die CDU, jene Partei, die uns 1980 in Gorleben einen kleinen Bürgerkrieg gegen Umweltschützer hingelegt hatte, diese CDU stieg aus der Atomkraft aus und leitete eine zweite Energiewende ein. Konnte das denn wahr sein? Am Tag der Ausstiegs-Entscheidung von Angela Merkel veröffentlichte die TAZ auf der Titelseite ein altes Foto aus den späten 70ern von ein paar zotteligen Typen, die irgendeinen AKW-Bauplatz besetzt hatten, und schrieb drüber: »So sehen Sieger aus!« Und was soll ich sagen: Einer der Typen sah genau so aus wie ich. Wie ich früher. War die CDU so ökologisch geworden – oder meine Ökologie so bescheiden? Letzteres fragte ich mich aber ehrlicherweise zunächst nicht.
Das war ein Fehler. Hier habe ich den Faden verloren.
Vielleicht lag es daran, dass die Energiewende zunächst ganz gut lief, vielleicht daran, dass ein ehemaliger Marburger Kommilitone, mit dem ich früher Straßenblockaden organisiert hatte, Staatssekretär wurde und die Energiewende gewissermaßen managte. Ich dachte oder wollte denken: Wenn der das macht, dann wird das was. Und wenn es nichts wird, dann macht er es nicht mehr.
Nach der Bundestagswahl 2017 hörte er aber auf. Was Union und SPD zusammen vereinbart hatten, glaubte er nicht mehr managen und schon gar nicht verantworten zu können. Mein Freund seit Marburger Tagen ging erst mal auf Weltreise, in einem Jeep, aber mit Solardach, und er fährt nicht nur so rum, er ist auf ökologischen Pfaden unterwegs, besucht Naturreservate und futuristische Solaranlagen. Weg ist er trotzdem.
Anders als ich.
Immerhin besann ich mich, nahm endlich zur Kenntnis, dass der ökologische Konsens in Deutschland durchaus zur Beruhigung meines ökologischen Gewissens diente, nicht so sehr allerdings zum Nutzen der Natur, schon gar nicht der Klimawende. Für diese Erkenntnis habe ich ein paar Jahre zu lange gebraucht. Hätte ich nicht auf die Politik gestarrt, auf die Mitte, auf das Gewusel des Gesagten und den Kreis des Sagbaren, hätte ich nicht Angst gehabt, zu weit von der Mitte abzuweichen – sondern hätte ich einfach nur auf die Zahlen, die ökologischen Fakten geschaut, ich hätte meine Wende schon weit früher vornehmen können. Oder müssen.
Irgendetwas in mir hatte schon länger geahnt, dass die verdächtige Harmonisierung von Leben, Politik, Etablierung und Gewissen nicht mehr zu halten war. Als mir mein Sohn im Sommer 2017 mitteilte, er ernähre sich fortan vegan, brach es aus mir ohne Zögern heraus: ich mache mit. Zunächst war das sehr privat, es ging um Gesundheit, aber auch darum, wieder mehr in Übereinstimmung mit meinen Werten und Idealen zu leben. Doch dabei sollte es nicht bleiben. Eine Dynamik kam in Gang.
Wenig später begann ich im politischen Ressort der ZEIT dafür zu werben, das Ökologische außerhalb von Klimakonferenzen nicht länger den Ressorts Wissen und Wirtschaft zu überlassen, sondern ins Zentrum unserer Arbeit zu stellen. Die Kolleginnen und Kollegen machten mit, und viele Leser sagten: endlich.
Im Sommer 2018 schrieb ich dann einen Artikel mit dem Titel »Verschärfte Wahrnehmung«, in dem ich über meine Erfahrungen nach einem Jahr veganer Ernährung berichtete. Es ging um Körperliches, Ethisches, Kulinarisches. Es wurde einer meiner erfolgreichsten Artikel überhaupt, gemessen an der Resonanz. Aber »vegan«, das war nun nicht mehr nur originell – das war einfach ein Millimeter zu weit weg von der Mitte, es gab Beschwerden, Gerede aus dem politischen Berlin, kein Wunder, im Kabinett gibt es nur eine einzige Vegetarierin (Ursula von der Leyen), kein einziger führender Grüner bekennt sich zu einer veganen Lebensweise, Veganismus war offenbar eine Mode, der man dort lieber nicht nachgeht. Der Ulrich spinnt, hieß es hinter vorgehaltener Hand. Plötzlich war ich wieder Minderheit, wer hätte das gedacht und gewollt, ich nicht. Es ist halt passiert.





























