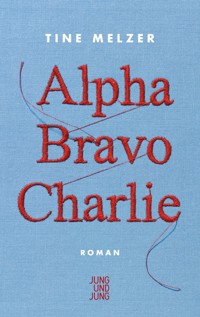
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jung und Jung Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Früher einmal war Johann Trost Pilot, heute ist er pensioniert. Früher war er außerdem Ehemann, heute ist er geschieden. Dennoch ist er immer noch treu, nicht nur seiner Exfrau, sondern auch sich selbst: Er ist zuverlässig, er schwört auf Regeln und Disziplin, er hat Prinzipien und weiß, was er mag und was er sich lieber vom Leib hält. Seine Mitmenschen zum Beispiel. Als er noch Uniform trug und im Dienst war, waren sie entweder seine Passagiere oder weit unter ihm, jetzt, als frisches Mitglied einer fidelen Freizeitgesellschaft, fühlt er sich plötzlich in Bedrängnis: Selbst Nichtigkeiten wie das Schuhwerk der Nachbarn wecken seinen Ordnungssinn. Um wieder den richtigen Abstand zu den Menschen und den Dingen zu gewinnen, beginnt er eines schönen Tages um 9.17 Uhr, die Welt auf eine erträgliche Größe zu schrumpfen, und wird zum Schöpfer einer Modellbaulandschaft.Tine Melzer erzählt in ihrem Debütroman mit hinreißender Komik von einem Menschen, der uns in seiner zuverlässigen Durchschnittlichkeit sofort ans Herz wächst. Auch weil er an etwas leidet, das uns alle betrifft: Wo ist unser Platz im Leben außerhalb des Cockpits? Wem sind wir dann zugehörig? Und was kann uns vor dem Absturz retten?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 127
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
© 2023 Jung und Jung, Salzburg
© Tine Melzer 2023
Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten
Umschlaggestaltung: Tine Melzer mit Nadja Niemann und Mathias Zuppiger;
Entwurf und Umsetzung: BoutiqueBrutal.com
ISBN 978-3-99027-194-0
TINE MELZER
Alpha Bravo Charlie
Roman
Inhalt
Neun Uhr siebzehn
Neun Uhr sechsundvierzig
Zehn Uhr eins
Zehn Uhr dreißig
Elf Uhr zwei
Zwölf Uhr zehn
Dreizehn Uhr fünfunddreißig
Vierzehn Uhr achtundzwanzig
Fünfzehn Uhr dreiundvierzig
Sechzehn Uhr
Sechzehn Uhr fünfzig
Siebzehn Uhr fünfzig
Neunzehn Uhr elf
Neunzehn Uhr zweiundfünfzig
Einundzwanzig Uhr fünfzehn
Einundzwanzig Uhr zweiundzwanzig
Einundzwanzig Uhr fünfzig
Neun Uhr siebzehn
Für eine Landschaft braucht es Bäume, sagt der Inhaber des Modellbauladens, etwas Gebüsch, ein paar Felsen und einen kleinen Bach. Den Miniaturgrasstaub in kleinen Plastiktüten und die Dose mit Kunststoffwasserimitat habe ich gerade gekauft, auch die Bauplatte, als Fundament. Miniaturlaub ist ausverkauft, Schnee gibt es keinen. Meine Papiertragetasche ist voller Zutaten für die ideale Landschaft, zu der mich der Ladenbesitzer ermuntert: Es wird immer schön, wenn es selbstgemacht ist. Ich bitte um sehr kleine Menschenfiguren, kleiner als das übliche Modellbaupersonal. Er ist enttäuscht, weil er die letzte Packung 1:200 nicht finden kann. Selten, dass ein Kunde darum gebeten habe in den letzten Jahren, so was will schon lange niemand mehr. Ich kaufe erst mal zwölf Menschen, vielleicht brauche ich sie später doch noch, auch wenn sie im Format 1:65 eigentlich zu groß sind für den Maßstab in meinem Kopf.
Jede Landschaft kenne ich nur flüchtig, ich kann sie nicht beschreiben. Draußen ist nichts flach, nichts unbewohnt. Es ist kein weiter Weg, eine halbe Stunde mit der Tram ans andere Ende der Stadt, vom Modellbauladen am Berg zurück nach Hause. Die Tramfahrt muss sein. Auf der Tagesfahrkarte des öffentlichen Nahverkehrs steht der Tarif, darunter das Wort Erwachsene. Diese Kategorie erscheint mir ungenau, Ausgewachsene wäre treffender.
Ich sitze inmitten anderer zufällig Anwesender, die wie am Strand mit maximalem Abstand zueinander Platz nehmen. Die Tram leert sich, je weiter es nach Norden geht. Nun sitzen manchmal Fremde vereint nebeneinander gegenüber einer leeren Sitzbank und schweigen. Als ich dem Passagier vis-à-vis auf die Schuhe schaue, denke ich gerührt an das tägliche Auf- und Zubinden der Schnürsenkel.
Abweisend wirken, kein Blickkontakt, nur mit den eigenen Leuten sprechen und dafür sorgen, dass es nicht zu viele werden. Fremde akzeptieren, wenn es einen Vorteil bringt. Jedes Lächeln muss sich lohnen. Zuspruch brauche ich nur von engsten Freunden. Nichts geht in mich hinein, ohne von mir gedacht oder gefühlt zu werden. Ich brauche mich auf eine unheimliche Weise. Die Welt ist schön, wenn die Menschen sich leise darin bewegen. Kein Wort soll lauter sein als die Stimme der Meeresbrandung an einem milden Tag. Ich lebe an einem See in den Bergen.
Als ich meinem Neffen einmal ein Schlaflied sang, ergriff mich eine Traurigkeit, die mich seither nur selten loslässt. Sie lockert ihren Griff nur beim Anblick frischer Prussiens, beim Tanz mit einem Fremden und wenn ich im Radio zufällig die Goldbergvariationen höre. Onkel sein, aber kinderlos, ist eine gute Rolle für mich. Ein paarmal im Jahr kann ich einem Kind ein Eis kaufen und es ein-, zweimal auf dem Riesenrad fahren lassen. Das hilft gegen die Langeweile. Als pensionierter Kurzstreckenpilot bleibt mir sonst wenig zu tun. Ein ehemaliger Busfahrer der Lüfte, ein ehemaliger Ehemann. Zivile Luftfahrt klingt so friedlich, dabei sind viele Flugpassagiere zu Hause unausstehlich.
Auch in diese Gesellschaft gehöre ich nicht: Gartenvereine, Musikklubs, Kirchenchöre, Wellness-Oasen, Labyrinthe, Einkaufspassagen, Haltestellen. In der Tram halte ich es aus, da will ja niemand umsonst sein.
Meine Einkaufstasche steht zu meinen Füßen. Die verpackten Landschaftsbestandteile sehen von oben aus wie irgendwelche Lebensmittel 1:1. Ich bin zu spät dran für eine gewohnheitsmäßige Ansicht vom Boden aus, entlang des Horizonts und auf ihn zu. Von der Seite, in die Ferne, auf einen Fluchtpunkt hin, horizontal und gestaffelt vor dem Himmel, ist das Land eine -schaft. Auf Bildern liegt jeder Horizont still da. Auf Malereien stilisiert, auf Fotos als Erinnerungsbruchstücke, rechteckig ausgeschnitten. Im Panorama der Tramfenster liegt eine Landschaft, die mich umgibt. Ich trage neuerdings eine Lesebrille bei mir.
Neun Uhr sechsundvierzig
Zu Hause lege ich die Holzplatte auf den Küchentisch, sie passt leicht darauf. Eine kleine Spraydose Elfenbeinfarbe wird später darüber entscheiden, ob die Landschaft im Winter liegt. Ist Schnee nicht noch weißer als Elfenbein? Der gelbliche Lack ist kein guter Ersatz für Pulverschnee aus der Tüte.
Seit ich mich für diese Landschaft entschieden habe, gehen die kleinen Verrichtungen des Tages leichter von der Hand. Nach dem nächsten Kaffee fange ich an. Die Zeitung sieht mich fordernd an und will mir von gestern berichten. Mein schlechtes Gewissen, den Wirtschaftsteil zuletzt oder gar nicht zu lesen. Meine Ungeduld damit, Zeit dafür auszugeben, keinem zu helfen. Wegsehen ist eine kollektive Handlung, der nichtgegangene Trampelpfad. Manche meiner früheren Kollegen treiben Sport oder Enkelkinder durch den Zoo und sehen gesund dabei aus. Auch ihre Haare fallen aus, aber sie wirken glücklicher. Sie haben ein Tagesprogramm, sitzen morgens zusammen mit den Pendlern in vollen Zügen und sind oft nur am Schuhwerk und an ihrer Gesprächigkeit von jenen zu unterscheiden.
Als Zuhausebleibender stelle ich mir vor, wie hilflos ich wäre, wenn ich fliehen müsste, ohne Kreditkarte und Wanderschuhe. Also bleibe ich daheim und schäme mich für mein angetrocknetes Frühstücksgeschirr und die zu große Wohnung. Für wen mache ich morgens mein Bett? Im Kopf ist alles zur Übersichtlichkeit verkleinert, zerkleinert zu Postkartenausschnitten der Welt. Abstandnehmen soll helfen, wenn einem etwas zu nahe geht.
Den Musikgeschmack meines Nachbarn kenne ich besser als sein Gesicht. Sein Radio steht am geöffneten Fenster, und weil es heute zu mild ist für einen Tag im frühen März, höre ich, was er hört. Mir wäre es lieber, meinen Musikgeschmack nicht mit Fremden teilen zu müssen, dann könnte ich sie leichtfertiger ablehnen. Der Nachbar und sein Radio sind keine Gründe, umzuziehen. Die Musik des Nachbarn ist zwar nicht immer meine erste Wahl, aber sie ist ja nicht nur für uns aufgelegt. Pop und damit verbundene Erinnerungen an früher. Ich finde mich damit ab, wie mit dem Wetter, und je schöner es ist, desto mehr höre ich vom Radio. Meistens lauschen wir den Gesprächen wichtiger Menschen, meist Männer, Wissenschaftler, Künstler und Profisportler, hören Politiker ins Mikrofon sprechen und Berichte aus der Ferne, die manchmal im nächsten Stadtviertel liegt.
Aus dem Radio des Nachbarn singt Nik Kershaw Wouldn’t it be good to be in your shoes? Meine habe ich angelassen. Heute sind es die schwarzen Lederschuhe, Budapester. Die Schnürsenkel sind rot, seit die schwarzen gerissen sind. Mein Hemd ist weiß, und ich trage keinen Gürtel. Oma hat mich mit einem Gürtel an den Küchentisch gefesselt, wenn sie länger weg war. Ich war noch nicht in der Schule, und ich habe niemandem gefehlt.
Der Flur ist leer, bis auf die Zeitungsstapel und den Garderobenhaken, an dem die ausgediente Kapitänsmütze hängt, als würde sie noch gebraucht. In einer Reihe stehen Schuhe wie treue Paare nebeneinander, Spitzen zur Wand, Innenseiten einander zugewandt. So müssen sie warten auf meine Füße. Durcheinanderliegende Schuhe kann ich nicht tolerieren, nicht aus Ordnungssinn, sondern aus Mitgefühl. Sehe ich leere Schuhe, stelle ich mir die unbequeme Beinhaltung des Menschen vor, der darin steckt. Wenn niemand zusieht, korrigiere ich den Schuhstand der Nachbarn im Treppenhaus.
Mein Staubsauger ist kaputt, und ich habe keine Geduld, ihn zu flicken. Die Landschaft braucht mich jetzt dringender. Seit ich nicht mehr fliege, fehlt mir die Übersicht. Bis vor Kurzem konnte ich so oft fliegen, wie ich wollte. Ich konnte täglich nachschauen, ob die Welt noch eine Kugel ist. Ich mochte es, wie die Städte nach dem Start kleiner wurden, die Menschen darin zu wissen, ohne sie zu sehen. Nicht einmal vom Cockpit konnte ich Grenzen erkennen, mal trennt ein Fluss zwei benachbarte Länder, aber den Feldern und Hügeln konnte ich nicht ansehen, welche Sprache da unten gesprochen wird. Ich verhalte mich still, sobald meine Kenntnisse in Geografie an ihre Grenzen stoßen. Das Baltikum, die Anden, Ozeanien. Aber ich weiß, wo die Polkappen liegen. Die Menschen reden über Geografie, als wären sie stolz darauf, dass sie etwas so Großes wie den ganzen Planeten in ihren kleinen Köpfen behalten können. Dabei übersehen sie, dass auch Erdkunde ein Modell ist.
Wann immer ich nicht selbst als Kapitän im Dienst war, durfte ich im Cockpit zwischen zwei Kollegen auf dem Jumpseat mitfliegen. Ich bekam den gleichen Lunch wie sie: eine kleine Cola und Curryreis. Beide Kollegen legten sich die Krawatte links über die Schulter, damit sie damit keine Flecken fingen. Ich hatte frei und trug freiwillig keine. Auch heute bin ich ohne Krawatte unterwegs gewesen. Ich besitze noch ein paar, die schwarze für die immer häufiger werdenden Begräbnisse. Die rote, die ich nie trage, die hellblaue für fröhlichere Feiern.
Ich übe die alten Bewegungen an neuen Tagen, sinnlos und absichtlich langsam, obwohl oder weil niemand es sieht. Es fehlt mir, kein Publikum zu haben, keine Crew und keine Passagiere, die anerkennend einen Blick ins Cockpit werfen oder noch lieber in meine Augen, die hellen grauen unter der Dienstmütze.
Ich lasse meine dunkelblaue Gabardine-Hose an, obwohl ich auf etwas Schmutz gefasst bin, und hole das Werkzeug aus dem Salon. Dort, im großen Wandschrank, sind Sägen, Hammer, Schraubenzieher und ein kleines Lager für Elektrikzubehör. Ich vermisse den Staubsauger.
Neben dem Schrank steht eine Jukebox. Mein Nachbar hat sie mir geliehen, um mich auf andere Gedanken zu bringen und um sicherzugehen, dass ich bei den anderen Gedanken bliebe. Danach ging er in seine Wohnung zurück und wünschte mir Glück. Bei den Bee Gees dachte ich zuerst, die Platte werde zu schnell abgespielt, bei Satisfaction fühlte ich mich für drei Minuten vierundfünfzig Sekunden wie ein Auserwählter. Und das war ich auch: auserwählt von einem Zufallsgenerator. Der Nachbar kennt mich besser als erwartet.
Und wir haben neuerdings noch zwei Dinge gemeinsam: eine Brille und Zeit. Auch er ist erst seit Kurzem pensioniert. Er muss gemerkt haben, dass ich es mag, nur über eine begrenzte Auswahl an Liedern zu verfügen. Deshalb mag ich auch sein Radio, weil ich die Musik nicht mitbestimmen kann. Wunschsendungen! Ja, aber mir wäre es zu intim. »Guten Tag, hier spricht der Johann, ich wünsche mir Nowhere Man von den Beatles.« Nein, so nicht.
An der Wand im Salon hängt ein Elchgeweih aus Skandinavien. Ich jage nicht, aber mein damaliger Nachbar in Finnland fand, ich solle zum Abschied etwas mitnehmen, was mich an die Schönheit der Natur erinnert. Ich habe immer noch Heimweh nach den Orten, an denen ich früher einmal zu Hause war.
Ans Fenster geklemmt, hoffe ich auf die Müdigkeit der anderen und darauf, nicht erkannt zu werden. Ich schaue hinaus, aber ich kann die Landschaft nicht mehr sehen. Die Landschaft da draußen ist spektakulär, sie hat es verdient, vom Menschen gepflegt zu werden. Es steht ihr gut, wie Wiesen und Felder auf ihr liegen, die ohne uns Menschen längst Wälder und von Wildschweinen bevölkert wären. Erst der Flug wildbrütender Vögel lässt mich glauben, auch die Landschaft unter ihren Flügeln sei natürlich. Sie geben noch dem gepflegtesten Kulturgebiet einen Hauch von Gottgewolltheit und Authentizität. Ich erkenne die Vogelart nicht genau, aber ich sehe etwas segeln, als dunkle symmetrische Tierchen ohne Oberseite und Alter.
Wenn ich aus dem Küchenfenster schaue, sehen die Köpfe der Spaziergänger zu klein aus zum Denken. Die Oberflächen und Muster ihrer Kleider werden zu dunklen Flächen, oder sie sind rot. Die Zigarette des Mannes an der Haltestelle scheint nicht kürzer zu werden. Er hat sein langes Haar zu einem losen Zopf zusammengefasst, aber keine Zeit, seine Schnürsenkel zu binden. Was sage ich da – natürlich trägt er Turnschuhe mit Klettverschluss!
Aus der Ferne sehen Hände und Füße endlich so aus, wie sie heißen: Extremitäten. Alle Menschen sind tragende Tiere. Jeder hat ein Säckchen dabei, umgehängt oder aufgeschnallt. Alle schleppen etwas von einem zum anderen Ort. Meine Bewunderung gilt jenen, die ohne Tasche aus dem Haus gehen. Wer nichts trägt, sieht überlegen aus. Nur manche sind überall zu Hause, nicht weil sie alles mithaben, sondern nichts unbedingt brauchen. Einen Hausschlüssel, eine Jacke, ein Telefon.
Nur ich besitze einen Schlüssel zu dieser Wohnung, die ich meine nenne, weil ich Miete zahle. Ich wohne auf Zeit und allein, auf Abruf. Früher hatte auch meine Frau einen Schlüssel zu dieser Wohnung. Seit sie weg ist, kommt mir die Küche größer vor. Ich bin fast nur noch hier, der Salon könnte eines Tages verschwunden sein, ohne dass ich ihn vermisse. Das Bett könnte im Flur stehen.
Manchmal lese ich dann doch den Wirtschaftsteil und fühle mich wie ein fleißiger Mann. Da kommt es vor, dass mir das Klischee vom glücklich Geschiedenen gut gefällt. Ich bin noch unrasiert, dafür mit Zigarette und Kaffee. Und wenn ich besonders verwegen sein will, morgens gleich nach dem Aufstehen, wärme ich mir zwei Knackwürste und esse sie mit scharfem Senf.
Irgendwo im Schrank lagert noch Gips. In meinem Modell soll es ein paar Hügel geben, wie aus großer Höhe gesehen. Nur im Flachland kann man nichts verbergen. Ich baue eine Miniaturlandschaft, weil ich weit weg sein will. Wenn sie fertig ist, sollen die grünen pelzigen Hügel seitlich angestrahlt werden von der Klemmlampe über dem Herd. Die Wiese wird sogar schöner sein als die bei Antwerpen. Es tut mir leid, dass ich mein früheres Leben vermisse, aber es ist niemand da, den das stört. Selbst Alleinsein ist ein pelziger Zustand.
Zehn Uhr eins
Die Kirchturmuhr schlägt wieder zur vollen Stunde. Heute bin ich froh, mich für niemanden rasieren zu müssen. Und darüber, dass mich die Kirchenglocken nicht stören, weil sie nicht mich rufen. Ich bin stolz darauf, einmal der eigenen Unfähigkeit im Durchhalten entkommen zu sein. Modellbau heißt dem Klischee nach: Flucht in die Harmlosigkeit. Ausblenden aller politischen Fragen, der Tüftler im Keller, dabei sitze ich doch am Küchentisch. Anstatt mich zur letzten Wahlmanipulation auf dem Kontinent nebenan zu äußern, schneide ich die Packung mit den Grasflocken auf. Statt mich für Datenschutz zu engagieren, lege ich eine grüne Waldmatte auf der Holzplatte zurecht, auf der die Aussicht entstehen soll. Die Zeitung vom Vortag liegt unter dem Klebespray. Der Wetterbericht mit den Klimakarten schützt die Tischplatte vor dem Leim. Ich lese die Zeitung wie eine Landkarte. Die Städtenamen kommen mir vor wie Neuigkeiten von gestern. Ein Tandem gibt es nicht im Maßstab 1:200.
Der Tisch ist sehr groß. Eine Familie mit vier Kindern könnte bequem daran zu Abend essen. Ich sitze immer auf demselben Platz. Jede Perspektive ist sehenswert, alle Blickwinkel sind Trost für das Auge, nirgends steht etwas unnötig herum. Bei mir auch nicht. Außer auf dem Küchentisch, der jetzt zur Werkbank geworden ist. Er ist eine Bühne für den Landstrich hinter dem nächsten Hügel, gesehen wie aus weiter Ferne.





























