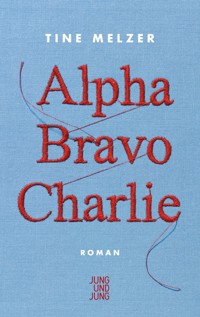Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jung und Jung Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sebastian Saum fehlt es an nichts: Er ist ein gefeierter Opernsänger, verkehrt in anregender Gesellschaft und lebt sorgenfrei mit seinem besten Freund Franz im geerbten Familienanwesen. Alles könnte gut so bleiben, wie es ist, bis er eines Abends ein Vollbad nimmt und beschließt, nicht mehr aus der Wanne zu steigen. Tag um Tag vergeht, und während Franz ihn geduldig und treu bewirtet, gewinnt er nackt und allein Distanz zur Welt. Sein Leben und die Rollen, die er darin einnimmt, werden ihm fragwürdig. Er legt sie ab wie ein Kostüm, wie seine Garderobe, wie alles, was er jemals getragen hat. Und was bleibt übrig, von einem nackten Sänger ohne Publikum, von einem, der von allem immer nur verschont wurde, der immer nur Applaus gesucht hat? Ein Haufen abgetragener Kleider und Schuhe, die er im Kopf sortiert. Und die Frage, was es wert ist, aus der Wanne zu steigen und sich mit den Menschen zu verbinden. Dieses schmale Buch hat es in sich: Mit beißendem Humor und Sätzen von scharfer Eleganz singt es eine Arie auf Verletzlichkeit und Verantwortung, auf Freundschaft und Treue. Ein Kunststück!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 197
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
DO RE MI FA SO
© 2024 Jung und Jung, Salzburg
© Tine Melzer 2024
Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung,
Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten
Umschlaggestaltung: Tine Melzer, Foto: Mathias Zuppiger
Entwurf und Umsetzung: BoutiqueBrutal.com
ISBN 978-3-99027-311-1
Inhalt
Erster Tag Samstag
Zweiter Tag Sonntag
Dritter Tag Montag
Vierter Tag Dienstag
Fünfter Tag Mittwoch
Sechster Tag Donnerstag
Siebter Tag Freitag
Achter Tag Samstag
Neunter Tag Samstag
Zehnter Tag Montag
Elfter Tag Dienstag
Zwölfter Tag Mittwoch
Dreizehnter Tag Donnerstag
Vierzehnter Tag Freitag
Fünfzehnter Tag Samstag
Letzter Tag Sonntag
TINE MELZER
Do Re Mi Fa So
Roman
Erster Tag Samstag
Aus Trotz habe ich in der Badewanne übernachtet, und es war wie Ferien an einem unbekannten Ort.
Ich blieb morgens einfach in der Wanne liegen, immer noch nackt, aber ohne Wasser und gebettet in Decken und Kissen. Man würde mich herausholen müssen wie eine schwangere Kuh aus dem Fluss, man müsste mir Gurte unterlegen und mich umspannen wie ein Klavier auf dem Weg aus dem zweiten Stock, um mich hier rauszubekommen. Nichts würde helfen, kein Wort, kein Zureden könnte mich aus meiner Lage befreien. Ich würde höflich bleiben und darum bitten, mich nicht zu behelligen mit Erwartungen, Verpflichtungen, Vorwürfen. Ich würde alle Fragen von Bord meines Bootes aus beantworten. Als badender Bariton.
Es ist ein tröstlicher Gedanke, in der Badewanne zu bleiben, bis das ganze gottverdammte untätige Wochenende vorüber sein würde, in keine Bar gegangen, aus Übermut zu Hause geblieben zu sein und im Radio ein Live-Konzert zu hören, das mir das Gefühl gibt, am richtigen Ort zu sein und genau nichts zu verpassen.
Die Stimme des Mannes im Radio auf dem Fensterbrett ist makellos, das Mikrofon so gut, dass ich die Zunge von unten an den Gaumen schlagen hören kann. Ich wohne der Geburt der Stimme aus dem Inneren des Radiomoderators bei. Die Zunge ist kein schönes Körperteil, sie ist wie neugeborene Säugetiere, augenlos und unbehaart, wie blinde Welpen. Die Zunge ist der Molch in der feuchten Höhle. Als Opernsänger kenne ich mich mit Zungen aus. Bariton ist eine Mittelstimme. Ich bin der hochgewachsene Mann mit dunklem gepflegtem Bart, mit großen Händen und langen Fingern, mit breiter Brust und einem geraden Kreuz. Ich bin ledig, aber nicht alleinstehend. Ich bin kinderlos, habe eine Schwester und eine tote Mutter und habe ihr Haus geerbt.
Das Haus liegt in einem breiten Tal, in einem Weiler, der nie bessere Zeiten gesehen hat. Alle, die sich hier noch Bauern nennen, tun das für die Leute aus der Stadt, die mit dem Auto zum Hofladen kommen, um einzukaufen, und abends statt des Tischgebets schwärmerisch sagen: Und alles das sind lokale Produkte. Vom Fenster aus kann ich das Feld sehen und den Waldrand, wo abgesägte Stämme liegen, tote Bäume, bereit zur Abholung. Abholzung als Erinnerung an den Wald. Ich denke deutlich: Wald, und sage es laut in das Badezimmer hinein.
Dieses alte Haus auf dem Land ist eine WG geworden, in der wir, zwei Männer Anfang vierzig, auf drei Stockwerken mit zwei getrennten Schlafzimmern, Wohnzimmern, drei WCs und zwei Bädern wohnen. Die meiste Zeit sitzen wir gemeinsam unten in der Küche von Franz, normalerweise.
An diesem Morgen, gegen neun vielleicht, bringt mir Franz ein Tablett ins Badezimmer, mit Milchkaffee, Grenadine-Sirup, Omelette und Birchermüsli, außerdem eine aufgelöste Tablette gegen den Kopfschmerz – er denkt wirklich an alles. Er setzt sich auf den geschlossenen WC-Deckel neben meiner Wanne, um mir aus der Zeitung vorzulesen, als wäre nichts. Offenbar hat eine weitere Regierung in Europa ihr Einverständnis gegeben, Adoption für Homosexuelle zu legalisieren. Ein neuer Krieg am Rande des Kontinents hat begonnen, so zu heißen, und die Kritik der Theaterpremiere, die wir gestern sausen ließen, ist streng, aber glaubwürdig.
Franz ist auf der Hut, er will nichts falsch machen. Er ist wie immer tadellos gekleidet und trägt sein Deodorant schon vor Mittag. Er tut so, als wäre ein spätes Frühstück in der Badewanne genau die angemessene Antwort auf die Nacht davor, die vergangene Woche oder die letzten Jahre. Ich bin froh, ihn zu sehen.
Bevor ich die Wanne bestieg, hatte ich Geburtstag. Ich wäre gestern Abend lieber ganz alleine geblieben, alleine mit Franz, aber ich konnte den Geräuschen aus dem unteren Stockwerk anhören, dass Besucher gekommen waren. Es war immerhin mein vierzigster. Überraschungspartys sollten verboten werden.
Ich hörte Stimmen und Gelächter, das Klappern von Töpfen und Tellern, Besteck und klirrende Gläser. Unter mir bewegten sich heitere Menschen in sauberer Kleidung, die gemeinsam trinken, essen und reden wollten und die zuerst vorsichtig, später dann lauthals ihre Meinung mitteilen würden, um die niemand sie gebeten hatte. Ich hörte eine fremde Männerstimme, ein Grollen als subsonisches Vibrieren, Geräusche wie aus einem Motorenraum. Dann grelle Rufe, eine Dame vielleicht, die hörbar exaltiert ihre Augenbrauen hob. Sicher ein Sopran.
Meine Abwesenheit wirkte anziehend auf manche Gäste. Sobald ich den Raum betrat, wurde es still, und ich tat überrascht. Ein Auftritt wie in einem Kammerspiel, vierter Akt, die rettende Figur, der Held ist da, er lebt! Mit sparsamen Gesten und leisen Worten nahm ich die schmeichelnden Blicke auf. Ich war da, endlich, obwohl es nur die Küche meines Mitbewohners war, die ich betrat. Im Salon erwarteten mich fremde Menschen und gute Kollegen, ein Schluck Cava, echte Wiedersehensfreude. Ich war froh, meine Schwester zu sehen, extra aus Bergamo angereist, wie rührend. Sie ist eine schöne Frau geworden, das Mädchen ist ihr aus dem Gesicht entwachsen, ihre dunkel umrandeten Augen können müde und begeistert gleichzeitig aussehen. Sie hat das Gesicht des Vaters bekommen, sein optimistisches Lachen, nur ohne Vollbart.
Im Augenwinkel sah ich, dass sich jemand nicht bewegte. Aus dem Augenwinkel sieht man oft das Flüchtige am besten. Da saß es still wie ein scheues Tier, aus Furcht, erkannt zu werden. Eine alte Dame, regungslos und aufrecht. Sie hätte meine Mutter sein können. Ich wandte den Kopf nicht, aber es war wohl meine Tante.
Andere Musiker waren auch da, weil sich Berufstätige meistens mit ihresgleichen abgeben. Bläser treffen sich auch freiwillig und privat mit dem Holz und Blech aus dem Orchestergraben. Nach der Schlacht um die Kunst kehren die müden Musiksoldaten heim, nur um sich, frisch geduscht und umgezogen, mit jenen zu verabreden, denen sie sonst im Grabenkampf bei der Arbeit zusehen und zuhören. Der Orchestergraben kann ja nichts dafür, dass er das Publikum von der Bühne trennt. Es wird Zeit, darüber hinwegzusehen.
Die Bühnenbilder unserer Theaterbetriebe entsprechen den Landschaften in Terrarien. Die Oper ist ein Tropenhaus, ein mehrstöckiger Palast mit echten Kunststoffpflanzen und hochwertigem Boden in Korkoptik. Die Langsamkeit der Figuren auf der Bühne ist der Lohn für die Mühsal, alle Kabel verlegt zu haben, das Licht zu steuern, für gute Belüftung und Feuersicherheit zu sorgen und backstage Blumen und Schokolade parat zu haben. Die Diva als kaltblütige Leguandame, ihr Hals schuppig, die Augen schließen sich selten zum Zwinkern. Ich selbst bin eine singende Schildkröte, ein Kleintier im Zoo der guten Gesellschaft, gefüttert von der Allgemeinheit – bitte nicht an die Scheibe klopfen. So klingen die Rufe der Zuschauer vor dem Gehege, begeistert oder empört, wollen ihr Geld zurück oder ein Abo für die neue Saison.
Auf dem enormen Esstisch standen Schalen mit Häppchen, Nüsschen und Früchten. Ein Apéro-Buffet ist der ideale Ort, um unsichtbar zu werden. Mit Blick auf das Angebot muss man nur zugreifen, von der Hand in den Mund. Angezogen von den verlockenden Häppchen kann der Buffet-Mensch sein Glück kaum fassen. So jemanden sollte man nicht ansprechen.
»Sie sind also der berühmte Opernsänger? Wie schön, Sie endlich persönlich zu treffen«, behauptete eine Fremde.
»Saum, Bariton. Angenehm«, log ich höflich.
Die Dame mit dem glatten gelben Seitenscheitel auf dem spitzen Kopf öffnete ihre violett geschminkten Lippen zu einem großen runden Oh. Franz hatte sie aus Wien mitgebracht, ich müsse sie unbedingt kennenlernen, berühmte Musikkritikerin, geachtete Musikwissenschaftlerin, eine Koryphäe. Ich habe Angst vor Koryphäen. Dann lachte sie wie eine überschäumende Limonade in alle Richtungen, laut und aus gut gespielter Verlegenheit. Fasste mich am Oberarm, als müsste sie sich auf einem schwankenden Schiff irgendwo festhalten und als wäre ich fester mit der Reling verbunden als sie. Dabei versuchte ich, das aus Anstand noch nicht in den Mund geschobene Avocado-Canapé nicht auf ihre pinke Bluse zu drücken, die sich mir bei ihrem einseitigen Tanzschritt gefährlich genähert hatte.
Ich nickte ausweichend und wendete mich dem Cava zu. Dann blickte ich mich in meiner Festgesellschaft um. Hirschgeweihe wurden gekreuzt, einer hatte ein Waldhorn dabei, und es wurde zur Jagd geblasen, auf einander, auf die Liebe, den Schnaps! Privilegien sind Vorteile, an die man sich gewöhnt hat. Privilegien kann man genießen, ohne es zu merken. Normalerweise gelingt das nicht. Wir können kaum unbemerkt Champagner trinken. Einer der Gäste war ein schöner älterer Mann mit dem Gesicht eines Entdeckers. Er trug eine kleine Brille, die seine Pupillen noch größer aussehen ließ, als seine Augen waren. Auch er war nicht gesprächig. Gemeinsam versteckten wir uns in einer Ecke mit einer Flasche Weißwein. Jemand der Anwesenden war sich der historischen Bedeutung unserer Zusammenkunft bewusst und filmte pausenlos mit seinem Mobiltelefon. Das Licht und die Stimmung wurden weicher, die Flaschen leerer. Der Sessel, auf dem im Augenwinkel meine Mutter gesessen hatte, war nun meiner. Ich fühlte ihre Hand auf meinem Scheitel.
Ich stahl mich um Mitternacht von meiner eigenen Party. Endlich allein ließ ich die Badewanne ein. Heiß musste es sein. Zu heiß. Viel Schaum, am besten Melisse. Die Wanne ist überlang, wie ein kleines Boot, eingelassen in die geflieste Umrandung eines geräumigen Badezimmers aus besseren Zeiten. Ich kann mich fast zur Gänze darin ausstrecken, und sie ist breit genug, mich zu umschließen, wenn ich untertauche.
Ich wollte mich selbst überraschen. Also trocknete ich nach dem Bad die Wanne ab und holte leise mein Bettzeug aus dem Schlafzimmer. Die trockene Wanne war kalt. Ich brauchte alle Decken und Kissen, die ich finden konnte, um schlafen zu können.
Ich bleibe zunächst bis zum Mittagessen in der Wanne. Es gibt Semmelknödel, frisch. Offenbar hat Franz es darauf angelegt, mich zu verwöhnen, in der Hoffnung, dass ich heiter aus der Wanne steige, sobald alles gegessen ist. Aber ich will unbedingt bis zum Abend nackt bleiben.
Sobald ich wieder allein im Badezimmer bin, kann ich endlich in Ruhe nachdenken. In jeder Rekapitulation steckt eine Kapitulation.
Der Wasserhahn sollte mal wieder entkalkt werden. Der Schlauch ist matt geworden, der Duschvorhang hat rosafarbene Schlieren, wohl eine Alge oder ein Pilz, oben fehlt eine Öse. Meine Zuneigung zu Details macht mich weich, dabei wäre ich manchmal gerne ein echter Kerl. Es riecht nach feuchtem Gips. Oben an der Ritze zur Decke sitzt grauer Flaum, aber er bewegt sich nicht. Noch nicht. Die Haarbürste könnte mal ersetzt werden. Ich nehme den Handspiegel aus dem Kosmetikschrank und lege mich in der Wanne unter ihn. Schneide Grimassen. Schaue erst ernst, dann wissend, lächle wie zum Selfie in eine Kamera. Lenke meinen Blick damit auf sonst unsichtbare Stellen. Sehe eine Achselhöhle. Eine Kniekehle. Schaue mir meine Eier von unten an.
Ich betrachte die bunte Shampooflasche, frage mich, wie die abgebildete Frucht heißt. Papaya steht in Neonpink darauf, aus Buchstaben wie mit Ketchup geschrieben. Palmen, Silhouetten hinter dem Wort fresh. Das Kleingedruckte ist kaum lesbar, aber so lang, dass ich mich frage, wie Pflegeprodukte mit so vielen Inhaltsstoffen gesund sein sollen. Meine Haut sieht gepflegt aus. Etwas trocken vielleicht.
Ich betrachte mich: Alles dran. Versicherungspolicen bezahlt, Gebiss saniert, Blutwerte gut, kein Drama in Sicht. Aber Fingernägel sind Problemzonen, miserables Design. Hätte der Schöpfer weniger Zeit mit dem großen Ganzen vertan, mit dem Universum, der Physik, der Chemie, der Natur und der Pflanzenwelt, besonders aber mit den Insekten, so hätte er an bestimmten Details des menschlichen Körpers einiges zu optimieren gefunden, Brustwarzen zum Beispiel. Lächerlich und bis auf extreme Ausnahmefälle vollkommen nutzlos. Der Haaransatz der meisten Menschen: Eine Zumutung. Ohrläppchen, Oberlippen und Nasenwurzeln sind für sich gesehen eher grässlich. Eine hängende Brust, eine lahme Hand, ein Überbein, eine spitz zulaufende Falte. Weitere Makel, Doppelpunkt: ein Leberfleck am Schlüsselbein, ein Geburtsmal am Steiß, das ich auch nur aus Spiegeln kenne, wie die Haare auf den Schulterblättern. Mein linkes Ohr sitzt höher als das rechte. Meine Augenbrauen wüchsen zusammen, wenn ich sie nicht pinzettengenau daran hindern würde. Für Tätowierungen bin ich gottlob schon zu alt. Meine Haut zeigt erste feine silberne Schuppen über den stark geäderten Händen und Armen. Egal welches Motiv, es würde schon bald schrumpfen wie eine in Seidenpapier gewickelte Gelbwurststulle.
Ich betrachte meine Hände: Satelliten des eigenen Willens. Sie berühren Gegenstände, Türklinken, Messer und Gabeln, Stifte und Briefe, Scheren und Stecknadeln, Bücher und das Telefon. Sie streichen über Kopfkissen und halten Handtücher, sie fassen den Körper an, zu dem sie gehören, berühren das eigene Gesicht, das Haar, das Kinn, die Armbeuge, manchmal auch das Gesäß und oft das Knie. Das Antlitz meines Freundes betaste ich hingegen kaum.
Haben unsere Finger nicht ein viel aufgeräumteres Verhältnis zur Welt als der Rest unseres Körpers? Die vielen Finger, doppelt so viele, wie ich auf einmal im Blick behalten kann. Zehn Finger wie zehn Räuber, verschworen und auf ewig zu Treue verdammt. Sie können meine Handteller nicht verlassen, nicht aus Trotz, nicht aus Protest, nicht aus Müdigkeit. Diese Finger halten sich sonst an allen Gegenständen fest, am Henkel der Tasse, an der Zahnbürste, am Hosenbund, am Bleistift. Jetzt fehlt mir nicht mal der Terminkalender.
Ich berühre mich aus Langeweile. Eine Hand umschließt passgenau das Knie und die Ferse. Die geöffnete Hand bedeckt exakt mein Gesicht. Ich kann mit meinem linken Arm meinen Kopf umfassen und das rechte Ohr berühren. Mit rechts umgekehrt auch, aber es tut weh, seit letzter Nacht, den Arm über den Kopf zu heben oder zur Schulter zu führen. Meine Fußsohle ist genauso lang wie mein Unterarm vom Ellbogen zum Handgelenk. Mein Daumen passt aufs Augenlid. Mein Zeigefinger in den Gehörgang. Mein kleiner Finger ins Nasenloch, der Zeigefinger knapp. Ich kann meinen Hintern überall berühren, auf dem Rücken bleiben unerreichbare Stellen. Ich kann mit beiden Händen meinen Oberschenkel umfassen, oberhalb des Knies, den Hals ganz knapp. Meine Stirn ist so lang wie mein Daumen. Der passt in den Bauchnabel. Meine Knie sehen aus wie Hindernisse, ich decke sie schnell zu. Ich kann verstehen, warum es genormte Maßeinheiten braucht. Mein Fuß, meine Elle. Mein Becken wird taub. Ich darf die Arme nicht auf den nackten Wannenrand legen. Er ist eiskalt.
Eine leere Badewanne ist ein schlechter Ort fürs Überwintern. Die Frühmenschen werden immer mit Fell bekleidet gezeigt. Was ich für bloße Romantik hielt, macht plötzlich viel Sinn. Ohne die Lammfelle aus dem Fundus meiner Mutter könnte ich es hier keine Viertelstunde aushalten, ohne zu frieren. Mit Schaffell ausgekleidet geht es wunderbar.
Die Gegenstände um mich herum haben alle ihre eigene Zeitlichkeit. Das Schaffell ist rund 10.000 Jahre alt, die Keramik viele Jahrhunderte. Die Seife ist noch ganz jung, das Frotteetuch zerfällt jeden Augenblick in Vorübergehendes. Meine Haut ist praktisch vorbei, nur die Knochen und Zähne können sich mit dem Metall der Armaturen zeitgeschichtlich messen. Die Moleküle warten nur darauf, wieder einmal Platz zu wechseln. Kohlenstoff überall. Die Chemie lacht mich aus: Aus diesem Leben auszusteigen, ist keine Option. Für meinen Körper nicht, nicht für die ganze materielle Welt. Ohne Ideen wäre dieser Planet ein verbeulter Tropfen ohne gedankliche Richtung.
Wasser ist Leben, beschwor meine Biologielehrerin uns mit einer ans Religiöse grenzenden Begeisterung. Den Fliesenfugen ist anzusehen, dass sie recht hatte. In Grau- und Grüntönen wird das Silikon langsam verdaut, bietet in jeder Ritze Platz für einen weiteren evolutionären Schritt zur Beherrschung des Landes durch Wesen aus dem Wasser. Seen, Meere und Ozeane verursachen selbst in meiner Vorstellung Ekel. Ich stelle mir immer die tausend Schichten schwimmenden Lebens unter meinem auf der Oberfläche treibenden Körper vor. Die Kraken und Riesenschildkröten, die Heringsschwärme und Aalfamilien, Krebse und Krabbenmuscheln und andere Kriechtiere am Meeresboden. Auch die jahrzehntelang in Zeitlupentempo herabsinkenden Einzeller beunruhigen mich. Die Anzahl von Lebewesen, die in einem einzigen Wassertropfen hausen, lässt mich leer schlucken. Die kleinsten, mit bloßem Auge nicht erkennbaren Organismen, die zitternden Wimperntierchen, Amöben, Mikroben, mikroskopisch kleinen Würmer, dazu tonnenweise Plankton: Wasser ist Leben ist eine Zumutung. Es klingt wie eine Drohung aller Mikroorganismen, die nie aufhören, sich zu vermehren. Hier in der Wanne hält mein Körper mit seinem mikroskopischen Darminnenleben hoffentlich die Balance mit den Einzellern und Pilzen, die mich umgeben. Ich bin der Wal und bade im Plankton.
Da nimmt sich die hereinfliegende Kleidermotte fast aus wie unsereins. Zum Flug fähig, mit Wahrnehmungsapparat und Richtung. Motten machen sich nur über feine Stoffe her, Kunststoffe fressen sie ungern. In den sechziger Jahren waren Motten fast ausgestorben, glaube ich. Insekten tragen Außenskelette. Kollegin Kleidermotte! Gestatten: Saum.
Kaum etwas auf der Welt ist uns so nah wie unsere Kleider. Als leere Hüllen warten sie herrenlos auf ihre Auferstehung, wenn wir schlafen gehen. Der nächste Morgen, wenn der Körper wie ein Geist in die Hosen und Hemden und Röcke und Rollkragenpullis fährt, bringt die Stoffe wieder in Form. Angezogen kann ich meistens davon absehen, dass ich ein Tier bin, eingefangen von Bündchen und Krägen, die Arme stecken in Ärmeln, die Hosenbeine sind schon ganz zu unseren eigenen Körperteilen geworden. Kleider sind leicht genug, dass wir sie vergessen können. Aber unsere Haut spürt das Gewebe und entspannt sich darunter, geschützt vor den Blicken der anderen Nacktaffen.
Jeder Arzt geht gern im Kittel. Patienten hingegen kommen im zerknautschten Pyjama. Ein Kind muss kurze gelbe Hosen tragen, damit man die aufgeschlagenen Knie sehen kann. Jeder Versuch der Flucht vor den Kleidsamkeiten endet in der Kapitulation, allein im Bett oder nackt im Bad. Wäre ich Metzger geworden, trüge ich weiße Plastikschürzen und wäre froh um die Zigarettenpausen im Freien.
Ohne Not habe ich am gestrigen Abend einigen Leuten den Glauben genommen, sie würden verstanden. Hoffentlich hatte das keine bösen Folgen. Würde der eine nun einen gebrauchten Rasenmäher anschaffen, um die Wiese ums Haus zu mähen? Würde der andere plötzlich den Hund ins Tierheim geben, weil er dem Anblick der traurigen Augen seines Gefährten nicht mehr standhielt? Würde die Dritte ihre teure Digitaluhr ins Klosett werfen und kräftig spülen? Würde der Vierte nachts im Gartenhaus die Pfennigabsätze der Pumps seiner Frau absägen und am nächsten Morgen im Kimono zur Arbeit erscheinen? Würde die, die auf ihre Pünktlichkeit schwört, bald an gar nichts mehr glauben? Würden die treuen Freunde ihren eigenen Vornamen vergessen haben und die Abkürzungen durch die Stadt nicht mehr finden? Würde die Verwandte plötzlich nicht mehr anrufen, weil sie keine Lust mehr hätte, das Geeignete zu tun? Meine Gäste waren weder unglücklicher oder unwichtiger als ich, nur aufgeregter und abgelenkter.
Da habe ich plötzlich aufgehört, meinen Beruf zu mögen. Ob es die anderen waren, die das Gleiche tun für Geld, oder mein Geiz, mit der verbleibenden Zeit etwas anderes, etwas Neues anzufangen, weiß ich nicht. Manchmal wäre ich lieber Mediziner. Bei jeder Fahrt im öffentlichen Nahverkehr könnte ich innerlich alle Knochen und Sehnen des Passagiers mir gegenüber auf Latein hersagen. Zum Einschlafen denke ich an Konjugationen.
Zweiter Tag Sonntag
Ein verkaterter und besorgt wirkender Franz kommt mit Frühstück an die Badewanne. Waffeln mit Ahornsirup, Erdbeeren mit Schlagsahne und Aspirin gegen meine Rückenschmerzen. Das frische Hemd schlage ich aus, die Unterwäsche ebenso. In Decken und Kissen und mit dem Heizkörper auf Stufe vier kann ich bequem nackt bleiben in meiner Wanne. Das Bad ist pfefferminzgrün gefliest, knapp zwei auf drei Meter, neben der Wanne ein WC und ein Waschbecken. Fenster ins Freie, ich habe die Kapitänskajüte. Franz hat unten sein eigenes Bad, und ich bin froh darum. Er versorgt mich rührend und bleibt für ein paar Worte bei mir sitzen. Er ahnt schon, dass dieses Wellness-Wochenende länger dauern könnte, und auch ich kann es mir vorstellen. Ich kann mir alles Mögliche vorstellen, aber sagen kann ich es nicht. Und umgekehrt.
Franz meint, es sei normal, sich selbst nicht zu trauen. Franz ist Pianist und sitzt jeden Tag (außer samstags, wenn er irgendwo auftritt oder kocht) im Salon am Flügel und macht Pianistensachen. Übt, komponiert, prüft seine Einfälle am Instrument. Er heißt Gold mit Nachnamen und kommt aus wohlhabendem Haus. Unsere Klingelschilder: Gold. Saum.
Franz trägt an diesem Morgen das graue Hemd, das mit den stoff bezogenen Knöpfen. Vielleicht habe ich mich auch deshalb für ein Leben mit ihm entschieden, weil er so zuverlässig gekleidet ist. Er gehört zu den Menschen, die nach ihren späten Jugendjahren die Körperform nicht mehr ändern. Er passt seit fast zwei Jahrzehnten in die gleichen Jacketts und Hosen, ohne darin merklich zu altern. Er sah schon als Jugendlicher aus wie mit Mitte dreißig und wird vielleicht für immer so aussehen. Die Kleider meines Mitbewohners lassen den Schluss auf einen stilsicheren und zugleich bescheidenen Menschen zu. Aber so wie er Schuhe putzen kann, so kann er auch fluchen.
Seine Garderobe ist eine, die diesen Namen noch verdient. Man kann ihm die Wochentage nicht ansehen. Man kann nicht erraten, ob es ein Festtag oder ein gewöhnlicher Arbeitstag ist, oder beides. Seine Dienstkleidung unterscheidet sich nur unmerklich von seinem Freizeitlook. Seine prachtvollen polnischen Pantoffeln stehen treu im Erdgeschoss neben der Eingangstür. Dort wechselt er in die weichen rotkarierten Filzslipper, ohne an Eleganz einzubüßen. Man kann sehen, dass er langsam in ein Alter kommt, in dem er beginnt, vor sich selbst Respekt zu haben.
Noch nie habe ich ihn einen Satz sagen hören, der mit Aber beginnt. Seine Stimme überschlägt sich nie, obwohl sie höher ist, als sein Körper vermuten lässt. Sie klingt wie die eines schlanken jungen Mannes, sie ist schöner als irgendetwas anderes an ihm.
Franz ist im perfekten Alter. Wäre er ein Brot, müsste man ihn jetzt aus dem Ofen nehmen.
Er ist unschuldig. Für seine fast unübersehbare Liebenswürdigkeit kann er nichts. Alles an ihm sagt: Ich bin da. Stillsitzen kann er nicht, seine Hände spielen immer mit etwas, die Hosenträger über seinem Bauch sind einzig dazu da, die Daumen mal ruhig zu halten. So ein Mensch könnte alles sein, sogar Friseur. Er kleidet sich wie ein Geographieprofessor oder Dirigent, er strahlt Professionalität aus wie ein Automechaniker oder Uhrmacher. Als Kapitän eines Schiffes wäre er kaum zum Piratenleben verdammt gewesen, weil man ihm seine Gutherzigkeit gleich ansieht. Sein Körper hängt an seinem Hals wie ein großer schwerer Talisman. Grotesk überflüssig, sein Kopf allein hätte genügt.
Sein Kopf hätte auf alle möglichen Identitäten gepasst. Es stimmt, dass Kleider Leute machen, was aber, wenn manche trotz aller Kostüme immer Menschen bleiben? Meine Schwester meint, dass wir einander ähneln. Wir sind die zwei Herren am Basar, die Backgammon spielen. Wir sind die zwei Alten auf dem Balkon in der Muppet Show. Wir sind die nach der Geburt getrennten Zwillinge, die einander gerade erst kennengelernt haben. Wir sind die zwei Pferde vor dem Gespann eines abgehalfterten Feldherrn. Wir sind die paarweise verschwindenden Schuhe. Wir sind ein Doppelbett mit zwei getrennten Matratzen. Wir sind Salz und Pfeffer auf den Tischen ländlicher Gaststätten. Wir sind die berüchtigten Retter der langen Tage. Wir sind die, die niemand anspricht, wir sind die, die vorne einsteigen, und wir sind die Beifahrer im Coupé. Wir sind die, denen die anderen gleich sind. Wir sind zwei Überraschte, zwei Haderer, außer wenn es um uns geht. Wir sind die, die nie genug Zeit haben, um alles zu sagen, die, die sich beeilen, den anderen zu Wort kommen zu lassen und ihn dann unterbrechen, die schnell sprechen und schnell zuhören, die die Worte erkennen, bevor sie fallen. Wir sind die, die es nicht geben müsste, außer für uns selbst. Wir sind das Paar, das keines ist. Die Liebe, die anders heißt. Wir sind ein gut getarnter Chor, ein himmlisches Duett, ein gut geteiltes Glück. Werden wir verrückt, jeder für sich, dann wenigstens nicht allein.