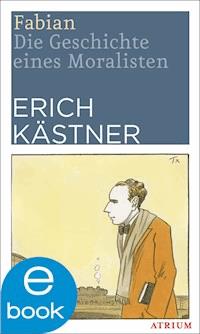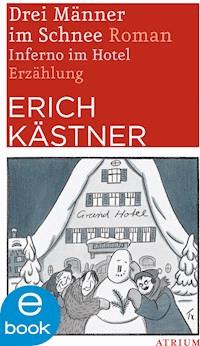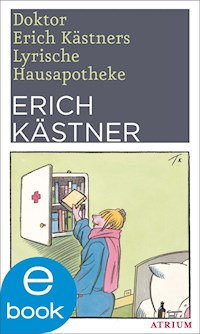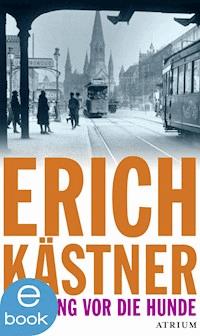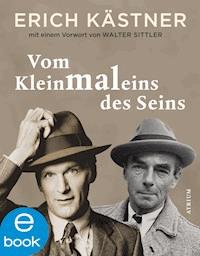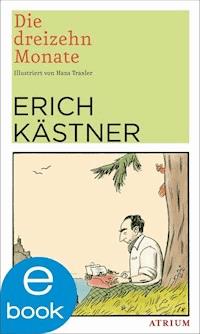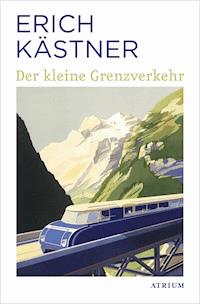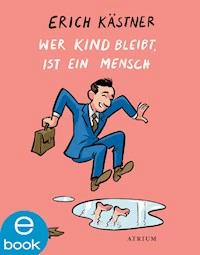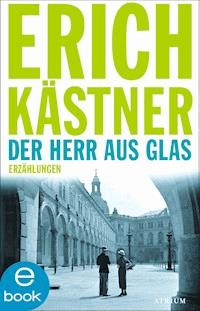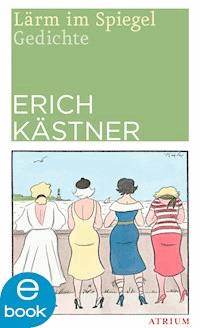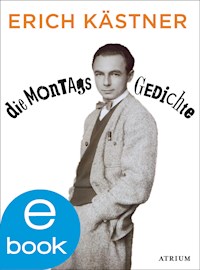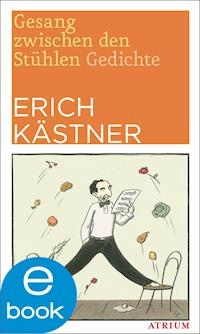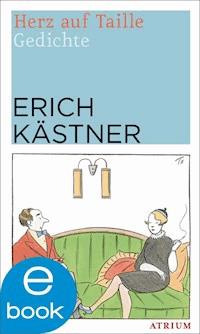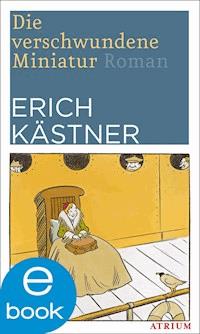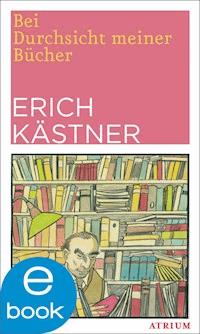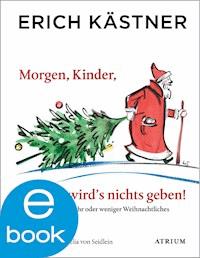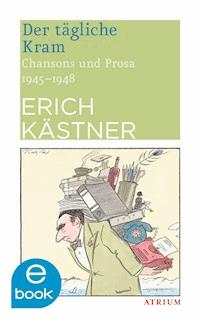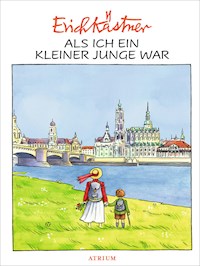
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Atrium Verlag AG Zürich
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
"In diesem Buch will ich Kindern einiges aus meiner Kindheit erzählen. Nur einiges, nicht alles. Sonst würde es eines der dicken Bücher, die ich nicht mag, schwer wie ein Ziegelstein, und mein Schreibtisch ist schließlich keine Ziegelei." Erich Kästner hält, was er verspricht: Er erzählt von alltäglichen, lustigen, aber auch nachdenklich stimmenden Erlebnissen aus seiner Zeit als Großstadtjunge.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 218
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Erich Kästner
Als ich ein kleiner Junge war
Illustriert von Horst Lemke
Erich Kästners Werke erscheinen im Atrium Verlag in ihrer originalen Textgestalt. Die Sprache hat sich im Lauf der Jahrzehnte gewandelt, manche Begriffe werden nicht mehr oder anders verwendet. Zum besseren Verständnis für heutige Kinder wurden einige Begriffe dem heutigen Sprachgebrauch angepasst.
Neuausgabe
© by Atrium Verlag AG, Zürich 2018
Alle Rechte vorbehalten
Erstveröffentlichung: Atrium-Verlag, Zürich, 1957
Coverillustration von Isabel Kreitz
Illustrationen von Horst Lemke
Covergestaltung: Herr K | Jan Kermes, Leipzig
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
ISBN978-3-03792-133-3
www.atrium-verlag.com
www.instagram.com/atrium_kinderbuch_verlag
Kein Buch ohne Vorwort
Liebe Kinder und Nichtkinder!
Meine Freunde machen sich schon seit langem darüber lustig, dass keines meiner Bücher ohne ein Vorwort erscheint. Ja, ich hab auch schon Bücher mit zwei und sogar mit drei Vorworten zustande gebracht! In dieser Hinsicht bin ich unermüdlich. Und auch wenn es eine Unart sein sollte – ich werde mir’s nicht abgewöhnen können. Erstens gewöhnt man sich Unarten am schwersten ab und zweitens halte ich es für gar keine Unart.
Ein Vorwort ist für ein Buch so wichtig und so hübsch wie der Vorgarten für ein Haus. Natürlich gibt es auch Häuser ohne Vorgärtchen und Bücher ohne Vorwörtchen, Verzeihung, ohne Vorwort. Aber mit einem Vorgarten, nein, mit einem Vorwort sind mir die Bücher lieber. Ich bin nicht dafür, dass die Besucher gleich mit der Tür ins Haus fallen. Es ist weder für die Besucher gut noch fürs Haus. Und für die Tür auch nicht.
So ein Vorgarten mit Blumenrabatten, beispielsweise mit bunten, kunterbunten Stiefmütterchen, und einem kleinen, kurzen Weg aufs Haus zu, mit drei, vier Stufen bis zur Tür und zur Klingel, das soll eine Unart sein? Mietskasernen, ja siebzigstöckige Wolkenkratzer, sie sind im Laufe der Zeit notwendig geworden. Und dicke Bücher, schwer wie Ziegelsteine, natürlich auch. Trotzdem gehört meine ganze Liebe nach wie vor den kleinen gemütlichen Häusern mit den Stiefmütterchen und Dahlien im Vorgarten. Und den schmalen, handlichen Büchern mit ihrem Vorwort.
Vielleicht liegt es daran, dass ich in Mietskasernen aufgewachsen bin. Ganz und gar ohne Vorgärtchen. Mein Vorgarten war der Hinterhof und die Teppichstange war mein Lindenbaum. Das ist kein Grund zum Weinen und es war kein Grund zum Weinen. Höfe und Teppichstangen sind etwas sehr Schönes. Und ich habe wenig geweint und viel gelacht. Nur, Fliederbüsche und Holundersträucher sind auf andere und noch schönere Weise schön. Das wusste ich schon, als ich ein kleiner Junge war. Und heute weiß ich’s fast noch besser. Denn heute hab ich endlich ein Vorgärtchen und hinterm Haus eine Wiese. Und Rosen und Veilchen und Tulpen und Schneeglöckchen und Narzissen und Hahnenfuß und Männertreu und Glockenblumen und Vergissmeinnicht und meterhohe blühende Gräser, die der Sommerwind streichelt. Und Faulbaumsträucher und Fliederbüsche und zwei hohe Eschen und eine alte, morsche Erle hab ich außerdem. Sogar Blaumeisen, Kohlmeisen, Hänflinge, Kleiber, Dompfaffen, Amseln, Buntspechte und Elstern hab ich. Manchmal könnte ich mich fast beneiden!
In diesem Buche will ich Kindern einiges aus meiner Kindheit erzählen. Nur einiges, nicht alles. Sonst würde es eines der dicken Bücher, die ich nicht mag, schwer wie ein Ziegelstein, und mein Schreibtisch ist ja schließlich keine Ziegelei, und überdies: Nicht alles, was Kinder erleben, eignet sich dafür, dass Kinder es lesen! Das klingt ein bisschen merkwürdig. Doch es stimmt. Ihr dürft mir’s glauben.
Dass ich ein kleiner Junge war, ist nun fünfzig Jahre her, und fünfzig Jahre sind immerhin ein halbes Jahrhundert. (Hoffentlich hab ich mich nicht verrechnet!) Und ich dachte mir eines schönen Tages, es könne euch interessieren, wie ein kleiner Junge vor einem halben Jahrhundert gelebt hat. (Auch darin hab ich mich hoffentlich nicht verrechnet.)
Damals war ja so vieles anders als heute! Ich bin noch mit der Pferdebahn gefahren. Der Wagen lief schon auf Schienen, aber er wurde von einem Pferde gezogen, und der Schaffner war zugleich der Kutscher und knallte mit der Peitsche. Als sich die Leute an die »Elektrische« gewöhnt hatten, wurden die Humpelröcke Mode. Die Damen trugen ganz lange, ganz enge Röcke. Sie konnten nur winzige Schrittchen machen und in die Straßenbahn klettern konnten sie schon gar nicht. Sie wurden von den Schaffnern und anderen kräftigen Männern, unter Gelächter, auf die Plattform hinaufgeschoben, und dabei mussten sie auch noch den Kopf schräg halten, weil sie Hüte trugen, so groß wie Wagenräder, mit gewaltigen Federn und mit ellenlangen Hutnadeln und polizeilich verordneten Hutnadelschützern!
Damals gab es noch einen deutschen Kaiser. Er hatte einen hochgezwirbelten Schnurrbart im Gesicht und sein Berliner Hof-Friseur machte in den Zeitungen und Zeitschriften für die vom Kaiser bevorzugte Schnurrbartbinde Reklame. Deshalb banden sich die deutschen Männer morgens nach dem Rasieren eine breite Schnurrbartbinde über den Mund, sahen albern aus und konnten eine halbe Stunde lang nicht reden.
Einen König von Sachsen hatten wir übrigens auch. Des Kaisers wegen fand jedes Jahr ein Kaisermanöver statt, und dem König zuliebe, anlässlich seines Geburtstags, eine Königsparade. Die Uniformen der Grenadiere und Schützen, vor allem aber der Kavallerieregimenter, waren herrlich bunt. Und wenn, auf dem Alaunplatz in Dresden, die Gardereiter mit ihren Kürassierhelmen, die Großenhainer und Bautzener Husaren mit verschnürter Attila und brauner Pelzmütze, die Oschatzer und Rochlitzer Ulanen mit Ulanka und Tschapka und die Reitenden Jäger, allesamt hoch zu Ross, mit gezogenem Säbel und erhobener Lanze an der königlichen Tribüne vorübertrabten, dann war die Begeisterung groß, und alles schrie Hurra. Die Trompeten schmetterten. Die Schellenbäume klingelten. Und die Pauker schlugen auf ihre Kesselpauken, dass es nur so dröhnte. Diese Paraden waren die prächtigsten und teuersten Revuen und Operetten, die ich in meinem Leben gesehen habe.
Der Monarch, dessen Geburtstage so bunt und laut gefeiert wurden, hieß Friedrich August. Und er war der letzte sächsische König. Doch das wusste er damals noch nicht. Manchmal fuhr er mit seinen Kindern durch die Residenzstadt. Neben dem Kutscher saß, mit verschränkten Armen und einem schillernden Federhut, der Leibjäger. Und aus dem offenen Wagen winkten die kleinen Prinzen und Prinzessinnen uns anderen Kindern zu. Der König winkte auch. Und er lächelte freundlich. Wir winkten zurück und bedauerten ihn ein bisschen. Denn wir und alle Welt wussten ja, dass ihm seine Frau, die Königin von Sachsen, davongelaufen war. Mit Signore Toselli, einem italienischen Geiger! So war der König eine lächerliche Figur geworden und die Prinzessinnen und Prinzen hatten keine Mutter mehr.
Um die Weihnachtszeit spazierte er manchmal, ganz allein und mit hochgestelltem Mantelkragen, wie andere Offiziere auch, durch die abendlich funkelnde Prager Straße und blieb nachdenklich vor den schimmernden Schaufenstern stehen. Für Kinderkleider und Spielwaren interessierte er sich am meisten. Es schneite. In den Läden glitzerten die Christbäume. Die Passanten stießen sich an, flüsterten: »Der König!«, und gingen eilig weiter, um ihn nicht zu stören. Er war einsam. Er liebte seine Kinder. Und deshalb liebte ihn die Bevölkerung. Wenn er in die Fleischerei Rarisch hineingegangen wäre und zu einer der Verkäuferinnen gesagt hätte: »Ein Paar heiße Altdeutsche, mit viel Senf, zum Gleichessen!«, wäre sie bestimmt nicht in die Knie gesunken, und sie hätte sicher nicht geantwortet: »Es ist uns eine hohe Ehre, Majestät!« Sie hätte nur gefragt: »Mit oder ohne Semmel?« Und wir anderen, auch meine Mutter und ich, hätten beiseitegeschaut, um ihm den Appetit nicht zu verderben. Aber er traute sich wohl nicht recht. Er ging nicht zu Rarisch, sondern die Seestraße entlang, blieb vor Lehmann & Leichsenring, einem schönen Delikatessengeschäft, stehen, passierte den Altmarkt, schlenderte die Schlossstraße hinunter, musterte, bei Zeuner in der Auslage, die in Schlachtformation aufgestellten Nürnberger Zinnsoldaten, und dann war es mit seinem Weihnachtsbummel auch schon vorbei! Denn auf der anderen Straßenseite stand das Schloss. Man hatte ihn bemerkt. Die Wache sprang heraus. Kommandoworte ertönten. Das Gewehr wurde präsentiert. Und der letzte König von Sachsen verschwand, unter Anlegen der Hand an die Mütze, in seiner viel zu großen Wohnung.
Ja, ein halbes Jahrhundert ist eine lange Zeit. Aber manchmal denk ich: Es war gestern. Was gab es seitdem nicht alles! Kriege und elektrisches Licht, Revolutionen und Inflationen, lenkbare Luftschiffe und den Völkerbund, die Entzifferung der Keilschrift und Flugzeuge, die schneller sind als der Schall! Doch die Jahreszeiten und die Schularbeiten, die gab es immer schon, und es gibt sie auch heute noch. Meine Mutter musste zu ihren Eltern noch »Sie« sagen. Aber die Liebe zwischen Eltern und Kindern hat sich nicht geändert. Mein Vater schrieb in der Schule noch »Brod« und »Thür«. Aber ob nun Brod oder Brot, man aß und isst es gerne. Und ob nun Thür oder Tür, ohne sie kam und käme man nicht ins Haus. Fast alles hat sich geändert und fast alles ist sich gleich geblieben.
War es erst gestern, oder ist es wirklich schon ein halbes Jahrhundert her, dass ich meine Rechenaufgaben unter der blakenden Petroleumlampe machte? Dass plötzlich, mit einem dünnen »Klick«, der gläserne Zylinder zersprang? Und dass er vorsichtig mit dem Topflappen ausgewechselt werden musste? Heutzutage brennt die Sicherung durch, und man muss, mit dem Streichholz, eine neue suchen und einschrauben. Ist der Unterschied so groß? Nun ja, das Licht schimmert heute heller als damals, und man braucht den elektrischen Strom nicht in der Petroleumkanne einzukaufen. Manches ist bequemer geworden. Wurde es dadurch schöner? Ich weiß nicht recht. Vielleicht. Vielleicht auch nicht.
Als ich ein kleiner Junge war, trabte ich, morgens vor der Schule, zum Konsumverein in die Grenadierstraße. »Anderthalb Liter Petroleum und ein frisches Vierpfundbrot, zweite Sorte«, sagte ich zur Verkäuferin. Dann rannte ich – mit dem Wechselgeld, den Rabattmarken, dem Brot und der schwappenden Kanne – weiter. Vor den zwinkernden Gaslaternen tanzten die Schneeflocken. Der Frost nähte mir mit feinen Nadelstichen die Nasenlöcher zu. Jetzt ging’s zu Fleischermeister Kießling. »Bitte, ein Viertelpfund hausschlachtene Blut- und Leberwurst, halb und halb!« Und nun in den Grünkramladen zu Frau Kletsch. »Ein Stück Butter und sechs Pfund Kartoffeln. Einen schönen Gruß, und die letzten waren erfroren!« Und dann nach Hause! Mit Brot, Petroleum, Wurst, Butter und Kartoffeln! Der Atem quoll weiß aus dem Mund, wie der Rauch eines Elbdampfers. Das warme Vierpfundbrot unterm Arm kam ins Rutschen. In der Tasche klimperte das Geld. In der Kanne schaukelte das Petroleum. Das Netz mit den Kartoffeln schlug gegen das Knie. Die quietschende Haustür. Die Treppe, drei Stufen auf einmal. Die Klingel im dritten Stock, und zum Klingeln keine Hand frei. Mit dem Schuh gegen die Tür. Sie öffnete sich. »Kannst du denn nicht klingeln?« »Nein, Muttchen, womit denn?« Sie lacht. »Hast du auch nichts vergessen?« »Na, erlaube mal!« »Treten Sie näher, junger Mann!« Und dann gab’s, am Küchentisch, eine Tasse Malzkaffee mit Karlsbader Feigenzusatz und den warmen Brotkanten, das »Ränftchen«, mit frischer Butter. Und der gepackte Schulranzen stand im Flur und trat ungeduldig von einem Bein aufs andre.
»Seitdem sind mehr als fünfzig Jahre vergangen«, erklärt nüchtern der Kalender, dieser hornalte, kahle Buchhalter im Büro der Geschichte, der die Zeitrechnung kontrolliert und, mit Tinte und Lineal, die Schaltjahre blau und jeden Jahrhundertbeginn rot unterstreicht. »Nein!«, ruft die Erinnerung und schüttelt die Locken. »Es war gestern!« Und lächelnd fügt sie, leise, hinzu: »Oder allerhöchstens vorgestern.« Wer hat unrecht?
Beide haben recht. Es gibt zweierlei Zeit. Die eine kann man mit der Elle messen, mit der Bussole und dem Sextanten. Wie man Straßen und Grundstücke ausmisst. Unsere Erinnerung aber, die andere Zeitrechnung, hat mit Meter und Monat, mit Jahrzehnt und Hektar nichts zu schaffen. Alt ist, was man vergessen hat. Und das Unvergessliche war gestern. Der Maßstab ist nicht die Uhr, sondern der Wert. Und das Wertvollste, ob lustig oder traurig, ist die Kindheit. Vergesst das Unvergessliche nicht! Diesen Rat kann man, glaub ich, nicht früh genug geben.
Damit ist die Einleitung zu Ende. Und auf der nächsten Seite beginnt das erste Kapitel. Das gehört sich so. Denn auch wenn der Satz »Kein Buch ohne Vorwort« eine gewisse Berechtigung haben sollte – seine Umkehrung stimmt erst recht. Sie lautet:
KEIN VORWORT OHNE BUCH
Das erste KapitelDie Kästners und die Augustins
Wer von sich selber zu erzählen beginnt, beginnt meist mit ganz anderen Leuten. Mit Menschen, die er nie gesehen hat und nie gesehen haben kann. Mit Menschen, die er nie getroffen hat und niemals treffen wird. Mit Menschen, die längst tot sind und von denen er fast gar nichts weiß. Wer von sich selber zu erzählen beginnt, beginnt meist mit seinen Vorfahren.
Das ist begreiflich. Denn ohne die Vorfahren wäre man im Ozeane der Zeit, wie ein Schiffbrüchiger auf einer winzigen und unbewohnten Insel, ganz allein. Mutterseelenallein. Großmutterseelenallein. Urgroßmutterseelenallein. Durch unsere Vorfahren sind wir mit der Vergangenheit verwandt und seit Jahrhunderten verschwistert und verschwägert. Und eines Tages werden wir selber Vorfahren geworden sein. Für Menschen, die heute noch nicht geboren und trotzdem schon mit uns verwandt sind.
Die Chinesen errichteten, in früheren Zeiten, ihren Ahnen Hausaltäre, knieten davor nieder und besannen sich auf die Zusammenhänge. Der Kaiser und der Mandarin, der Kaufmann und der Kuli, jeder besann sich darauf, dass er nicht nur der Kaiser oder ein Kuli, sondern auch das einzelne Glied einer unzerreißbaren Kette war und, sogar nach seinem Tode, bleiben würde. Mochte die Kette nun aus Gold, aus Perlen oder nur aus Glas, mochten die Ahnen Söhne des Himmels, Ritter oder nur Torhüter sein – allein war keiner. So stolz oder so arm war niemand.
Doch wir wollen nicht feierlich werden. Wir sind, ob es uns gefällt oder nicht, keine Chinesen. Drum will ich meinen Vorfahren auch keinen Hausaltar bauen, sondern nur ein klein wenig von ihnen erzählen.
Von den Vorfahren meines Vaters »nur ein klein wenig« zu erzählen, macht nicht die geringsten Schwierigkeiten. Denn ich weiß nichts über sie. Fast nichts. Ihr Hochzeitstag und ihr Sterbejahr, ihre Namen und Geburtsdaten wurden von protestantischen Pfarrern gewissenhaft in sächsischen Kirchenbüchern eingetragen. Die Männer waren Handwerker, hatten viele Kinder und überlebten ihre Frauen, die meist bei der Geburt eines Kindes starben. Und viele der Neugeborenen starben mit ihren Müttern. Das war nicht nur bei den Kästners so, sondern in ganz Europa und Amerika. Und es besserte sich erst, als Doktor Ignaz Philipp Semmelweis das Kindbettfieber ausrottete.
Das geschah vor etwa hundert Jahren. Man hat Doktor Semmelweis den »Retter der Mütter« genannt und vor lauter Bewunderung vergessen, ihm Denkmäler zu errichten. Doch das gehört nicht hierher.
Meines Vaters Vater, Christian Gottlieb Kästner, lebte als Tischlermeister in Penig, einer sächsischen Kleinstadt an einem Flüsschen, das die Mulde heißt, und hatte mit seiner Frau Laura, einer geborenen Eidam, elf Kinder, von denen fünf starben, ehe sie laufen gelernt hatten. Zwei seiner Söhne wurden, wie der Vater, Tischler. Ein anderer, mein Onkel Karl, wurde Hufschmied. Und Emil Kästner, mein Vater, erlernte das Sattler- und Tapeziererhandwerk.
Vielleicht haben sie und ihre Vorväter mir die handwerkliche Sorgfalt vererbt, mit der ich meinem Beruf nachgehe. Vielleicht verdanke ich mein – im Laufe der Zeit freilich eingerostetes – turnerisches Talent dem Onkel Hermann, der noch mit fünfundsiebzig Jahren im Peniger Turnverein die Altherrenriege anführte. Ganz sicher aber haben mir die Kästners eine Familieneigenschaft in die Wiege gelegt, die alle meine Freunde immer wieder verwundert und oft genug ärgert: die echte und unbelehrbare Abneigung vorm Reisen.
Wir Kästners sind auf die weite Welt nicht sonderlich neugierig. Wir leiden nicht am Fernweh, sondern am Heimweh. Warum sollten wir in den Schwarzwald oder auf den Gaurisankar oder zum Trafalgar Square? Die Kastanie vorm Haus, der Dresdner Wolfshügel und der Altmarkt tun es auch. Wenn wir unser Bett und die Fenster in der Wohnstube mitnehmen könnten, dann ließe sich vielleicht darüber reden! Aber in die Fremde ziehen und das Zuhause daheim lassen? Nein, so hoch kann kein Berg und so geheimnisvoll kann keine Oase sein, so abenteuerlich kein Hafen und so laut kein Niagarafall, dass wir meinen, wir müssten sie kennenlernen! Es ginge noch, wenn wir daheim einschliefen und in Buenos Aires aufwachten! Das Dortsein wäre vorübergehend zu ertragen, aber das Hinkommen? Niemals! Wir sind, fürchte ich, Hausfreunde der Gewohnheit und der Bequemlichkeit. Und wir haben, neben diesen zweifelhaften Eigenschaften, eine Tugend: Wir sind unfähig, uns zu langweilen. Ein Marienkäfer an der Fensterscheibe beschäftigt uns vollauf. Es muss kein Löwe in der Wüste sein.
Trotzdem sind meine Herren Vorväter und noch mein Vater, wenigstens einmal im Leben, gereist. Auf Schusters Rappen. Als Handwerksburschen. Mit dem Gesellenbrief in der Tasche. Doch sie taten’s nicht freiwillig. Die Zünfte und Innungen verlangten es. Wer nicht in anderen Städten und bei fremden Meistern gearbeitet hatte, durfte selber nicht Meister werden. Man musste in der Fremde Geselle gewesen sein, wenn man daheim Meister werden wollte. Und das wollten die Kästners unbedingt, ob sie nun Tischler, Schmied, Schneider, Ofensetzer oder Sattler waren! Diese Wanderschaft blieb zumeist ihre erste und letzte Reise. Wenn sie Meister geworden waren, reisten sie nicht mehr.
Als mein Vater im verflossenen August vor meiner Münchner Wohnung aus einem Dresdner Auto kletterte – ein bisschen ächzend und müde, denn er ist immerhin neunzig Jahre alt –, war er nur gekommen, um festzustellen, wie ich wohne, und um aus meinem Fenster ins Grüne zu sehen. Ohne die Sorge um mich hätten ihn nicht zehn Pferde von seinem Dresdner Fenster fortgebracht. Auch dort blickt er ins Grüne. Auch dort gibt es Kohlmeisen, Buchfinken, Amseln und Elstern. Und viel mehr Sperlinge als in Bayern! Wozu also, wenn nicht meinetwegen, hätte er reisen sollen?
Ich selber bin ein bisschen mehr in der Welt herumgekommen als er und unsere Vorfahren. Ich war schon in Kopenhagen und Stockholm, in Moskau und Petersburg, in Paris und London, in Wien und Genf, in Edinburgh und Nizza, in Prag und Venedig, in Dublin und Amsterdam, in Radebeul und Lugano, in Belfast und in Garmisch-Partenkirchen. Aber ich reise nicht gern. Nur, man muss wohl auch in meinem Beruf unterwegs gewesen sein, wenn man daheim, eines schönen Tages vielleicht, Meister werden will. Und Meister werden, das möchte ich schon sehr gerne. Doch das gehört nicht hierher.
Ida Amalia Kästner, meine Mutter, stammt aus einer sächsischen Familie namens Augustin. Im 16. Jahrhundert hießen diese meine Vorfahren noch Augsten und Augstin und Augusten. Und erst um 1650 taucht der Name Augustin in den Kirchenbüchern und den Jahresrechnungen der Stadtkämmerei Döbeln auf.
Woher ich das weiß? Es gibt eine »Chronik der Familie Augustin«. Sie reicht bis ins Jahr 1568 zurück. Das war ein interessantes Jahr! Damals sperrte Elisabeth von England die Schottenkönigin Maria Stuart ins Gefängnis und König Philipp von Spanien tat dasselbe mit seinem Sohne Don Carlos. Herzog Alba ließ in Brüssel die Grafen Egmont und Horn hinrichten. Pieter Brueghel malte sein Bild »Die Bauernhochzeit«. Und mein Vorfahre Hans Augustin wurde vom Stadtkämmerer in Döbeln mit einer Geldstrafe belegt, weil er zu kleine Brote gebacken hatte. Nur wegen dieser Geldstrafe geriet er in die Jahresrechnungen der Stadt und mithin neben Maria Stuart, Don Carlos, Graf Egmont und Pieter Brueghel ins Buch der Geschichte. Wäre er damals nicht erwischt worden, wüssten wir nichts von ihm. Mindestens bis zum Jahre 1577. Denn da wurde er wieder wegen zu klein geratener Brote und Semmeln erwischt, bestraft und eingetragen! Desgleichen 1578, 1580, 1587 und, zum letzten Mal, im Jahre 1605. Man muss also zu kleine Brötchen backen und sich dabei erwischen lassen, wenn man berühmt werden will! Oder, im Gegenteil, zu große! Doch das hat noch keiner getan. Jedenfalls habe ich nichts dergleichen gehört oder gelesen.
Sein Sohn, Caspar Augustin, heißt in meiner Chronik Caspar I. Auch er war Bäcker und wird in den Annalen Döbelns dreimal erwähnt: 1613, 1621 und 1629. Und warum? Ihr ahnt es schon. Auch Caspar I. buk zu kleine Brötchen! Ja, die Augustins waren ein verwegenes Geschlecht! Aber es half ihnen nicht recht weiter. Obwohl sie Scheunen, Gärten und Wiesen kauften, Hopfen bauten und nicht nur Brot buken, sondern auch Bier brauten. Erst fiel die Pest über die Stadt her und raffte die halbe Familie hin. 1636 plünderten die Kroaten und 1645 die Schweden die kleine sächsische Stadt. Denn es herrschte ja der Dreißigjährige Krieg, und die Soldaten schlachteten das Vieh, verfütterten die Ernte, luden die Betten und das Kupfergeschirr auf Caspar Augustins Pferdewagen, verbrannten, was sie nicht mitnehmen konnten, fuhren mit der Beute davon und freuten sich diebisch auf das nächste Städtchen.
Der Sohn Caspar Augustins hieß gleichfalls Caspar. Die Chronik nennt ihn deshalb Caspar II. Auch er war Bäcker, regierte die Familie bis zum Jahre 1652 und ärgerte sich zu Tode. Denn sein Bruder Johann, der in Danzig lebte, kam nach Kriegsende angereist und verlangte sein Erbteil, das ja doch die Schweden mitgenommen hatten! Er forderte, weil er während des Krieges nicht hatte reisen wollen, sogar beträchtliche Zinsen! Es kam zu einem Prozess, der mit einem Vergleich endete. Der Vergleich wurde vom Stadtkämmerer fein säuberlich aufgeschrieben und damit gerieten meine Vorfahren wieder ins Buch der Geschichte. Diesmal nicht mit zu kleinen Brötchen, sondern mit einem Familienstreit. Nun, auch ein Bruderzwist kann sich sehen lassen!
Allmählich merke ich, dass ich mich werde kürzerfassen müssen, wenn ich beizeiten zum eigentlichen Gegenstande dieses Buches gelangen will: zu mir selber. Ich fasse mich also kurz. Was gäbe es auch groß zu berichten? Die Augustins rappelten sich wieder hoch, und jeder – ob nun Wolfgang Augustin oder Johann Georg I., Johann Georg II. oder Johann Georg III. –, ein jeder von ihnen wurde Bäckermeister. 1730 brannte die Stadt ab. Im Siebenjährigen Krieg, als es Döbeln wieder besser erging, kamen die Preußen. Die Stadt wurde eines ihrer Winterquartiere. Denn damals hatte der Krieg im Winter große Ferien. Das konnte selbst Friedrich der Große nicht ändern. Die Regimenter machten es sich also bequem und vernichteten die feindlichen Städte und Dörfer, statt mit Pulver und Blei, mit ihrem Appetit. Als man sich wieder erholt hatte, kam Napoleon mit seiner Großen Armee, und als er in der Völkerschlacht bei Leipzig geschlagen wurde, waren auch die Augustins wieder einmal am Ende. Denn erstens liegt Döbeln in Leipzigs Nähe. Und zweitens war der König von Sachsen mit Napoleon verbündet gewesen. Er gehörte zu den Verlierern. Und das spürten seine Untertanen, auch die in Döbeln, mehr als er selber.
Doch die Augustins ließen nicht locker. Wieder brachten sie es zu einigem Wohlstand. Wieder als Bäcker, und wieder mit der Genehmigung, Bier zu brauen und zu verkaufen. Dreihundert Jahre waren sie nun schon Bäcker. Trotz Pest und Brand und Kriegen. Da vollzog sich, im Jahre 1847, die große, entscheidende Wendung: Der Bäckermeister Johann Carl Friedrich Augustin eröffnete ein Fuhrgeschäft! Seit diesem historischen Datum haben die Vorfahren meiner Mutter mit Pferden zu tun. Und es ist nicht ihre Schuld, dass das Pferd, dieses herrliche Tier, im Aussterben begriffen ist, und mit dem Pferd der Beruf des Fuhrwerksbesitzers und des Pferdehändlers.
Das dritte Kind Johann Friedrich Augustins wurde Carl Friedrich Louis getauft. Er wurde später, in Kleinpelsen bei Döbeln, Schmied und Pferdehändler. Und Pferdehändler wurden sieben seiner Söhne. Zwei davon brachten es zum Millionär. Mit dem Pferdehandel lässt sich mehr verdienen als mit Brot und Semmeln, selbst wenn sie zu klein geraten. Dazu kommt, dass man Pferde, auch wenn man sie kauft und verkauft und an ihnen verdient, lieben kann. Bei Brötchen ist das viel, viel schwieriger. Endlich hatten die Augustins ihren wahren Beruf entdeckt!
Der Schmied aus Kleinpelsen wurde mein Großvater. Seine mit Pferden handelnden Söhne wurden meine Onkels. Und seine Tochter Ida Amalia ist meine Mutter. Doch sie gehört nicht hierher. Denn meine Mutter ist ein ganz, ganz andres Kapitel.
Das zweite KapitelDie kleine Ida und ihre Brüder
Meine Mutter kam am 9. April 1871 im Dorfe Kleinpelsen zur Welt. Und auch damals gab es, wie so oft im Leben, gerade Krieg. Deshalb wurde ihr Geburtsort auch nicht halb so berühmt wie im gleichen Jahre Wilhelmshöhe bei Kassel, wo Napoleon III., der Kaiser der Franzosen, interniert, oder wie Versailles bei Paris, wo König Wilhelm von Preußen zum deutschen Kaiser ernannt wurde.
Der französische Kaiser wurde in einem deutschen Schloss eingesperrt und der deutsche Kaiser wurde in einem französischen Schloss proklamiert. Umgekehrt wär’s eigentlich viel einfacher und wesentlich billiger gewesen! Aber die Weltgeschichte kann ja nicht genug kosten! Wenn ein Kolonialwarenhändler in seinem kleinen Laden so viele Dummheiten und Fehler machte wie die Staatsmänner und Generäle in ihren großen Ländern, wäre er in spätestens vier Wochen bankrott. Und er käme ganz und gar nicht ins goldne Buch der Geschichte, sondern ins Kittchen. Doch das gehört, schon wieder einmal, nicht hierher.
Die kleine Ida Augustin, meine zukünftige Mama, verbrachte ihre Kindheit in einem Bauernhaus. Zu diesem Hause gehörte mancherlei: eine Scheune, ein Vorgärtchen mit Stiefmütterchen und Astern, ein Dutzend Geschwister, ein Hof mit Hühnern, ein alter Obstgarten mit Kirsch- und Pflaumenbäumen, ein Pferdestall, viel Arbeit und ein langer Schulweg. Denn die Schule lag in einem Nachbardorf. Und sehr viel gab’s in der Schule im Nachbardorfe nicht zu lernen. Denn sie hatte nur einen einzigen Lehrer und nur zwei Klassen. In der einen Klasse saßen die Kinder vom siebenten bis zum zehnten, in der andern vom elften Lebensjahre bis zur Konfirmation. Da war außer Lesen, Schreiben und Rechnen nichts zu holen, und für die gescheiten Kinder war es schrecklich langweilig! Vier Jahre in ein und derselben Klasse – es war zum Auswachsen!
Im Sommer war es damals heißer als heutzutage und im Winter kälter. Woran das gelegen hat, weiß ich nicht. Es gibt Leute, die behaupten, sie wüssten es. Aber ich habe sie im Verdacht, dass sie renommieren.
Im Winter lag der Schnee mitunter so hoch, dass die Haustür nicht aufging! Dann mussten die Kinder durchs Fenster klettern, wenn sie in die Schule wollten. Oder weil mein Großvater meinte, sie sollten wollen! Wenn sich die Tür, trotz des Schnees, öffnen ließ, musste man mit Schaufeln erst einen Tunnel graben, durch den die Kinder dann ins Freie krochen! Das war zwar ganz lustig, aber die Lustigkeit dauerte nicht lange. Denn der Wind pfiff eisig über die Felder. Man versank im Schnee bis zu den Hüften. Man fror an den Fingern und Zehen und Ohren, dass einem die Tränen in die Augen schossen. Und wenn man schließlich pitschnass, halb erfroren und zu spät in der Schule ankam, gab es nicht einmal etwas Rechtes und Interessantes zu lernen!
Das alles verdross die kleine Ida nicht. Sie kletterte aus dem Fenster. Sie kroch durch den Schneetunnel. Sie fror und weinte auf dem Schulweg vor sich hin. Es machte ihr wenig aus. Denn