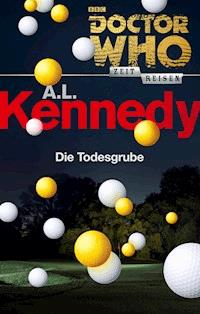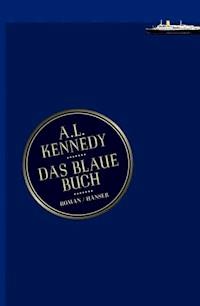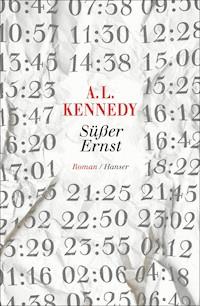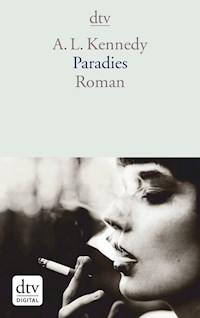Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Meisterwerk der moralischen Beunruhigung – die Weltpremiere von A.L. Kennedys neuem Roman. Soll man Unbarmherzigen gegenüber barmherzig sein? Anna unterrichtet an einer Grundschule und möchte immer noch die Welt verbessern. Wie vor fünfundzwanzig Jahren, als sie in Edinburgh mit einer Gruppe von Straßenkünstlern gegen die Kriegs- und Sozialpolitik der englischen Regierung demonstrierte. Was sie damals nicht ahnte: Einer ihrer Kumpane war ein V-Mann, der sie alle verriet. Nun stellt sie dem Peiniger nach. Doch bis wohin reicht das Böse – und kann Anna sich selber davon freihalten? Ein Meisterwerk der moralischen Beunruhigung. In ihrem unnachahmlichen Stil, in dem sich Ironie und Empathie verbinden, erzählt A.L. Kennedy von der Möglichkeit der Liebe der Menschen füreinander.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 672
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Über das Buch
Ein Meisterwerk der moralischen Beunruhigung — die Weltpremiere von A.L. Kennedys neuem Roman.Soll man Unbarmherzigen gegenüber barmherzig sein? Anna unterrichtet an einer Grundschule und möchte immer noch die Welt verbessern. Wie vor fünfundzwanzig Jahren, als sie in Edinburgh mit einer Gruppe von Straßenkünstlern gegen die Kriegs- und Sozialpolitik der englischen Regierung demonstrierte. Was sie damals nicht ahnte: Einer ihrer Kumpane war ein V-Mann, der sie alle verriet. Nun stellt sie dem Peiniger nach. Doch bis wohin reicht das Böse — und kann Anna sich selber davon freihalten? Ein Meisterwerk der moralischen Beunruhigung. In ihrem unnachahmlichen Stil, in dem sich Ironie und Empathie verbinden, erzählt A.L. Kennedy von der Möglichkeit der Liebe der Menschen füreinander.
A. L. Kennedy
Als lebten wir in einem barmherzigen Land
Roman
Aus dem Englischen von Ingo Herzke und Susanne Höbel
Hanser
Für WMF
Wir sind so gewöhnt, uns vor anderen zu verstellen, dass wir es zuletzt auch vor uns selber tun.
François de la Rochefoucauld
MENSCHEN WERDEN, was sie sein müssen, damit sie sich ihrer Zeit stellen können. Das ist meine Theorie. Natürlich braucht man Glück, damit es dazu kommt. Und manche Menschen haben kein Glück. Darum sollte es Barmherzigkeit geben.
Wann genau Sie dies lesen, lässt sich nur vermuten. Ich denke aber, ich kann davon ausgehen, dass vieles entsetzlich sein und entsetzlich bleiben oder danach gar noch entsetzlicher werden wird. Angenehmere Umstände werden vielleicht nicht wieder eintreten, weil wir als Spezies einfach nicht überzeugen.
Das tut mir leid. Ich weiß nicht, was wir uns dabei gedacht haben.
Aber vielleicht — vielleicht geht es uns auch gut. Oder vielleicht sind wir kurz vorm Aufblühen, alles bereit dafür. Vielleicht lernen wir und leben irgendwie in den Feuern, die wir selbst entzündet haben, und sind zufrieden und verbrennen nicht. Vielleicht treten wir hinterher aus der Gewitterfront in ein behutsames Leben. Wir werden voranschreiten und selten zurückblicken.
Das ist jedenfalls zu hoffen, oder etwas in der Art. Man muss doch hoffen, oder?
Ich habe einmal von einem Experiment gelesen, bei dem Mäuse in schreckliche mit Wasser gefüllte Röhrchen gesteckt wurden. Man überließ sie sich selbst, und sie strampelten und paddelten, um über Wasser zu bleiben, aber schon nach wenigen Minuten waren sie vollkommen erschöpft und kurz vorm Ertrinken. An dieser Stelle mussten die Forscher, die ein ihrer Ansicht nach wohl vernünftiges und notwendiges Experiment beobachteten, die Mäuse aus dem Wasser fischen.
Das Komische war, dass dieselben Tierchen, wenn die fürchterlichen Forscher sie wieder in die Wasserfolterröhren steckten — denn das taten sie natürlich —, schwammen und schwammen und schwammen, doppelt so lange, zehnmal so lange wie vorher und immer weiter. Irgendwo in ihren kleinen Mäusehirnen vertrauten sie darauf, dass sie gerettet würden, wenn sie völlig verzweifelt wären, und das ließ sie länger durchhalten. Ich kann nicht sagen, ob das eine gute Nachricht war.
Dennoch hoffe ich. Und ich meine es gut. Muss man heutzutage. Wenn Sie sich überhaupt irgendwelche Gedanken machen, dann sind Sie verpflichtet, es richtig gut zu meinen und gut zu handeln, mit allem Nachdruck, wirklich jeden Tag, denn am lautesten und profitabelsten ist immer die Gegenseite.
Und die Oakwood School meint es auch gut. Wir rezitieren alle immer noch jeden Morgen zuallererst das Oakwood-Grundschul-Gelöbnis. Wir setzen uns alle stolz und aufrecht vor unsere Bildschirme, hinter uns unsere Zimmer, und so eben außer Sicht unsere jeweiligen streunenden Haustiere und unser jeweiliges Chaos.
Wir sind hilfreich und freundlich, wir geben gut acht,
Wir machen heil, nicht kaputt, und tun unsere Pflicht,
Wir wachsen alltäglich in Schönheit und Licht,
Wir lernen, sind mutig und schlafen gut bei Nacht.
An den meisten Tagen trifft nichts davon auf mich zu. Ich möchte gern glauben, dass es den Kindern besser gelingt. Wir versuchen voranzukommen, darauf kommt es an.
Oakwood ist eine Schule, an der das Schulgeld von wohlhabenden Eltern wohlstandsverwahrloster Kinder die ratlosen Eltern ratloser und belasteter Kinder subventioniert und alle vor allem ihr Bestes geben. Es sind natürlich auch sehr normale Kinder hier, auch wenn das Normalitätsniveau schwankt. Letzten Monat war Tony noch grundstabil und weit weg von irgendwelchen Ertränkungsröhren. Dann starb sein Großvater allein, versteckt in dem Koma, von dem die Ärzte ein wenig gehofft hatten, es würde Opa vor dem Tod verstecken. Niemand war dabei, um seine Hand zu halten oder ein Wort zu sprechen, als er ging. Sein Beatmungsgerät pumpte zweifellos während des ganzen Vorgangs ungerührt weiter, denn Maschinen regen sich nicht auf.
Damit hatte Jahrgang fünf mehr als genug Gesprächsstoff. Wir bekamen Angst. Wir berappeln uns jetzt wieder, wir verarbeiten es, aber ich merke immer noch gelegentlich, wie dunkle Wolken über die Gesichter ziehen. Dinge streifen und drücken nachts an unsere Fenster wie Gesichter von Irren. Allerdings erwähnen wir die womöglich irren Dinge nicht oft, falls sie hören, wie wir ihre Namen sagen, und sich plötzlich für uns interessieren.
Alle werden abergläubisch. Ich töte nicht einmal mehr die großen und schnellen Spinnen. Nur zur Vorsicht.
Am Mittwoch brach Talha plötzlich in Tränen aus — an seinem Küchentisch, die Bilder ordentlich im Hintergrund seiner Arbeitsnische, sein komisches Haarbüschel in die Luft ragend — wie eine Antenne, die ihn mit zu viel Realität verbindet. Talha ist klug, auf besorgniserregende Art intelligent.
Ich wäre inzwischen sehr enttäuscht vom Jahr 2020, wenn ich nicht schon wüsste, wie Jahre sein können. Es fällt schwer, Dinge nicht persönlich zu nehmen, aber vielleicht sind wir einfach mal dran.
Egal.
So habe ich mir den Beginn meiner Ausführungen nicht vorgestellt, aber da müssen wir jetzt gemeinsam durch.
Das hier ist unser Zuhause — meins und Pauls. Wir leben in unserem kleinen Haushalt, einer abgeschotteten Heimatinsel inmitten anderer Inseln mit mehr oder weniger durchlässigen Küsten. In der Isolation entwickeln wir Gefühlslagen und Manien, die sich mit der Zeit womöglich zu Bräuchen entwickeln könnten. Wenn Paul als Nächstes vorschlägt, draußen im Hof einen Weidenmann zu flechten und zu verbrennen, könnte ich einwilligen. Ich fördere gern die Kunst. Und ich mag Grillabende. Warum nicht beides?
Korbflechten und gegrillte Auberginen und vielleicht heidnische Lieder. Womöglich gar Popcorn. Wer könnte was dagegen haben?
Ich habe vor, exzentrisch zu werden.
»Noch exzentrischer?«
»Nur exzentrisch.«
Zu unserer Kultur gehört auch der verbale Schlagabtausch. Der leitet Spannungen ab.
»Mama, du trägst Flipflops, Unterhose und deine Backschürze. Du hast dein Ziel erreicht. Exzentrisch. Sie sind angekommen.«
»Es ist heiß. Und komm mir nicht mit dem Navi, junger Mann.«
»Nächster Halt: Im Park Eichhörnchen rasieren.«
»Ich verbitte mir solche Vorschläge. Den Eichhörnchen die Haare färben und sie zum Taschendiebstahl abzurichten — das könnte ein Plan sein, keine Frage.«
Wir sind ganz wir selbst. Gott sei Dank. Wir haben uns und das hier. Und draußen, jenseits unserer Mauern, strömt und wirbelt neuerdings brutale Luft die Wicklow Street entlang. Die Flut, die uns wegspülen will.
Ich sage den Kindern immer, sie sollen einen Plan machen, wie ausgestreute Krümel durch den Wald der Dinge, die ihr sagen wollt. Wenn ihr den Pfad gefunden habt, folgt ihm einfach nach Hause.
Und ich lebe in diesem Wald. Es ist mein Wald. Mein Leben. Ich stelle mir vor, es gibt wilde Brombeerhecken darin, lästige Bäche und Senken, vielleicht bösartige Bäume. Aber es gibt einen Pfad. Ich habe ihn getreten. Ich muss nur die Erinnerung zulassen, auch wenn ich das normalerweise lieber nicht tue.
Ich bin der Plan.
Verzeihen Sie mir, wenn ich unsere Eingangsszene so darstelle wie in einem Film. Ich hoffe — man muss hoffen —, das führt mich sanft zurück zu dem, was geschehen ist, lässt aber alles entfernter wirken. Außerdem ist meine Geschichte tatsächlich so wie viele Filme. Ich wollte in keiner Spionagehandlung mitmachen, auch in keinem Actionfilm oder Politthriller, aber es ist immer wieder passiert. Ich bin keine in Kampfkünsten versierte Agentin, keine Sirene, die für versteckte Erpressungskameras Opfer anlockt. Ich arbeite nicht mit Pseudonymen.
Ich bin bloß Grundschullehrerin.
Nein. Vergessen Sie das bloß.
Ich bin Grundschullehrerin. Ich bin einer der Menschen, die ihre Gesellschaft gleich von Anfang an am Laufen halten und dafür zu sorgen versuchen, dass sie nicht aus lauter kaputten Menschen besteht. Da ein bloß einzufügen, ist unangemessen.
Ich habe die übliche Anzahl von Namen: Mrs McCormick für die Kinder und die Telefonschwindler, Anna Louisa McCormick für Formulare und wenn ich so tun will, als wäre ich eine Gräfin von 1900, Anna für die meisten Menschen, woraus bei Paul Na-na wurde, allerdings hat sich Na-na inzwischen in Mum verwandelt. Eine absolut nachvollziehbare Änderung. Natürlich bin ich dagegen, aber ich behalte meine Einwände für mich, denn die Zeit schreitet voran, und manchmal lassen sich meine Gefühle ignorieren. Ich kann den armen Jungen ja nicht zwingen, im Laden Na-na, Na-na nach mir zu rufen. Da würden die Leute denken, er hat was an den Kopf gekriegt.
Ganz ehrlich wirkt Mum im Augenblick schon stark genug. Wenn er es sagt, ist das wie ein sanfter Schlag in die Magengrube — oder wie ein Vogel, der sich in meiner Brust entzündet. Genauso ist es immer. Sogar an Tagen, wenn ich ihn nicht mag — Schwärme verbrannter Feldlerchen, jedes Mal, wenn Paul es sagt. Dann frage ich mich, ob meine Mutter das wohl auch gefühlt hat, auch wenn ich es mir nicht vorstellen kann. Wenn Ma mir gegenüber nur schlichtes Missfallen ausdrückte, war es schon ein toller Tag. War nicht ihre Schuld. Sie war von Anfang an ein bisschen verdreht. Inzwischen komme ich damit klar. Und die Natur hat sich an ihr gerächt und sämtliche Tassen, die sie noch im Schrank hatte, in alle Richtungen verstreut. Außer Reichweite. Oder vielleicht gibt es auch kein Karma, und manchmal passieren willkürlich widerliche Dinge einfach willkürlich widerlichen Menschen.
Inzwischen können Sie sich denken, welche Option ich für wahr halte.
Arme Ma. Alles machte ihr Angst, daher ihre Wut.
Das ist das Problem mit dem Lockdown — er schiebt so viel Gerümpel und Geschäftigkeit beiseite. Dann kommt die Wirklichkeit durch. Plötzlich bin ich traurig, dass mein Hund nicht mehr da ist, dabei ist er schon seit Jahrzehnten weg. Offensichtlich habe ich nie aufgehört, darüber traurig zu sein — ich habe mich bloß erfolgreich davon abgelenkt.
Tage werden zu immer weniger bedeutsamen Zeitklumpen. Sie dauern alle etwa zwanzig Minuten und dehnen sich zugleich zwei bis drei Monate lang. Irgendwie bieten sie zu viele Gelegenheiten zum Nachdenken. Es gibt Augenblicke, da verabscheue ich alle Menschen auf der Welt, möchte aber auch jedem einzelnen vergeben. Auf jeden Fall ist mir klar, dass jeder sie braucht, die Vergebung. Und ziemlich viele von uns verdienen sie sogar.
Sogar ich dummer, ängstlicher Mensch könnte freigesprochen werden.
Was müssen Sie sonst noch wissen?
Ja — vor langer Zeit kannte man mich eine Zeit lang als The Amazing Annanka Ladystrong. Ich war gern Annanka. Ich wuchs mit ihr, in ihre Ansprüche hinein. Und in einen anderen Namen.
Außerdem versucht F. L. mich umzutaufen. Er probiert Kosenamen aus, hat aber noch keinen gefunden, der passt. Was womöglich daran liegt, dass ich nicht so sehr zum Kosen tauge.
Aber ich mag F. L. An ihm ist nichts auszusetzen. Ich bin ziemlich sicher, dass er mich liebt, sehr sicher sogar.
Ich reagiere darauf nicht angemessen — das muss mir vergeben werden. Und das Problem ist: Er vergibt mir auch. Er ist noch nicht abgehauen. Was macht das mit einem Menschen wie mir?
Unsere aktuelle Katastrophe hat ihn von unserer Als-ob-Insel abgeschnitten. Er steckt auf einer echten, tatsächlichen, von Wasser umgebenen Landmasse fest, mit Buchten und einem Hafen und so weiter — Colonsay. Ich vermisse ihn. Ich merke, wie ich ihn vermisse. Ich gehe regelmäßig ins Wohnzimmer und erwarte, ihn auf dem Sofa sitzen zu sehen, und immer wieder bin ich verblüfft, dass er nicht dort sitzt. Er ist auf sowohl unscheinbare als auch grundlegende Art abwesend — als hätte jemand über Nacht all meine Lichtschalter abmontiert. Ich strecke die Hand aus und merke erst dann, dass da nichts mehr ist.
Mit so etwas habe ich nicht gerechnet. Ich hatte nicht geglaubt, dass ich mich im Hinblick auf irgendeinen anderen Menschen als Paul so amputiert fühlen könnte. Das ist doch ein Fortschritt, oder?
Vielleicht.
In den ganzen Zusatzminuten, die wir jetzt haben, beschäftigen F. L. und ich — aber vor allem F. L. — uns mit meinem Unwillen, aus dem Unterholz hervorzukommen, in dem ich ein nervös zuckendes Waldwesen bleiben kann, sicher verborgen vor unserer Beziehung. Manchmal erstaunt es uns.
Wie alle wirklich schrecklichen Situationen ist auch diese gelegentlich witzig. Eines Abends — zu der Zeit, als es noch Besuche und Treffen und Reisen gab — tauchte F. L. tatsächlich mit zwei Backhandschuhen an den Händen und einem Netz auf. Er hatte eine Art Kescher geborgt — groß, aber nicht ganz groß genug, um einen Menschen zu fangen.
»Wozu die Handschuhe?«
»Gegen Bisse.«
»Ich beiße nicht.«
»Sagst du.«
»In das Netz kriegst du mich nicht.«
»Das ist ein Symbol, Anna.«
»Es riecht komisch. Symbole sollten nicht komisch riechen.«
»Multisensorisch.«
»Du weißt doch, ich stehe nicht auf Requisitenkomik.«
»Ich weiß. Weiß ich genau.« F. L. und seine immer müderen Augen. Sein Netz sank ein wenig und sah weniger gesellig aus.
Das Ding roch nach Klärgruben und kleinen, nach Luft schnappenden Lebewesen.
Das sagte ich nicht.
Bei F. L. muss ich an das Wort viereckig denken. Sehr gerader Rücken, Oberkörper wie ein großer Mann, aber kurze Arme und Beine. Auf Zoom fällt das nicht so auf, aber auch da strahlt er Verlässlichkeit aus.
Aber das tun auch die allerschlimmsten Menschen.
Wie sich zeigt, bringt es unsere Beziehung am meisten voran, wenn er ganz und gar wegbleibt, ohne es zu wollen.
Ihn zu vermissen, war sehr lehrreich — wenn ich ihn vermisse, muss ich ihn in meiner Nähe haben wollen.
Dieser Kescher hat mich ein bisschen wütend gemacht.
Aber dann auch wieder nicht.
Er kann gut mit Tieren umgehen.
Aber manche Tiere sind letztlich zu undankbar und wild. Manchmal ertappe ich mich bei dem Gedanken, wie leid es mir tut, dass er so viel Zeit auf mich verschwendet.
Paul. F. L. Ich.
Das ist im Grunde das gesamte Ensemble. Alle Menschen, die wichtig sind.
Ich erwähne außerdem natürlich Sue Delara, unsere Direktorin. Ich werde versuchen, Mr Simms nicht zu erwähnen, der die Viertklässler unterrichtet und einen komischen Schnauzer trägt, weshalb ich ihn auf einer Lehrer-Weihnachtsfeier nach zu viel Advocaat-Eierlikör Mr Krankgesicht nannte.
Eigentlich zu viel Gin, aber Advocaat klingt festlicher — er sieht sogar aus wie Rentierrotz. Und löst so eine schwüle Übelkeit aus, die alle Kinder aus ungeordneten Verhältnissen kennen, wenn sie an die bevorstehende Lametta-Saison denken.
Lehrerin der dritten Klasse — Polly Larsson, kann gut Grafiken und Spinnen mit bloßen Händen fangen. Klasse zwei — Brian Scott, der bei Filmen weint. Klasse eins — Mrs Parker, die mit allen redet, als wären sie vier Jahre alt — und liegt sie so weit daneben?
Sechste Klasse — Mrs Filmore. Ich versuche ihr nicht übel zu nehmen, dass sie mir meine Fünftklässler wegnimmt, wie es sich gehört. Sie ist wirklich eine gute Lehrerin. Weil sie wirklich gut ist, lenkt sie ihre Zuneigung um. Das soll sie auch. Und nach den ersten Tagen des Winterhalbjahrs ist meine neue Fünfte nur noch die Fünfte, und meine Zuneigung wurde ebenfalls umgelenkt und dann übertragen.
Klasse sieben — Mrs Decker. Sie bereitet alle auf die Probleme eines möglichen Wechsels an eine konventionellere Schule vor. Deswegen wirkt sie ein bisschen laut und herrisch. Aber sie weiß, wie man Autos knackt, was gelegentlich nützlich ist. Wir fragen sie nicht, warum sie so gut mit halben Tennisbällen und Draht und dergleichen umgeht. Vielleicht liegt es an der konventionelleren Schulbildung.
Aber Paul und F. L. und ich — auf uns kommt es an.
Und dies ist die Geschichte, die Na-na Paul nicht erzählt hat. Auch F. L. nicht. Sie weiß nicht genau, warum.
Aber jetzt ist es so weit.
Ehrlich gesagt weiß ich genau, warum ich sie noch nicht erzählt habe. Ich verspreche Ihnen, ich erzähle es irgendwann. Wenn ich kann. Wenn ich an eine ruhige Stelle in der Geschichte komme.
Und jetzt — denn jetzt fange ich wirklich an — tun wir so, als wäre das ein Film, den ich mir ansehe, und der läuft ganz weit weg auf einer großen, unpersönlichen Leinwand und berührt mich kaum. Oder ich schaue aus einer hübschen Hecke auf meine Erinnerungen und rolle mich dann zum Schlafen in eine Art weiches Nest, mit Pelz ausgepolstert, eine Höhle, einen Bau, einen Kobel, und nichts bedroht mich, ich bin unauffindbar und sicher.
Wir fangen damit an, dass ich auf Ludgate Hill bin, wo es nicht sonderlich hügelig ist, aber so ist London eben — überall irreführende Werbung. Ludgate Hill ist nur eine Straße, vielleicht durch Stadtentwicklung flach gehalten. Es ist November 2019, die Zeit vor Masken und Wutausbrüchen wegen Masken. Unser letztes halbnormales Jahr. Außerdem ein Jahr, in dem eine kompetente Regierung dafür hätte sorgen können, dass wir vor neuen Krankheiten und anderen vorhersehbaren Erschütterungen und Unglücken geschützt werden. Doch die Prioritäten lagen woanders, legten ihr Gewicht auf seltsame Orte — man konnte fast spüren, wie sie die Pflastersteine kippten.
Ich renne nicht direkt durch die strömenden Massen auf der Straße, aber ich bin schnell.
Die Bürgersteige werden nur noch voller werden, denn es ist fast Mittag. Ich folge einem Mann, und vielleicht denkt er schon an die bevorstehende Hektik, an seinen Fluchtplan. Er war schon immer gut in Fluchtplänen.
Ludgate Hill liegt nicht einfach in London — sondern tief in der City selbst, jener ganz besonderen Quadratmeile, wo das Geld Angstträume und Wunschträume hat und im Schlaf groß wird oder aber aufgrund von Fehlkalkulationen und vielleicht Kokain plötzlich verschwindet. Kommt Geld schmutzig an, wird es hier gewaschen wie ein geliebtes Baby oder ein bettlägeriger Kranker. Die Armen hier sind ungeheuer arm, aber das Geld ist gepflegt, und das ist es, was zählt. Die Menschen, die hier arbeiten, gehen alle irgendwie grimmig entschlossen und tragen meist Hemden, die ich soziopathisch nennen würde. Die allgemeine Haltung ist: Kopf runter, Ellbogen raus, sich durch die niedere Masse schieben und zugleich die Konkurrenz ausstechen. Die Blicke sind auf eine Zukunft gerichtet, die Spitzenwetten auf Futures und anschließende Hubschrauber, aber auch Herzinfarkte und Scham beinhaltet.
Ich falle ein wenig dadurch auf, dass ich weiblich und nicht ganz so makellos gepflegt bin. Außerdem bin ich schneller als die meisten. Meine Entschlossenheit hat tatsächlich ein Ziel.
Der Mann vor mir bewegt sich auf die andere lokaltypische Art voran, eine Art gleitendes und privilegiertes Marschieren. Er hat rotes Haar, das er kurz geschoren über dem Kragen eines dunkelblauen Mantels trägt, der zwar nicht militärisch ist, aber so tut. Vielleicht ein Offizier, vielleicht aber auch ein Anwalt — das will er glauben machen. Hier sind schließlich Englands oberste Gesetze zu Hause, und er will sich einfügen. Er scheint ein reicher Mann zu sein, und das teilt die Menge der Umstehenden irgendwie, wenn er sich nähert. Es hängen genug latente Ehrerbietung und feudaler Geist in der Luft, dass er mühelos vorankommt. Natürlich — dies ist London.
Der Mann, an den ich mich erinnere, war nicht sonderlich wohlhabend und hatte keine roten Haare. Andererseits habe ich ihn gar nicht so gut gekannt.
Ich möchte ihn nicht aus den Augen verlieren. Das ist auch unwahrscheinlich bei dem sehr roten Haar. Er hatte wirklich nie rotes Haar.
Aber vielleicht irre ich mich auch.
Vielleicht habe ich die Gestalt auf der Besuchergalerie direkt neben der Tür falsch zugeordnet. Ich hatte sein Kommen nicht bemerkt, aber aus irgendeinem Grund nach etwa zwanzig Minuten den Blick von der Verhandlung abgewendet — weg von Gerichtssaal 10 mit seinen abgenutzten Büromöbeln und dem grünen Teppich, der mit silbernem Gaffer-Tape geflickt war.
Er entschlüpfte rasch wieder, mit seinem schönen Managerkoffer in der Hand.
Gerichtssaal 10 befindet sich im relativ modernen Teil von Old Bailey. Man gelangt über eine Wendeltreppe dorthin, die an ein Gefängnis oder ein ganz schlimmes Bed & Breakfast erinnert. Die Räume sind überladen mit Zetteln, die einem das Händewaschen erklären und Gewalt sowie unangemessene Kleidung verbieten. Die Besucher müssen leise wie im Gottesdienst sein und in Gegenwart der Justiz oder von Geld, das sich in juristischer Form Raum verschafft, den Hut abnehmen. Inmitten der offensichtlichen Langeweile des Gerichtspersonals gab es Ausbrüche von Rechtsprechung und Ordner voller Akten, markiert mit bunten Klebezetteln. Ein Anwalt bohrte konzentriert in der Nase, und so etwas weckt bei jeder Grundschullehrerin Empörung. Der Staatsanwalt stand wieder auf und sah noch adlernasiger aus, noch mehr mit Autorität gesegnet. Die Angeklagten starrten alle aus dem Plexiglaskasten heraus, der verhinderte, dass ihr Unrecht heraussickerte.
Die Angeklagten. Ich kann sie mir immer noch nicht mit ihren Alltagsnamen vorstellen, den Namen, an denen die Anklagen hängen und die viel zu klein und fade sind, um sie je ganz zu erfassen. Damals, als ich Annanka Ladystrong war, hießen sie Phil the Pill und Utility Bill, Dynamo, Magnificent Arthur, Percussion Karl. Sie waren meine Freunde — mehr als das.
Dynamos Haar ist ausgefallen. Karls Muskeln sind zu Fett geworden. Phil und Bill sitzen nicht nebeneinander, wie sie sollten, weil sie immer nebeneinander waren, ein Paar, frei gewählte Brüder. Sie lehnen sich vor, lehnen sich zurück, versuchen sich mit Abstand zuzulächeln. Das lässt sie unzuverlässig wirken.
Gerichtssaal 10 war voll von Anklagen über Anklagen. Es wurden so viele schrecklich klingende Dinge laut gesagt, dass man kaum noch klarsehen oder atmen konnte. Nach so vielen unschuldigen Jahren wurde nun das Jahr 1999 angeklagt, nachdem sie so viele Jahre — nehme ich an — glauben konnten, einen Fehler gemacht zu haben, aber damit durchgekommen zu sein. Ein Atomstützpunkt und seine Unversehrtheit waren sozusagen verletzt worden, es hatte die Ansätze zu einem Feuer gegeben — weniger Brandstiftung als vielmehr ein Missgeschick mit symbolischen Papierlaternen und trockenem Torf; zwei Wachsoldaten des Verteidigungsministeriums waren verkrüppelt worden — allerdings beschränkte sich die Verkrüppelung bei dem einen auf ein blaues Auge und Prellungen, bei dem anderen auf einen gebrochenen Finger, während Phil irgendwie zwei Rippen gebrochen und das Jochbein zertrümmert bekommen hatte. Rippen und Jochbein waren jedoch offensichtlich nicht als Beweis zugelassen — ebenso wenig wie Prellungen bei den Angeklagten.
Die mildernden Umstände zu jedem Anklagepunkt wurden gedämpft, die Taten hingegen klangen laut und schrecklich und ließen auf verzweifelten Vorsatz schließen. Nichts davon klang nach uns, nach dem OrKestrA. Nichts davon klang wie etwas, das meine so lieben Freunde planen würden. Es stellte sich sogar heraus, dass jemand anderes, jemand, den ich nicht kannte, die Aktion geplant hatte, jemand, der ganz am Ende der Reihe hinter dem Plexiglas saß und auf seine Hände starrte, als könnten sie Hinweise liefern.
Meine Freunde waren also weit weg vom Rest unserer Familie gewesen, mit jemand anderem zusammen, mit Nummer sechs, dem letzten der Beschuldigten. Und warum waren sie ohne uns andere aktiv? Warum fühlten sie sich ganz wohl und sicher ohne den Rest, ohne das UnRule OrKestrA, die Lieferanten von frischem Nonsens, Spaßmacher und Spaziergänger, Spieler und Narren? Warum wollten sie nicht mehr die Narren spielen?
Es ist nicht schlimm, ein Narr zu sein, wenn man es ehrlich meint. Ein Narr hat viele Nester, in denen sich Wahrheit verstecken und wachsen kann, um dann herauszutönen.
Ich wusste nichts von der Anklage, bis Mrs Fire mich anrief. Sie organisierte — das ist ihr Job. Pläne und Listen sind ihre Natur, und sie erstellte eine Tabelle von Leuten, die ins Gericht gehen und »Die OrKestrA Five«, wie sie die Gruppe nannte, unterstützen sollten, wann immer wir konnten. Ich konnte noch Sonderurlaub nehmen. Ganz ohne Zweifel würde ich dabei sein. Hätte sich jeder denken können.
Außerhalb von Gerichtssaal 10 und Mrs Fires kleiner Propagandamaßnahme blieb all das, was wir anstelle von Zeitungen haben, seltsam still. Wir waren kaum einen Absatz wert. Offenbar fiel es Journalisten beim Nachdenken über den Fall schwer, klarzusehen oder zu atmen, weshalb es ihnen plötzlich so ging wie mir, nur aus anderen Gründen.
Die ganze Situation war zumindest schräg, wenn nicht gar verdächtig — wie eine fremde Aufführung, in die wir ohne Probe hineingeschubst wurden. Und ich? — Ich fühlte mich nackt.
Ich hätte leicht hinter dem Plexiglas und eine der Angeklagten sein können.
Wenn einer der fünf mich gebeten hätte, etwas mitzumachen, hätte ich das vielleicht wirklich getan. Ich hätte womöglich geglaubt, dass wir nicht das ganze OrKestrA dabei brauchten oder dass wir sie sicher aus der Sache heraushalten sollten. Ein Vorschlag in diese Richtung hätte mich vielleicht überzeugt. Und wenn ihre Gedanken wirklich hart, dunkel, seltsam geworden wären, hätte ich es vielleicht nicht bemerkt oder geahnt, wohin es führte.
Das letzte Mitglied der Gruppe — Nummer sechs — konnte ich wirklich nicht einordnen, weder von einer Demo noch einem Konzert, noch einem Komitee, nirgends. Und ich traute ihm nicht mal in Gedanken. Er wirkte wie jemand, dem ich schon mal begegnet war — hart, dunkel, seltsam.
Und der Mann an der Tür der Besuchergalerie, der mit dem sehr roten Haar — da war ich sicher, dass ich ihn schon mal gesehen hatte. Nach so vielen Jahren war er da — aber nur einen Augenblick, dann drehte er sich um und eilte hinaus und davon.
Ich könnte mich geirrt haben. Vielleicht hatte ich einfach nur mit ihm gerechnet, denn gewissermaßen war er schon eine Weile ein Teil von uns gewesen.
Fast dreißig Jahre hatten sich die Angeklagten verändert, waren aber auch ziemlich gleich geblieben. Im OrKestrA hatten wir alle versucht, demonstrativ glücklich zu sein, aktiv glücklich, gemeinsam glücklich. Das wollten wir wirklich. Und das jahrelange Leben mit diesen Absichten hatte die Gesichter der Angeklagten weich werden lassen, ihre Sanftheit passte nicht in Gerichtssaal 10. Sie sahen aus wie Menschen, die hier weinen oder schreien würden, wie alle Menschen, wenn sie rechts und links von Polizisten flankiert würden und das Gesetz um ihr Plexiglasgehäuse herum trieb. Was hier geschah, könnte ihnen den Rest ihres Lebens rauben, aber es blieb sorgsam dumpf und murmelnd, wie es so vor sich hin plätscherte. Die Ödnis steigerte den Schrecken. Dass nicht geschrien wurde, erweckte den Anschein, dass hier niemand wirklich ein Mensch war.
Wegen dieser endlosen unerträglichen Ruhe wandte ich den Blick vom Gericht ab. Es war wie Folterkino in Zeitlupe, und mir wurde langsam übel, und ich bin sicher, dass es irgendwo Aushänge gab — klare Vorschriften —, dass man sich im Gericht Ihrer lieben Majestät nicht übergeben darf.
Eins möchte ich deutlich sagen — es war mein Wille, der mich zur Tür blicken ließ, nicht irgendeine Geste oder Trick von ihm. Ich wollte hinsehen. Und da saß er, bereit, angeschaut zu werden — erschien plötzlich wie ein Kobold. So als würde er gerade aus seinem Platz wachsen; er hätte aber auch gerade erst daraufrutschen können.
Doch dieses erste Zucken meines Kopfes jagte ihn geradewegs die Treppe hinunter.
Ich folgte ihm. Ich beschloss, ihm zu folgen. Und seine Füße erzeugten eine seltsame Störung, eine Gefühlsregung in einem Gebäude, in dem kein Gefühl ausgedrückt werden sollte.
Und er ist der, dem ich folge.
Er ist es.
Ich bin mir dessen fast sicher.
Ich habe jahrelang nach ihm gesucht — haben wir alle. Jetzt stellt er sich selbst, und zwar genau dann, wenn es uns am meisten verstört.
Ich weiß nicht, ob er jetzt diese Haarfarbe hat, um mich zu verwirren oder um mich anzulocken.
Ich weiß auch nicht, was ich tun werde, wenn ich ihn erwische.
Fünf oder sechs Meter vor mir sehe ich, wie er von einem etwas entschlosseneren Master of the Universe ein Stück zur Seite geschoben und gebremst wird. Dessen Blick sagt: »Wie kannst du es wagen?« Er scheint sich nicht viel um sein Aussehen zu scheren. Das kommt auch hin. Der Mann, für den ich ihn halte, hat es immer genossen, Empörung zu generieren.
Ich behalte ihn im Auge, aber er vergrößert seinen Vorsprung, und die Mittagsmassen helfen ihm und behindern mich.
Ich habe noch keinen Schimmer, wie bald ich mich nach Menschenmengen sehnen werde. Niemand auf dem Bürgersteig ahnt, dass wir uns monatelang darauf freuen werden, uns wieder über Menschen zu ärgern, die uns im Weg stehen.
Noch ist eine Gruppe von Kindern, die ein- und ausatmen, kein Schreckensbild. Ich folge bloß einem Mann. So schnell ich auch gehe, er ist einen Hauch schneller — wie immer.
Die City hat offenbar nur minimalen Respekt vor mir. Niemand denkt auch nur daran, mir aus dem Weg zu gehen, und ich habe keine Zeit, einen Kuchen zu backen oder ein Baby auszutragen, um meinen gerechten Anteil am Bürgersteig einzufordern, weil ich nützlich und schön bin.
Dann verschwindet der Mann plötzlich nach links. Ich habe mich schon gefragt, ob er mich wirklich abzuschütteln versucht, und jetzt bin ich sicher. Und wie er so zur Seite gleitet, sieht er nicht mehr nach Herr und Meister aus. Das ist er selbst.
Und ich denke — Ich irre mich nicht. Rothaarig oder nicht, ich kenne dich. Ich kenne dich.
Ich erhöhe das Tempo, laufe und hoffe, dass er nicht irgendwo untergetaucht ist, eine Tür hinter sich geschlossen hat. Dafür sah er nicht selbstgefällig genug aus. Er sah aus wie jemand, der keinen Ausweg hat und in Panik gerät. Sein Körper wurde ein bisschen aufrichtiger und ängstlicher. Das gefällt mir. Ich mag ihn ängstlich.
Ich komme zu einem Torbogen, der unter einem schlanken Gebäude hindurch und zu einer schmalen Gasse führt. Das erklärt, wie er verschwunden ist, und ich stürze mich hinterher. Ich weiß nicht, worauf ich mich einlasse, aber ich laufe weiter durch den plötzlichen Schatten.
Vielleicht war er ein bisschen vorbereitet. Vielleicht hat er das Gelände nach Sackgassen und Ausgängen abgesucht, so wie man es vor einer Aktion oder einer Demo macht, weil man nie in eine Falle geraten will. Man will immer das Gelände beherrschen und nicht von ihm beherrscht werden.
Seine Schritte knallen aufs Pflaster, sehen kann ich allerdings nur einzelne späte Esser, die in Schlangen vor kleinen Läden auf Mittagshappen warten. Egal, wo er hinwill, jetzt flüchtet er. Hier ist es viel ruhiger, die Menschen bewegen sich weniger, also war das eine schlechte Wahl. Es sei denn, er will in einem Gebäude Zuflucht suchen.
Ich laufe im Höchsttempo und dann noch schneller. Ich bin nicht mehr so fit wie früher, aber heute bin ich mir sicher, dass ich so und noch schneller laufen kann, wenn ich muss. Ich spüre meine Füße nicht auf die Steinplatten prallen. Ich bin nur Geschwindigkeit und Richtung. Ich bin Annanka Ladystrong, und die war ich seit Jahrzehnten nicht mehr.
Ich laufe an Ladenfronten in Landhausfarben vorbei und an Schildern zu diesem und jenem aus Handarbeit. All das verschwimmt neben mir, als wäre ich ein Zug.
Dies ist eine Art Bau, aber kein behaglicher — hohe Wände und Fenster und das Echo zweier Menschen, die um die Wette laufen. Ich höre ihn immer noch davonrennen, aber nicht mehr so weit weg. Er ist am Limit.
Jetzt kommt eine kurze, ein bisschen frühe Schlange für Leckereien, die als »maßgeschneidertes Gebäck« beschrieben werden, ich kurve daran vorbei, und eine Frau im Schaufenster dreht sich zu mir um, als wäre ich eine Laune der Natur, und einen Moment lang sehe ich sie direkt an, damit sie weiß, ich bin eine. Heute bin ich eine. Vielleicht zuckt sie zurück, aber ich laufe schon weiter.
Türen und Tore und Höfe, nichts scheint bereit, ihm zu helfen, ihn aufzunehmen, denn seine Flucht knarrt immer noch vor mir mit Schuhleder auf Stein. Ich entdecke sein Haar, als er zwischen unbeteiligten Fußgängern hindurchläuft. Und jetzt sehe ich den ganzen Mann, seine Mantelschöße zeigen ihr blaues Futter, seine Beine arbeiten, heben die bleichen Sohlen seiner Oxfords. So bewegt sich ein Körper, wenn er getrieben ist und sein wahres Wesen zeigt. Das ist er. Das ist der Mann mit zu vielen Namen. Ich lasse ihn laufen, und das will ich.
Ich will ihm Angst einjagen.
Sechsundzwanzig Jahre her, und ich hatte nicht gewusst, dass ich darauf wartete, ihm Angst einzujagen.
Bloß, dass ich es doch wusste.
Aber das Wissen nützte mir nichts, also ignorierte ich es.
Meine Kehle schmerzt vom schweren Atmen, oder vielleicht schreie ich auch, und deshalb drehen sich Köpfe nach mir um. Mein Herz ist so laut, dass ich eine Weile glaube, wir hämmerten zu dritt durch die Straßen.
Ich sehe ihn scharf nach links abbiegen und folge ihm in den Schwung einer anderen Gasse, die etwas breiter und leerer ist, da so viele beim Mittagessen sind, so viele Köpfe über Bio-Essen oder Ethno-Food oder auch traditionelle Speisen zu unerträglichen Preisen gebeugt sind.
Ich weiß nicht, warum er hierhergekommen ist. Er hatte keinen guten Grund, in der Nähe des Gerichts zu sein. Es wäre ihm nie in den Sinn gekommen, dass er sich entschuldigen sollte, auf die Knie fallen, flehen und winseln sollte, und das würde immer noch nicht reichen.
Ich renne mit geballten Fäusten, mit Fäusten, die nach vorn schlagen, wieder zurück und vorwärts durch die Luft sausen.
Sollte ich ihn schlagen, hole ich den Schlag aus dem Bauch, aus den Hüften, aus dem Rückgrat, aus 26 Jahren.
Er biegt noch mal nach links und rutscht ein bisschen weg, und ich will, dass er ganz stürzt und auf dem Rücken landet, verletzt, in die Enge getrieben. Doch dann schwingen seine Arme wild, er hält das Gleichgewicht, nutzt das Gewicht seines Koffers, um sich zu stabilisieren. Er berappelt sich. Er hat also immer noch die alten Fähigkeiten, ist immer noch der Seiltänzer.
Ich habe mich nicht fit gehalten, ich habe stattdessen ein normales Leben geführt. Ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, wie er die Zeit verbracht hat.
Doch meine Schwächen spielen heute keine Rolle, denn ich bin geistig auf Draht und hole auf, ich gewinne. Ich komme ihm näher, und das Drängen der hohen Häuser auf beiden Seiten hilft mir irgendwie, mich zu konzentrieren.
Von heute an werde ich sehr viel stärker sein. Annanka ist wieder da. Das spüre ich.
Als ich ihn fast eingeholt habe, sehe ich, wie die Gasse vor ihm endet und direkt in die höchste Betriebsamkeit von ganz London mündet. Er wird hineintauchen und darin verschwinden.
Und mir wird klar, dass ich ihn riechen kann. Der Wind weht mir jetzt ins Gesicht und bringt ein Aftershave mit, das ich nicht erkennen will. Auch der Hauch seines Körpers liegt darin, darunter verborgen.
Das treibt mir Schweiß auf die Stirn, aber ich halte nicht an.
Er rast über das letzte Kopfsteinpflaster zwischen zwei Restaurants, dann über den Bürgersteig auf die Hauptstraße. Busse gleiten heran, versperren mir die Sicht auf ihn, aber ich laufe trotzdem weiter, stürze mich selbst kopfüber in den Verkehr. Ich kann nicht anhalten.
Ich werde fast von einem Taxi angefahren. In Wirklichkeit wird ein Taxi fast von mir angelaufen. Ich fühle mich auf blöde Art unverwundbar. Ich stemme mich gegen die Motorhaube und erwarte fast, dass sie vor meinen Händen zurückweicht, weil sie nichts ist und ich im Recht.
Dann stehe ich wieder auf Pflaster, aber nicht auf einem Bürgersteig. Alles ist plötzlich sehr offen, fast wie ein Platz, es gibt zu viel zu sehen. Zu meiner Linken die Statue von Queen Anne, die wir den Kindern bei einem Frühlingsausflug gezeigt haben, und da die vielen kleinen Steine, sorgsam zu Mustern unter den Füßen angeordnet, und ein Schwarm Touristen mit einem Führer, der eine italienische Flagge auf der Spitze seines Golfschirms hochhält, und gleich zu meiner Rechten so ein blasses Bergmassiv, die Fassade der Kathedrale St. Paul’s. Sie sieht aus wie eine hässliche weiße Uhr auf Gottes Kaminsims.
Und da ist er.
Er steht an einer Säule oben am Absatz der schmuddelig weißen Stufen und atmet sehr schwer, seine Arme zittern, als er seinen Spitzenkoffer an die Brust drückt. Ich habe ihn zu einem gestressten Tier auf der Treppe gemacht, er macht einen verängstigten Jungen nach, wie er seine Schultasche vor sich hält. Meinetwegen ist er in die Menge gerannt, damit die auf ihn aufpasst oder sein Zeuge wird, oder sein Alibi.
Als ich ihn entdecke, senkt er den Kopf, aber ich kann noch erkennen, dass er alt geworden ist, nicht wahr? Im Nacken, im Kiefer, in den eingesunkenen Wangen ist er alt, und ich habe mich besser gehalten.
Gut.
Er schaut auf seine Füße und sucht kein Kirchenasyl — es sei denn, die Stufen zählen schon dazu.
Es kostet zwanzig Pfund, hineinzukommen und Zuflucht zu finden.
Ich bleibe, wo ich bin, und lasse meine Stimme weit tragen, weil ich das kann. Das konnte ich schon immer. Vom Straßentheater zur Lehrerin — die Fähigkeit ließ sich übertragen. Sie können mich in jede gedrängte Masse stellen, und ich schaffe es, dass alle mich hören.
»Buster.«
Ich höre mich an wie jemand anderes, wie jemand Angespanntes, heiß gelaufen, es rast in meinen Gelenken und Fingern und im Magen, in meiner Brust.
Ich gehe auf ihn zu. Meine Beine fühlen sich steif an — als wüsste er Zaubersprüche und versuchte mich zum Stolpern zu bringen, aber ich kämpfe dagegen an.
Mit einem Mal fliegt eine Wolke Tauben auf, weil sie nicht in meiner Nähe sein wollen.
»Buster.«
Als er den Kopf hebt, sieht er traurig aus.
Und das ist eine Lüge, eine Lüge, eine Lüge, bloß noch eine Lüge, und er lügt, denn das ist alles, was lügende Lügner jemals tun.
WENN MAN EINE GESCHICHTE an sich heranlässt, kommt auch der Erzähler mit rein. Das sage ich den Kindern. Ich bin keine Bedrohung, aber nicht alle sind freundlich gesinnt. Nicht alle wollen helfen. Geschichten hinterlassen Spuren in eurem Denken: Schmutz und Kratzer und Fußabdrücke und Stellen, die so glänzen, wie wenn man etwas immer wieder hin und her darüberschleift, immer auf dem gleichen Fleck.
Ich sage meiner Klasse, der einzigen fünften an der Oakwood, wie wichtig es ist, keine bösen Mitbewohner im Kopf zu haben. Ihr wisst nie, was sie euch da oben erzählen. Vielleicht spielen sie schreckliche Musik oder zünden Feuer an.
Fünfte Klasse ist das beste Alter. Zu der Zeit merkt das zwar niemand, aber mit zehn oder elf Jahren sind wir wahrscheinlich auf dem Gipfel unseres Lebens. Danach kommen bloß noch Sex, Angstattacken und körperlicher Verfall.
Das ist übertrieben, aber dennoch bin ich eine verlässliche Erzählerin. Verlässlichkeit ist wichtig. Ich werde beispielsweise auf St. Paul’s und die Kirchenstufen zurückkommen, das verspreche ich. Aber nicht jetzt. Das kann ich noch nicht. Und viele andere Sachen und Menschen sind wichtiger als Buster.
Wie Sue Delara, unsere Direktorin und gute Hexe, unser Guru, unsere Anführerin. Nur ihretwegen können wir uns alle noch sehen, auch wenn wir fern voneinander sind. Sie hat alle Budgets umgeschmissen und alle angerufen, die wir normalerweise anrufen — plus noch ein paar mehr —, und so einen kleinen Berg zusätzlicher Laptops und reparierbarer Laptops und Kopierschutzstecker und Router und alter Handys zusammengetragen.
Weshalb niemand unversorgt ist. Niemand sollte unversorgt sein.
Außerhalb unserer Reichweite murmelt und floskelt die Regierung darüber, womöglich vielleicht über Mittel und Wege nachzudenken, wie Kinder in Zukunft auch von zu Hause aus lernen könnten.
Es wird also nichts getan werden.
Und eine sehr vorhersehbare Gruppe von Menschen wird jetzt schon Geld damit verdienen, etwas jetzt sofort dringend Benötigtes nicht zu liefern.
Immerhin haben wir hier an der Oakwood Lösungen und Flexibilität. Wir konnten sogar überschüssige Technik an eine Hilfsorganisation spenden. Und wir haben Sue.
Wir sind eine private, aber nicht unabhängige Schule und liegen bei der Finanzierung im Allgemeinen am unteren Ende. Wir sind im Moment ziemlich ausgeblutet, aber wenigstens können wir noch einige Kinder umsonst aufnehmen und so unterrichten, als würden wir Kinder wirklich mögen. Unsere Zukunftspläne hängen zu sehr davon ab, dass eine nette alte Dame stirbt und uns in ihrem Testament bedenkt, was ein bisschen abscheulich ist, aber es bringt nichts, sich damit aufzuhalten.
Und die Fünftklässler-Eicheln (so nennen wir unsere Schülerinnen und Schüler) treffen sich jeden Tag online, und wir können so tun, als ob wir es behaglich hätten. Wir winken unseren Eichelgruß und unseren Eichengruß, wir tanzen unseren Freudentanz, nur im Sitzen, und wir reißen die Augen ganz weit auf, um unsere Freunde zu sehen, und ich weine dabei auch nicht mehr.
Zoom ist keine große Hilfe, wenn man lernen will, Brüche zu addieren und zu subtrahieren und so — was niemand so wirklich toll findet, außer vielleicht Kwakou und Talha —, aber wir machen trotzdem Fortschritte. Sogar Rosie, die eine Art Allergie gegen Mathe hat, kommt gut voran.
Und wir legen uns gegenseitig bemalte Steine vor die Tür. Ich habe 16 Steine vor meinem Gartentor. Einer für jedes Kind in meinem Jahrgang. Die kleine Klassengröße ist eines unserer Verkaufsargumente, aber auch der Grund, warum wir nur wenig Einnahmen aus Schulgeld haben.
Gehupft.
Gesprungen.
Auch das geht nicht so gut per Zoom — auf dem Schulhof der Oakwood, ja, aber nicht zu Hause.
Das alles ist wichtiger als Buster.
In letzter Zeit habe ich mit den Kindern über Rumpelstilzchen gesprochen. Das ist eine sehr wichtige Geschichte. Jedes Jahr sorge ich dafür, dass meine Eicheln auf Rumpelstilzchen vorbereitet sind, egal, welche Tricks er versuchen wird.
Sie erinnern sich sicher an die Handlung: Eine junge Frau wird von ihrem mehr als nutzlosen Vater verraten und von einem schrecklichen König entführt. Ihr Vater hat den König aus unerklärlichen Gründen glauben lassen, sie könne Stroh zu Gold spinnen. Der König ist sehr daran interessiert. Es überrascht nicht, dass die einzige Person, die zu viel Gold hat, mehr davon will. Also stiehlt er das Mädchen und gibt ihr seine Bestellung auf — Gold, und zwar reichlich.
Nun ist es nicht möglich, Stroh zu etwas anderem als gesponnenem Stroh zu spinnen. Die Frau ist in einem Raum mit einem Spinnrad und wahrscheinlich haufenweise Stroh eingesperrt. Vielleicht hat sie Allergien, auf jeden Fall ist sie sehr traurig und ratlos. Dann taucht plötzlich eine schreckliche Zauberperson auf, als sie spät in der Nacht verzweifelt ist. Und sie schließt einen Handel mit ihm ab — einen schrecklichen Handel.
Das erinnert uns daran, dass Hoffnungslosigkeit spät in der Nacht vermieden werden sollte und dass schreckliche Menschen häufig auftauchen, wenn man verletzlich ist, andere Dinge im Kopf hat und im Lampenlicht sitzt. Die Fünftklässler wissen, dass man durchatmen und nach jemandem Ausschau halten sollte, der einem hilft, anstatt einfach die erstbeste Person zu nehmen, die man sieht. Sie könnte ein Ungeheuer sein.
Das Mädchen — dessen Name nicht erwähnt wird — geht einen Handel mit jemandem ein, der sich als böser, magischer Kobold entpuppt.
Die Fünfte hat einen Namen für das Mädchen ausgesucht, weil es lächerlich ist, dass sie keinen hat.
Ranbir wählte den beliebtesten — Brenda.
Brenda … Das bringt uns zum Lächeln.
Brenda gibt dem Kobold ihre Halskette. (Wir wissen nicht, was Kobolde mit Schmuck machen — vielleicht tauschen sie ihn gegen schnelle Autos ein …) Er stellt dann in angestrengter Nachtarbeit Gold für sie her, denn Zauberei und andere seltsame Dinge geschehen oft nachts.
Die Fünfte ist mutig, aber vorsichtig im Dunkeln.
Am Morgen freut sich der König über Unmengen von neuem Gold, aber natürlich will er noch mehr. Das macht unsere Brenda wieder ganz verzweifelt, denn der König könnte sie hinrichten lassen, wenn sie nicht wieder was ganz Unmögliches tut. So ist das mit den Majestäten — wenn sie nicht gerade Rehe, Füchse und langsame Vögel töten, werfen sie ein Auge auf Kapuzen und scharfe Äxte.
Als Brenda in der Nacht weint, taucht der Kobold wieder auf. Diesmal nimmt er den Ring des Mädchens mit — das Einzige, was sie von ihrer heiligen Mutter noch besitzt. Die Fünftklässler-Eicheln sind alle sehr dagegen — Atticus vermutet, dass Brendas Vater ihre Mutter auf dem Dachboden eingesperrt und aus irgendeinem Grund alle ihre Schuhe verkauft hat, aber das wäre eine andere Geschichte.
Am nächsten Morgen, als Brenda aufwacht, ist noch mehr Gold da. Doch der König lässt sich nicht aufhalten, er will genug Gold, um darin zu schwimmen, genug Gold, um sein Schloss mit Gold auszukleiden, goldenes Toilettenpapier und goldene Socken zu haben und die unendliche Macht, die ihm unendlich viel Gold bringen wird. Brenda ist hoffnungslos und niedergeschlagen — sie hat nichts mehr, was sie dem Kobold geben könnte.
Sie weint und weint, allein in dem Zimmer, das nun bis zur Decke mit erwartungsvollem Stroh gefüllt ist. Als der Kobold diesmal auftaucht, verlangt er Brendas erstgeborenes Kind. Einem Kobold ein Baby zu versprechen, ist eine furchtbare Sache, aber Brenda will leben, also stimmt sie zu. Menschen stimmen oft schrecklichen Dingen in der Zukunft zu, nur um in ihrer schrecklichen, unmöglichen Gegenwart zu überleben. Das ist etwas, worauf sich alle Stilzchen verlassen.
Der Kobold produziert genug Gold, die ganze Stadt zu pflastern und alle im Land reich zu machen — aber nicht, dass etwa wirklich geteilt würde. Der König ist überglücklich und endlich zufrieden — wahrscheinlich fängt er jetzt an, von einem Zeremonienboot aus Delfine mit Spießen zu jagen —, heiratet unsere erschöpfte Jungfer und macht sie zur Königin Brenda. Das ist eine Art Sieg, denn dadurch ist sie viel sicherer, kann schönere Kleider tragen und wird nicht mehr jede Nacht im Strohzimmer eingesperrt. Außerdem darf sie aus den Fenstern der Kutsche winken. Trotzdem scheint der König nicht sehr nett oder unterhaltsam zu sein. Wenigstens fragt er nicht mehr nach Gold.
Zu gegebener Zeit bekommt Brenda ein Baby — wie und warum das passiert, wird in der sechsten Klasse ausführlich behandelt — und dann ist sie sehr mit Windeln und Birnenpüree beschäftigt und bringt ihm bei, wie man redet und läuft. Wir beschließen, dass sie es Ari nennt.
Brenda vergisst den Kobold völlig.
Unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich. Manchmal können wir es nicht ertragen, an die schrecklichen, schrecklichen Stilzchen-Dinge zu denken, und so verschließen wir sie in kleinen Kommoden in unseren Köpfen.
Es gibt andere Möglichkeiten, und die Eicheln wissen, wie man sie nutzt — ihre Lehrerin versteht die Theorie, aber nicht die Praxis.
Gerade als Baby Ari zu einem wunderbaren kleinen Jungen mit fröhlichen Augen und einer nützlichen Anzahl von geschickten Fingern und Zehen herangewachsen ist, taucht der Kobold wieder auf.
Wir hätten damit rechnen und koboldsichere Schlösser anbringen können. Aber Brenda hat bestimmt ihr Bestes getan.
Der Kobold lacht und verdreht die Augen. Er sagt Brenda, dass er in drei Tagen wiederkommen wird, um ihren Sohn zu holen. Er sagt nicht, was er mit einem kleinen Jungen anstellen will, und wir wollen nicht raten.
Manche von uns wollen gern schreckliche Dinge erraten, und manche von uns wollen gern in Angst und Schrecken versetzt werden, also wird nicht geraten.
Brenda weint daraufhin, wie noch nie jemand geweint hat, und überschwemmt ihr königliches Schlafzimmer mit salzigem Unglück. Der Kobold lenkt ein wenig ein — er ist recht klein und droht zu ertrinken — und sagt, sie habe drei Tage Zeit, seinen Namen zu erraten. Wenn sie richtig rät, wird er seine Macht verlieren.
Die Fünftklässler sind zu alt für Märchen, dessen sind wir uns bewusst. Aber wir schauen uns manchmal noch einfache Dinge an. Wir nehmen sie auseinander und sehen, wie sie funktionieren. In diesem Schuljahr haben wir aufgrund des beharrlichen Interesses von Millie, Ignacy, Kwakou, Max und Talha — vor allem Talha, er ist enthusiastisch — das Projekt Rumpelstilzchen gestartet. Wir haben Stilzchen-Köpfe — zwei davon sind wirklich verstörend — aus Ton modelliert. Wir haben Stilzchen-Tänze erfunden. Wir haben etwas über Stroh gelernt. Wir haben eine Spinnerei-Vorführung von Madeline Spears ertragen. Es gibt anscheinend kein Handwerk, das Madeline nicht mit ungeschickter Entschlossenheit ausübt. Und sie ist immer bereit, alles zu demonstrieren. Offensichtlich stimmt irgendwas Kompliziertes, aber Harmloses nicht mit ihr.
Wenn irgendwas Harmloses mit einem nicht stimmt, wird Sue einem fast jede Verfehlung verzeihen. Als Schulleiterin Mrs Delara ist sie die ultimative Bedrohung der Lehrerschaft und kann mit einem Blick das große Lehrerzimmer oder ein aufsässiges Herz zum Schweigen bringen. Aber wir alle wissen, dass sie uns auch verzeiht. Das sieht man in ihren Augen. Sie ist Mrs D. Sie ist Sue.
Und weil es Mrs Delara auch sehr am Herzen liegt, dass die Stadtkinder das Land kennenlernen, war es seltsam einfach, kleine Pakete mit Rohwolle zu besorgen und an jeden Eichel-Haushalt zu liefern. Das bedeutet, dass wir alle unsere Hände mit Schaffett weich gemacht haben, was ein anderer Name für Lanolin ist. Dann haben wir uns ständig gewaschen, um den furchtbaren Schafgeruch loszuwerden.
In dieser Lektion haben alle auf dem Bildschirm dasselbe gefühlt und gerochen, und so waren wir sehr vereint.
Ich glaube nicht, dass ich das je vergessen werde.
Atticus’ Mutter war natürlich nicht glücklich über die Wolle. Sie war der Meinung, dass die Aspekte Allergien, Hygiene und Tierquälerei nicht ausreichend recherchiert wurden. (Wir hatten sie wirklich recherchiert — Oakwood liebt nichts mehr als Ethik-Recherchen.) Und Atticus’ Mutter hat ihren Sohn Atticus genannt, hat sie also wirklich nur sein Bestes im Sinn?
Als Klasse haben wir unsere eigenen Mythen geschrieben — alle außer mir. Ich habe Mathefragen über das Gewicht von Gold und Spinnereien und die Aufteilung von Kobolden in Viertel- und Fünftelkobolde und so weiter verfasst. Wir sind nicht im Rückstand.
Trotzdem sind wir nicht so glücklich, wie wir sein könnten. Tony wirkt erschöpft. Millie sieht wegen irgendetwas bedrückt aus, und ich wüsste sehr gerne, weshalb. Es ist schwer, online oder während der Sozialkontrollen ein wirkliches Gespräch zu führen.
Vieles ist schwer. Wir können keinen Ausflug ins Grüne machen und die üblichen Spiele spielen oder zum York House gehen und die Eichhörnchen besuchen und die Statuen der panischen Damen, deren Kleider weggeweht sind, oder das schöne und verrückte Strawberry Hill House, das wie eine gotische Kirche wirkt, und den Park, der keinen Eintritt kostet. Wir können keine von den Sachen machen, bei denen wir uns sonst eng aneinanderdrücken und an den Händen halten.
Aber wir kriegen das schon hin. Wir leben in einem Land, in dem das Hinkriegen als Gipfel an Genuss und Zufriedenheit gilt. Dabei reicht es kaum so hoch wie ein Mitternachtskobold mit üblen Deals. Und das war ein kleiner Kobold.
Ich kriege es auch hin. Ich schaffe es. Ich kann an dieser Stelle erwähnen, dass Kinder zwar anstrengend und schwierig zu hüten, aber wunderbare Geschöpfe sind, wenn es darum geht, ansteckende Neugier und Freude zu vermitteln. Die Einzelheiten davon vermisse ich. Langjährige Grundschullehrer können kindisch und übereifrig werden, aber es gibt Schlimmeres. Gegen ein bisschen Staunen ist nichts einzuwenden.
Oakwood erfüllt die Wissensanforderungen der Schulleistungsmessung, aber niemand muss den ganzen Prüfungsprozess verabscheuen, denn wir wollen Menschen hier nicht lehren, wie man Leiden erträgt. Günstige Ausflüge gibt es reichlich, für teurere wird gespart. Hart arbeiten. Mit Spaß arbeiten. Besser arbeiten. Das steht im Lehrerzimmer auf einem gestickten Banner. Wenn du etwas in ein Banner gestickt hast, meinst du es wirklich ernst.
Natürlich steht Oakwood immer knapp vor dem Aus. Wir sammeln Spenden und taumeln weiter wie ein Betrunkener, der am Rande eines Kais von Möwen angegriffen wird. Das ist jedenfalls das Bild, das ich immer vor Augen habe, wenn ich an uns denke. Zumindest halten wir uns auf den Beinen, zumindest bisher. Ich habe ständig befristete Sechs-Monats-Verträge, noch etwas, worüber ich nicht nachdenken sollte, aber im fünften Monat bekomme ich immer Kopfschmerzen.
Letzte Woche haben die Fünftklässler darüber nachgedacht, wie die Rumpelstilzchen-Geschichten wohl entstanden sind. Nichtsnutziger Vater, reizende Brenda, gieriger König, trickreicher, böser Kobold mit geheimem Namen — wir haben versucht, uns vorzustellen, welcher Teil zuerst kam. Und wir sammelten die Namen, unter denen Stilzchen an anderen Stellen auftritt — all die Decknamen, die ihn zu einem Verbrecher oder Spion machen. Wir haben diskutiert. Nichts mag man in Oakwood lieber als eine Diskussion.
Und ich sitze jeden Morgen in der Küche und sehe 16 kleine Gesichter, die lebendig sind und sagen, was sie denken, mit einer Kühnheit, die sich abnutzen wird, wenn die Welt sie in die Finger kriegt. Wer Lehrer ist, gibt vor, mutig zu sein. Er oder sie ist Vorbild — dafür sind wir da. Und im Klassenzimmer kann man die Realität harmlos und vernünftig und anständig organisiert halten. Das liegt daran, dass jedes Klassenzimmer zum Teil eine Geschichte ist, in die wir uns freiwillig begeben. Lehrerinnen und Lehrer glauben mehr als alle anderen an diese Geschichte, weil wir länger als alle anderen darin vorkommen. Wir sind diejenigen, die anfangen, und alle Anfänge sind beängstigend, also gehen wir voran.
Deshalb werfen sich Lehrer regelmäßig in Kugeln, wenn jemand mit einer Schusswaffe in ein Klassenzimmer kommt. Wir neigen dazu, uns als Mythen und Legenden zu betrachten, nicht als Menschen, die sterben können. Wir sind an Eltern statt, darum tun wir, was Eltern tun — wir sterben für unsere Kinder. Das passiert nicht nur in Amerika. Es geschah auch in Dunblane. In Dundee. Es würde in Oakwood geschehen. Ich bin sicher, ich würde einfach erstarren. Ich würde tapfer sein wollen, aber ich bin mir nicht sicher. Ich weiß, dass Sue am schnellsten eingreifen würde.
Sue Delara — schreckliche Schuhe, seltsame Kleidung, wunderbare Anführerin.
Heute Morgen habe ich den Fünftklässlern erzählt, dass hinter der Geschichte von Rumpelstilzchen wahrscheinlich Menschen stehen, die es gut meinen. Sie ist alt, vielleicht so alt wie die erste richtige Schrift, vielleicht sogar noch älter. Seit etwa 4000 Jahren machen sich Menschen die Mühe, Versionen einer Geschichte zu erfinden, sie zu verändern und weiterzugeben und so ihre guten Absichten zu verbreiten. Man stelle sich das vor — eine Geschichte ohne Sintflut, ohne Götter, ohne mächtige Helden, nur ein gewöhnlicher Mensch mit einem Problem, das durch Lügen und missbrauchte Macht verursacht wurde.
Und jahrhundertelang — mindestens Jahrhunderte — haben die Menschen so etwas wie die heutige Version benutzt, um zu sagen, dass manche Eltern unklug sind und dass Mädchen, die auf sich allein gestellt sind, vorsichtig sein sollten — und um klarzustellen, dass wirklich jeder so klug wie möglich sein sollte, um sein Leben zu meistern.
Natürlich endet die Geschichte von Rumpelstilzchen in den modernen Versionen damit, dass Königin Brenda sich den Kopf zerbricht und Kundschafter, Reiter und Weise ausschickt, um Rumpelstilzchen aufzuspüren, herumzufragen und zu versuchen, den Namen des bösen Kobolds zu erfahren. Allein in ihrem mit Gold gefüllten Schloss verbringt sie ihre erste Nacht damit, alle Namen durchzugehen, die sie je gehört hat. Als der Kobold auftaucht, ist kein einziger von ihnen der richtige. Pech.
In der zweiten Nacht steht Brenda dem seltsamen kleinen Mann mit dem spöttischen Lächeln gegenüber und denkt sich Namen wie Möhrenfuß, Wespenwut, Ackback und Stinkemund aus. Zumindest haben sich die Eicheln diese Namen ausgedacht — neben anderen, die weniger geeignet waren. Als Brenda den Kobold beleidigt, fühlt sie sich zwar besser, aber sie ist immer noch in großen Schwierigkeiten und hat nur noch eine Nacht Zeit.
Dann geht die Sonne unter und läutet die letzte Nacht ein, und gerade noch rechtzeitig erscheint — keuchend und staubig — ihr letzter Kundschafter. Er ist am weitesten gegangen, hat sein Bestes getan und ist möglicherweise heimlich in Brenda verliebt. Er erzählt ihr, dass er zu einem seltsamen Haus in einem seltsamen Wald kam, durch ein seltsames Fenster hineinschaute und einen seltsamen, schrecklichen kleinen Mann sah, der im Schein eines grünen Feuers tanzte und sang: »Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiß! Sie wird es nie erraten!« Er könnte auch »Dumme Brenda!« gerufen haben. Wir vermuten es stark.
Diese Nachricht gibt Brenda gerade genug Zeit, ihren Lieblingspullover anzuziehen und sich die Haare zu kämmen, bevor — Puuff — der Kobold mit einem Sack auftaucht, der gerade groß genug ist, um den armen Ari hineinzustecken. Brenda tut so, als wäre sie erschrocken und verwirrt, und dann — gerade als der schreckliche kleine Mann zur Tür von Aris Schlafzimmer getanzt ist — schreit Brenda: »Ich kenne deinen Namen! Du bist Rumpelstilzchen! Rumpelstilzchen! Rumpelstilzchen! Rumpelstilzchen!«
Und das besiegt ihn, und er verschwindet mit einem schrecklichen Schrei, den niemand beachtet, weil er erledigt ist und machtlos. Danach sind alle glücklich statt traurig, und die Bäume blühen, der König wird weiser und gütiger und weniger gierig, und das Königreich wird angenehm und entspannt, und der Kundschafter findet jemanden, den er liebt, sogar mehr als Brenda, und alles, was man sich noch besser vorstellen kann, wird auch verbessert.
Und Ari und Brenda sind manchmal so glücklich, dass sie nicht einmal sprechen können. Sie tanzen einfach. Sie tanzen von einem wunderbaren Zimmer zum anderen und werfen Gold aus dem Fenster.
Seit 4000 Jahren erzählen wir uns gegenseitig, was wir wissen zu müssen glauben — dass man alle Ungeheuer besiegen kann, wenn man weiß, wer sie wirklich sind.
IM UNTERRICHT GEHEN WIR behutsam vor, wenn wir von Ungeheuern sprechen. Es ist nie ratsam, sich zu viele Vorstellungen von ihnen zu machen.
Im Gegensatz zu unseren anderen Skulpturen, die in der Kunstausstellung in meiner Küche stehen, befinden sich Alice’ und Tonys Stilzchen-Köpfe in meinem Bücherregal mit Glastüren. Deshalb sieht Anja nicht mehr ständig so aus, als müsse sie darüber nachdenken, wie neue Katastrophen sich verhindern lassen.
Ich habe allen gesagt, dass wir uns jetzt daran erfreuen können, wie großartig fies und kunstvoll die Köpfe sind, ohne Angst vor ihnen zu haben. Die Bücher können von Rumpelstilzchens Macht ablenken und sie besiegen, und das Glas sorgt für unsere Sicherheit.
Ich habe also doch einen neuen Mythos erfunden.
An jedem Tag kann guter Wille uns auch helfen, gut zu sein. Was wäre sonst der Sinn? Und wie bei den Fünftklässler-Eicheln ist es auch mit der Welt — wir wären in einem viel schlimmeren Schlamassel, wenn wir alle aufgeben würden. Außerdem sollte man begreifen: Was wir uns regelmäßig sagen, das werden wir auch.
Manche Menschen bemerken das nie.
Erwachsene vergessen es, oder sie denken, dass Ironie sie davor bewahrt, ihre eigene Bedeutung, ihre Absicht zu hören. Aber was auch immer Sie sagen, es bleibt bei Ihnen, lässt sich in Ihnen nieder, auch wenn Sie versuchen, sich davon zu entfernen. Ich schreie oft Teile des Oakwood-Grundschulversprechens um acht Uhr morgens in Richtung Decke, mit unguter Einstellung und wahrscheinlich verkrampften Fingern. Ich untergrabe also seine Wirksamkeit, aber ich spreche es trotzdem. Ich versuche weiter, meinen Zustand als Erwachsener zu verbessern.
In Oakwood ist mein Name ein kleines Liedchen in den Stimmen der Fünftklässler — immer das gleiche Lied: Miss-is McCor-mick. Ich benutze ihn als Decknamen, der mir dabei hilft, Menschen ein funktionierendes Erwachsensein zu zeigen, die später vielleicht mal eine Welt bauen, die immer noch ideal werden kann, darauf bestehen wir. Die Oakwooders — unsere Absolventen — sollten woanders weitermachen, zumindest positiv genug, um ihre Zwanzigerjahre zu überstehen. Simons Vater, Anjas Geschichte, Bobs Mutter und Marthas Mutter, Artenschwund, Klimaextreme, Klimakollaps, verheerende Krankheiten — wir wollten sie mit dem ausstatten, was uns alle retten kann.
Menschen versuchen immer noch, sich gegenseitig zu retten. Fast alle, die an der Macht sind, wollen uns derzeit davon abschrecken, aber ich will weiterhin glauben, dass dies das Beste an uns ist.
FALLS SIE SICH WUNDERN: Ich schreibe diesen Teil, während wir alle einen lachhaften Tag erleben. Tatsächlich hat mich dieser Tag zum Schreiben gebracht. Ich benutze meinen gelben Notizblock für den vorgesehenen Zweck, und das hält mich davon ab, durch die Straßen zu stapfen und laut aufzuheulen.
Es ist der 8. Mai, und auf einmal feiern wir den VE-Day. Victory in Europe. Die Titelseiten der Zeitungen, die ich nicht kaufe, lauern im Imbiss an der Ecke, um mir zu sagen, dass wir den VE-Day schon immer gefeiert haben, aber ich bin anderer Meinung. Ich weiß, dass wir damals gefeiert haben — meine Großeltern zündeten ein VE-Feuer an, das so groß war, dass es den nagelneuen, nach dem Blitzkrieg aufgebrachten Asphalt in ihrer Straße ruinierte und ihnen Ärger mit der Stadtverwaltung einbrachte. Sie zündeten ein weiteres Feuer für den VJ-Day an, den wir nicht noch einmal feiern werden.
Das Wichtigste ist offenbar die Behauptung, dass es beim VE-Day darum ging, Europa zu besiegen.
Und in ganz London — und anderswo — freuen sich verschiedene Patrioten darüber, dass wir Europa erobert haben, weil sie auf diese Weise schmerzfrei über die Weltgeschichte nachdenken können. Unser heutiger VE-Day vermeidet jede Erwähnung von alliierten Streitkräften, dunkelhäutigen Soldaten oder irgendwelchen geschmacklosen Details über Nazis.
Ich habe zu keiner Zeit meines Lebens mein Haus mit Wimpeln behängt, als ob ich den tapferen Chalky White und den frechen Dusty Miller erwarte, die nach der Befreiung Belgiens nach Hause marschiert kommen.
Für Chalky und Dusty ist dies jedoch kein Fest — sie und ihre nichtfiktiven Freunde sind damit beschäftigt, vor ihrer Zeit zu sterben, weil sie offenbar entbehrlich sind und alle Menschen, die in den wenigen ihnen noch verbleibenden Jahren Renten beziehen wollen, eine Belastung darstellen.
Ich nehme an, sie würden vielleicht sogar wieder den Faschismus besiegen wollen — peinlich. Also sollen sie lieber weiter in pestverseuchten Pflegeheimen verrecken, was bedeutet schon ein Jahr oder ein Tag oder eine Stunde für unwichtige Leute?