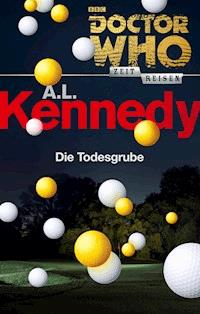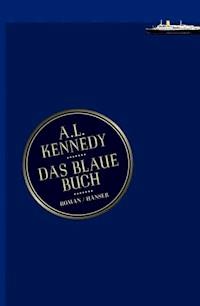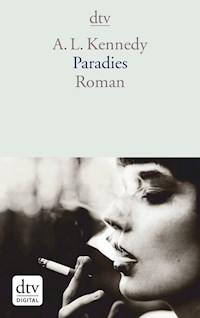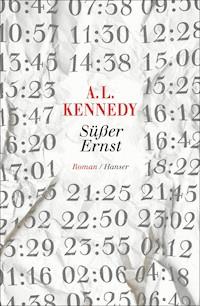
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Jon ist ein guter Mensch in einer schlechten Welt. Als Staatsdiener der britischen Regierung in London muss er täglich unmoralisch handeln. Um seiner Entfremdung zu entkommen, schreibt er Liebesbriefe im Auftrag alleinstehender Frauen. Eine von ihnen ist Meg, die sich gerade von ihrer Alkoholsucht erholt. Von seiner Handschrift und seinen Worten betört, sucht sie Jon inmitten der pulsierenden Großstadt auf… Gibt es sie wirklich, jene Liebe, die wahrhaft süß ist, weil sie den anderen – seine Verletzungen, seine Einsamkeit – ernst nimmt? In ihrem ergreifenden und skurril-witzigen Roman fragt A.L. Kennedy, wie in unserer narzisstischen Zeit wahre Gefühle noch möglich sind.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 718
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jon ist ein guter Mensch in einer schlechten Welt. Geschieden von der untreuen Exfrau, von seiner Tochter mit Verachtung gestraft, verbringt er seine Tage mit stillem Selbsthass. Als Staatsdiener der britischen Regierung muss er täglich unmoralisch handeln, um jedoch seiner Entfremdung zu entkommen, schreibt er alleinstehenden Frauen in deren Auftrag Liebesbriefe. Eine von ihnen ist Meg, eine bankrotte Buchhalterin, die sich gerade von ihrer Alkoholsucht erholt. Von Jons Handschrift und seinen Worten betört, sucht sie ihn inmitten der wild pulsierenden Metropole auf.
In ihrem berührenden und skurrilwitzigen Roman fragt Kennedy danach, wie wahre Gefühle in unserer narzisstischen Zeit noch möglich sind.
Hanser E-Book
A. L. KENNEDY
Süßer Ernst
Roman
Aus dem Englischen von Ingo Herzke und Susanne Höbel
Carl Hanser Verlag
Für V. D. B. wie immer
»Man strebt in allen Bereichen des Wissens danach, den Gegenstand so zu sehen, wie er an sich wahrhaftig ist.«
Matthew Arnold
Eine Familie sitzt in der Londoner U-Bahn. Sie sitzen alle in einer Reihe, und zwar in der Piccadilly Line. Sie haben beträchtliches Gepäck dabei. Sie wirken müde und ein wenig derangiert, und sie kommen eindeutig von weit her: eine Großmutter, ein Vater, eine Mutter, und eine etwa zwölf Monate alte Tochter. Die Erwachsenen reden leise auf Arabisch miteinander. Die Großmutter trägt ein Kopftuch, die Ehefrau nicht.
Ihre erwachsenen Begleiter wirken zwar alle recht schäbig, doch die Erscheinung des kleinen Mädchens ist von uneingeschränkter Farbenpracht. Sie hat Pailletten an den makellos weißen Schuhen und trägt Haarspangen, die mit Schmetterlingen besetzt sind. Sie zeigt Farben über Farben. Quer über ihre Strickjacke verläuft ein kompliziertes Stickmuster, wie Blumen und wie Sterne. Sie sitzt auf dem Schoß ihres Vaters, hat dem Herbst in den Fenstern und dem abnehmenden Licht den Rücken zugewandt und schaut den Rest des Wagens an, selbstsicher, interessiert, von Natur aus voller Charisma. Sie richtet ihren stillen, erwachsenen Blick auf die anderen Fahrgäste und grinst.
Das Mädchen hat außerordentlich schöne Augen.
An den Händen, den pummeligen Fingerknöcheln, an der Halsseite und an Wange und Schläfe hat sie recht frische Verletzungen. Manche sind nur verschorfte Abschürfungen, andere sind ernster. Keine ist richtig abgeheilt. Es scheint eindeutig, dass etwas Schreckliches, womöglich Explosives sie erwischt hat – nicht schlimm, aber schlimm genug. Einige der Wunden werden zwangsläufig Narben hinterlassen. Davon abgesehen ist ihre Haut seidig und flaumig und so bemerkenswert wie die eines jeden Kleinkindes, doch sie hat diese beharrlichen Verwundungen.
Sie übt Winken – manchmal winkt sie ihrer Großmutter und ihrer Mutter, manchmal auch Fremden, die nicht anders können, als zurückzuwinken. Die Kraft ihrer Persönlichkeit ist beträchtlich. Sie nimmt offensichtlich an, dass sie etwas Besonderes ist und nur aus gutem Grund im Zentrum der Aufmerksamkeit steht. Und es sollte möglich sein, dass sie mit dieser Annahme richtigliegt, dass sie immer richtigliegen wird. Erst wiederholte Einmischungen von außen würden ihr die Selbstsicherheit und das Glück nehmen.
Doch an diesem Morgen ist sie gebieterisch und winkt freudig. Immer wenn ein Fahrgast lächelt oder zurückwinkt, wirken ihre Angehörigen sowohl stolz als auch Gefühlsregungen nahe, die sie zu überwältigen drohen. Die offensichtliche Anspannung der Erwachsenen, das Unausgesprochene zwischen ihnen macht sie den Mitreisenden mysteriös – zugleich Geheimnis und Grund zu stiller, intimer Sorge.
Die Mutter, der Vater, die Großmutter – sie beschäftigen sich, bieten der Kleinen gesunde Leckereien und Getränke aus verschiedenen Taschen und Päckchen an. Auch Spiele haben sie dabei. Sie haben kleine Stoffbüchlein und ein hübsches Spielzeugtier, ein wenig wie ein Pferd. Sie sind so gut vorbereitet, wie man nur sein kann.
06:42
Das war – ach du lieber Gott – das hatte er nicht – neinneinneinneinnein.
Mist.
Jon spürte, wie sein Hemd von Panikschweiß feucht, seine Jacke schwer und belastend wurde. Er war nicht richtig angezogen für so was, für dieses Problem, für diese Art Problem.
»Ich tue, was ich kann. Wirklich. Ach komm … Bitte …«
Er hielt einen Vogel fest.
Obwohl er nicht wollte.
Er hatte einen Vogel in der Hand.
Eine Taube auf dem Dach wäre mir definitiv lieber. Hahaha.
Aber dieser Vogel schaffte es weder aufs Dach noch sonst irgendwohin. Das war ja das Problem.
Dämliche Sprüche sind das Problem. Aber das ignorieren wir mal. Wenn man dämliche Sprüche ignoriert, verpuffen sie womöglich. Im Gegensatz zu Problemen.
»Lass mich … lass mich einfach. Ich bringe das in Ordnung.« Er war auch nicht ansatzweise überzeugt, dass er es in Ordnung bringen konnte.
Gut möglich, dass er log. Einen Vogel anlog.
Der war ziemlich jung, das ornithologische Äquivalent eines dicklichen Kleinkinds oder vielleicht auch eines Pommes mampfenden Teenagers, und er wehrte sich in Jons gewölbter linker Hand, während Jon sich mit der Rechten abmühte, ihn zu besänftigen. Jetzt war er nämlich gar nicht sanft. Der Vogel zwickte ihn, kniff seinen linken Zeigefinger mit dem Schnabel – ein Zeichen entschlossener Ohnmacht und winziger Tapferkeit.
Jon wollte ihn nicht ängstigen.
Aber er konnte ihn auch nicht seinem Schicksal überlassen – nicht in seinem derzeitigen Zustand.
Aber weil er ihn eben nicht ließ – weil er ihn rettete –, kam er schon zu spät. Das Tier untergrub seinen Vormittag, zog seinem Terminplan den Stöpsel heraus. Darauf hätte er ehrlich gesagt verzichten können, wo sein Tag ohnehin anstrengend zu werden versprach, mörderisch, zum Scheitern verurteilt, leicht aus der Bahn zu werfen durch einen verdammten unvorsichtigen Atemzug. Sozusagen.
Heute ist der Tag, an dem ich kriege, was ich verdiene.
Glaube ich. Möglicherweise.
Als könnte das irgendein Mensch, irgendein menschlicher Körper aushalten.
Sozusagen.
Aber man musste aus dem Tag das Beste machen, was auch geschah. Man musste immer sein Bestes geben – denn sonst stellte sich ja niemand zur Verfügung.
Andererseits war man vielleicht schon dabei, etwas gar nicht so Gutes zu tun – Vögel waren empfindlich, Tiere im Allgemeinen waren empfindlich, und Vögel im Besonderen waren schnell überfordert und konnten durch einen einfachen Schock buchstäblich umgebracht werden. Vielleicht tötete er den Vogel.
Aber das wollte oder beabsichtigte er gar nicht … was wiederum für ihn sprach.
Aber mit seiner mangelnden Erfahrung würde er das garantiert vermasseln …
Zu viele Aber – das sieht mir gar nicht ähnlich. Ich bin doch der Mann, der die Aber beseitigt. Dafür bin ich bekannt – jedenfalls ein bisschen. Ich kann sie aus jeder öffentlichen Verlautbarung, Pressemitteilung, Zusammenfassung, aus jedem Bericht, Verlaufsprotokoll, Grünbuch, Weißbuch, aus jeder Notiz auf einem Briefumschlag tilgen, wenn Sie darauf bestehen, dass Sie meine Hilfe brauchen und einen heiklen Tag haben, dann tue ich eben, was ich kann … Theoretisch kann ich sogar eine Krebserkrankung, nun ja, verwandeln … der Krebs ist zwar noch da, aber stellt sich zugleich als glückliche Fügung heraus, wenn man mir nur genug Zeit gibt. Diese Fähigkeit habe ich. Ich will sie nicht, aber es scheint notwendig zu sein, dass Jon Corwynn Sigurdsson jedes Hindernis, jedes Gefühl von Widerstand beseitigt und die möglichen Folgen jeder beliebigen Handlung übertüncht. Wenn Sie das Gefühl haben, dass Ihnen irgendein Teil der Wirklichkeit einfach nicht gefallen mag, dann komme ich ins Spiel und formuliere diese Wirklichkeit für Sie um.
Aber ich möchte lieber nicht.
Und meine eigentlichen Pflichten liegen woanders. Ganz woanders. Meiner Meinung nach.
Das macht mich fertig.
Jon schloss die Augen und ließ seine Gedanken zur Ruhe kommen – so wie man eine Decke über einen Käfig wirft, um den Papagei darin zum Schweigen zu bringen: so viel Lärm, so wenig Sinn …
Ich kann zwar alles umschreiben, doch in diesem Augenblick geht es um den Tod, und der wird doch gemeinhin – selbst bei ganz gewöhnlichen Vögeln – als unglückliche Fügung gesehen.
Die Amsel schauderte – was ein schlechtes Zeichen sein mochte, Jon wusste es nicht.
Kein normaler Mensch hatte gern einen Tod in der Hand. Noch dazu in einer Hand, die offenbar für solche Aufgaben nicht entwickelt genug war – noch zu affenartig: seine hatten unansehnliche Haare auf den Knöcheln, und es mangelte ihnen an männlichem Geschick.
Wie man gebaut ist, enttäuscht einen eher.
Außerdem wäre dies ein Unverzeihlicher Tod – noch schlimmer.
Schwangere Frauen, Hunde, Pferde, manche Katzen, alle Schimpansen, die meisten Kinder, rüstige Senioren, Männer mit gutem Herzen, hübsche Frauen, tapfere Blinde, vielversprechende junge Menschen aus schwierigen Verhältnissen mit Stipendien für Oxford oder Cambridge – und liebenswert mutige Vogeljunge – der Tod solcher Lebewesen darf als unverzeihlich betrachtet werden. Herzzerreißende Fotos in allen möglichen sozialen Medien können ihren tragischen Status untermauern, indem sie die Opfer in vergangenen Momenten argloser Hoffnung zeigen. (Falls ein Pferd – rein hypothetisch – überhaupt Hoffnung empfinden kann.) Ihr schrecklicher Verlust mag Aktivisten inspirieren, Gesetzesreformen anstoßen, die Bereitstellung kommunaler Einrichtungen, die nach ihnen benannt werden – vielleicht aber auch neu entdeckte Krankheiten. Oder es werden frische Pferde bereitgestellt und nach ihnen benannt.
Der kleine Vogel stieß – was er in unvorhersehbaren Abständen tat – einen weiteren schrill drängenden Klagelaut aus, Flehen und Vorwurf zugleich, der seiner Größe ganz und gar nicht entsprach.
Dann zwickte der Kleine ihn wieder.
»Ach, komm … Hör mal … Bitte …«
Wir bewahren die Namen, erlassen Gesetze und errichten Gedenkstätten, damit die Unverzeihlichen Tode so wirken, als dienten sie einem Zweck. Obwohl es in Wirklichkeit natürlich wir sind, die dem Zweck dienen. Die Toten und ihr Tod können es nicht – sie sind nur ein Entfernen, ein Auslöschen. Niemand – das ist jetzt ein etwas sperriges Beispiel, übertrieben dramatisch – aber niemand ist im Holocaust gestorben, um eine ausgleichende Welle von Menschenrechtsgesetzen auszulösen. Das war nicht ihr Ziel. Niemand hat sich in den Leichenschlamm an der Somme geworfen, weil er auf inspirierende Erinnerungskunst hoffte. Und doch … kommen uns solche Gedanken, weil wir uns nach Hoffnung und Bedeutung sehnen und uns wünschen, dass sie aus der Bitterkeit entspringen und das WIEDER durch ein vorangestelltes NIE auf Dauer modifizieren mögen …
Das ist eine vereinfachende Haltung, deren letzte Konsequenzen ziemlich gefährlich sein könnten. Sie könnte dazu führen, dass wir fremdes Leid fördern, weil es womöglich etwas ungenügend definiertes und daher inspirierendes Gutes bewirkt. Es könnte dazu führen, dass wir die Früchte verschiedener vergifteter Bäume genießen. Es könnte sogar dazu führen, dass wir vergiftete Bäume pflanzen …
Dabei ist jeder Tod absolut unverzeihlich.
Es wäre eine moralische Bankrotterklärung, wollte man suggerieren, dass es so etwas wie Verzeihliche Tode gibt. Und ich bin nicht moralisch bankrott – noch nicht ganz. Andere womöglich schon. Vielleicht. Vielleicht will ich damit sagen, dass andere Menschen gelegentlich ihren moralischen Kompass verlieren und daraufhin Todesfälle auf einer absteigenden Skala einreihen könnten, angefangen mit … sagen wir einem Todesfall von erschütternder Bedeutung, der eine berühmte Persönlichkeit trifft, über Folgenlose Todesfälle, Langweilige Todesfälle bis hin zu Geschmacklosen Todesfällen und schließlich Notwendigen und mit gebührendem Ernst zur Kenntnis genommenen Todesfällen. Das wären alles Vorhersehbare Todesfälle. Selbst die unerwarteten können vorhergesagt, ihr Wirklichkeitsanteil gemessen werden – auch wenn die emotionale Distanz und Verrohung, die durch derlei Quantifizierung angeregt wird, wenig wünschenswert sein mag. Umgekehrt sollte man aber nicht zu harsch urteilen, wenn jemand den Tod anderer Menschen auf die leichte Schulter nimmt oder nur seine Öffentlichkeitswirkung abwägt oder Kosten und Nutzen gegeneinander aufrechnet – das könnte weniger ein spiritueller Aussetzer oder Defekt sein als vielmehr der vernünftige Versuch, im vollen Mitgefühlskalender Prioritäten zu setzen.
Ich könnte also trotz angemessener Zurückhaltung eine derartige Beobachtung äußern.
Eine Beobachtung andere betreffend. Nicht mich selbst.
»Ich bin kein schlechter Mensch.« Der Vogel schien nicht überzeugt. »Aber ich bin … ich komme zu spät. Und das darf ich nicht. Nicht heute. Heute ist …« Wieder brach ihm der Schweiß aus. »Heute ist heute, und heute ist einfach zu viel …«
Scheiße.
Das war Valeries Schuld – weil sie etwas verändert hatte. Die Vegetation auf ihrer Terrasse war normalerweise von grimmiger Geradlinigkeit – eingetopftes Grünzeug, dem es nichts ausmachte, wenn sie ihren Rauch darauf blies. Doch jetzt hatte sie sich offenbar einen Heidelbeerbusch ins Haus geholt. Oder jemand hatte ihr einen Heidelbeerbusch geschenkt – viel wahrscheinlicher –, und den hatte sie daraufhin hier draußen abgeladen.
Wo er eine Gefahr darstellte.
Wo er als Köder in einer unnötigen Falle diente.
Und so bildete das gesamte Szenario den Charakter dieser schrecklichen Frau nur allzu klar, eindeutig ab – es zeigte unmissverständlich, wie sie war und immer sein würde.
Der Vogel streckte sich in seinem Gefängnis, seine winzigen Bemühungen und seine große Not machten Jons Finger vor lauter Schuldgefühlen noch unbeholfener, trotz seiner Hilfsversuche.
Er war sich bewusst, dass dies ein ebenso klares und eindeutiges Abbild seines eigenen Charakters bot – furchtsam wie ein Kind, Finger wie ein Tier …
»Ist okay. Ist schon okay … Ich mache es wieder gut, ich sorge dafür, dass es dir wieder bessergeht. Ehrlich.« Er hatte die ganze Zeit mit dem Tier geredet – mit diesem hellbraunen, zwickenden Drosseljungen –, seit er es rufen gehört hatte. Er war aus der Küche nach draußen gelaufen, in den dämmernden Morgen, und hatte den Vogel entdeckt, wie er erbittert mit dem besonders dichten Netzwerk am Boden des viel zu verschnörkelten Übertopfes kämpfte.
Muss ein Geschenk gewesen sein. Sie hätte sich niemals freiwillig etwas besorgt, was so viel Pflege braucht. Es sei denn – ist es diesen Monat im Trend, frische Beeren vom Zweig zu essen, oder gilt es als probates Mittel gegen unvermeidliche Alterungsprozesse oder gegen Krebs?
Herrgott, sie kann so widerwärtig sein. Auch wenn ich das nicht sagen sollte.
»Tut mir leid … tut mir leid …« Jon entschuldigte sich und versuchte beruhigend zu klingen.
Mir ist klar, dass ich weniger gehässig sein sollte.
Hass ist ganz allgemein fast schon so eine Art Hobby in meinem Leben geworden. Ich laufe zwischen den gemieteten Ficus-Töpfen im Portcullis House umher und hasse. An den Wochenenden praktiziere ich stillen, zielgerichteten Hass, und in entspannten Augenblicken schlendere ich durch das Natural History Museum und kann mich nicht mehr darauf verlassen, wirklich etwas zu sehen, so dicht ist der Nebel aus Hass, durch den ich im Vorbeieilen zu spähen versuche. Das ist nicht angemessen. Es hilft niemandem. Das ist mir klar.
»Tut mir leid.«
Und in meiner derzeitigen Lage darf, darf, darf ich nichts und niemanden hassen, denn richtige Tiere spüren solche Negativität. Richtige Tiere bemerken im Gegensatz zu Menschen schon den kleinsten Anflug von Abscheu, sie verstecken sich davor, flüchten mit Füßen oder Flügeln.
Außerdem kann ich nicht vor Hass triefen – nass vor Hass, kann man das sagen? Kann ich nicht – nicht heute. Etwas hassen, meine ich. Heute geht es – wenn möglich – um das Gegenteil von Hass.
Also – selbst wenn ich das nicht ohnehin tun sollte, ich muss sanft denken, freundlich fühlen, sonst merkt es mein Vogel.
Nicht mein Vogel. Er gehört mir nicht.
Dieser Vogel.
Meine Verantwortung. Nicht mein Eigentum, aber meine Pflicht.
Und das wäre ein schönes Zitat, wenn man es ein wenig poliert und demütig vorträgt – ein bewegender Ausspruch, um die Moral zu heben, tempora und mores zu bessern, falls noch irgendjemand weiß, was das bedeutet …
»Ach, Herrgott noch mal!«
Über ihm schoss die Amselmutter vorbei, hielt sich akkurat über seinem Scheitel, drohte ihm mit harten, ratternden Warnkaskaden. Es hörte sich an, als würde jemand mit immer heftigeren Hieben auf dünnes Geschirr losgehen. Sie hatte ihn noch nicht getroffen. Sie tat allerdings so, als würde sie das gleich; mehr konnte sie nicht tun. Sie zeigte eine Art gewalttätiger Liebe.
»Ich bin … könntet ihr … würdet ihr beide … ich tue, was ihr wollt. Versprochen … ich …«
Nachdem er die Lage erfasst hatte, war er sofort in Valeries leicht versiffte Küche zurückgelaufen – die Griffe sämtlicher Schubladen fettig – und hatte eine Schere gefunden, war wieder hinausgeeilt, um das grässliche grüne Geflecht vom Leib des zitternden Vogels zu schneiden. Diese erste Rettungsaktion hatte den Vogel zwar unversehrt aus dem Netz befreit, doch war er selbst noch in diese schrecklichen Plastikfasern verstrickt, und er musste das arme Tier hochheben, in der Hand halten, es sicher umfangen und dann ganz sachte, schnipp, schnipp – Herrje, wenn ich in den Flügel geschnitten hätte oder so, ihn verkrüppelt hätte, uns beide zu dem darauffolgenden Gnadentod verurteilt, ein Unverzeihlicher Mord … und das könnte immer noch passieren, könnte immer noch, schrecklich, schrecklich …
Jons freie Hand hatte ziemlich blind mit der bedrohlichen Scherenspitze herumgetastet, hatte gehofft, die Einschnürung um die Atemwege des Vogels erwischen und zerschneiden zu können – diese spürbare Hysterie, als er sich mit matten Kräften in seinem Griff wand.
Das kleine Ding stieß wieder erstaunlich lautes, erschrecktes Zwitschern aus.
»Ich werde dich nicht fressen. Bestimmt nicht.«
Er fand es eigenartig, wenn nicht gar rührend, dass in diesem Ruf etwas erkennbar Kindliches lag. Das schien ein Naturgesetz zu sein: Wenn wir wirklich, ernsthaft in Not sind – ob Vogel, Schimpanse, Pferd, Mensch, alles, was Blut in den Adern hat –, werden wir wieder Kinder, wünschen uns unsere Eltern herbei, schreien nach unserer Mama, ob ihre Hilfe zur Stelle ist, nützlich wäre oder nicht.
»Ich werde dir überhaupt nicht wehtun. Das verspreche ich. Versprochen.«
Die Amselmutter stieß wieder sinnlos herab, diesmal mit noch lauteren Rufen.
Diese ganze Situation war einzig und allein darauf zurückzuführen, dass Valerie war, wie sie war, und immer das Falsche tat. Sie hatte einen Instinkt dafür. Das Netz über dem Heidelbeerbusch war das falsche Netz. Jon war streng genommen kein Gärtner, aber er hatte das Zeug oft genug gesehen, mit dem man Nutzpflanzen abdecken sollte. Der Durchmesser, die Maschenweite – er wusste nicht genau, wie man Vogelnetze einteilte –, die Materialstärke, Dichte … es sollte doch sicherlich sogar Spatzen abhalten. Jeder vernünftige Mensch würde damit Eindringlinge abhalten, nicht jedoch sie erwürgen wollen. Val aber hatte über ihre verdammten Heidelbeeren offensichtlich das Netz mit den größtmöglichen Maschen geworfen – eine drohende Gefahr für alle und jeden. Ein Treibnetz für alles Gefiederte. Aß sie jetzt Vögel, frisch vom Zweig gepflückt? Sollte das ihre von den Wechseljahren geplagte Haut zum Strahlen bringen? Was hatte sie sich dabei gedacht – wenn sie überhaupt nachgedacht hatte? Diese Frau war weitgehend unbelastet von jeder Rücksichtnahme. Jedes Tier, das kleiner war als ein dicker Kater, musste auf der Suche nach Heidelbeeren direkt in die Falle stürzen, musste gefesselt, allein und verwirrt um Hilfe schreien.
Das war das Problem mit Tieren – ihr fehlendes Begriffsvermögen brachte so viel Not hervor: erst ihre eigene und dann die eines Menschen. Man sah sie an, sah sich selbst in ihnen und wurde ganz närrisch und überdreht.
»Um Himmels willen! Wenn ich dich fressen wollte, hätte ich es doch schon längst getan! Oder etwa nicht?«
Brüllen war manchmal ein Ventil. Nicht dass Jon oft brüllte.
»Schh, nein. Schh. Ich hab’s nicht so gemeint. Ich bin nicht böse auf dich. Ich bin überhaupt nicht böse. Keine Sorge. Bitte. Mach dir keine Sorgen meinetwegen.«
Weder seine Versuche, den Vogel zu beruhigen, noch sein Wutausbruch schienen irgendwas an ihrem Verhältnis zu ändern. Tatsächlich waren beide Amseln jenseits seiner kommunikativen Fähigkeiten.
Worauf Val ihn sicher hingewiesen hätte. Sie hatte ein gutes Ohr für Pointen, konnte das Versagen anderer präzise auf den Punkt bringen.
»Entschuldigung. Sschh. Ich werde … Das wird … Es sollte …«
Probehalber zupfte er an einem Stück Plastik, das er aufgeschnitten und gelöst zu haben glaubte – das Ende des Problems. Jon zog etwas fester, und ein unangenehmer, schartiger Faden lief aus seiner Faust, der zweifellos zuerst über die Vogelbrust und unter den Flügeln entlanggeschabt war. Er spürte das Tier erschaudern. Es war bemerkenswert, wie sich die Last des Schreckens zwischen ihnen übertrug.
Als Reaktion auf diese ungewohnte Berührung kackte das Vogeljunge – völlig verständlich – warm auf Jons Hose, was einen langen lilafarbenen Streifen hinterließ. Die Farbe geklauter Heidelbeeren, der ersten Früchte.
Dann rief es noch klagender als zuvor – darauf hätte Jon gern verzichten können –, und die Mutter antwortete, schwang sich empört an seinem Ohr vorbei. Was wollte sie sagen? Versuchte sie zu beruhigen, trauerte sie schon, stieß sie Drohungen aus, schwor sie Rache, gab sie Ratschläge? Sie hatte den Gesang aller anderen Vögel in der Nähe zum Schweigen gebracht, diese hatten sich in sichere Entfernung zurückgezogen.
Ihr Schweigen wirkte schon vorwurfsvoll, während sich das Drama fortsetzte – obwohl Jon es anscheinend geschafft hatte. Nichts schien seinen Gefangenen mehr zu behindern. »Siehst du? Schhhh. Das ist … So … Ich habe dir doch gesagt …« Er versuchte festzustellen, ob alles in Ordnung war. Er würde dieses Ding nie wieder in die Finger kriegen, wenn er das jetzt vermasselte und es immer noch hilfsbedürftig war, wenn er es aussetzte … Man mochte sich gar nicht vorstellen, wie ein Lebewesen durch seine eigene Bewegung oder durch sein Wachstum ganz langsam stranguliert würde … oder sonst wie verkrüppelt … solche Sachen … Missbildungen, Wundbrand.
Der Pluspunkt wäre, dass Tod bei Missbildung und Wundbrand ein Wünschenswerter Tod wäre.
O Gott, bin ich ein Arschloch.
Nein, ich tue, was ich kann. Ich gebe mein Bestes.
Er drehte die gefiederte Gestalt in diese und jene Richtung, spähte durch seine Finger und versuchte, sich genügend auf seinen Tastsinn zu konzentrieren, um womöglich übrig gebliebene Fäden zu entdecken.
Jetzt schien es kein Problem mehr zu geben.
Glaube ich.
»Okay. Also gut. Alles in Ordnung.«
Von irgendwo sah ihm die Mutter zu, verabscheute ihn, ließ weitere heftige Beschimpfungen ab.
Jon murmelte ihrem Nachwuchs zu: »Alles gut. Wirklich. Du Dummchen. Hast du nicht …?« Mit einem Säuseln, das er von sich kaum kannte.
»Alles in Ordnung.«
Er holte Luft. Ein leichtes Schaudern behinderte das Einatmen, ließ dann aber nach. Er schwitzte nicht mehr. Seine Oberschenkelmuskeln entspannten sich. Er betrachtete seine leicht besudelte Hose, den dunklen, weiß geäderten Fleck auf dem farblich sich beißenden blauen Stoff.
Dann schaute er sich um und stieß die Luft seufzend aus.
Der gelbe Lichtquader, der aus der Küchentür fiel, war völlig unsichtbar geworden, als die Morgendämmerung zum Tag erstarkt war. Dennoch hielt sich eine sanfte Bläue, eine Zartheit hier und da in den Schatten, die er betrachtete. Es herrschte eine Atmosphäre zugänglicher Schönheit. Wenn er gewollt hätte, hätte Jon lächeln können. Aber er schaute nur hin, sehr sorgfältig, erlaubte sich zu sehen, zu sehen und noch einmal zu sehen, atmete wieder ein und hielt den Atem an, Luft und Friedlichkeit füllten seine Lunge.
Und um ihn strömte dichte Stille heran.
Schloss sich.
Sicherheit trat ein, Trost wurde verabreicht, gegen sieben Uhr am Morgen. Und jede Bewegung verschwand.
Jon roch den Fluss: die relative Nähe von freigelegtem Schlamm und Frühlingsgrün, schmutziges Leben, das sich außerhalb von Valeries Heim abspielte. (Ein gefragtes Gebäude aus dem 18. Jahrhundert, dem schmutziges Leben nicht ganz fremd war. Das macht sie nur, um einen zu ärgern, weil sie weiß, wie sehr es einen reizt.) Doch kein Laut, nicht der geringste, war zu hören. Er konnte sich einbilden, dass die Bäume draußen an der Straße, die gepflegt wildwüchsigen Gärten zum Wasser hin, das Gründeln der Schlickbewohner, das Wachsen der Weiden draußen auf dem Werder, das Schieben und Anbranden der Strömungswellen, dass alles völlig zum Stillstand gekommen war. Und der frühe Autolärm am Hogarth-Kreisel, das endlose Zischeln der Jets am Himmel über ihm, das aggressive Wirbeln von allem, was für diesen ganz besonderen Aprilfreitag nötig war – das alles hatte jetzt ausgesetzt.
Nur jetzt.
Nur für den Moment.
Selbst die Amselmutter war stumm und reglos.
Es war so, als hätten die allseitigen Ängste – die der Vögel und seine eigenen und die der Welt – ein gegenseitiges Einverständnis herbeigeführt, eine Pause zur Bestandsaufnahme.
Und dann zwinkerte Jon.
Was den Bann brach.
Die Wirklichkeit taumelte weiter.
»Also. Okay. Dann …«
Und er ließ los, kam einem Seufzer ziemlich nahe, öffnete die Hand und schaute einen ganzen langen Moment das Vogeljunge an, das sich nicht rührte und dessen dunkel glänzender Blick auf Jon ruhte.
In Jon schimmerte eine Schuljungenhoffnung auf, dass ihm der Vogel womöglich dankbar war – und bei ihm bleiben, auf seinem Finger sitzen und seine zerzausten Federn ordnen würde.
Oh.
Aber er verließ ihn.
Oh.
Natürlich.
Oh.
Der Vogel zuckte in einem plötzlichen Ausbruch von Hast hoch und stieß einen Ruf aus, als wäre er keinesfalls weniger als schwer verwundet worden. Und doch war er offenbar genug bei Kräften, um zu entkommen, war ganz und gar frei und gerettet. Jon hatte etwas gerettet.
Er schaute dem Vogel nach, der pfeilschnell in das kleine Kästchen Himmel schoss, das über Valeries Terrassenmauern hing.
Oh.
Und dann war er so was von weg. Die Mutter ebenso.
Seine Handfläche kühlte ab.
Seine übliche Anspannung setzte wieder ein.
Eine Panik oder so etwas Ähnliches, etwas wie Nervosität, aber ohne Anwesenheit von Nerven, so als wäre die innere Verkabelung entfernt worden und man spürte die Lücke. Das war es. Hier war es.
Ich glaube, ich muss mich vielleicht übergeben.
Ein halbes Dutzend Sittiche glitten über ihn hinweg, so hoch, dass er nur die Silhouetten sah. Sie hatten scharfkantige Flügel, die Schwanzfedern liefen lang und spitz aus – von der schieren Geschwindigkeit, konnte man annehmen, vom gnadenlosen Geradeausflug. Und sie machten dabei so ein lautes Geräusch – tssiuuh, tssiuuh, tssiuuh. Sie machten ein Geräusch wie Ehefrauen.
Nein, diese Bemerkung ziehe ich zurück. Sie klingen wie die Angst vor Ehefrauen, die Angst vor einer Frau, meine Angst vor einer Frau, vor meiner Frau, meine Angst vor meiner Frau, vor dieser Ehefrau.
Tssiuuh, tssiuuh, tssiuuh.
Ich weiß nicht, ich weiß es nicht. Ich weiß nichts über Ehefrauen oder Sittiche. Ich müsste wissen, wie sie sich anhören, aber ich weiß es nicht. Ich könnte mich auch irren. Ich habe Affenhände und keine Verkabelung. Ich bin ein großes Kind im Anzug eines Mannes und für keinen Zweck geeignet.
Tssiuuh, tssiuuh, tssiuuh.
Und jetzt bin ich wirklich zu spät. Dabei muss ich heute Zeit haben, ich muss mir Zeit schaffen, weil ich dann in der Lage bin … Es gibt Dinge, die ich zu Ende bringen muss, und die sollten nicht übereilt werden.
Aber ich glaube, ich schaffe es. Wirklich. Ich schwöre. Ich werde mir ein großes Loch im Terminplan freischaufeln, damit ich frei atmen und funktionieren kann, so wie ich sollte, und ich werde es möglich machen, dass ich sehen, sehen, sehen kann, was als Nächstes kommt.
Tssiuuh, tssiuuh, tssiuuh.
Wie es sich anhört, ausgelacht zu werden.
Hier ist es.
Tssiuuh, tssiuuh, tssiuuh.
Ja, hier ist es.
06:42
Weil es nicht ratsam war, wach im Bett zu liegen, war sie hier hochgekommen, um den Morgen heraufziehen zu sehen. Der Stadtrat ließ die Parkanlage oben auf dem Hügel geöffnet, sogar nachts. Wegen der schönen Aussicht waren durchgehende Öffnungszeiten unerlässlich. Die Menschen hatten das Gefühl, sie müssten jederzeit vorbeikommen und nach der Metropole schauen können, die ihnen da so untypisch zu Füßen lag. War sie nicht flach – die Stadt –, wenn man sie so sah, so ganz eindeutig in einem Gezeitenbecken angelegt, in den Schlick gegründet? Fremde machten solche Bemerkungen zu anderen Fremden. Die Bewohner des Telegraph Hill brauchten das nicht, sie waren daran gewöhnt. Sie konnten einfach weiterschlendern, vielleicht zu Musikbegleitung – der Hügel ist sehr musikalisch, Leute üben auf ihren Instrumenten –, und auf die verblüffende Wirkung eines waschechten Londoner Sonnenuntergangs hoffen, auf das Blut und Glitzern, das über die Ufer ferner Fenster schwappte und Träume in den Himmel malte. Oder vielleicht bekamen sie den Kampf wogender Gewitterfronten, oder Feuerwerke, oder hohe Nachmittage, wenn das viele Blau des Sommers siedete und gleißte wie die Flagge eines außerordentlichen, makellosen Landes. Selbst an einem durchschnittlichen Tag musste die Stadt beobachtet werden. Man sollte London nicht den Rücken zuwenden, denn es war ein gerissenes altes Biest.
Sie hatte einen Sonnenaufgang gewollt. Beziehungsweise hatte sie einfach rausgewollt, es war sehr früh gewesen, und sie hatte nicht unbedingt eine Wahl gehabt – im Morgengrauen kommt verlässlich ein Sonnenaufgang, da kann man ganz ruhig bleiben und muss nicht mit Enttäuschungen rechnen. Da geht alles klar.
Sie war in den Park eingebogen und hatte den Hauptweg genommen, gefahrlos zwischen entfernt dösenden Bäumen, keine Schatten, in denen Ärger lauern konnte. Als Frau allein – da willst du dich nicht ständig bedroht fühlen, aber du musst dich auch nicht zu dämlich aufführen. Du willst dich nicht in Gefahr begeben. Oder doch? Nein, willst du nicht. Solltest du nicht. In Gefahr sollte man nicht leben.
Dann hatte sie den stillen Tennisplatz umrundet und war – trotz des Dämmerlichts einigermaßen zielsicher, weil sie häufig hier war – über das Gras, das sich irgendwie ölig anfühlte, auf den höchsten Punkt des Hangs zugesteuert. Irgendwo in der Nähe hatten Füchse gesungen, geschrien.
Es war gute Tradition, Füchse zu hassen, warum auch immer. Sie nahm an, das hatte mit Schuldgefühlen zu tun. Sie klangen immer, als würden sie verletzt, wenn nicht gar gequält, und das ließ einen daran denken, welches Leid man anderen in der Vergangenheit zugefügt hatte. Vielleicht waren die Füchse eine Art Heimsuchung, die einen an frühere Sünden erinnerte, und so etwas kam nie gut an bei den Leuten. Oder vielleicht steckte auch gar keine Logik dahinter, bloß willkürliche Abscheu, die sich ein Ziel sucht und dabei bleibt.
Sie genoss diesen warmen Lärm der Füchse, diesen blutig-pelzigen und weißzahnigen Klang – er war intensiv, und was intensiv war, mochte sie. Das war ihre Wahl. So wie auch der Hügel ihre Wahl war. Die offene Dunkelheit gab ihr das Gefühl, auf einer Klippe zu stehen, sobald die mächtige Skyline in Sicht kam. Das bot ihr die schöne Illusion, von hier aus in den Weltraum vorstoßen zu können, einfach hinaus- und nach oben zu schwimmen. Unter ihr ausgebreitet lagen Quellen und Ketten von Lichtern, hingen scheinbar in einem riesigen Nichts, ein herrlicher Wirrwarr. Es war leicht sich vorzustellen, dass Londons Wände und Bauwerke überflüssig geworden wären, sich aufgelöst hätten, und dass nur noch Leben, reine Leben brennend in der Luft hingen, wie Hitzebündel dort schwebten, oder wie Farben, Willensäußerungen vielleicht. Was diese Leben in der Luft hielt, war nicht zu sagen.
Doch dann hatte sich im Lauf einer Stunde tatsächlich die Sonne im Osten hereingedrängt, war aufgegangen, Vögel waren erwacht, hatten die Tatsache, ebenso wie Flugzeuge und Busse, verkündet, und die Welt hatte sich verfestigt und sie ausgeschlossen. Wie bei jemandem, den man nachts kennenlernt und der bei Tageslicht nicht dieselbe Person ist. Unter dem immer noch goldfarbenen, pudrigen Himmel waren Gebäude einfach zu Gebäuden geworden, im Vordergrund erkennbar viktorianisch, aufgereiht und belebte Furchen bildend, das Muster hier und da unterbrochen, wo im Krieg Bomben gefallen waren. Diese Explosionslücken waren mit neueren, hässlicheren Gebäuden gefüllt oder zu Parks geworden. Manche Grundstücke waren auch einfach leer geblieben. Sie waren zerstört und dann verlassen worden, konnten zu kleinen Wildnissen werden, Leerstellen einer vergessenen Sache. 44 waren V-1- und V-2-Raketen eingeschlagen. Irgendwo unter der heutigen Bücherei – die nicht mehr städtisch war – hatte sich ein zerschmettertes Gebäude befunden, zerfetzte Menschen, Dutzende von ihnen zur Mittagszeit aus dem Leben gerissen. Man sah davon nichts mehr. Irgendwo gab es eine Gedenktafel, wenn man die bemerkte, doch andere, zumindest nicht sichtbar zerfetzte Menschen gingen gewöhnlich vorbei und verschwendeten keinen Gedanken daran.
Sie allerdings gehörte zu denen, die einen Gedanken verschwendeten. Sie interessierte sich für Schäden, konnte man sagen: für Schäden und Lücken. Konnte beides lehrreich sein.
Andere Orte waren friedlicher. Sie konnte Kirchtürme ausmachen, oder die cremefarbenen Schornsteine des ehemaligen Battersea-Kraftwerks. Weiter hinten schoben sich dünne Züge unbekannten Zielen entgegen, und die Einzelheiten verschwammen. Ganz in der Ferne erhoben sich Formen oder Andeutungen oder Träume von unmöglichen Küsten, Lagunen und Bergen. Trugbilder krochen aus dem Horizont hervor. Und irgendwo, dem Auge unsichtbar, buckelte die verkrümmte Gestalt der Themse der Küste zu.
Es war kein schlechter Morgen. Sie war eigentlich kein Morgenmensch, aber es konnte ihr trotzdem gefallen. Die Sittiche glitten schon lebhaft umher, bremsten farbflackernd ab und ließen sich auf Bäumen nieder, ein fremdartiges Grün, das nie zuvor hier gewesen war, sie wippten und legten die Köpfe schräg im stumpfen Grün der Bäume. Sie stammten aus dem Land der Trugbilder jenseits der Hausdächer. Zuerst hatte es auf dem Hügel nur ein Pärchen gegeben, aber mehr als zwei brauchte es auch nicht – man denke nur an Noah. Eins plus eins macht mehr. Sie brachten den Elstern schlimme Wörter bei.
Inzwischen – fast sieben Uhr an einem Freitagmorgen im April – wurden die üblichen architektonischen Orientierungspunkte geboten: der komplizierte Metallzylinder, der sich in der Nähe von Vauxhall erhob, der riesige Glaszapfen bei der London Bridge, die Turbinen, die unsicher über Elephant & Castle aufragten, die gut gedrechselte Geländerstütze, die Fitzrovia markierte … all die Navigationshilfen. Und dann das Spielzeugkistendurcheinander in der City, eine schludrige Ansammlung unwahrscheinlicher Formen, oder die irgendwie an Art déco erinnernden Pralinenschachteln von Canary Wharf, und hier und dort eingestreut die fernen Drahtgitter von Kränen, die weitere Seltsamkeiten in den schutzlosen Himmel hievten.
Das waren selbstgewisse Monumente selbstbewusster Organisationen und prominenter Männer – und alle, die weniger bedeutend waren, mussten sie anschauen und über sie nachdenken. Unbedeutende Menschen gaben ihnen Spitznamen und verglichen dieses oder jenes noble Bauwerk absichtlich mit Sachen im Hosentaschenformat, mit Haushaltsgegenständen: das Handy, die Käsereibe, die Senfgurke. Wenn man sie schon nicht verschwinden lassen oder verhindern konnte, dass neue auftauchten – diese Zeugnisse von konzentrierter Macht und Albernheit, von albernem Reichtum –, dann konnte man sie wenigstens für lächerlich erklären. Man konnte sich an ihren Konstruktionsfehlern, an ihren Baumängeln, an ihrem teuren Büroleerstand erfreuen. Das half zwar nicht, aber es brachte einen zum Lächeln.
Das Gleiche konnte man auch mit anderen Bereichen der Realität versuchen. Manchmal.
Manchmal konnte kunstvolle Namensgebung feindliches Terrain eine Zeitlang unterwerfen. Sie hatte einmal einen Freund – eher ein Freund von Freunden – im Krankenhaus besucht. Das Zimmer, das er mit zwei anderen Patienten teilte, lag hoch genug, dass man über Chelsea schauen konnte. Ein früherer Insasse hatte eine detaillierte Zeichnung der Stadtlandschaft hinterlassen, jedes Dach als Schattenriss auf einem langen Streifen Karton abgebildet. Die Einzelheiten waren obsessiv genau wiedergegeben. Jedes Gebäude war namentlich gekennzeichnet und mit historischen oder skurrilen Fußnoten versehen.
Da sie sich mit dem Freund von Freunden sehr wenig zu sagen hatte, war sie darauf verfallen, Vermutungen über den unbekannten Künstler anzustellen. Sie hatte gesagt, derjenige habe Woche um Woche sehr krank hier gelegen oder sehr gelangweilt sein müssen, oder im Sterben liegend und habe daher noch etwas Sinnvolles hinterlassen wollen. Der Freund von Freunden hatte zu der Zeit ebenfalls im Sterben gelegen, auch wenn er es gelassen nahm.
Es war so einer jener Tage gewesen, an denen ihr Taktgefühl sie im Stich gelassen hatte.
Jetzt fragte sie sich, ob auf dem Hill wohl jemand aufzutreiben wäre, der ihnen allen eine ebenso lange, schmale Ansicht zeichnen könnte, um ihnen die Aussicht zu erklären und sie in der Spur zu halten. Das wäre sowohl nützlich als auch angemessen. Wenn die Anwohner im Sommer frühmorgens draußen herumlungerten, um zu rauchen, in Gärten und Vorgärten auf und ab gingen, sich an Türrahmen lehnten und auf Stufen saßen, dann hatte die Gegend tatsächlich etwas vom Krankenhaus: Hausschuhe und Nachthemden, stilles Zunicken im Vorbeigehen, halbwaches Starren, in den weichen Gesichtern noch Kissenfalten. Sie brauchten alle einen therapeutischen Stadtplan, den sie aufsuchen und von dem sie lernen konnten, den sie ändern, vervollkommnen, mit zusätzlichen Fußnoten garnieren konnten, wie sie wollten. Das würde Kraft verleihen.
Oder sie konnten weitermachen wie bisher – mit Halbwissen, durch Wiedererkennen, Schlussfolgerungen.
Oder sie konnten sich Sachen ausdenken. Sie konnte das. Sie war gut im Erfinden, eine Eigenschaft, die oft wenig hilfreich war. Schnell fühlte sie sich kategorisch und definitiv, zeigte auf Das Da und verkündete: Das ist der Horchposten, der eure Zuneigung aufzeichnet, das ist die Konditorwerkstatt, in der man eure Seelen nachbildet – die machen das mit Zuckerwatte, und die Seelen werden nie gekauft, nur als Geschenk angenommen oder gegessen –, und das ist die Lagerstätte der Reue, und dort ist der Zugang zum Flammenofen, bewacht von einem klugen Hund. Sie konnte endlos derlei Unsinn abspulen – ohne einen Gedanken daran, ob man es hören wollte oder nicht.
In trüber Stimmung wäre es ihr lieber gewesen, wenn all diese architektonischen Markenzeichen, diese großen phallischen Gesten ganz sachgerecht umgetauft würden: der Glitzerschwanz, der Stachelschwanz, der Fettschwanz, der Plattschwanz, der Schrägschwanz, der Übersehene, der Schlappschwanz, der Hübsche, der Mickrige, der Schielende und der Trostpreis.
Warum nicht sagen, wie es ist?
Aber heute war sie gar nicht in trüber Stimmung. Sicher, im Gespräch hätte sie sagen können: »Wir treffen uns unterm Stachelschwanz – gleich neben dem Bahnhof.« Aber das hätte sie nur witzig gemeint. Vielleicht hätte sie es sogar bloß gedacht, aber den Mund gehalten. Ihr wäre eingefallen, dass manche Menschen Ausdrücke wie Schwanz nicht gern hören, also hätte sie gewartet und nachnachnachgedacht, um herauszufinden, ob sie auf den billigen Witz lieber verzichten und Worte von der Stange wählen sollte. So trat man niemandem auf die Füße. Auch wenn man später herausfand, dass Menschen, die gewöhnlich nicht fluchen, gelegentlich doch Gefallen daran fanden und zum richtigen Zeitpunkt schlimme Worte von anderen zu schätzen wussten. Nach bloßem Anschein schwer zu beurteilen. Man musste die Stimmung testen, erst mal nur den Zeh ins Wasser halten, ohne gleich das Ertrinken zu riskieren, und dann vorsichtig losschwimmen. Mit aller Vorsicht hätte sie also sagen können: »Ich treffe dich am Freitag, gleich neben dem Hochhaus – am Bahnhof London Bridge.« Ganz ohne Ausschmückungen.
Aber sie wäre glücklich gewesen, ganz egal, wie sie sich ausgedrückt hätte. Sie wäre auf jeden Fall glücklich gewesen.
Ich treffe dich.
Das ist eine glückliche Aussage.
Das ist ein schönes Versprechen.
Und es hatte sich in ihrem Kopf als weiterer angenehmer Gedanke zu ihrem Geburtstag gesellt.
Ich habe Geburtstag.
Es ist ihr erster Geburtstag.
Sie ist fünfundvierzig Jahre alt und hat zum ersten Mal Geburtstag.
Es ist ihr erster Geburtstag seit ziemlich langer Zeit, länger als üblich, um ehrlich zu sein.
Ich spinne den Gedanken weiter. Versuch nur, mich dran zu hindern. Kannst du nicht. Wetten, nicht? Dieser Geburtstag gehört ganz allein mir.
Sie hat es bis zu ihrem fortdauernden ersten Geburtstag geschafft und trottet immer noch voran. Ein wirklich hervorragender Gedanke.
Sie hat eine ganze Sammlung von erstklassigen Gedanken, die sie sich gerne im Stillen aufzählt. Szenen und Augenblicke, an die sie sich bewusst erinnert. Das ist ihr Gegenstück zu warmen Kieseln, von Hand in Hand gegeben, zu einer Misbaha, einer Mala, einem Komboloi, einer Gebetskette, zu Sorgenperlen – alle haben Sorgen, warum sich nicht mit Perlen behelfen? Sie zählte sich unsichtbare Bruchstücke auf und wünschte, sie wären offensichtlicher, würden anderen Menschen deutlicher zu verstehen geben: Lasst mich einfach kurz in Ruhe, ich bin nämlich damit beschäftigt, mich gut fühlen zu wollen.
Daran ist doch nichts auszusetzen.
Ist doch nicht schlimm, seinen Geburtstag auszuschlachten. Selbst wenn er schon über eine Woche her ist – na und?
Ich heiße Meg. Heute ist mein Scheißgeburtstag.
Sie findet das gerechtfertigt.
Wie oft hat man schließlich seinen ersten Geburtstag? Normalerweise nicht mehr als einmal.
Na gut, schön – es war kein Geburtstag, es war ein Jahrestag.
Ich heiße Margaret Williams, Meg Williams. Ich heiße Meg, und heute ist mein Jahrestag. Ein Jahr.
Aber Geburtstag war ein besserer Ausdruck, denn wenn man sich selbst den ersten Geburtstag einredete, erinnerte man sich daran, dass man einmal eine Art Rockstarberühmtheit gewesen war, aber noch zu jung, um es zu genießen. Als du geboren wurdest, warst du sofort eine gute Nachricht. Wenn andere dich sahen, lächelten sie. Sie schenkten dir Sachen. Sie wollten dich auf dem Arm halten und dich beschützen und nett sein. Du konntest dich kleiden wie ein Geisteskranker und kein einziges vernünftiges Wort rausbringen, aber das war okay, das war cool, das gefiel den Leuten, und sie wollten einfach noch mehr über dich und deine Bedürfnisse wissen. Wenn du Scheiße gebaut hast, putzte jemand anderes dein Problem weg, und du musstest einfach nur sein, und das allein stellte alle zufrieden. Dass du du warst, war für jeden, der es mitbekam, ein verdammtes Freudenfest.
Eins ist das Alter automatischer Berühmtheit.
Wer will davon nicht was abhaben?
Eins ist unbefleckt und unbelastet und tut niemandem weh. Es hat nur die Geister der Dinge, die da kommen – und jeder Einzelne von ihnen ist ein glückverheißendes Versprechen.
Sie verspürte beim Gedanken an die Zukunft nicht die herkömmliche Freude – die Zukunft war widerspenstig.
Doch wenn du eins warst, hattest du diese riesengroße, unübersehbare, lächelnde Zukunft – sie war nur für dich da, direkt vor dir und, wie behauptet wurde, einladend. Du hattest Potenzial, und das sollte nicht schwinden oder jedenfalls erst, wenn du älter wurdest. Du warst ein Versprechen. Für die anderen ebenso wie für dich selbst.
Ein Gefühlsschub stieg brodelnd von ihren Füßen aus aufwärts, und sie hoffte, dass die Menschen, die ihre Hunde in der Frühe spazieren führten, ihr nicht zu nahe kamen und merkten, dass sie ein wenig weinte. Der Hill war eine schwatzhafte Gegend, womöglich ließ man dir Tränen nicht durchgehen – man musste sich vor Nachfragen schützen.
Eigentlich sollte sie jetzt wirklich nach Hause und sich aufwärmen und sich richtig anziehen. Ausflüge in Gummistiefeln und Mantel über dem Pyjama galten in vielen Haushalten der Umgebung als akzeptables morgendliches Verhalten. Der Hill verurteilte niemanden. Bei abendlichen Autofahrten konnte man sich an den gleichen Dresscode halten. Wenn man ein Auto hatte. Sie hatte keins mehr. Und bald ging es an die Arbeit, und vorher stand noch anderes an, und sie musste sich auf verschiedene Arten vorbereiten, und die Busfahrpläne hatten in letzter Zeit nur noch theoretische Bedeutung, was bedeutete, sie musste verantwortlich handeln und genug Wegzeiten einplanen. Sie sollte duschen, sich fertigmachen und direkt losdüsen, da hin, wo sie sein sollte, und dann ihre Arbeit machen und einem Zweck dienen.
Das war noch ein guter Gedanke: Sie hatte Arbeit, und ihre Arbeitgeber fanden sie nützlich und wollten, dass sie weiter wie vereinbart zur Arbeit erschien, und sie bezahlten sie und stellten ihren Angestellten einen Wasserkocher und Becher zur Verfügung – kostenlos – und unterstützten gemeinschaftsfördernde Bräuche, zum Beispiel die Regel, dass reihum an jedem letzten Freitag im Monat jemand Kuchen mitbringen musste.
Der Druck, dass sie als Nächste mit dem Kuchen dran war, war in Ordnung, stellte sie fest.
Andererseits war es schon Druck.
Wenn ein Kuchen schlecht ankam, verdarb das dem ganzen Büro die Laune, und der Monat endete traurig. Darum war Erfolg auf dem Kuchengebiet so wichtig.
Sie würde einen kaufen müssen, weil sie nicht backen konnte, jedenfalls nicht verlässlich. Den Kuchen selbst zu backen würde ohnehin nur Hysterie auslösen. Wenn es ein grässlicher Kuchen aus dem Laden war, konnte man die Schuld auf den Laden schieben. Dein eigener grässlicher Kuchen – die Leute müssen natürlich höflich bleiben, aber sie wollen ihn nicht essen, und weil du selbst im Anschluss an deine unerträgliche Kuchengabe anwesend bist, müssen sie sich wegschleichen und ihre Stücke heimlich wegwerfen. Und am Ende entdeckst du in Servietten gewickelte Kuchenstücke im Müll – immer noch sehr offensichtlich – oder auf Fensterbänken, wo die Tauben sich damit abquälen, oder sonst irgendwo, das hing davon ab, wie einfallsreich deine Kollegen und Kolleginnen bei GFH waren, und je einfallsreicher, desto mehr Energie mussten sie darauf verschwenden, deine Katastrophe zu beseitigen, die allein deine Schuld war, und der ganze Schlamassel wäre so zutiefst erniedrigend, dass man gar nicht daran denken durfte.
Also sollte sie nicht daran denken.
Stattdessen sollte sie anerkennen, dass es gar keine große Sache war und dass sie dramatisch übertrieb.
Dennoch hatte sie einmal die Woche gekauften Kuchen getestet, um auf Nummer sicher zu gehen. Wie gut sie waren, hing in deprimierendem Maße vom Preis ab. Sie wollte einen relativ preiswerten Kuchen. Sie wollte außerdem einen Kuchen, der unschuldig wirkte, so als hätten ihn die Hände einer erfahrenen Verwandten geformt – schlicht, aber lecker und von Herzen kommend. Sie wollte den Leuten etwas Einfaches, Freundliches geben.
Das war aber nicht zu kriegen.
Der billige Kuchen war schrecklich. Der teure Kuchen schmeckte nach Gier – nach gierigen Bäckern.
Sie konnte es nicht richtig machen.
Wer hätte gedacht, dass Kuchen so eine Arschkarte ist?
Es waren nicht die großen Probleme, über die man stolperte – über heldenhaftes Leid und Chaos ließ sich eigenartig leicht reden. Und ebenso konnte man auch versuchen, sich seiner sehr vielen Unzulänglichkeiten nicht zu schämen und nicht auf ihnen herumzureiten. Aber lachhafte, obsessive Angst aus im Grunde nichtigem Anlass: das war beschämend, darum bliebst du stumm, und es gärte in dir.
Ich lasse mich von Eiern, Butter, Zucker und Mehl quälen.
Sie sollte Schokolade für die Belegschaft von Gartcosh Farm Home kaufen. Schokoladenkuchen.
Schokolade funktionierte immer.
Ein Kuchen konnte fies sein, kommerziell, unpersönlich, leicht toxisch – wenn er mit Schokolade war, funktionierte er trotzdem. Das war eine Art Grundregel.
Idiotensicher.
Vielleicht.
Man konnte sich nicht ganz sicher sein, denn vielleicht hatten die Leute bei GFH irgendwann doch die Nase voll von Schokolade. Jeder ergriff gern die Gelegenheit, Süßigkeiten mitzubringen, darum kam es so häufig vor.
Sie sollte nicht langweilig sein.
Sie sollte nicht allen anderen die Möglichkeit verbauen, Freude zu bereiten.
Sie sollte nicht allen anderen für immer die Lust an Schokolade verderben.
Herrgott, war das schwierig.
Kuchen war schwierig.
Nein.
Sie war jetzt wieder raus aus dem Park und auf dem Rückweg zu ihrer Wohnung – schnellen Schrittes wegen ihrer backwarenbedingten Anspannung.
Nein. Das ist doch irre.
Sie blieb am Bordstein stehen, als nähme sie sich vor plötzlich auftauchendem Autoverkehr in Acht, auch wenn dergleichen nicht einmal in der Ferne zu sehen war.
Ich kann mich doch nicht von Kuchen schikanieren lassen. Noch nicht mal von richtigem Kuchen – von theoretischem.
Sie schniefte, runzelte die Stirn und trat auf die leere Straße.
Ich sollte einfach einen Schokoladenkuchen und noch einen anderen besorgen …
Nein.
NeinverdammteScheißKotzPissKacke.
Also mal ehrlich.
Ich sollte einfach nicht darüber nachdenken.
Ab sofort.
Nicht über Schokoladenkuchen nachdenken, der keine Spuren von Nüssen enthält.
Und kein Gluten.
Und keinen Alkohol.
Bio-Schokolade.
Schokolade, die hungernden Dorfbewohnern half und Waisen den Schulbesuch ermöglichte, die Schulen baute, Leben rettete, Gemeinden ernährte, starke Frauen zum Singen brachte und kluge Männer dazu, die Frauen zu lieben.
Dagegen konnte niemand etwas haben.
Allerdings gab es auch keinen Grund, deshalb so einen Aufstand oder sich so viele Gedanken zu machen. Nicht wegen Kuchen.
Es war doch bloß ein Scheißkuchen.
Der ein Schokoladenkuchen sein sollte.
Warum zum Teufel waren alle so anspruchsvoll?
Menschen zu zwingen, Kuchen mitzubringen. Was für ein Sadist hatte sich das ausgedacht?
Obwohl es eigentlich eine ganz gute Idee war.
Es war ganz allein ihre eigene Schuld, dass die Aussicht auf Kuchenpflichten ihr innerhalb von Sekunden ein Loch in den Schädel bohren und jede Vernunft hinauströpfeln lassen konnte, Unfallfantasien heraufbeschwor: Ersticken, Allergien und Übelkeiten, worauf sofort ihre Entlassung und Verelendung folgte, Obdachlosigkeit, Bettelei und Tod.
Nur ein Kuchen.
Nur die Drohung eines Kuchens.
Also denk nicht daran.
Sie sollte sich in eine andere Richtung bewegen.
Sie sollte sich eines ihrer strahlendsten, schönsten Dinge aussuchen. Einen warmen Gedanken, einen wahren.
Wir treffen uns.
Sie öffnete ihr Gartentor, ging den kurzen Weg zur Haustür und schwor sich, dafür zu sorgen, dass sie während der Wartezeit auf den zweifelhaften Bus, und dann noch etwas Unangenehmem danach, und dann auf der Arbeit – sie mochte ihre Arbeit – dass sie da dieses Versprechen bei sich halten würde, verlässlich und fest.
Ich werde dich treffen.
Angst oder keine Angst, dieser Gedanke war bei ihr – ganz tief drinnen.
Ich werde dich treffen.
Er war so gefährlich voller Hoffnung, dass sie ihn nur in kleinen Ausbrüchen denken konnte, um ihn nicht vor lauter Sorgen zu zerpflücken. Aus Angst vor der Angst und noch mehr Angst, die ihre Angst erzeugen würde. Eins plus eins macht mehr.
Ich werde dich treffen.
Doch er war bei ihr.
Ich heiße Meg, und ich hatte gerade mein einjähriges Jubiläum, und ich habe das hier dabei.
Ich werde dich treffen.
Meg hatte das beinahe sichere Gefühl, wenn jemand ihren Brustkorb öffnete und hineinsähe, würde er darin ein Licht finden. Wegen all dieser Dinge.
Es war bei ihr.
Hier ist es.
Eine Frau mittleren Alters sitzt in einem Café am Fenster. Hinter ihr ein Chaos aus Eltern und Kindern – irgendein Gruppenausflug. Mütter und Väter unterhalten sich erschöpft um eine große Ansammlung von Tischen, während ihre Schützlinge herumtoben und kreischen. Hinter dem Fenster tobt das Wetter: horizontale graue Regenschwaden, zerrupfte Blätter, die durch Rinnsteine geprügelt werden. Der Park auf der anderen Straßenseite ist ein Durcheinander von schwankendem und gepeitschtem Grün. Nur die Frau ist still. Sie starrt irgendwie abwesend durch die Scheibe, mit einem Ernst, der die Kinder fernhält, auch wenn sie sonst durch nichts aufzuhalten sind.
Die Frau nippt an einem Becher von irgendwas und wendet sich wieder den weißen Blättern auf ihrem Tisch zu – drei fast quadratische Blätter Papier mit schwarzer Handschrift darauf. Sie betrachtet das Geschriebene, und an ihrer Miene lässt sich nicht ablesen, ob es ihre Aufmerksamkeit fesselt, weil es so wundervoll oder so grauenhaft ist.
Dann lächelt sie.
Jon hatte sich leise und gesittet in Valeries Erdgeschosstoilette übergeben, alle Indizien weggespült und war dann auf der Suche nach etwas zum Wechseln die Treppe hinaufgestiegen.
Das Erbrechen hatte ihn beruhigt, wenn auch auf seltsam unpersönliche Weise.
Mein Rücken und das Hemd hinten – durch das Hemd durch – alles schweißnass.
Ich muss mich komplett umziehen.
Dem würde Val frohgemut zustimmen.
Jon war in den zweiten Stock hinaufgetappt und hatte gerade begonnen, Vals Zusatzschrank im Rosenzimmer zu durchkämmen – ihre Bezeichnung, nicht meine: verdammtes Rosenzimmer, verdammt lächerlich –, als sein Telefon klingelte. Wie zu erwarten, zuckte er zusammen.
Obwohl es gar nicht sie ist.
Obwohl sie mit meiner Neugier rechnen und sie auskosten würde – das würde ihr gefallen und sie nicht ärgern – und obwohl sie nicht mehr das Recht hat, mich anzuschreien.
Wie herrlich. Wenn ich drüber nachdenke. Diese Abwesenheit von Geschrei.
Im Augenblick war Valerie angeblich in oder in der Nähe einer Villa auf den Bahamas, wie sie es nannte, und freute sich an der exotischen Fauna des Inagua-Nationalparks. So war es ihm gesagt worden.
Sie hasst die Natur. Wahrscheinlich steht der, mit dem sie dort zusammen ist, auf Sandfliegen und Flamingos. Wird nicht lange gutgehen.
Aber vielleicht steht ihr derzeitiger Begleiter ja auch auf Geschrei. Solche Leute gibt es. Die Leute werden scharenweise von allen möglichen schädlichen Dingen angezogen, inklusive Geschrei.
Oder wenn sie sich den Schaden nicht ausgesucht haben, dann bekennen sie sich jedenfalls nachträglich dazu, als könnte das irgendwas helfen. So was kann unterschiedliche Auswirkungen auf eine Beziehung haben – letztlich kann ein Mensch der Grausamkeit vertrauen, sich der Grausamkeit vermählen, Grausamkeit geradezu ersehnen. Und wenn man das im Hinterkopf behält, kann eigentlich jeder vernünftige Mensch Zweifel haben, wenn ihm ein anderer mit scheinbar unverminderter Warmherzigkeit gegenübertritt. Dieser ursprüngliche Mensch – der erste der beiden –, dem Zweifel gekommen sind, der denkt sich vielleicht: Ja, aber bin ich denn so wunderbar? Wirklich? Oder bin ich bloß das neue Messer, über das sie ihre Pulsadern ziehen will? Hat sie das mit mir vor? Bin ich eine Waffe? Wäre ich wirklich lieber nicht …
Und – als jemand, der selbst womöglich vorhersehbare Schmerzen liebt – wäre ich nicht mit jemand Schroffem besser dran?
Und würde das nicht zu dauerhafter emotionaler Gefangenschaft führen?
Für Valerie wäre das ein Beispiel für krankhaftes Denken.
Sein Telefon hatte aufgehört zu klingeln, strahlte jedoch immer noch ein Gefühl von etwas Unerledigtem aus.
Aber warum hat Valerie mich gewählt, wenn nicht als Demütigung, als morbide Befriedigung? Ich war ein Stachel, den sie mit Wonne unerträglich finden konnte.
Er rieb sich übers Gesicht, als könnte er durch äußerliche Stimulation seines Schädels auch sein Hirn zerzausen und erfrischen. Dann fragte er sich, ob er sich nach der Bearbeitung seiner Hose gründlich genug die Hände gewaschen hatte.
Scheiße.
In jedem Sinn des Wortes.
Sein Telefon fing wieder an zu klingeln.
Und scheiße.
Und das ist hier ist nicht das verdammte Rosenzimmer, es ist das Gästezimmer-mit-der-aberwitzig-teuren-Blockdrucktapete-in-relativ-ekelhaftem-Pink. Aber das ist zu lang. Kann ich verstehen. Sie verschwendet nicht gern Worte.
Beim Schreien braucht man nicht viele Worte, das verdirbt nur die Wirkung.
Es sei denn, man lässt eine Tirade los. Manchmal ist sie über schlichtes Schreien und Kreischen hinausgegangen – hat in Tiraden geschwelgt.
Ich schreie nicht oft.
Tiraden gibt es von mir auch nicht. Nie.
Ich bin eine ganze Menge nicht.
Und was sehen sie in mir – Frauen – seit Valerie, wenn sie mich anschauen?
Genau den richtigen Beschädigungsgrad?
Eine Gelegenheit zum Schreien.
Oder bin ich es, der auf das Geschrei steht?
Wie dem auch sei, heutzutage würde Valerie nicht mich anschreien. Jetzt nicht mehr. Nicht mich, warum auch?
Das Telefon kitzelte ihn fragend in der Jackentasche – vielsagend, selbstgefällig. Sie wussten beide, am Ende würde er reagieren müssen.
Aber sie wird es nicht sein.
Wieso immer noch damit rechnen? Sie wird überhaupt nicht an mich denken – nicht, wenn sie … sie wird nicht mehr wach sein. Und wenn doch, dann aus den üblichen Gründen, und deswegen wird sie kaum an mich denken.
Nichtsdestoweniger rechnete er hauptsächlich mit ihrem Namen auf dem Display, als er nachschaute.
Nein. Sansom.
Mit Sansom wollte er nicht sprechen. Auch wenn ein so früher Anruf eine Dringlichkeit andeutete, auf die Jon reagieren sollte, wollte er lieber nicht. Er war nicht in der Stimmung.
Und frühe Anrufe hin oder her – bis er es von hier ins Büro geschafft hätte, wäre es längst nicht mehr früh genug. Es war schon nach sieben. Er musste jetzt wirklich mal ein bisschen in Schwung kommen.
Nur dass Schwung ihm gerade völlig unmöglich erschien.
Nein, Sansom.
Das Telefon belästigte ihn weiter, als er es entgegen seinen Protesten in die Sakkotasche schob. Dann verstummte es.
Als würde man ein Kätzchen ertränken.
Er lächelte und machte sich wieder an Valeries Kleiderbügeln zu schaffen, wie ein Einbrecher.
Weniger Einbrecher, eher Triebtäter.
Da seine Hose durch Vogelscheiße und dilettantisches Herumwischen an Vogelscheiße ruiniert und sein Hemd unzumutbar war, brauchte Jon tatsächlich frische Kleidung.
Er war sicher, dass er ein paar Sachen hiergelassen hatte. Dies und das. War allerdings gut möglich, dass sie die schon weggegeben hatte. Vielleicht hatte sie seine Kleidung auch im AGA-Herd verbrannt, geschreddert, ins Weltall geschossen, wer konnte das schon sagen … sie konnte gelegentlich eine prachtvolle Gehässigkeit an den Tag legen. Wirklich. Das meinte er gar nicht böse – ihre Fantasie war in vielen Bereichen sehr beeindruckend.
Meine ist mir abtrainiert worden. In vielen Bereichen.
Bis zu einem gewissen Grad.
Darum kann ich heute ganz unbefangen und ohne Ablenkung Vals Haus durchsuchen …
Sie wäre enttäuscht, wenn ich es nicht täte.
Auf den Bügeln hingen schwer ihre Wintermäntel, einige ihrer in den Ruhestand versetzten Abendkleider, Wintergarderobe, an die er sich erinnerte, und – ja! – zwei Herrenanzüge.
Von denen keiner ihm gehörte.
Zwei Herrenanzüge. Die Anzüge zweier Herren, um genau zu sein. Dieses Blau gehört verboten, und der da sieht aus, als stammte er aus dem Armenhaus – pseudoproletarischer Chic der vorletzten Jahrhundertwende. Verschone mich. Was der in der Woche an Bartwachs und anderen Produkten zur Gesichtshaarpflege ausgibt, hätte ein solcher Malocher im ganzen Jahr nicht verdient. Und ganz bestimmt hat er einen Schnauzbart, und ganz bestimmt wachst er ihn. Zwirbelt die Enden hoch, möchte ich wetten.
Hemden gab es auch. Vier … nein, fünf Hemden. Grässliche Hemden – auf zwei verschiedene Arten grässlich. Er nahm an, dass Nummer eins bis drei zum blauen Anzug und damit einem Trottel gehörten, der glaubte, in zivilisierter Gesellschaft breit geschnittene Haifischkragen tragen zu können – eher jung, arbeitet wahrscheinlich in der Finanzbranche, wie dick soll denn der Krawattenknoten werden, der dazu passt …? Und was will er damit beweisen? Meine Güte … Und dann waren da noch die zwei unerklärlichen Versuche von jemand anderem: Gar kein so schlimmer Spitzkragen, aber aus Seide und in Farben und erschlagenden Mustern, die eindeutig auf ein letztes Haschen nach Sex hinwiesen, bevor man seine Trostlosigkeit salonfähig dadurch ausdrückt, dass man die Freundinnen der zwanzigjährigen Tochter zum Tee ausführt. Noch mal meine Güte. Es ist immer traurig, wenn eine Verflossene so tief sinkt.
Verflossen … eher weitergereicht.
Trotzdem, es tut überhaupt nicht mehr weh. Es tut mir nicht weh. Glaube ich. Soweit ich feststellen kann, lauert der Schmerz nicht mehr hinten in irgendeiner Schublade auf mich oder ist nur vorübergehend betäubt. Er ist verflogen. Hat sich verzogen – mein Schmerz ist mir, wie in allen Belangen, voraus.
Er hatte im Laufe der Jahre offensichtlich eine Art Nerventod erlitten – der immer gleiche Schmerz in stetiger Wiederholung war schließlich fast ganz verschwunden, wenn man mal die Nebensymptome vernachlässigte.
Und was ich jetzt fühle, ist kein Kummer.
Eigenartig, wie einem der Kummer genommen wird, wenn es einem nicht mehr zu schaffen macht, ob er noch da ist oder nicht. Und es sich anfühlt, als würde ich einfach etwas bessere Schuhe tragen. Ich hätte mir vielleicht gar nicht so dringend gewünscht, frei zu sein, hätte ich gewusst, dass es so unspektakulär ist. Wenn wir mal annehmen, dass ich frei bin. Ich bin nicht ganz sicher. Bedeutet eine Scheidung gleichzeitig Befreiung?
Das Telefon klingelte und vibrierte an seiner Brust, was auf eine Salve von Textnachrichten und – zweifellos – E-Mails schließen ließ, höchstwahrscheinlich von Sansom. Niemand sonst dürfte Grund haben, sich bei ihm zu melden. Das Ministerium war nicht mehr oder weniger unter Druck als gewöhnlich, jedenfalls nicht in einem realen Sinne.
Und Sansom hatte sicher auch keine realen Gründe, ihn anzurufen. Sansom war selbst nicht real.
Er ist so was wie der Junggesellinnenabschied seines Berufsstandes – nicht, dass ich mich mit so was auskenne. War einmal bei einem Junggesellenabschied – zwanzig Minuten lang. Sansom ist so überzeugend wie die Dame, die plötzlich auftauchte und vergeblich vortäuschte, sie sei Polizistin, ehe sie sich entkleidete. Er ist wie ein falscher Feuerwehrmann vor dem Striptease. Ich glaube, bei den Bräuten kommen Feuerwehrleute. Ich vermute, falsche Krankenpfleger würden eher unklare Botschaften senden, was die sexuelle Orientierung und drohende Krankheiten angeht … und bei militärischen Uniformen könnte man an posttraumatische Belastungsstörung denken. Wer kann das wollen? Wäre das sexy? Keine Ahnung.
Was ich sagen kann: Sansom ist der Junggesellinnenabschied unter den Sonderberatern. Oder Junggesellen. Beides. Er ist notfalls in jede Richtung offen. Loyal wie eine Zecke.
Er schloss die Kleiderschranktüren. Dann beschloss er, eine offen stehen zu lassen – dann wüsste sie genau, dass er da gewesen war. Sie machte die Türen immer zu – Angst vor Motten.
Kein Ersatzanzug, ich muss also wieder nach Hause und mich vor der Arbeit umziehen. Kann mich nicht in so zwielichtigen Hosen sehen lassen. Wir legen zwar keinen großen Wert auf Formalitäten, aber trotzdem … Ich kann nicht weiter in einer so unseligen Hose herumlaufen, nicht mit Flecken innen am Schenkel, die auf ein schwer zu erklärendes Malheur hindeuten, Herrgott noch mal. Und mein Hemd, einfach ein Ärgernis … aber selbst wenn die Ärmel lang genug wären, könnte ich nicht das Hemd von einem kreditgeilen Kind tragen, oder einem schwanzgesteuerten Versager, oder jemandem, der sich hinter einem gewachsten Schnauzer versteckt. Das darf nicht passieren, nicht heute.
Ich kann nicht stillvergnügt das Hemd eines Mannes tragen, der mit meiner Frau geschlafen hat. Meiner Exfrau. Ich glaube, das ist keine unvernünftige Haltung.
Und dann mischte sich wieder das klingelnde Telefon ein. Jon war alt genug, sich an die Zeiten zu erinnern, als »nicht bei der Arbeit« tatsächlich nicht bei der Arbeit bedeutete.
Es war Sansom.
Das Prinzip Belohnungsaufschub kannte Sansom nicht.
Jon zog das Telefon aus der Tasche und überlegte.
Was? Was ist? Was soll ich wohl für dich tun können? Und warum?
Diese Einstellung war nicht statthaft, das musste Jon besser hinkriegen, aber der Duft von Valeries Parfüms, diese schräge Mischung unharmonischer Noten und die Drohung verflossener Gelegenheiten – all das brachte ihn aus dem Konzept.
Ich bin nicht traurig. Nicht verletzt. Ebenso klar ist, dass ich nicht erfreut bin, nicht mal zufrieden … mir ist unbehaglich, das weiß ich schon … Ist das Nostalgie …? Neuralgie …? Verstopfung …? Verspäteter Schock nach dem Kampf auf der Terrasse …?
Und da stand Sansoms Name in nervig leuchtenden Buchstaben auf dem Display.
Bitte um Entschuldigung, Mr Sansom – Andy –, dass es mir nicht gelungen ist, das hohe Leistungsniveau zu halten, nach dem wir immer streben. Ich werde gleich für Sie da sein. Im Augenblick werde ich von einer unerwünschten Erinnerung heimgesucht: der Innentemperatur vom Mund meiner Frau – Sie wissen ja, wie das ist. Gut möglich, dass Sie sogar genau wissen, wie sich das anfühlt.
Nein. Einen Sansom hätte sie nur als demonstrative Geste ausprobiert, und als Sansom seinen Posten angetreten hatte, waren sie und Jon schon fast ein Jahr über das Stadium hinaus, in dem solche Gesten nötig gewesen sein könnten.
Oder genauer gesagt: Das glaube ich jedenfalls, aber ich könnte mich irren.
Lieber Gott, ich fühle mich seltsam. Bin ich bloß müde? Ich schlafe kaum. Ich sollte also müde sein. Ende der Arbeitswoche – früh aufgestanden, um hier reinzuschauen und rechtzeitig wieder abzuhauen, weil ich abends keine Gelegenheit habe … da habe ich ja wohl ein Recht darauf, müde zu sein.
Wie er in Zimmerecken herumhing – festgebissen, sich vollfressend … Wofür ist so etwas wie ein Sansom überhaupt gut?