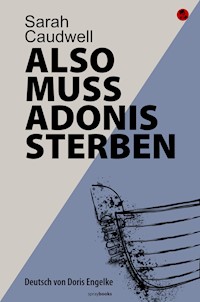
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: spraybooks
- Kategorie: Krimi
- Serie: Hilary Tamar
- Sprache: Deutsch
Fünf junge Londoner Anwälte – die schusselige und sexy Julia Larwood sowie ihre Freunde Timothy Shepherd, Desmond Ragwort, Michael Cantrip und Selena Jardine – treffen sich regelmäßig zum abendlichen Stammtisch, zu dem Professor Hilary Tamar stößt, Dozentin für Rechtsgeschichte in Oxford, die den Sommer über beruflich in London zu tun hat. Julia, Fachanwältin für Steuerrecht mit eigenen, durchaus beträchtlichen Problemen mit dem Finanzamt, reist kurzentschlossen nach Venedig, um ihren Steuersorgen zu entfliehen und erotische Bedürfnisse auszuleben. Und gerät prompt in einen komplizierten Mordfall … Die Freunde unter Leitung von Professor Tamar versuchen alles, um Julia aus dem Gefängnis zu holen. »Mein Beruf besteht vor allem darin, über die Toten Schlechtes zu sagen«, sagt Hilary Tamar über die mit wachem Verstand, nicht nachlassender Neugierde und beißendem Humor ausgeübte Nebentätigkeit als Detektiv. Oder Detektivin. Die Autorin Sarah Caudwell fand es nämlich schon Anfang der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts so nebensächlich wie dröge sich, was die geschlechtliche Identität ihrer Hauptfigur angeht, festlegen zu lassen. Und das macht ihre ohnehin spannenden und in bestem Oscar Wildschen Sinne scharfen wie intelligent witzigen Krimis um so heutiger. Jetzt, hier, in neu bearbeiteter Übersetzung, die dem Originaltext und der Hauptfigur diese zwischen den Identitäten changierende, aufregende Farbigkeit wieder zurück gibt. Mord, Lüge, Ironie und Jura sind, im richtigen Mix, eben einfach unschlagbar. You better call Hilary? Definitiv!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 358
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
„Eine köstliche Komödie.“
SAN FRANCISCO EXAMINER & CHRONICLE
„Diese Geschichte […] über eine versierte Anwältin, die in Venedig vom rechten Weg abkommt, ist eine wahre Freude. Hinweise und Indizien sind reichlich vorhanden, und wir Anwälte sollten eigentlich in der Lage sein, die Lösung des Falles sofort zu erkennen – aber können wir das wirklich? Das Buch ist ein Prachtstück!“
NEW LAW JOURNAL
„Vorhang auf für eine weitere große englische Autorin von Detektivromanen. Sarah Caudwell ist unbestritten die Beste. Ihr Können und enormes Geschick, was Komödie, rätselhafte Todesfälle, die klassische Literatur, Steuern und vor allem die englische Sprache betrifft, sind meiner nicht geringen Erfahrung nach unübertroffen.“
AMANDA CROSS
„Ein Roman so herzlich, geistreich und elegant wie der andere … Fast möchte man schwören, sie wäre der uneheliche Sprössling von P. G. Wodehouse.“
THE DENVER POST
„Wahrscheinlich der bezauberndste Kriminalroman, den ich je gelesen habe, buchstäblich ein ‚Mordsspaß‘ von Anfang bis Ende.“
ANNA AUF GOODREADS.COM
„Mit urkomischen Anmerkungen zu britischem Leben, Shakespeare und vielem mehr, neben einer berauschenden, aber auch ein wenig überraschenden Beiläufigkeit gegenüber der sexuellen Orientierung mehrere Figuren aus dem Schwulen/Bi-Spektrum sowie der Tatsache, dass Professor Hilarys Geschlecht weder enthüllt wird noch Teil der Erzählung ist, war diese Lektüre mehr als nur gut. Es war ein köstlicher Genuss.“
THEBOOKSMUGGLERS.COM
„Ein ausgesprochen witziger und komplex konstruierter Krimi.“
CLASSIC MYSTERIES, JANUAR 2017
„In hohem Maße elegant und gebildet. Eine wunderbare Prosa voller Humor.“
REX E. KLETT
»Mein Beruf besteht vor allem darin, schlecht über Tote zu reden.« So beschreibt Hilary Tamar diese mit wachem Verstand, nicht nachlassender Neugier und beißendem Humor ausgeübte Nebentätigkeit als Detektiv. Oder Detektivin.
Die Autorin Sarah Caudwell fand es nämlich schon Anfang der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts so nebensächlich wie dröge sich, was die geschlechtliche Identität ihrer Hauptfigur angeht, festzulegen. Und das macht diese ohnehin spannenden und in bestem Oscar Wildeschen Sinne scharfen wie intelligent witzigen Krimis umso aktueller.
Jetzt, hier, in neu bearbeiteter Übersetzung, die dem Originaltext und der Hauptfigur diese zwischen den Identitäten changierende, aufregende Farbigkeit wieder zurück gibt. Mord, Lüge, Ironie und Jura sind, im richtigen Mix, eben einfach unschlagbar. You better call Hilary? Definitiv!
ALSO MUSS ADONIS STERBEN
EIN HILARY TAMAR–ROMAN
SARAH CAUDWELL
ÜBERSETZT VONDORIS ENGELKE
Titel der englischen Originalausgabe »THUS WAS ADONIS MURDERED«, 1981
Copyright © 1981, 2021 by Sarah Caudwell
Copyright der deutschen Übersetzung © 2021 by Doris Engelke
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werks darf in irgendeiner Form ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
ISBN: 978-3-945684-34-4
eBook v2.0, Juni 2022
Copyright © dieser Ausgabe 2021 bei spraybooks Verlag
Redaktion: Jürgen Bürger
Korrektorat: Ute Lüers
spraybooks Verlag Bielfeldt und Bürger GbR, Remigiusstr. 20, 50999 Köln
www.spraybooks.com
VORWORT
Im Herbst 1987 erhielt ich den Anruf einer aufgeregten Lektorin. Ich sollte wahrscheinlich dazu sagen, dass ich Literaturagent bin, knapp zwei Jahre vor diesem Telefonat meine eigene Agentur gegründet und einen gewissen Ruf für gute Kriminalliteratur hatte. Meine Freundin, die Lektorin, war bekannt dafür, dass sie ziemlich gute Krimis verlegte. Sie, ein eigentlich eher ruhiger Mensch, war geradezu atemlos vor Begeisterung.
»Sarah Caudwell ist in der Stadt«, sagte sie und ihre Stimme klang nach jeder Menge Ausrufungszeichen. »Wer?«, fragte ich.
»Sarah Caudwell! Eine erstaunliche Autorin! Sie sucht einen Agenten! Ihr müsst Euch unbedingt kennenlernen!«
Seit dem Aufkommen von E-Mails und SMS leben wir in einer Welt der Ausrufungszeichen, aber die einzigen Ausrufungszeichen, die ich je von dieser Lektoren-Freundin als Reaktion bekommen habe, waren in diesem kurzen Gespräch unüberhörbar – und außerordentlich angebracht!
Ein paar Stunden später erwähnte ich einer Schriftstellerin und Freundin gegenüber (sie half mir aus in der Agentur), dass ich hoffte, bald eine Schriftstellerin namens Sarah Caudwell zu treffen, die auf der Suche nach einem Agenten war. Meiner Freundin, die im New Yorker veröffentlichte, selbst Romane schrieb und später einen berühmten New Yorker Autor heiratete, verschlug es die Sprache, als sie das hörte.
»Wirklich? Sarah Caudwell!!«
Sie kannte Sarahs Romane, ALSO MUSS ADONIS STERBEN (Thus Was Adonis Murdered) und BLITZSCHNELL IN DEN HADES (The Shortest Way to Hades) und war hingerissen. Natürlich ging ich auf der Stelle in die nächste Buchhandlung, kaufte die Bücher, verschlang sie und wurde zum neuesten Mitglied in Sarahs Fanclub. Ein oder zwei Tage später verabredeten wir uns auf einen Drink – im Algonquin Hotel. Natürlich wohnte sie dort während ihres Aufenthaltes in New York!
Das Algonquin, im Herzen von Manhattan gelegen, ist berühmt als die Heimat des Round Table, eines literarischen Zirkels von Schauspielern, Journalisten und anderen klugen Köpfen, die sich in den 1920er Jahren täglich mehrmals dort trafen. In den Achtzigern war es immer noch ein Treffpunkt von Literaten und Künstlern. William Shawn, damals Lektor des New Yorker, war berühmt dafür, dass er dort an fünf Tagen die Woche ausgiebig frühstückte. Das Algonquin hatte keine Bar im eigentlichen Sinne, oder vielmehr eine kleine, die an die Wand der großen, eigentlich recht schäbigen Lobby geschoben worden war. Hier trafen sich Intellektuelle und Künstler und genossen ihren Drink. Polstersessel und Sofas füllten den Raum, dazu herrschte ein angenehmes Stimmengewirr.
Ich weiß nicht mehr, wie ich sie erkannte (das war lange vor den Zeiten des Internets), aber da saß Sarah, eine kleine, schmale Frau mit kurzen dunklen Haaren und einem Gesicht, das so klug wie freundlich war. Auf dem Tisch neben ihr stand eine offene Flasche Chablis und nachdem ich mich vorgestellt und in einen Sessel gesetzt hatte, der im rechten Winkel zu ihrem stand, hob sie die Flasche und zog fragend eine Augenbraue hoch. Auf mein Nicken hin goss sie einen ordentlichen Schluck in das leere Glas neben dem ihren. Dann holte sie ihre Pfeife hervor (sie war eine berühmte Pfeifenraucherin), stopfte sie, zündete sie an und wir kamen ins Reden!! Wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht, tranken wir mindestens noch ein Flasche Chablis, oder vielleicht waren es auch eher zwei. Irgendwann, es war kurz vor Mitternacht und die Putzleute saugten bereits die Lobby. waren wir die letzten Gäste. Ich war eigentlich mit meinem damaligen Partner zum Abendessen verabredet und rannte zu einem öffentlichen Telefon (es gab noch keine Handys) entschuldigte mich wortreich und versicherte ihm, dass ich nicht verunglückt war.
Noch nie in meinem Leben hatte ich jedes Zeitgefühl verloren – ich bin ein nüchterner Mensch, und ein wenig reserviert. Aber von Sarah ging etwas aus, was ihr Gegenüber entspannte und öffnete und sie weckte den freudigen Gesprächspartner in mir. Anfangs sprachen wir natürlich über ihre Bücher. Wie sie auf die Idee gekommen war, wie ihr erster Roman entstanden war. Von da aus gingen wir über zu den Büchern, die wir gerade lasen, und welche wir danach lesen wollten. Wir sprachen über unsere Familien. Ihre Mutter, Jean Ross, war Christoph Isherwoods beste Freundin in Berlin gewesen, und die Figur der Sally Bowles in seinen Berliner Geschichten basiert auf ihr. (Im Laufe der Jahre erfuhr ich, dass Jean Ross auch Kritikerin und Autorin und politische Aktivistin, und während des Spanischen Bürgerkriegs Kriegsreporterin gewesen war). Sarahs Vater war Claud Cockburn, kommunistischer Journalist in England. Wir sprachen über die Universität. In Oxford hatte sie Jura studiert und eine zentrale Rolle dabei gespielt, dass Frauen zur Oxford Union zugelassen wurden, dem hoch renommierten Debattierclub. Als uns schließlich klar wurde, wie spät es war, stand Homer im Zentrum unseres Gesprächs – sie war eine unbeirrbare Anhängerin der Ilias und ich werde ein Anhänger des Odysseus sein, bis ich sterbe.
Sarah wurde meine Klientin – und eine liebe Freundin. Leider ist sie viel zu jung gestorben – im Jahr 2000 mit nur 60 Jahren. Aber sie lebt weiter in den 4 wunderbaren Romanen, die sie uns hinterlassen hat. Im Mittelpunkt ihrer Kriminalromane stehen das Liebesleben, der Witz und der juristische Scharfsinn einer Gruppe junger Rechtsanwälte, Mitglieder der Chancery Bar am Lincoln’s Inn in London, erzählt von Hilary Tamar, Oxford Professor für Rechtsgeschichte. Sarahs außerordentliche Intelligenz, Ironie und listige Lebensfreude werden Ihnen auf jeder Seite ihrer Romane begegnen.
PS: Vielleicht wird Ihnen Sarahs überraschend moderner literarischer Trick, eine der Hauptfiguren betreffend, auffallen. Ob Sie das bemerken oder nicht, wird Ihnen eine Menge verraten über Ihre Fantasie.
Barney Karpfinger im Mai 2021
Die in diesem Buch beschriebenen Charaktere und Ereignisse sind frei erfunden. Jede Ähnlichkeit mit lebenden Personen oder einem tatsächlichen Vorfall ist rein zufällig.
Für J.G.F.C.G.
statt all der Briefe, die ich Dir nicht geschrieben habe
INHALT
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
1
Der Geist der Wissenschaft verlangt, gottlob, nichts außer der Wahrheit. Nicht um des schnöden Mammons willen verfolgt er (der Geist der Wissenschaft) sie (die Wahrheit) durch das Dickicht der Unwissenheit, erhellt er die Finsternis mit dem Licht der Vernunft und zerteilt mit der scharfen Schneide des Intellekts das Dornengestrüpp des Irrtums. Er verlangt auch nicht nach öffentlicher Anerkennung und dem Beifall der Massen; den Gelehrten lässt das Geschrei des Pöbels kalt. Er gibt sich nicht einmal der Hoffnung hin, dass die wenigen guten Freunde, die seine mühselige Wahrheitssuche aus nächster Nähe miterlebt haben, den endlich errungenen Erfolg mit einigen Worten fachkundiger Anerkennung honorieren. Und das ist gut so – sie werden es nämlich nicht tun.
Wenn die Ereignisse, in die Julia Larwood im vergangenen September verwickelt wurde, nicht mit der Akribie des Gelehrten, nämlich der meinigen, untersucht worden wären – würde Julia wohl immer noch in Venedig im Gefängnis schmachten. Da man die Tat für ein Verbrechen aus Leidenschaft hielt, wäre das Urteil sicher milde ausgefallen; das britische Foreign Office hätte womöglich interveniert, die italienische Regierung sie vielleicht begnadigt. Höchstwahrscheinlich sogar. Dennoch wage ich zu behaupten, dass einzig und allein dank meiner Untersuchungen Julias Unschuld einwandfrei bewiesen wurde und sie mit makellosem Leumund nach England zurückkehren konnte.
Als Beispiel für den praktischen Nutzen wissenschaftlicher Methoden verdient die Affäre durchaus einen Bericht. Vielleicht erwartet der geneigte Leser, dass diejenigen, die dazu in der Lage waren – Bescheidenheit hindert mich daran, hier von einem Privileg zu sprechen –, meiner überzeugenden Beweisführung unmittelbar zu folgen, dass diese Leute also sich danach drängen würden, die Aufgabe selbst zu übernehmen. Wie viel wissen Sie über den Stand des Barristers? Es wäre doch zu erwarten gewesen, dass Timothy Shepherd, beflügelt durch die Verehrung, die er zweifellos für mich empfindet, freudig die Gelegenheit ergriffen hätte. Aber nein. Timothy hat gerade einen Fall, der unter das Aktiengesetz fällt und demnächst im House of Lords verhandelt wird; er ist mit seiner Arbeit seit Wochen im Rückstand und kann folglich nicht. Julias Freundin Selena Jardine, die wohl sehr verzweifelt gewesen wäre, wenn Julias Haft noch länger gedauert hätte, ist im Auftrag von Gegnern eines Straßenverbreiterungs-Projekts mit einer Planungsüberprüfung beschäftigt. Auch sie ist mit ihren Akten seit Monaten im Rückstand und kann auf keinen Fall. Dann sind da noch Michael Cantrip und Desmond Ragwort, auch sie Mitglieder derselben Kanzlei. Cantrip vertritt eine Klägerin, die sich auf ein uraltes Gewohnheitsrecht beruft, ihre Wäscheleine quer durch den Garten ihres Nachbarn zu spannen, während dieser seinerseits Ragwort mit einer Gegenklage beauftragt hat; beide glauben, dass der Fall sie mehrere Monate sowie den zuständigen Richter beim High Court mindestens für vierzehn Tage beschäftigen wird; nein, selbstverständlich können beide ebenfalls nicht.
Es bleibt mir deshalb nichts übrig, als, wenn auch widerstrebend, selbst zur Feder zu greifen. Das aber bedeutet, dass ich meine eigentliche Arbeit einstweilen zurückstelle. Also verschieben sich die Veröffentlichung von »Die Causa in den Anfängen der englischen Rechtsgeschichte« von Hilary Tamar und das Erscheinen solch lobender Kritiken wie »Professor Tamars meisterhafte Abhandlung«, »Professor Tamars bahnbrechende Analyse« und so weiter in eine noch fernere Zukunft als ohnehin schon. Aber ich bin bereit, das Opfer zu bringen. Wenn ich noch zögere, dann nur, weil meine Leserinnen und Leser womöglich den Verdacht hegen, dass mich der eitle Wunsch nach Selbstdarstellung leiten könnte. Mich einem so schmählichen Verdacht auszusetzen, hätte mich fast von dem Vorhaben Abstand nehmen lassen; aber ich habe nicht das Recht, aus persönlicher Empfindlichkeit der interessierten Öffentlichkeit eine so wichtige und lehrreiche Falldarstellung vorzuenthalten. Ich werde protokollieren, was geschah und wie es geschah. Und wenn es mir auch aus Gründen der Wahrhaftigkeit nicht möglich ist, meine eigene Leistung zu bagatellisieren, so hege ich doch die Hoffnung, dass die wahrhaft Weisen unter meinen Leserinnen und Lesern deshalb nicht schlecht von mir denken.
Ich hatte mich entschlossen, den September in London zu verbringen, da meine Studien über die »Causa« es erforderlich machten, verschiedene Dokumente im Public Record Office auszuwerten. Außerdem ist Oxford im September keine Freude.
Anfangs war ich unsicher, wo ich logieren sollte. Für ein, zwei Nächte kann ich stets auf freundliche Aufnahme in Timothys Wohnung an der Middle Temple Lane rechnen. Meine Anwesenheit für einen ganzen Monat würde seine Gastfreundschaft allerdings über Gebühr strapazieren. Der Zufall kam mir zu Hilfe, denn ein ehemaliger Kollege, inzwischen Besitzer eines Hauses und zweier Katzen in Islington, hatte sich zu einem mehrwöchigen Aufenthalt in den USA entschlossen und erst sehr spät begriffen, wie schwierig es sein würde, die Tiere dorthin mitzunehmen. Er schrieb mir einen mitleidheischenden Brief und bat mich, in seinem Hause für sie zu sorgen. Glücklich darüber, ihm helfen zu können, stimmte ich zu.
An meinem ersten Tag in London stand ich früh auf. Kurz nach zehn Uhr war ich bereits im Public Record Office, dem Staatsarchiv; ich orderte die Akten, die ich für meine Forschungen benötigte, und richtete mich an meinem Arbeitsplatz ein. Ich vertiefte mich so sehr in die Arbeit, dass ich – typisch für Gelehrte – alles um mich herum vergaß und nicht bemerkte, wie die Zeit verging. Als ich wieder zu mir kam, war es fast elf und ich war total erschöpft. Ohne eine kleine Erfrischung würde ich nicht vernünftig weiterarbeiten können.
Wer um elf Uhr morgens an einem Wochentag das Public Record Office verlässt, nach rechts in die Chancery Lane abbiegt und an den Silbergewölben vorbei das nächste Kaffeehaus ansteuert, trifft dort in der Regel auf die jüngeren Mitglieder der Kanzlei New Square Nr. 62 (falls ihre beruflichen Verpflichtungen und der Bürovorsteher dies zulassen). Sie bilden eine attraktive kleine Gruppe, und wer an keinem einzigen von ihnen Gefallen findet, hat einen merkwürdigen Geschmack. Zwischen Ragwort und Cantrip besteht eine gewisse Ähnlichkeit: gleiches Alter, gleiche Größe, beide schlank und blass. Wer den Anblick von Schönheit und Stil genießt, ist bezaubert von Ragworts edlem Profil und herbstlaubfarbenem Schopf. Im Gegensatz dazu sind Cantrips Augen und Haare von hexenhaftem Schwarz, eine Freude für alle, die einen Hauch von Verruchtheit vorziehen. Selena. Es fällt mir kein besonderes Merkmal ein, das Selena, mit ihrer durchschnittlichen Größe und Figur und dem Haar in wechselnden Blondschattierungen gegenüber anderen hübschen jungen Frauen Mitte zwanzig auszeichnet – bis sie den Mund aufmacht. Ihre Stimme ist nämlich einmalig, weich und suggestiv, sehr zum Leidwesen gegnerischer Anwälte. Aber sonst? Stellen Sie sich eine zufriedene Perserkatze vor, die gerade mit Erfolg ein Kreuzverhör geleitet hat, dann haben Sie ein Bild von Selena. Timothy schließlich, mein ehemaliger Schüler und schon zwei oder drei Jahre länger Anwalt als die anderen, ist beruflich sehr in Anspruch genommen, und war an jenem Morgen nicht zugegen. Deswegen gibt es keinen Grund, ihn zu beschreiben.
Das Gespräch pflegt sich um jene Fragen zu drehen, die einen Barrister nun einmal beschäftigen, etwa ob es in einem bestimmten Fall sinnvoller ist, Klage zu erheben oder eine Parlamentsentscheidung anzustreben, oder was mit Nordirland geschehen soll oder wer die anderen zum Kaffee einlädt.
»Skandalös«, sagte Ragwort, als ich das Café betrat. Als Objekt seiner Missbilligung kam so gut wie alles in Frage – Ragwort hat außerordentliche, ethische Grundsätze. Diesmal nahm er, wie sich herausstellte, Anstoß am Preis des Kaffees. Aber er ist ein junger Mann von vollendeten Manieren – als er mich sah, bestellte er, fast ohne Zögern, auch eine Tasse für mich.
Ich hatte befürchtet, Lincoln’s Inn während der Sommerferien verlassen vorzufinden und drückte meine Überraschung und Freude aus, weil dem nicht so war.
»Hilary«, sagte Selena, »du weißt doch bestimmt inzwischen, dass Henry uns in der Zeit, die man ironischerweise Große Ferien nennt, nie mehr als vierzehn Tage Urlaub gönnt. Cantrip und ich haben unsere zwei Wochen schon gehabt – Ragwort hebt sich seine bis zum Monatsende auf.«
Henry ist der Bürochef der Kanzlei New Square Nr. 23. Aus der Art und Weise, wie Selena und die anderen über ihn sprechen, könnten die mit dem englischen Justizwesen nicht so vertrauten Leser vermuten, dass sie seine Angestellten sind und zwar zu Bedingungen, die einer Leibeigenschaft gleichkommen. Ich möchte klarstellen, dass dem nicht so ist: Henry ist ihr Angestellter. Seine Aufgabe ist es, als Vermittler zur Außenwelt zu fungieren, Verwalter, Manager und Geschäftsführer in einer Person, ihre Leistungen anzupreisen, ihre Irrtümer zu beschönigen, ihre Honorare zu rechtfertigen und ihre Versäumnisse zu bemänteln. Als Gegenleistung bekommt er zehn Prozent ihrer Einnahmen. Er muss den besonders wohlhabenden Mandanten schmeicheln und denjenigen, die nach zwei oder mehr Jahren noch nicht gezahlt haben, vorwurfsvolle Briefe schreiben. An einem einzigen Vormittag muss er sechsmal im Brustton der Überzeugung jemandem versprechen, dass eine bestimmte Akte sofort und vorrangig bearbeitet wird. Mit Außenwelt meine ich natürlich die einfachen Anwälte, die Solicitors. Sich ohne Vermittlung eines Solicitors mit einem Mandanten zu befassen, wäre ausgeschlossen für einen Barrister.
Ich erkundigte mich, ob Timothy zu seinem Vergnügen unterwegs war. Selena und Ragwort schüttelten den Kopf.
»Er ist gekrallt worden«, sagte Cantrip.
»Gekrallt?«, wiederholte ich irritiert. Cantrip hat in Cambridge studiert – man versteht nicht immer, was er meint. »Gekrallt? Von wem? Oder, um mich des in Cambridge üblichen Idioms zu bedienen, wem von?«
»Von Henry natürlich«, antwortete Cantrip. »Der hat Tim beim Fluchtversuch erspäht und ihm die Schergen auf den Hals gehetzt. Zurück zur Zwangsarbeit.«
»Cantrip will damit sagen«, meinte Selena, »dass, als wir in die Pause gingen, Henry uns die Aushilfsschreibkraft hinterher geschickt hat, weil Timothys Anwesenheit bei einem Termin erforderlich sei. Eine renommierte Londoner Kanzlei benötigt in einer besonders dringenden Angelegenheit den Rat eines Barristers.«
»So ist es«, stellte Cantrip fest. »Während wir unseren Kaffee genießen, lauscht der Ärmste den senilen Wahnideen des Seniors der Firma Tiddley, Thingummy & Whatsit.«
»Wie du siehst, Hilary«, meinte Selena, »haben wir alle keine Ferien. Außer Julia natürlich. Die ist inzwischen wohl schon in Venedig.«
»Julia?«, rief ich einigermaßen überrascht. »Du hast sie doch hoffentlich nicht allein nach Venedig fahren lassen?«
»Bin ich Julias Hüter?«
»Allerdings«, sagte ich streng, ihre Einstellung schien mir etwas leichtfertig. Sie tut immer so, als sei Julia eine normale erwachsene Frau, die man ohne Bedenken zum Brötchenholen schicken kann; aber das ist natürlich völliger Unsinn. Die arme Julia! Sie versteht einfach nicht, was um sie herum passiert oder wieso, und auch nur die einfachsten Dinge zu lernen, die man zum Überleben braucht, überschreitet ihre Fähigkeiten. Schon während ihrer Kindheit muss klargeworden sein, dass sie als Erwachsene niemals imstande sein würde, das Leben ohne Hilfe anderer zu meistern. Sie war sicher ein nettes kleines Mädchen mit einer gewissen Begabung für lateinische Verben und Intelligenztests. Aber wozu soll sowas gut sein? Auf der Suche nach einem stillen Winkel, wo ihre Unfähigkeit nicht allzu sehr auffallen würde, ist ihre Familie klugerweise auf Lincoln’s Inn verfallen. Sie ist jetzt Mitglied der kleinen, auf Steuerrecht spezialisierten Kanzlei am New Square Nr. 63, wo sie den ganzen Tag Leute in Steuersachen berät und weiter keinen Schaden anrichtet. Aber sie nach Venedig reisen zu lassen – ich sah sie förmlich vor mir, wie sie allein durch die winkligen Gassen irrt, verstört und aufgelöst wie die Heldin einer griechischen Tragödie (so sieht sie ja schon in guten Momenten aus), und ich konnte nicht anders; ich musste Selena einfach tadeln.
»Überdies«, setzte ich hinzu, »brauchst du nicht so zu tun, als hättest du bei diesem Unternehmen keine aktive Rolle gespielt. Wenn du mir erzählen willst, dass Julia ohne Hilfe eines kompetenten Erwachsenen eine Reise gebucht, ihren Pass gefunden, ihren Koffer gepackt und es rechtzeitig zum Flugplatz geschafft hätte, so glaube ich dir kein Wort.«
Selena gab zu, dass sie bei diesem Vorhaben aktiv geworden war. Sie war mit Julia in ein Reisebüro gegangen und hatte dort an ihrer Stelle den Wunsch nach einem Urlaub in Venedig – und zwar in fünf Tagen – vorgetragen. Ich verzichtete auf die Frage, weshalb Julia sich nicht früher entschlossen hatte. Fünf Tage im Voraus zu planen ist für sie eine reife Leistung. Das Reisebüro hatte einen freien Platz in einem Pauschalangebot namens Art Lovers’ Holiday aufgetan. Auf die Frage, inwiefern sich dieses Urlaubsangebot von anderen unterscheide, hieß es, dass Ausflüge zu einigen historisch und kunsthistorisch interessanten Orten im Preis inbegriffen seien; weitere Besichtigungen konnten zusätzlich gebucht werden.
»Julia war von dieser Auskunft tief beeindruckt«, sagte Selena, »Sie schloss daraus, dass, wenn einige der Ausflüge zusätzlich gebucht werden konnten, die anderen Pflicht waren. Sie würde also den größten Teil der Zeit nicht auf sich allein gestellt sein, sondern mit einer Gruppe ehrenwerter Kunstliebhaber und einem qualifizierten Reiseleiter im Veneto herumreisen. Du siehst, Hilary, deine Sorgen und deine Schwarzseherei sind völlig unbegründet.«
»Du willst natürlich nur die positive Seite sehen«, versicherte ich. »Aber soweit ich weiß, haben Reiseleiter weder eine Zusatzausbildung als Kindermädchen noch als Aufsichtsperson für Lebensuntüchtige. Der oder die Ärmste lässt sie womöglich kurz aus den Augen, und schon verläuft sie sich. Was dann?«
»Sie fragt sich zu ihrem Hotel durch.«
»Sie hat den Namen des Hotels vergessen.«
»Sie hat den Namen auf einem Zettel bei sich.«
»Sie hat den Zettel verloren. Sie ist plötzlich allein in einer fremden Stadt. Sie wird nicht wissen, wo sie ist und was sie machen soll.«
»Genau das passiert ihr doch in London mindestens alle vierzehn Tage.«
Da ist leider etwas dran. In ihrer Heimatstadt ist Julia bis heute unfähig, den Weg von Holborn nach Covent Garden zu finden. Dennoch …
»In Venedig«, versicherte Ragwort, »kann Julia sich nicht verlaufen. Ich habe ihr meine Reiseführer geliehen, einen von Venedig und einen über die anderen Städte im Veneto, die in Frage kommen. Ich habe nur einen auf Englisch, der andere ist italienisch, aber das macht nichts. Wichtig sind die Stadtpläne darin. Übersichtliche Stadtpläne. Julia sieht sofort, wo sie ist, wo sie sein sollte, und wie sie vom einen zum anderen Ort kommt.«
Diese Leihgabe war keine bloße Gefälligkeit, sondern ein Zeichen von tiefer Freundschaft. Seit seiner Venedigreise im Frühjahr hatte Ragwort eine große Zuneigung zu der Stadt und zu allem, was mit ihr zusammenhing, gepackt. Die Reiseführer waren kostbar wie Andenken an eine Liebesgeschichte. Sie Julia zu übergeben, zumal wenn man bedenkt, wie häufig sie Dinge bekleckert …
»Ich habe sie gebeten«, warf Ragwort ein, »sorgfältig mit den Büchern umzugehen und nicht darin zu lesen, während sie Gin trinkt. Oder Kaffee. Oder Pizza mit den Fingern isst. Und ich habe die Bücher in Packpapier eingeschlagen. Eigentlich kann nichts passieren.«
»Es wird auch nichts passieren«, sagte Selena. »Und dass eines der Bücher italienisch ist, macht nichts. Julia spricht sehr gut Italienisch.«
Selenas Meinung beruht auf einem Irrtum, aber daran ist nichts zu ändern. Sie selbst weigert sich, irgendeine Fremdsprache zu lernen. Julia dagegen pflegt sich an den Küsten des Mittelmeeres zu tummeln in dem naiven Glauben, dass die Leute immer noch eine Art Latein sprechen, bei dem man nur die Endung der Wörter verschlucken und ein bisschen staccato reden muss. Diese vermeintliche Redegewandtheit führt dazu, dass Selena sie auf gemeinsamen Reisen als diejenige betrachtet, die die Landessprache beherrscht.
Ich stellte noch eine Frage, die mich beunruhigt: »Das Ganze ist doch bestimmt nicht billig. Wie kann Julia sich so etwas leisten? Soviel ich weiß, hat das Finanzamt sie bis aufs Hemd ausgezogen.«
Julias unglückliche Beziehung zur Steuerbehörde ist eine Folge davon, dass sie es in den ersten vier Jahren ihrer leidlich erfolgreichen Anwaltskarriere unterlassen hat, eine Einkommensteuererklärung abzugeben. Ich denke, dass sie im tiefsten Herzen nicht an die Existenz von Steuern geglaubt hat. Steuerrecht war für sie nur das Fach, das sie für ihre Prüfungen studiert und in dem sie anschließend eine Anzahl Mandanten beraten hat. Dementsprechend hat sie niemals geahnt, dass der Gegenstand etwas mit der Realität zu tun haben könne.
Es kam der Tag, an dem das Finanzamt Julias Existenz entdeckte und sie an die seinige erinnerte. Die Behörde hat nicht sofort Geld von ihr verlangt; zuerst hat man so unvernünftig wie unerbittlich ihre Steuererklärung gefordert. Auf diese Weise hat das Finanzamt verraten, dass es ganz und gar nicht von dem gerechten und gesetzeskonformen Wunsch, die öffentlichen Kassen zugunsten des Gemeinwohls zu füllen, beflügelt wurde. Tatsächlich wollte das Amt Julia zwingen, monatelang jeden Abend an einer alten klapprigen Schreibmaschine zu sitzen und die sie betreffenden Eintragungen aus dem Gebührenrechnungsbuch der Kanzlei abzuschreiben. Ich persönlich glaube nicht so recht, dass Alter und Reparaturbedürftigkeit der Schreibmaschine wesentliche Bestandteile der behördlichen Strategie waren. Julia aber ist davon überzeugt: Jedes Mal, wenn die Maschine hakte, wuchs ihr Groll. Und dann hat das Finanzamt für die Früchte ihres Fleißes kein einziges Wort des Dankes oder der Anerkennung gehabt, sondern stattdessen eine große Summe Geldes gefordert, mehr als sie besaß. Mehr, als sie je besessen hat, behauptet Julia, aber hier irrt sie sich wohl. Mehr, als sie je zu besitzen erhofft.
In ihrer Not wandte sie sich an ihren Bürochef. Er heißt William, ist älter als Henry und vielleicht ein bisschen weniger streng.
Seine Hilfsbereitschaft zu mobilisieren, bedurfte es nur zweier Stunden schmeichlerischen Flehens, begleitet von der feierlichen Zusicherung künftigen Fleißes. William schickte allen Anwalts- und Notarfirmen, die Julia für ihre Bemühungen noch Geld schuldeten, Gebührenrechnungen mit der Bitte um umgehende Regulierung.
Dank seiner Aktivitäten kam eine Summe zusammen, die zwar genügte, das Finanzamt zu befriedigen, aber nichts übrig ließ, wovon Julia ihr Leben hätte fristen können. Oder doch nur gerade so viel, um zu überleben. Ich verstand nicht, wie sie es sich leisten konnte, nach Venedig zu reisen.
»Die tragischen Ereignisse, auf die du dich beziehst«, meinte Selena, »spielten sich vor einigen Monaten ab. Genauer gesagt, in dem Steuerjahr, das am 5. April endete. Etwa um diese Zeit meldete sich das Finanzamt bei Julia, um sie daran zu erinnern, dass nunmehr die Steuererklärung für ein weiteres Jahr benötigt werde.«
»Und Julia war ganz schön verschnupft«, warf Cantrip ein, »denn nach ihrer Ansicht hatte sie ihre Pflicht und Schuldigkeit in puncto Abrechnung bereits getan.«
»Aber sie tröstete sich mit dem Gedanken«, fuhr Selena fort, »dass es jetzt nur um die Zahlen eines einzigen Jahres ging und daher nicht so schlimm werden konnte wie beim ersten Mal. Also setzte sie sich wieder an ihre Schreibmaschine und fabrizierte in weniger als drei Monaten ihre Steuererklärung für das abgelaufene Jahr.«
»Aber«, warf Ragwort dazwischen, »da nun bei ihrem Einkommen in der fraglichen Zeit die beträchtliche Summe zu Buche schlug, die William eingetrieben hatte, um ihre vorjährigen Steuerschulden zu bezahlen …«
»… steht sie jetzt noch tiefer in der Kreide als letztes Jahr. Inzwischen ist sie ganz verzweifelt. Für sie ist klar, dass jeder Versuch, ihre Steuern zu zahlen, nur dazu führt, dass die Forderung immer größer wird. Eine Logik, die schwer zu widerlegen ist.« Selena starrte betrübt in ihre Kaffeetasse.
»Mir ist immer noch nicht klar, wieso sie dann meint, Geld für eine Reise ausgeben zu können.«
»Stimmt«, sagte Selena, »wenn sie jetzt Urlaub macht, kann sie ihre Steuern nicht bezahlen. Aber wenn sie den Urlaub nicht macht, kann sie sie genauso wenig begleichen. Nach dem Grundsatz ›nun ist alles egal‹ hat sie sich zur Venedig-Reise entschlossen. Ich halte das für sehr vernünftig. Sie wird seelisch gestärkt und für den Lebenskampf gewappnet nach London zurückkehren.«
»Seelisch?«, wiederholte Ragwort. »Liebe Selena, wir alle wissen, was Julia in Venedig zu finden hofft, und das hat, wie ich mit Bedauern feststelle, nichts mit ihrer Seele zu tun.« Er presste die feingeschwungenen Lippen zusammen, wie um die Äußerung weiterer, unschicklicher Einzelheiten zurückzuhalten.
»Was sie will, ist ein bisschen rumflippen«, behauptete Cantrip. Dieser in Cambridge übliche Ausdruck bezeichnet, soweit ich weiß, das Streben nach erotischer Befriedigung.
»Julia hat den ganzen Sommer über schwer gearbeitet«, erklärte Selena, »und hatte wenig Gelegenheit zur Entspannung. Das bisschen harmlose Zerstreuung wird ihr hoffentlich niemand missgönnen. Meine einzige Sorge ist, dass sie ein wenig überstürzt handeln könnte. Ich habe sie daran erinnert, dass junge Männer gern glauben, man interessiere sich für sie als Mensch. Wenn man sie allzu früh merken lässt, warum man tatsächlich an ihnen interessiert ist, sind sie meist beleidigt und werden arrogant. Hoffentlich weckt jemand gleich in den ersten ein, zwei Tagen Julias Interesse, damit sie nicht meint, die Zeit sei zu kurz für eine sensible Annäherung.«
»Wieviel Zeit hat sie denn?«, fragte ich.
»Zehn Tage. Eigentlich nur acht; zwei entfallen auf die Reise. Samstag in einer Woche ist sie wieder hier.«
Nach einem Moment des Nachdenkens fügte Selena ihrer letzten Äußerung wohlweislich ein Deo volente hinzu. Was ihr dabei vorschwebte, war bestimmt eher ein kleines Malheur und nicht eine Verhaftung wegen Mordverdacht.
2
Obwohl Selena angeblich so sicher war, dass Julia nichts zustoßen werde, verriet sie sich doch während der folgenden Tage durch ein ungewöhnlich gründliches Studium der Times, und zwar speziell der Seiten, die aus Italien berichteten. Die Zeitung war plötzlich voll von Artikeln über Studentenunruhen in Bologna, Probleme des Pfirsichanbaus in der Toskana und neue Doktrinen des Vatikans und der Kommunistischen Partei Italiens. Zum Glück betrafen anscheinend weder Verbrechen noch Verkehrsunfälle, weder Unruhen noch Naturkatastrophen eine Person, deren Beschreibung auf Julia zutraf.
Neben solchen ausbleibenden Hiobsbotschaften wartete Selena auf Post. Sie hatte Julia eingeschärft, jeden Tag zu schreiben, zur Erbauung und Unterhaltung der in Lincoln’s Inn Zurückgebliebenen.
»Du hast ihr hoffentlich klargemacht«, sagte Ragwort, »dass die Briefe zum Vorlesen in einer gemischten Gruppe geeignet und die geschilderten Aktivitäten salonfähig sein müssen?«
»Nicht direkt«, antwortete Selena. »Ich habe nur gesagt, wir erhoffen uns von ihr eine phantasievolle Reihe von Verführungsversuchen. Allerdings habe ich ihr zugestanden, dass wir nicht jedes Mal einen vollen Erfolg erwarten. Im Gegenteil, wir würden das eher für mangelnde künstlerische Ausgewogenheit halten.«
Ragwort seufzte.
Ich hatte Selenas Annahme, die Briefe aus Venedig würden früher in London ankommen als Julia selbst, für reichlich optimistisch gehalten; aber glücklicherweise funktionierte die Post relativ gut. Julias erster Brief traf am Dienstag ein, und Selena, die als einzige die Handschrift entziffern konnte, las ihn uns beim Kaffee vor.
Heathrow,
Donnerstagnachmittag
Liebste Selena,
»12 Ehebrüche, 9 Flirts, 64 Fälle von Unzucht und eine kleine Vergewaltigung« hast Du von mir verlangt, um Dein Bedürfnis nach Unterhaltung zu befriedigen. Indessen wirst Du Dich gedulden müssen – das Flugzeug bietet nicht genug Platz für derlei Eskapaden. Ich fange jedoch an zu schreiben, wie ich auch fortfahren werde, nämlich in Einklang mit Deinen Instruktionen – das heißt, mit der unverzüglichen Berichterstattung all dessen, was passiert.
Da fällt mir ein, dass Deine Anweisung bei der Ausführung von Ehebrüchen, Flirts usw. zum Hemmnis werden könnte. Ich muss deshalb, was die genaue zeitliche Abfolge angeht, auf ein wenig Nachsicht hoffen – die mir von Dir als der vernünftigsten aller Frauen bestimmt gewährt wird.
Es ist etwa eineinhalb Stunden her, dass wir uns am Flugplatz verabschiedet haben. Seit Du mich verlassen hast, ist es mir nicht allzu gut ergangen: Man hat mich von einem Raum, wo es Gin gab, zu einem geschleppt, wo es keinen gibt, und von einem Ort, wo ich rauchen konnte dahin, wo ich nicht rauchen darf. Mit anderen Worten, von der Abflughalle in das Flugzeug. Sie haben mir auch den Pass abgenommen.
»Das können die doch mit Julia nicht machen«, empörte sich Selena. »Sie ist britische Staatsbürgerin.«
Und es nützt mir nichts, wenn Du jetzt sagst, Selena, dass ich die britische Staatsbürgerschaft besitze und sie das nicht mit mir machen können. Und ob sie das können! Es begann mit einer Meinungsverschiedenheit, was meinen Koffer betrifft. Ich dachte, er sei Handgepäck und ich könnte ihn bei mir behalten. Die Stewardess entschied allerdings im letzten Moment anders. Ich fügte mich der Expertin, und sie schob den Koffer auf eine Art Rutsche. Erst als er wie unwiderstehlich angesaugt im Bauch des Flugzeugs verschwand, fiel mir ein, dass sich mein Pass in der Seitentasche befand. Ich werde also meinen Pass erst wiedersehen, wenn ich mein Gepäck ausgehändigt bekomme. Und das wird, wenn meine Erinnerung an Prozeduren am Flughafen nicht täuscht, erst hinter den Schranken der Passkontrolle sein. Das Dilemma ist also vorprogrammiert.
Zu spät, ach zu spät, Selena, erinnere ich mich an Deinen (wie immer) exzellenten Ratschlag, meinen Pass grundsätzlich in der Handtasche aufzubewahren. Zusammen mit den anderen wichtigen Dokumenten wie Flugschein, Reiseschecks, dem italienischen Mini-Lexikon, Ragworts Reiseführer von Venedig und dem diesjährigen Steuergesetz. Was meinst Du, wird irgendwas davon als Beleg für meine Identität akzeptiert werden? Oder bin ich auf ewig dazu verdammt, zwischen London und Venedig hin- und herzupendeln, mit gelegentlichen, durch bürokratische Fehler bedingten Umwegen über Ankara und Bangkok?
»Ich verzichte darauf zu bemerken«, warf ich ein, »dass ich es vorhergesagt habe.«
»Der Poststempel ist von Venedig«, sagte Selena. »Wir dürfen unterstellen, dass das Steuergesetz als Passersatz akzeptiert wurde.«
Und das, möchte ich einflechten, ist die optimistische Annahme, die darauf basiert, dass wir es überhaupt nach Venedig schaffen. Die pessimistische Annahme ist die, dass das Flugzeug entführt wird. Neben mir sitzt ein Mann Anfang fünfzig, der etwas Militärisches an sich hat und durchaus der Typ für so etwas sein könnte. Seine Sonnenbräune hat er sicherlich nicht in England erworben; sein weißer Schnurrbart sträubt sich piratenmäßig; seine blauen Augen leuchten irgendwie fanatisch. Und er trägt Bermudashorts, die seine Unterschenkel unbekleidet lassen, ein Paar behaarte Greifwerkzeuge wie die Beine einer Spinne. Ein Mensch, der besagte Gliedmaßen in besagter dürftiger Verhüllung öffentlich zur Schau stellt, und das in einem Flugzeug voller Passagiere – davon einige in zartem Alter, andere vielleicht von schwacher Konstitution –, solch ein Mensch ist zu jeder Gräueltat fähig. An seinem Handgepäck ist ein Schildchen, ähnlich dem, das ich von meinem Reisebüro bekommen habe; es weist ihn – wie mich – als Art Lover aus. Aber ohne ein Minimum an ästhetischer Sensibilität kann man kein Kunstliebhaber sein. Über dieses Minimum verfügt er nicht – Beweise: vide supra. Die Schlussfolgerung lautet: Er ist ein Hochstapler.
»Kann Spinnen nicht ausstehen, das arme Kind«, stellte Cantrip fest. »Hab ich euch je erzählt …?«
»Aber ja«, bestätigte Selena, »wir kennen die Episode mit der Spinne, Cantrip, und wir möchten sie nicht noch einmal hören. Eine eklige Geschichte.«
»Ich fand die Sache eigentlich witzig«, sagte Cantrip.
»Ich hatte eher den Eindruck«, meinte Ragwort, »dass Julia sie gar nicht witzig gefunden hat.«
»Nein«, bestätigte Cantrip betrübt, »nein, das hat sie tatsächlich nicht.«
Es wird hoffentlich an keinem Punkt meines Berichts nötig werden, meine Leser mit der Schilderung der degoutanten Spinnenepisode zu belästigen. Ich möchte nur bemerken, dass jeder wie auch immer geartete erotische Kontakt zwischen Julia und Cantrip, von dem im Folgenden die Rede sein wird, vor jenem Vorfall stattgefunden haben muss. Obwohl ich um der Gerechtigkeit willen zugeben muss, dass jede Frau, die sich am 31. März eines beliebigen Jahres mit Cantrip für die Nacht zurückzieht, ohne das Datum des folgenden Tages zu bedenken – nun ja, ich schlage vor, dass wir über diese Angelegenheit den Schleier des Schweigens breiten.
Liebe Selena, was das Ausschauhalten nach potentiellen Entführern angeht, so bin ich ein bisschen misstrauisch wegen der Matrone in der mittleren Sitzreihe. Korsett wie eine Ritterrüstung, ominöse Frisur – können Locken tatsächlich eine derart eherne Symmetrie annehmen? Und kann eine Dame, die so große Ähnlichkeit mit der Briten-Königin Boadicea aufweist, frei von militärischem Ehrgeiz sein?
Es erfüllt mich mit Unbehagen, dass auch sie als Art Lover etikettiert ist. Vielleicht ist es eine Verschwörung. Vielleicht hat sich eine Bande skrupelloser Extremisten mit finsteren Absichten als kunstliebende Bildungsbürger verkleidet? Ich werde mich unauffällig umsehen, ob es noch mehr von ihnen gibt.
Ein weiteres Art Lover-Schildchen baumelt an der Schultertasche einer hübschen jungen Frau, ein paar Reihen hinter mir, auf der anderen Seite des Ganges. Ihre Haarfarbe gleicht der, die Du letztes Frühjahr getragen hast – ich glaube, sie hieß »Herbstmond«. Ihr Teint ist von jener ätherischen Blässe, bei der man sofort an Idealismus denkt. Flugzeuge werden häufig von Idealisten entführt.
Neben ihr sitzt ein junger Mann. Sie gehören anscheinend zusammen, obwohl sie wenig miteinander sprechen. Wenn das zutrifft, ist er vermutlich ebenfalls ein sogenannter Kunstfreund. Sein Gesicht hat die Form, die in der Geometrie als Trapez bezeichnet wird: ein Viereck, am Kinn breiter als an der Stirn. Sein Rumpf bildet dieselbe geometrische Figur, nur umgekehrt, nämlich breiter an den Schultern als an den Hüften. Immerhin, eine saubere, gesunde Erscheinung, auf der das Auge mit Wohlgefallen ruhen könnte. Aber er macht einen gereizten, argwöhnischen Eindruck, als sei er ständig darauf gefasst, hereingelegt zu werden.
Er fragt eben die Stewardess, wie lange wir hier noch warten müssen. Seine Miene drückt aus, dass er keine der Wahrheit entsprechende Antwort erwartet, sein Akzent verrät den Amerikaner. Amerikaner sind ebenfalls zu einem hohen Prozentsatz an Flugzeugentführungen beteiligt.
Die einzigen anderen Art Lovers, die ich ausmachen kann, sind zwei junge Männer, die ein paar Reihen vor mir sitzen. Ich hätte sie wohl gar nicht bemerkt, wäre nicht der eine von ihnen soeben auf den Mittelgang getreten, damit der andere sein Handgepäck ins Gepäckfach heben kann. (Handgepäck im Gepäckfach unterzubringen ist nicht erlaubt. Die Stewardess hat sie gerade gerügt.)
Derjenige, der das Hochheben besorgte (und, nach der Rüge, das Herunterholen), eignet sich gut dafür, denn er hat die Physis eines außergewöhnlich muskulösen Ochsen – ungefähr so wie dieser Rugbyspieler, der in Oxford in Dich verknallt war, so bieder aussah und immer mit Selbstmord drohte. Sein Gesicht, das er mir einmal kurz zugewendet hat, wirkt mit den buschigen, fast zusammengewachsenen Augenbrauen irgendwie finster und gequält. Ganz und gar nicht mein Typ.
Der andere dagegen – der, der wegen der Gepäckaktion zur Seite trat –, ist schon eher mein Fall. Sein Haar ist noch einen Ton heller als das der blonden jungen Frau. Und er ist gertenschlank. Er trägt ein bildschönes Hemd mit weiten Ärmeln aus dem Musselin, den Ragwort bisweilen bevorzugt. Ich glaube, man nennt den Stoff indische Baumwolle. Gerade stützt er sich höchst anmutig so auf die Rückenlehne, dass seine bezaubernde linke Hüfte gut zur Geltung kommt. Nur sein Gesicht habe ich noch nicht gesehen.
»Skandalös«, sagte Ragwort.
»Hat sie wenigstens abgelenkt von den Luftpiraten«, konterte Cantrip.
»Ästhetische Überlegungen«, sagte Selena, »haben die Sorge um ihre persönliche Sicherheit verdrängt. Das spricht für sie.«
»Ästhetisch, hört, hört!«, brummelte Ragwort.
Der Flugkapitän hat verkündet, dass wir demnächst starten. Er hat uns empfohlen, die Broschüre mit den Sicherheitsvorschriften zu lesen. Ich habe mir wirklich Mühe gegeben, aber das Heft enthält nur Zeichnungen, keinerlei Erläuterung. Zuerst ist da ein Bild von einer Frau, die aufrecht dasitzt, daneben ein Pfeil; dann ein Bild auf dem sie sich, den Kopf in den Händen, nach vorn beugt. Erwartet man im Katastrophenfall von mir, dass ich mich vorbeuge und meine Hände um den Kopf lege? Wenn ja, so werde ich das hinkriegen. Aber vielleicht entgeht mir eine tiefere Bedeutung? Vielleicht wollte der Künstler einen Moment der Reue darstellen – die Dame erwartet ihrem Schöpfer gegenüberzutreten. Diese Vorstellung ist weniger angenehm.
Einige Meilen über Paris.
Später.
Die Lage hat sich außerordentlich gebessert. Meine Lungen haben sich mit gesundheitsspendendem Nikotin gefüllt. Das notwendige Quantum Gin kreist in meinem Blut. Man hat mir Nahrung auf kleinen Plastiktabletts gereicht. Ich habe beschlossen, dass die Art Lovers das Flugzeug nicht entführen werden.
Zwar zeigt die blonde Frau immer noch diese durchscheinende Blässe, die ich mit Idealismus assoziiere. Ich schließe allerdings inzwischen eher auf Reisekrankheit.
Der Mann neben ihr ist vielleicht wirklich Amerikaner; aber obwohl viele Entführungen von Amerikanern begangen werden, folgt daraus nicht zwingend, dass viele Amerikaner Entführungen begehen. Der Umkehrschluss führt leicht in die Irre.
Die gepanzerte Matrone hat ihr kämpferisches Temperament bewiesen, indem sie sich bei der Stewardess über die Beköstigung beschwert hat. Sie bemängelt sowohl die Qualität wie die Quantität. Ihre Ansicht über erstere müsste sie, sollte man meinen, gleichgültig gegenüber letzterem werden – dem ist aber nicht so: Sie findet das Essen ungenießbar und verlangt eine zweite Portion!
Mein spinnenbeiniger Nachbar dagegen ist mit allem hochzufrieden. So, meint er, gefällt ihm das Leben. »Das muss man den Reisefritzen lassen«, meinte er, »sie verwöhnen einen ganz schön bei so ’ner Pauschaltour. Gutes Flugzeug, gutes Essen, genug zu trinken, dufte Puppe neben einem. Sowas gefällt doch einem Bob Linnaker.«
Das sollte wohl ein Kompliment sein.
»Das Reisebüro«, entgegnete ich mit, wie ich hoffte, Ragwort-ähnlicher Miene, »hat kein Recht, mich in ihr Pauschalangebot einzuschließen. Wenn es das behauptet hat, können Sie laut Wareneigenschaften-Gesetz Entschädigung fordern.«
Darauf brach er in dröhnendes Gelächter aus und meinte, ich sei ein helles Köpfchen. Leider ist meine Ragwort-Imitation nicht perfekt. Wenn ich wieder in London bin, muss ich rauskriegen, wie er die zusammengekniffenen Augen und die beeindruckend schmalen Lippen hinkriegt.
»Ich fürchte«, sagte Ragwort, »dass Julia respekteinflößendes Auftreten niemals lernt, egal, wie viel sie übt. Ihr Äußeres spricht dagegen.«
»Ich finde, Julia hat ein ziemlich hübsches Äußeres«, gestand Cantrip. Ein Hauch von Zärtlichkeit lässt seine schwarzen Hexenaugen sanfter erscheinen. Zweifellos erinnerte er sich an Zeiten vor der Spinnenepisode.
»Genau«, sagte Ragwort und sein Gesicht strahlte jetzt jene eiskalte Höflichkeit aus, die Julia so gut gebrauchen könnte. »Es ist das Äußere, das zu –so taktvoll wie möglich formuliert– irreführenden Rückschlüssen auf Sinnlichkeit verleitet.«
»Keinesfalls irreführend«, seufzte Cantrip, immer noch nostalgisch gestimmt.
»Äußerst irreführend«, stellte Selena fest, »für jene, die schnell solche Schlüsse ziehen.«
Was die beiden jungen Männer angeht, so kann ich Dir nichts weiter berichten – die Sitzordnung hindert mich daran, sie zu beobachten. Ich wünschte, ich könnte das Gesicht des Schlanken sehen. Das Gesicht ist für mich immer das Interessanteste. Egal, wie anmutig die Gestalt, wenn das Gesicht keinen ästhetischen Reiz hat, springt kein Funke über. Ich weiß, das ist Unsinn – Du wirst über mich lachen und sentimental finden, aber so bin ich nun mal; ich kann’s nicht ändern.
»Könnte man Julia sentimental nennen?«, fragte Ragwort, » Ausgerechnet Julia?«
»Hoffnungslos sentimental«, antwortete Selena.
Mein Nachbar hält offenbar räumliche Nähe für die Grundlage freundlichen Umgangs. Er nennt mich Liebchen. Im Gegenzug habe ich ihn kühl als Mr Linnaker angesprochen; das hat ihn nicht irritiert. Eigentlich, sagt er, ist er nicht Mister, sondern Major, obwohl er nicht darauf herumreitet, seit er ins Zivilleben zurückgekehrt ist. Egal, seine Freunde nennen ihn Bob. Das bringt mich in die Klemme: ihn Bob zu nennen wäre ein Zugeständnis, jede andere Anrede dagegen wäre unhöflich.
Inzwischen hat er auch begonnen, mein Knie zu tätscheln. Das ärgert mich ein bisschen. Ich bemühe mich ja um Toleranz gegenüber den unschuldigen Vergnügungen meiner Mitmenschen, aber schließlich ist es mein Knie. Wenn man neben jemandem im Flugzeug sitzt, gibt es leider keine Möglichkeit, unauffällig zur Seite zu rücken.
Ich könnte versuchen, das diesjährige Steuergesetz zu studieren. Das würde sicher äußerst ehrbar wirken. Irgendwann auf dieser Reise muss ich mich ohnehin damit befassen. Ich habe William versprochen, ihm mein Gutachten über die Ergänzung Nr. 7 spätestens 48 Stunden nach meiner Rückkehr abzuliefern. Nur unter der Bedingung hat er der Reise nach Venedig zugestimmt. Aber trotz seines interessanten Inhalts und eleganten Stils ist das Steuergesetz im Moment für mich ohne jeden Reiz.





























