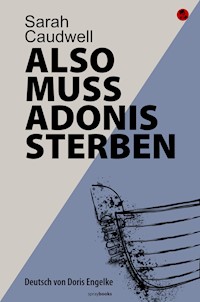6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: spraybooks
- Kategorie: Krimi
- Serie: Hilary Tamar
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Der junge Londoner Anwalt Michael Cantrip reist auf die britischen Kanalinseln, weil er dort eine wichtige Steuerangelegenheit klären soll. Die Insel Jersey ist, ähnlich Monaco, eine Steueroase, und die dort registrierten Firmen laufen unter Decknamen. Auch Cantrip untersucht einen solchen Fall, die Daffodil-Vereinbarung, einen Treuhandvertrag, der neun Millionen Pfund eingebracht hat, nur weiß leider niemand, wer der rechtmäßige Nutznießer dieser Summe ist. Die Sache entwickelt sich zu einem handfesten Skandal und lukrativen Geschäft. Edward Malvoisin, ein ebenfalls mit dem Fall beauftragter Anwalt, kommt unter verdächtigen Umständen ums Leben, und Gabrielle, eine Mitarbeiterin der Daffodil-Firmengruppe, wird von einem Unbekannten verfolgt und fürchtet um ihr Leben. Als Cantrip einem Attentat nur knapp entgeht, schaltet sich Hilary Tamar ein …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 362
Ähnliche
»Voller scharfsinnigem Witz, geschrieben in tadellos ausgewogener Prosa.«
— H. R. F. KEATING, THE TIMES
»Ein absolut köstliches Buch ... unwiderstehlich für alle, die geschliffene, gepflegte Literatur lieben. Die wunderbar cleveren jungen Anwälte, deren Missgeschicke uns in Sarah Caudwells früheren Krimis so amüsiert haben, kehren für einen weiteren großen Spaß zurück.«
— NEW YORK TIMES BOOK REVIEW
»Wahnsinn! ... Der mörderische Gesang der Sirenen ist eine absolute Lesefreude.«
— ELIZABETH PETERS
»So warm, witzig und elegant wie seine Vorgänger ... Man könnte schwören, dass sie der uneheliche Nachkomme von P. G. Woodhouse ist.«
— THE DENVER POST
»Sarah Caudwell ist unbestritten die Beste von allen. Ihre Fähigkeiten in den Bereichen Komödie, mysteriöser Tod, Recht, Klassiker, Steuern und vor allem die englische Sprache sind nach meiner nicht gerade mageren Erfahrung unübertroffen.«
— AMANDA CROSS
»Sarah Caudwell ist akribisch in ihrem Handwerk (und reiselustig) und besuchte die Kanalinseln, Monaco und die Kaimaninseln auf der Suche nach einem geeigneten Schauplatz für Der mörderische Gesang der Sirenen, das als ›eine Saga über Sex, internationale Steuerplanung und Hexerei‹ beschrieben worden ist.«
— MARTIN EDWARDS
Sarah Caudwell wurde in London geboren. Nach Abschluss eines Jurastudiums am St. Anne’s College in Oxford wurde sie an die Chancery Bar berufen und arbeitete als Barrister mehrere Jahre am Lincoln’s Inn in London. Später spezialisierte sich auf internationale Steuerplanung bei einer großen Londoner Bank und begann etwa zu dieser Zeit mit dem Schreiben.
Die Schärfe ihrer juristischen Pointen verschaffte ihr zahlreiche Bewunderer unter Juristen, während die fröhliche Wildheit ihres satirischen Stils sie zu einem Liebling der Kritiker machte. Im New York Times Book Review wurde sie dafür gelobt, dass sie „in einem Englisch schreibt, das es seit den Tagen von Oscar Wilde nicht mehr gegeben hat.“
Im Januar 2000 starb sie im Alter von 60 Jahren.
Der junge Londoner Anwalt Michael Cantrip reist auf die britischen Kanalinseln, weil er dort eine wichtige Steuerangelegenheit klären soll. Die Insel Jersey ist, ähnlich Monaco, eine Steueroase, und die dort registrierten Firmen laufen unter Decknamen. Auch Cantrip untersucht einen solchen Fall, die Daffodil-Vereinbarung, einen Treuhandvertrag, der neun Millionen Pfund eingebracht hat, nur weiß leider niemand, wer der rechtmäßige Nutznießer dieser Summe ist. Die Sache entwickelt sich zu einem handfesten Skandal und lukrativen Geschäft. Edward Malvoisin, ein ebenfalls mit dem Fall beauftragter Anwalt, kommt unter verdächtigen Umständen ums Leben, und Gabrielle, eine Mitarbeiterin der Daffodil-Firmengruppe, wird von einem Unbekannten verfolgt und fürchtet um ihr Leben.
Als Cantrip einem Attentat nur knapp entgeht, schaltet sich Hilary Tamar ein …
Weitere Fälle löst Hilary Tamar in Also muss Adonis sterben und Blitzschnell in den Hades.
DER MÖRDERISCHE GESANG DER SIRENEN
EIN HILARY TAMAR-ROMAN
SARAH CAUDWELL
ÜBERSETZT VONINGRID KRANE-MÜSCHEN
Titel der englischen Originalausgabe THE SIRENS SANG OF MURDER, 1989
Copyright © 1989, 2022 by Sarah Caudwell
Copyright der deutschen Übersetzung © 2001, 2022 by Ingrid Krane-Müschen
Auf dem Cover wird ein Ausschnitt des Fotos Old woman going home on street in Antigua von Jan Canty auf Unsplashverwendet
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werks darf in irgendeiner Form ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
ISBN: 978-3-945684-36-8
eBook v1.0, Juni 2022
Copyright © dieser Ausgabe 2022 bei spraybooks Verlag
Redaktion: Doris Engelke
Korrektorat: Ute Lüers
spraybooks Verlag Bielfeldt und Bürger GbR, Remigiusstr. 20, 50999 Köln
www.spraybooks.com
VORWORT
Im Herbst 1987 erhielt ich den Anruf einer aufgeregten Lektorin. Ich sollte wahrscheinlich dazu sagen, dass ich Literaturagent bin, knapp zwei Jahre vor diesem Telefonat meine eigene Agentur gegründet und einen gewissen Ruf für gute Kriminalliteratur hatte. Meine Freundin, die Lektorin, war bekannt dafür, dass sie ziemlich gute Krimis verlegte. Sie, ein eigentlich eher ruhiger Mensch, war geradezu atemlos vor Begeisterung.
»Sarah Caudwell ist in der Stadt«, sagte sie und ihre Stimme klang nach jeder Menge Ausrufungszeichen. »Wer?«, fragte ich.
»Sarah Caudwell! Eine erstaunliche Autorin! Sie sucht einen Agenten! Ihr müsst Euch unbedingt kennenlernen!«
Seit dem Aufkommen von E-Mails und SMS leben wir in einer Welt der Ausrufungszeichen, aber die einzigen Ausrufungszeichen, die ich je von dieser Lektoren-Freundin als Reaktion bekommen habe, waren in diesem kurzen Gespräch unüberhörbar – und außerordentlich angebracht!
Ein paar Stunden später erwähnte ich einer Schriftstellerin und Freundin gegenüber (sie half mir aus in der Agentur), dass ich hoffte, bald eine Schriftstellerin namens Sarah Caudwell zu treffen, die auf der Suche nach einem Agenten war. Meiner Freundin, die im New Yorker veröffentlichte, selbst Romane schrieb und später einen berühmten New Yorker Autor heiratete, verschlug es die Sprache, als sie das hörte.
»Wirklich? Sarah Caudwell!!«
Sie kannte Sarahs Romane, ALSO MUSS ADONIS STERBEN (Thus Was Adonis Murdered) und BLITZSCHNELL IN DEN HADES (The Shortest Way to Hades) und war hingerissen. Natürlich ging ich auf der Stelle in die nächste Buchhandlung, kaufte die Bücher, verschlang sie und wurde zum neuesten Mitglied in Sarahs Fanclub. Ein oder zwei Tage später verabredeten wir uns auf einen Drink – im Algonquin Hotel. Natürlich wohnte sie dort während ihres Aufenthaltes in New York!
Das Algonquin, im Herzen von Manhattan gelegen, ist berühmt als die Heimat des Round Table, eines literarischen Zirkels von Schauspielern, Journalisten und anderen klugen Köpfen, die sich in den 1920er Jahren täglich mehrmals dort trafen. In den Achtzigern war es immer noch ein Treffpunkt von Literaten und Künstlern. William Shawn, damals Lektor des New Yorker, war berühmt dafür, dass er dort an fünf Tagen die Woche ausgiebig frühstückte. Das Algonquin hatte keine Bar im eigentlichen Sinne, oder vielmehr eine kleine, die an die Wand der großen, eigentlich recht schäbigen Lobby geschoben worden war. Hier trafen sich Intellektuelle und Künstler und genossen ihren Drink. Polstersessel und Sofas füllten den Raum, dazu herrschte ein angenehmes Stimmengewirr.
Ich weiß nicht mehr, wie ich sie erkannte (das war lange vor den Zeiten des Internets), aber da saß Sarah, eine kleine, schmale Frau mit kurzen dunklen Haaren und einem Gesicht, das so klug wie freundlich war. Auf dem Tisch neben ihr stand eine offene Flasche Chablis und nachdem ich mich vorgestellt und in einen Sessel gesetzt hatte, der im rechten Winkel zu ihrem stand, hob sie die Flasche und zog fragend eine Augenbraue hoch. Auf mein Nicken hin goss sie einen ordentlichen Schluck in das leere Glas neben dem ihren. Dann holte sie ihre Pfeife hervor (sie war eine berühmte Pfeifenraucherin), stopfte sie, zündete sie an und wir kamen ins Reden!! Wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht, tranken wir mindestens noch ein Flasche Chablis, oder vielleicht waren es auch eher zwei. Irgendwann, es war kurz vor Mitternacht und die Putzleute saugten bereits die Lobby. waren wir die letzten Gäste. Ich war eigentlich mit meinem damaligen Partner zum Abendessen verabredet und rannte zu einem öffentlichen Telefon (es gab noch keine Handys) entschuldigte mich wortreich und versicherte ihm, dass ich nicht verunglückt war.
Noch nie in meinem Leben hatte ich jedes Zeitgefühl verloren – ich bin ein nüchterner Mensch, und ein wenig reserviert. Aber von Sarah ging etwas aus, was ihr Gegenüber entspannte und öffnete und sie weckte den freudigen Gesprächspartner in mir. Anfangs sprachen wir natürlich über ihre Bücher. Wie sie auf die Idee gekommen war, wie ihr erster Roman entstanden war. Von da aus gingen wir über zu den Büchern, die wir gerade lasen, und welche wir danach lesen wollten. Wir sprachen über unsere Familien. Ihre Mutter, Jean Ross, war Christoph Isherwoods beste Freundin in Berlin gewesen, und die Figur der Sally Bowles in seinen Berliner Geschichten basiert auf ihr. (Im Laufe der Jahre erfuhr ich, dass Jean Ross auch Kritikerin und Autorin und politische Aktivistin, und während des Spanischen Bürgerkriegs Kriegsreporterin gewesen war). Sarahs Vater war Claud Cockburn, kommunistischer Journalist in England. Wir sprachen über die Universität. In Oxford hatte sie Jura studiert und eine zentrale Rolle dabei gespielt, dass Frauen zur Oxford Union zugelassen wurden, dem hoch renommierten Debattierclub. Als uns schließlich klar wurde, wie spät es war, stand Homer im Zentrum unseres Gesprächs – sie war eine unbeirrbare Anhängerin der Ilias und ich werde ein Anhänger des Odysseus sein, bis ich sterbe.
Sarah wurde meine Klientin – und eine liebe Freundin. Leider ist sie viel zu jung gestorben – im Jahr 2000 mit nur 60 Jahren. Aber sie lebt weiter in den 4 wunderbaren Romanen, die sie uns hinterlassen hat. Im Mittelpunkt ihrer Kriminalromane stehen das Liebesleben, der Witz und der juristische Scharfsinn einer Gruppe junger Rechtsanwälte, Mitglieder der Chancery Bar am Lincoln’s Inn in London, erzählt von Hilary Tamar, Oxford Professor für Rechtsgeschichte. Sarahs außerordentliche Intelligenz, Ironie und listige Lebensfreude werden Ihnen auf jeder Seite ihrer Romane begegnen.
PS: Vielleicht wird Ihnen Sarahs überraschend moderner literarischer Trick, eine der Hauptfiguren betreffend, auffallen. Ob Sie das bemerken oder nicht, wird Ihnen eine Menge verraten über Ihre Fantasie.
Barney Karpfinger im Mai 2021
Die in diesem Buch beschriebenen Charaktere und Ereignisse sind frei erfunden. Jede Ähnlichkeit mit lebenden Personen oder einem tatsächlichen Vorfall ist rein zufällig.
Für Billee
und seine Geduld
INHALT
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
PROLOG
Der Welt der Wissenschaft steht eine schwere Enttäuschung bevor, fürchte ich. Vom Gemeinschaftsraum der Dozenten im St. George’s College, wo die Kollegen mich jeden Tag begierig fragen: »Bald fertig, Hilary?«, bis hin zu den weit entlegenen Hörsälen von Yale und Columbia, wo, wie mir erzählt wurde, die Formulierung »In Tamars bald zu erwartender Publikation« ständig zu hören ist, warten die Gelehrten voller Ungeduld und Wissensdurst auf mein seit langem angekündigtes Werk über den Begriff der Causa in der englischen Rechtsgeschichte.
Wie soll ich ihnen beibringen, dass ich mich wieder einmal vom schnurgeraden Pfad der Wissenschaft habe ablenken lassen und das, was ich meinen Lesern hier offeriere, nichts weiter ist als die Chronik dieser meiner Desertion?
Wäre es nicht vielleicht besser, von der Veröffentlichung eines Berichtes über die Daffodil-Affäre Abstand zu nehmen und die ganze Angelegenheit dem Vergessen zu übergeben? Die bloßen Fakten des Falls sind schließlich kaum von ausreichender Bedeutung, um eine Veröffentlichung zu rechtfertigen: Die hohe Sterblichkeitsrate unter den mit dem Daffodil-Vertrag betrauten Rechtsberatern; die Identität jener weiß gekleideten Gestalt, die in der Walpurgisnacht auf den Klippen gesichtet wurde; wie es dazu kam, dass Julia eines Morgens am Strand von Jersey im Abendkleid verhaftet wurde – von welch ernsthaftem Interesse oder Wert könnte es für meine Leserschaft sein, mehr über diese Angelegenheiten zu erfahren? Und dennoch: Der Fall demonstriert auf so bemerkenswerte Weise die Methoden, mit denen die Wissenschaft selbst in unbedeutenden Fragen die Irrlehre entlarven und die Wahrheit enthüllen kann, dass er vielleicht nicht nur lehrreich für die Öffentlichkeit ist, sondern auch anderen Wissenschaftlern als bitter nötige Ermutigung dienen könnte. Folglich habe ich mich trotz aller Bedenken überzeugen lassen, dass es nicht recht wäre, Ihnen diesen Bericht vorzuenthalten.
Als ich vor Ostern nach London fuhr, lag es mir fern, mich von den der Wissenschaft geziemenden Nachforschungen ablenken zu lassen. Mein einstiger Schüler, Timothy Shepherd, heute praktizierender Barrister am Kanzleigericht, war aufgrund beruflicher Verpflichtungen und seiner Arrangements für die Osterferien gezwungen, London für etwa drei Wochen zu verlassen. Er hatte mir angeboten, während dieser Zeit seine Wohnung auf der Middle Temple Lane nach Bedarf zu nutzen. Tatsächlich machten meine Recherchen gerade häufige Besuche im Public Record Office notwendig, die von Oxford aus kaum durchführbar waren, und so akzeptierte ich seine Einladung so bereitwillig wie dankbar. Natürlich bedauerte ich, dass Timothy selbst nicht anwesend sein würde, denn er war ein äußerst großzügiger Gastgeber. Doch die Freundschaft, die mich seit langem mit den anderen jungen Mitgliedern seiner Kanzlei in Nr. 62 New Square verband, versprach angenehme Gesellschaft, wann immer ich meine Arbeit unterbrechen und Zerstreuung suchen sollte.
Bei meiner Ankunft in der Hauptstadt warnte mich nichts vor den finsteren Machenschaften, in die ich schon bald verstrickt werden sollte. Die Sonne schien auf Lincoln’s Inn Fields, die Azaleen blühten in den Gärten am New Square, die Barrister, die in Perücke und Talar die Carey Street entlangeilten, debattierten über die aktuelle Frage, wer wohl dieses Jahr »die Seide« bekommen würde. Wie meinen Lesern zweifellos bekannt ist, verkündet der Lord Chancellor alljährlich am Gründonnerstag, wer aus den Reihen der Barrister in den ehrwürdigen und lukrativen Rang eines Anwalts der Krone aufsteigen soll.
Wenn meine jungen Freunde in Nr. 62 New Square nicht gerade damit beschäftigt waren, sich über die unzulänglichen Honorare zu beschweren, die ihr Bürovorsteher Henry mit ihren Auftraggebern ausgehandelt hatte, gingen sie ganz und gar unschuldigen und für Anwälte durchaus typischen Aktivitäten nach: Selena Jardine, wenn ich mich recht entsinne, war mit einem langwierigen und erbittert geführten Prozess bezüglich der Rechte der Schuldscheininhaber einer Gesellschaft des öffentlichen Rechts beschäftigt; Desmond Ragwort stellte die notwendigen Dokumente zur Übertragung des Eigentums an gewissen Ländereien im West Country zusammen; Michael Cantrip war mit diversen Rechtsstreitigkeiten vor verschiedenen Bezirksgerichten befasst. In der Steuerrechtskanzlei nebenan studierte Julia Larwood in aller Ruhe die neuesten Gesetzesvorlagen zum Finanzrecht.
Kurzum, alles verlief der Jahreszeit und der Natur der Dinge entsprechend und wich in keiner Weise von der natürlichen Ordnung der Dinge ab, wie man sie vielleicht als Ankündigung verborgener Gefahren und mysteriöser Todesfälle erwarten sollte. Zumindest erschien es mir so. Natürlich war mir nicht bewusst, wie eigenartig es war, dass Cantrip auf die Kanalinseln geschickt wurde.
1
»Nein, nein, lassen Sie mich los, oder ich schreie«, rief die hinreißende Elaine. Ihre schönen Augen füllten sich mit Tränen und ihre Brust bebte unter der dünnen Seide ihrer Bluse, während sie sich aus der widerlichen Umarmung des brutalen Bürovorstehers zu befreien suchte.
»Schrei so viel du willst, du dumme Gans«, knurrte der Bürovorsteher, sein abscheuliches Gesicht zu einem boshaften, lüsternen Grinsen verzerrt. »Hier ist niemand mehr, der dich hören könnte.«
Doch in diesem Moment erschien an der Bürotür die aristokratische Gestalt des liebenswürdigen, brillanten jungen Barristers Martin Carruthers.
»Da irren Sie sich, Toadsbreath, Sie schleimige Kröte«, sagte er mit charmanter Verachtung. »Nehmen Sie augenblicklich Ihre schmuddeligen Hände von Elaine. Sie mag nur die Aushilfssekretärin sein, aber sie ist ein zu reines und edles Geschöpf, um von Ihresgleichen berührt zu werden.«
»Mr Carruthers, Sir, ich dachte, Sie wären schon gegangen, Sir«, stammelte Toadsbreath und wand sich wie ein geprügelter Köter angesichts der Verachtung des jungen Anwalts.
Elaine betrachtete Carruthers, ihre hübschen Augen waren voller Bewunderung.
Cantrip und Julia arbeiteten gemeinsam an einem Roman, der auf ihren Erfahrungen aus dem Anwaltsleben basieren und den Titel Gericht! tragen sollte. Sie waren überzeugt, dass dieses Werk ihnen ein Vermögen einbringen würde, das selbst die habgierigsten Träume überstieg, und sie somit von der Tyrannei ihrer jeweiligen Bürovorsteher erlösen würde. Sie waren übereingekommen, dass Cantrip den Anfang verfassen sollte.
Mir war das außerordentliche Privileg zuteilgeworden, einen Blick auf die ersten Seiten zu werfen. Ich las sie beim Licht einer Kerze im Corkscrew, jener Weinbar an der Nordseite von High Holborn, die meine Freunde in Lincoln’s Inn für gewöhnlich aufsuchen, wenn der lange Arbeitstag endlich überstanden ist. Cantrip saß mir gegenüber und beobachtete mich mit der besorgten Miene, die so charakteristisch ist für den ambitionierten Schriftsteller. Ich fand, dass er zumindest äußerlich eine recht gute Vorlage für einen Romanhelden abgab: Sein schwarzes Haar und die dunklen Augen im Kontrast zu seiner blassen Haut schienen auf gewisse romantische Eigenschaften hinzudeuten, die auf den für dergleichen zugänglichen Teil der Leserschaft durchaus einen gewissen Reiz ausübten.
»Was meinst du, Hilary? Das ist ziemlich heiß, oder?«
Da mir die Empfindsamkeit der kreativen Seele sehr wohl vertraut ist, antwortete ich, dass ich es kaum erwarten könne, weiterzulesen.
»Darf ich aus deiner Bemerkung, die Handlung basiere auf Tatsachen, schließen, dass es in der Kanzlei eine neue Aushilfssekretärin gibt?«, fragte ich.
»Stimmt«, sagte Cantrip. »Sie heißt eigentlich Lilian. Ist blass und blond und strahlt eine gewisse Wehmut aus. Man könnte meinen, sie wäre eine Waise, die arbeiten gehen muss, um ihre alten Eltern über die Runden zu bringen.«
»Eine so bewegende und ungewöhnliche Zwangslage muss unweigerlich das Mitgefühl der Leser erwecken«, versicherte ich. »Und entspricht es den Tatsachen, dass du den Bürovorsteher dabei überrascht hast, wie er ihr unwillkommene Avancen macht?«
»Oh, absolut. Natürlich nicht genau so, wie ich es beschrieben habe. Man muss die Fakten ein bisschen aufpeppen, nicht wahr? Aber ich kam neulich abends ins Vorzimmer und Henry stand irgendwie über sie gebeugt und sie sagte: ›Schluss mit dem Unsinn, Henry, es kann jeden Moment jemand kommen.‹ Also hab ich ihn scharf angeguckt und gefragt, ob ich störe.«
»Und Henry hat sich gewunden?«
»Na ja, eher nicht. Er hat gesagt: Nein, ganz und gar nicht, er wolle mit Lilian auf einen Drink ins Seven Stars, und ob ich mich nicht besser meinen Schriftsätzen für die Verhandlung vor dem Willesden County Court widmen sollte. Und das«, fügte Cantrip mit Rachsucht in der Stimme hinzu, »war der Moment, da ich beschlossen habe, ihn die Schleimige Kröte zu nennen.«
Ich wünschte dem gemeinschaftlichen literarischen Vorhaben jeden denkbaren Erfolg, es erschien mir allerdings äußerst problembehaftet. Der unterschiedliche Bildungsstand – Julia hat in Oxford studiert, während Cantrip, der bedauernswerte Junge, die prägenden Jahre ohne eigenes Verschulden an der University of Cambridge verbracht hatte – musste unweigerlich zu grundsätzlich verschiedenen stilistischen Ansätzen führen. Außerdem konnte ich mir nicht vorstellen, wie sie den Schaffensprozess untereinander aufteilen wollten.
»Oh, das ist ganz einfach«, versicherte Cantrip. »Wir haben gründlich recherchiert, soll heißen, wir haben Berge von diesen Büchern gelesen, mit denen die Leute sich eine goldene Nase verdienen, und uns ist folgendes aufgefallen: Manche haben Heldinnen, die zerbrechlich und schutzbedürftig sind, etwa so wie Lilian, und andere haben Heldinnen, die eher gebieterisch sind. Zur Sicherheit wird es in unserem Buch von jeder Sorte eine geben. Ich schreibe die Elaine-Passagen und Julia die mit der gebieterischen Heldin. Sie heißt Cecilia Mainwaring und ist Steueranwältin.«
»Du meine Güte«, sagte ich, »will Julia sich selbst porträtieren?«
»Nein, nicht ganz. Cecilia ist so, wie Julia wäre, wenn sie nicht Julia wäre, falls du verstehst, was ich meine. Sie ist wahnsinnig cool und souverän und perfekt gekleidet, hat niemals Laufmaschen und kippt Kaffee über ihre Schriftsätze oder so. Oh, da kommt Julia. Sei bitte besonders nett zu ihr, sie hatte einen scheußlichen Vormittag bei Gericht.«
Auf den ersten Blick zeigte Julia keinerlei Spuren schlechter Behandlung. Ihr Haar war nicht zerzauster als gewöhnlich, ihre Kleidung nicht unordentlicher als sonst und auf dem Weg zur Bar stolperte sie nur über die übliche Anzahl von Aktenkoffern. Allerdings erstand sie mit fieberhafter Gier eine Flasche Niersteiner und sank dann mit mitleiderregender Erschöpfung auf einen Stuhl. Behutsam erkundigte ich mich, ob sie einen schwierigen Tag gehabt habe.
»Das kann man wohl sagen«, seufzte Julia. »Ganz ähnlich den Christen, die einen recht schwierigen Tag hatten, als sie im Kolosseum auf die Löwen trafen. Ich bin heute gegen die Finanzbehörde angetreten, und zwar vor dem ehrenwerten Richter Welladay.«
»Aber, aber, Julia«, beschwichtigte ich nachsichtig. »Der ehrenwerte Richter Welladay konnte dich doch nicht auffressen.«
»Das habe ich mir auch einzureden versucht, bekam allerdings diesbezüglich die größten Zweifel. Es ist eine unschwer zu verifizierende Tatsache, dass Welladay doppelt so viele Zähne hat wie sonst wer und noch dazu sind alle von enormer Größe. Dazu hat er Augenbrauen, die über der Nase zusammengewachsen sind und wirkt dadurch wie eine Bestie in einem urzeitlichen Dschungel, die nur darauf wartet, einen anzuspringen.«
Obwohl das Risiko bestand, dass ich weitaus mehr über irgendeine obskure Vorschrift des Steuerrechts erfahren würde, als ich je wissen wollte, fand ich es angebracht, mich zu erkundigen, in welcher Frage sie und der gelehrte Richter unterschiedlicher Auffassung waren. Obwohl ich die Ehre habe, Mitglied der juristischen Fakultät zu sein, gebe ich doch bereitwillig zu, dass ich eher den Historikern als den Juristen angehöre und am englischen Steuerrecht nach 1660 eher weniger interessiert bin. Doch es wäre rücksichtslos gewesen – und da sie den Wein bezahlt hatte, auch noch undankbar –, der armen Julia den Trost zu verweigern, den eine ausführliche Schilderung ihrer Leiden ihr gewiss spenden würde.
»Mein Mandant ist ein einfacher, unschuldiger Baulöwe«, begann Julia. »Er hat eine absolut legale Transaktion vorgenommen, die zufällig über eine Bank in Amsterdam und ein oder zwei Firmen auf den Niederländischen Antillen abgewickelt wurde und die zur Folge hatte, dass er keine Steuern zu zahlen brauchte. Oder besser gesagt, das wäre das Ergebnis gewesen, wäre der Fall nicht vor Richter Welladay verhandelt worden, der es als Pflicht jeden Bürgers ansieht, der Maximierung seiner Steuerpflicht oberste Priorität einzuräumen. Ebenso sieht er es auch als die Pflicht eines jeden steuerrechtlichen Beraters an, den Bürger in seinem Streben nach diesem Ziel zu unterstützen. Als ich darauf hinwies, dass das Urteil im Fall des Herzogs von Westminster Gegenteiliges aussagt und dass dieser Präzedenzfall auch für ihn bindend sei, gab er ein höchst unangenehmes Lachen von sich und fragte, ob ich noch nie von dem House of Lords-Urteil im Fall Furniss gegen Dawson gehört hätte. Ich habe den Rest des Tages damit verbracht, mit allem gebotenen Respekt darzulegen, dass die Sachlage im Fall Furniss gegen Dawson in keiner Weise mit dem hier vorliegenden Fall vergleichbar sei. Pausenlos sagte er, »Also wirklich, Miss Larwood« und »Miss Larwood, wollen Sie ernsthaft behaupten …«, und bewegte die Augenbrauen zunehmend bedrohlich. Die Frau, die du hier vor dir siehst, Hilary, ist nicht die Julia vergangener Zeiten, sondern nur noch der zermalmte Überrest, den der Auftrag gebende Solicitor schließlich vom Fußboden des Gerichtssaales abkratzen konnte.«
Ein weiterer Schluck Niersteiner schien sie wieder zu beleben.
»Doch mein ist die Rache. Der Tag ist nicht mehr fern, da der bösartige Richter Heltapay auf die stolze und unerschrockene Cecilia Mainwaring treffen wird, und dann können weder seine Zähne noch seine Augenbrauen ihn retten. Unter dem verächtlichen Blick ihrer wunderbaren Augen wird er schlichtweg vergehen, sie wird ihn als Unterdrücker der Witwen und Waisen entlarven und seine Unfähigkeit, geltenden Entscheidungen des Berufungsgerichtes zu folgen, entsprechend kommentieren.«
Ich war erleichtert, dass die Unterhaltung sich erfreulicheren Themen zuwandte. »Wenn ich recht verstanden habe, gibt es in dem Roman zwei Heldinnen, aber nur einen Helden. Werden Cecilia und Elaine um Carruthers’ Zuneigung buhlen?«
»Auf keinen Fall«, entgegnete Julia. »Cecilia gilt wegen ihres kühlen und distanzierten Auftretens als vollkommen immun gegenüber zärtlichen Gefühlen, doch insgeheim ist sie in edler, spiritueller Leidenschaft entbrannt für den hochmütigen, eleganten Dominic Ravel. Da sie jedoch fürchtet, zurückgewiesen zu werden, ist sie zu stolz, sich ihm zu offenbaren.« Mühelos erkannte ich Ragwort in Dominic Ravel. Julia allerdings hätte niemals eine solche Zurückhaltung an den Tag gelegt, wie sie sie jetzt ihrer Heldin aufbürdete.
»Ich habe nichts dagegen, wenn Dominic hochmütig und elegant ist«, sagte Cantrip beunruhigt. »Aber er darf keinesfalls liebenswürdig sein. Carruthers ist der Liebenswürdige. Ist es deutlich geworden, Hilary, dass Carruthers ein ungeheuer liebenswürdiger Bursche ist?«
Ich versicherte ihm, dass diese Eigenschaft seines Heldens in bewundernswerter Weise herausgearbeitet worden sei.
»Und wer ist der Schurke?«, fragte ich. »Toadsbreath oder Heltapay?«
»Beide«, antwortete Cantrip. »Elaine ist in Wahrheit eine reiche Erbin, verstehst du, und Heltapay ist der Nachlassverwalter ihrer Erbschaft und will das ganze Vermögen an sich bringen. Auch Toadsbreath, die Schleimige Kröte will verhindern, dass sie es bekommt; sie soll weiterhin seiner Gnade und seinen dunklen Absichten ausgeliefert sein. Also stecken die beiden unter einer Decke und wollen verhindern, dass sie von der Erbschaft erfährt. Am Ende durchkreuzen natürlich Carruthers und Cecilia ihre Pläne; Elaine bekommt ihr Vermögen und heiratet Carruthers und die beiden leben glücklich und zufrieden bis ans Ende ihrer Tage.«
Ich erkannte, dass das gemeinsame Werk wohl eher der romantischen als der realistischen Tradition genügen sollte.
»Es ist vor allem so angelegt, dass wir damit reich werden«, erklärte Cantrip. »Und das schafft man nur, wenn man die Dinge ein bisschen übertreibt.«
»Wir wollen natürlich ein möglichst breites Publikum ansprechen«, sagte Julia. »Und wir haben das Gefühl, dass die Leser, die eine aus dem Leben gegriffene Geschichte wollen, eine verschwindend kleine Minderheit sind gegenüber denen, die eine größere Portion Fiktion in ihrem Leben genießen würden.«
»Das heißt natürlich nicht, dass Mimosis uns nicht wichtig wäre«, versicherte Cantrip. »Oder heißt es Mimesis? Es basiert alles auf dem wahren Leben, also gibt es eimerweise Mimosis in diesem Roman.«
»Nur in den ganz nebensächlichen Kleinigkeiten haben wir uns Abweichungen von den Fakten erlaubt«, erklärte Julia. »Der Handlungsfaden, wonach man Elaine die ihr rechtlich zustehende Erbschaft vorenthält und unser Held ihr schließlich zu ihrem Recht verhilft, gründet vollkommen auf realen Ereignissen: Lilian hat tatsächlich etwas geerbt.«
Ich konnte meine Skepsis nicht ganz verbergen. So angenehm die Gesellschaft in Nr. 62 New Square auch sein mochte, dass eine junge Frau wie Lilian die ein beachtliches Vermögen geerbt hat, dort weiterhin als Aushilfssekretärin arbeiten sollte, erschien mir doch ein wenig unwahrscheinlich.
»Die Höhe der Erbschaft ist nur ein nebensächliches Detail«, entgegnete Julia. »Laut Testament des Erblassers, ihres Onkels, hat Lilian einen Erbanspruch auf eine Gesamtausgabe der Werke des verstorbenen Captain W. E. Jones. Die Testamentsvollstrecker, die Solicitors Stingham & Grynne, haben es aber bislang versäumt, ihr diese auszuhändigen.«
»Ich glaube nicht, dass sie sie behalten wollen«, meinte Cantrip. »Aber sind wir doch mal ehrlich: wenn man eine hochnäsige Firma wie Stingham mit der Testamentsvollstreckung beauftragt und dann stirbt und ein Vermögen von zwölfhundert Pfund hinterlässt, wird diese Angelegenheit nicht gerade als höchste Priorität betrachtet.«
»Das arme Mädchen hat zuerst Henry um Rat gefragt. Der meinte, die Sache sei es nicht wert, einen großen Wirbel zu machen. Natürlich, weil er sich bei einer der führenden Solicitor-Firmen nicht unbeliebt machen wollte. In ihrer Verzweiflung wandte sie sich schließlich an Cantrip.«
»Na ja, Verzweiflung trifft es vielleicht nicht ganz«, schränkte Cantrip ein. »Aber sie war ziemlich sauer. Lilian hatte diesen Onkel zwar seit ihrer Kindheit nicht mehr gesehen – er gehörte zu der Sorte, die auszieht, um ein Vermögen zu machen, und alle zehn Jahre mal aufkreuzt, um sich einen Fünfer zu borgen –, aber sie fand es doch furchtbar nett von ihm, dass er ihr diese Bücher vermachen wollte, und irgendwie schrecklich, dass sie sie jetzt doch nicht bekommen sollte. Die Geschichte knüpfte eine Art Band zwischen uns, denn genauso habe ich mich gefühlt, als mein Onkel Hereward mir zum vierzehnten Geburtstag ein Luftgewehr schenkte und es mir wieder weggenommen hat, nur weil ich ein paar Fensterscheiben zertrümmert habe.«
»Und du konntest ihr helfen?«, fragte ich.
»Oh, natürlich«, antwortete Cantrip. »Bei Stingham arbeitet ein Mädel namens Clemmie Derwent, eine alte Freundin von mir – wir waren zusammen in Cambridge. Also hab ich sie angerufen und gebeten, mal ein bisschen Bewegung in die Sache zu bringen, um der guten alten Zeiten willen. Jetzt kann die Herausgabe der Bücher jeden Moment geschehen. Also denkt Lilian, ich bin ein Genie, und Henry ist stinkwütend.«
»Das muss dich doch außerordentlich erfreuen«, meinte ich.
»Nun ja, in gewisser Weise schon«, sagte Cantrip mit einem zweifelnden Blick. »Das Problem ist nur, wenn Henry sauer ist, kann er einem das Leben ziemlich schwer machen. Auf einmal hat man keine Honorareingänge mehr und die einzigen Mandate, die man noch bekommt, betreffen die Vertretung von Prozesskostenhilfeempfängern vor irgendwelchen Provinzgerichten nahe der schottischen Grenze. Und jetzt hat er mir einen Strich durch die Rechnung gemacht, was den netten kleinen Urlaub angeht, den ich auf Jersey machen wollte. Clemmie Derwent will, dass ich am Freitag nach Ostern dort hinkomme, um ihre Mandanten in irgendeiner Treuhandgeschichte zu beraten, und ich soll bis zum darauffolgenden Montag bleiben. Also hab ich mir gedacht, es wäre doch naheliegend, den Rest der Woche dort am Strand zu sitzen und Sandburgen zu bauen. Aber jetzt hat Henry eine Vertretung vor dem West London County Court für Dienstagnachmittag angenommen und er sagt, er kann es sonst niemandem übertragen, also muss ich zurückkommen. Ich gehe jede Wette ein, dass er das mit Absicht gemacht hat.«
»Willst du damit sagen, dass Clementine Derwent dich in einem Fall auf Jersey hinzuzieht?«, fragte Julia neugierig.
»So ist es«, bestätigte Cantrip. »Ich habe nicht die geringste Ahnung, worum es geht.«
»Verstehe … Wie nett.« Julia sprach diese Worte mit einer Kälte aus, die meines Erachtens eine weitaus differenziertere Erklärung verdient hätten.
Ich war verwundert und konnte mir nicht vorstellen, was der Grund für ihren abrupten Stimmungswechsel sein sollte. Vielleicht hatte sie beschlossen, im Dienste der Kunst die eisige Herablassung, die ihre Heldin auszeichnete, in propria persona zu erproben? Ihr Ton war zweifellos der einer gut erzogenen englischen Dame, und sollte wohl klarstellen, dass sie eine Szene machen würde, wenn sie weniger gut erzogen oder weniger englisch wäre. Hätte ich nicht gewusst, wie lange es schon her war, dass sie und Cantrip in einem Verhältnis zueinanderstanden, das manchmal ein solches Gefühl hervorbringt, ich hätte mich des Verdachts kaum erwehren können, dass Julia eifersüchtig war.
»Sag mal, bist du sauer wegen irgendwas?«, wollte Cantrip wissen.
»Nein«, erwiderte Julia. »Natürlich nicht.«
»Doch, bist du«, widersprach er. »Worüber bist du verstimmt?«
»Mein lieber Cantrip, ich sagte bereits, dass ich keineswegs verstimmt über irgendetwas bin.«
»Also schön, und was genau ist es, worüber du nicht verstimmt bist?«
»Wenn du es genau wissen willst: Ich bin insbesondere nicht verstimmt darüber, dass Clementine Derwent dich mit einem Mandat beauftragt, das einen Fall in Jersey betrifft. Clementine hat das Recht zu beauftragen, wen sie will, und ich hoffe, ihr Mandant ist von der Originalität ihrer Wahl des Rechtsberaters ebenso beeindruckt wie ich.«
»Also jetzt mal Klartext, Larwood«, forderte Cantrip. »Was soll das heißen?«
»Angesichts unserer langjährigen Freundschaft wirst du mir hoffentlich verzeihen, wenn ich sage, dass du nicht unbedingt als Kapazität für Steuerfragen giltst.«
»Nein, natürlich nicht. Jedes Mal, wenn ich versuche, ein Steuergesetz zu lesen, wird mir ganz flau und ich muss mich hinlegen, so ähnlich wie du, wenn du ein Erste-Hilfe-Buch in der Hand hast. Aber was hat das mit meinem Trip nach Jersey zu tun? Niemand hat gesagt, dass die Sache irgendwas mit Steuern zu tun hat.«
»Mein lieber Cantrip, in Jersey hat alles mit Steuern zu tun. Das ist der alleinige Daseinszweck dieser Insel.«
»Aber nur weil es eine Steueroase ist …«
»›Offshore-Finanzzentrum‹ ist der in höflichen Kreisen bevorzugte Terminus.«
»Nur weil es ein Offshore-Dingsda ist, heißt das doch noch lange nicht, dass sie nicht auch Rechtsfälle in anderen Bereichen haben. Es gibt doch jede Menge Kühe da, oder? Vielleicht ist es ein Streit um das Eigentum an einem Kuhstall.«
»Das fiele unter die Gesetze von Jersey, soll heißen unter das altehrwürdige Gewohnheitsrecht des Herzogtums Normandie und würde somit von einheimischen Juristen auf Jersey vertreten. Englische Anwälte werden in Jersey nur dann in Anspruch genommen, wenn steuerrechtliche Gesichtspunkte von zentraler Bedeutung sind. Darum ist es üblich, verstehst du, in solchen Angelegenheiten einen Barrister zu beauftragen, der mit dem Steuerrecht eine zumindest flüchtige Bekanntschaft unterhält. In weniger origineller Stimmung würde Miss Derwent daher jemand anderen beauftragen … mich, zum Beispiel.«
Meine Verwunderung schwand. Die Kränkung einer von ihrem Liebsten verschmähten Frau ist nichts im Vergleich zu der eines Barristers, dem die Aufträge einer führenden Solicitor-Kanzlei abspenstig gemacht werden. Cantrip, der jetzt ebenfalls erkannte, wo das Problem lag, beeilte sich, Julia mit aller ihm möglichen Eloquenz zu besänftigen.
»Jetzt hör mal, Larwood, ich habe dich im Lauf der Jahre eine Menge Mist reden hören, aber das, was du dir jetzt zusammenfaselst, schlägt alles bisher Dagewesene. Schalt dein Hirn ein, um Himmels willen. Selbst wenn Clemmie plötzlich keine Lust mehr hätte, dir ihre Steuergeschichten zu übertragen, glaubst du doch wohl nicht im Ernst, dass sie sie mir geben würde, oder? Clemmie ist keine Idiotin, sie würde einen anderen Steueranwalt nehmen.«
»Das ist nicht gänzlich von der Hand zu weisen«, räumte Julia ein, schon wieder halbwegs versöhnt.
»Wahrscheinlich will Clemmie mir irgendwas grauenhaft Langweiliges aufs Auge drücken: Vielleicht soll ich in irgendeinem grässlichen Büro zweihundert Ordner mit Korrespondenz durchforsten oder was weiß denn ich. Sehen wir den Dingen ins Auge: Ich schulde ihr einen Gefallen, weil sie mir in Lilians Sache geholfen hat, und wenn ein Solicitor, dem du einen Gefallen schuldest, dich vier Tage nach Jersey schickt, muss die Sache einen Haken haben. Gegen die Insel an sich ist doch nichts einzuwenden, oder? Ich muss doch nicht diese komische Sprache lernen, die es da gibt?«
Julia versicherte ihm, dass es nicht nötig sei, sich das einheimische Patois der Insel anzueignen und dass es dort auch sonst nichts Nachteiliges gäbe. Vielmehr sprach sie mit solchem Enthusiasmus von goldenen Stränden und pittoresken Tälern, von imposanten Burgen und schmucken Gutshäusern, von vielfältigen Milchprodukten, steuerfreien Alkoholika und Zigaretten, dass man meinen konnte, es handele sich um das Paradies auf Erden.
»Außer du fürchtest dich vor Hexen.«
»Sag bloß, da gibt es wirklich Hexen?«, fragte Cantrip.
»Oh, aber sicher. Ich bin Expertin auf diesem Gebiet, mich hat einmal dichter Nebel vier Stunden lang auf dem Flughafen von Jersey festgehalten, und ich hatte nichts zu lesen dabei, nur ein Buch über Hexen auf den Kanalinseln. In längst vergangenen Zeiten, so versicherten die gut unterrichteten Autoren glaubhaft, war Jersey das Zentrum eines Kults zu Ehren Demeters und Persephones, ähnlich jenem Kult auf der Insel Samothraki in der Ägäis. Wir dürfen davon ausgehen, dass dort auch Hekate gehuldigt wurde, der Königin der Hexen, die mit diesen beiden Göttinnen eng verbunden ist, als drittes Mitglied der verehrten Triade aus Jungfrau, reifer Frau und alter Gevatterin. Die Priesterinnen dieses Kults beherrschten, so heißt es, mit ihren Gesängen den Wind und das Meer, sodass Seefahrer auf dem Weg nach Le Hocq gut beraten waren, ihnen den geforderten Tribut zu zollen. Ähnliche Kräfte wurden im Volksglauben späterer Epochen den Hexen von Jersey nachgesagt.«
»Ich wollte sowieso hinfliegen«, erklärte Cantrip.
»Ein oder zwei Geschichten deuten darauf hin, dass die Hexen ihr Interesse nicht immer ausschließlich auf die Seefahrer beschränken. Du solltest dich bemühen, nie nach Einbruch der Dunkelheit in die Nähe von Roqueberg Point in der Gemeinde Saint Clement am südöstlichen Zipfel der Insel zu sein. Dort, so wird erzählt, versammeln sie sich im Mondlicht, um zu singen, zu tanzen und junge Männer ins Verderben zu locken.«
»Um welche Art von Verderben handelt es sich?«
»Diesbezüglich legen die Experten sich nicht fest, aber es wäre unklug anzunehmen, dass es eine besonders angenehme Form von Verderben ist. Du solltest außerdem daran denken, dass die Hexen, genau wie die Göttin Demeter selbst, sich in schöne junge Frauen oder hässliche alte Vetteln verwandeln können. Ich möchte deine Freude an der Reise nach Jersey keinesfalls trüben, mein lieber Cantrip, aber ich muss dir raten, dich zu deiner eigenen Sicherheit von jungen Mädchen, reifen Frauen und alten Gevatterinnen fernzuhalten.«
2
Ragwort befürchtete das Schlimmste.
Am Abend vor Cantrips Aufbruch saß ich wieder mit Julia im Corkscrew, am selben kerzenbeleuchteten Tisch, von Schatten umspielt. Cantrips Abwesenheit wurde durch Selenas und Ragworts Gegenwart wettgemacht. Selena, die die letzten Tage auf dem Solent gesegelt war, wirkte vergnügt, beinah übermütig – die Abenteuerlust leuchtete noch in ihren Augen, das Sonnenlicht schimmerte noch in ihrem Haar. Ragwort hingegen zeigte eine so finstere, geradezu versteinerte Miene, dass er an die Marmorstatue eines Heiligen erinnerte, der unter Domitian zum Märtyrer geworden war.
Trotz allergrößter Bemühungen, ein schickliches, akzeptables Motiv für Miss Derwents Wunsch bezüglich Cantrips Anwesenheit auf Jersey zu erkennen, hatte er keines finden können. Mit äußerstem Unbehagen und Missfallen hatte er sich daher gezwungen gesehen anzunehmen, dass die Motive unschicklicher Natur waren. Er hielt es nicht für angebracht, deutlicher zu werden.
»Ich dachte, Clemmie Derwent ist verlobt«, sagte Selena. »Mit einem Solicitor.«
»Der Ansicht war ich auch«, stimmte Ragwort zu. »Aber ihr Verlobter arbeitet meines Wissens für sechs Monate in Hongkong, und sie wirkt nicht wie eine junge Dame von asketischem Temperament.«
»Nein, irgendwie nicht«, pflichtete ihm Julia bei. »Sie vermittelt eher den Eindruck von unverwüstlicher Vitalität und gesundem Appetit, wie jemand aus einer Reklame für Cornflakes. Dass sie bereitwillig sechs Monate lang auf die Freuden des Fleisches verzichtet, kann ich mir kaum vorstellen.«
»Du bestätigst meine Befürchtungen«, sagte Ragwort.
»Eine junge Frau in Clementines Situation würde zweifellos annehmen, dass es zwei Sorten Männer gibt«, fuhr Julia fort. »Da gibt es die, zu denen beispielsweise du zählst, mein lieber Ragwort, denen man nichts Minderes offerieren kann als lebenslange Hingabe und tiefgründige spirituelle Zuneigung, beinah unbefleckt von aller vulgären Fleischlichkeit. Ein Auge auf einen jungen Mann dieser Sorte zu werfen ist Clementine durch ihre bestehende Bindung offensichtlich verwehrt. Andererseits gibt es aber auch junge Männer, die sich eventuell mit etwas weniger zufrieden geben. Junge Männer von entgegenkommendem Gemüt. Und ich denke, es ist allgemein bekannt, dass Cantrip eher zu letzteren zählt.«
»Was für ein abscheulicher Gedanke, dass ein Kollege aus der eigenen Kanzlei die niederen Triebe einer Frau befriedigen könnte, der es gerade zufällig an einem Ehemann oder Verlobten mangelt. Da ich jedoch weiß, dass dies der Fall ist, müssen wir, fürchte ich, davon ausgehen, dass Miss Derwent die Situation auszunutzen gedenkt.«
Selena war nicht überzeugt. Auch wenn sie wusste, dass eine Reihe intelligenter und scharfsichtiger Frauen Cantrip gelegentlich attraktiv gefunden hatten – an dieser Stelle warf sie Julia einen strengen Blick zu –, sah sie keinen Grund zu der Annahme, dass er das Objekt allgemeiner Begierde, oder genauer gesagt, Clementine Derwents Objekt der Begierde sein könnte.
So gerne Ragwort sich ihrer Meinung angeschlossen hätte, es war ihm unmöglich. Selena habe wohl die scheußliche Episode vor etwa achtzehn Monaten vergessen, als Cantrip Miss Derwent von einer Party nach Hause begleitet hatte.
Da ich nichts von diesem Vorfall wusste, bat ich um Einzelheiten.
»Clementine war beunruhigt über die zunehmende Kriminalität in Central London und hatte daher vernünftigerweise einen Kurs in den Künsten der Selbstverteidigung belegt«, erklärte Selena. »Sie war erpicht darauf, das Gelernte in die Praxis umzusetzen. Daher wettete sie mit Cantrip, dass sie ihre Tugend selbst gegen den entschlossensten und hartnäckigsten Angreifer verteidigen könnte.«
»So lautete angeblich die vertragliche Vereinbarung«, fuhr Ragwort fort. »Ich fürchte aber, dass es um den äußerst anstößigen Erwerb einer Dienstleistung der allerpersönlichsten Art für die Summe von fünf Pfund ging, eine Summe, die selbst Cantrip als demütigend gering erachten würde.«
»Aber wenn der Vertrag wirklich so lautete, dann muss Clementine ihre Fertigkeiten unterschätzt haben«, sagte Julia. »Sie hat den armen Cantrip glatt k.o. geschlagen. Als er wieder zu sich kam, hatte er jegliches Interesse an der geplanten Notzucht verloren. Fairerweise muss man allerdings anmerken, dass Clementine sich weitaus besser benahm, als Solicitors es sonst in finanziellen Angelegenheiten Barristern gegenüber tun: Von ihrem Gewinn lud sie Cantrip zum Mittagessen ein.«
»Und sollte sie Cantrip Avancen machen, die nicht willkommen sind, kann er immer noch nein sagen«, meinte Selena. Eine Aufwärtsbewegung von Julias Augenbrauen und eine Abwärtsbewegung von Ragworts Mundwinkeln kündeten von beider Unglauben, dass Cantrip dieses Wort über die Lippen bringen könnte. »Na ja, vielleicht doch nicht. Aber selbst, wenn er es nicht kann, scheint mir das kein Anlass zu übertriebener Sorge zu sein.«
»Nun mal langsam«, widersprach Ragwort. »Meine liebe Selena, bedenke, was du sagst. Übertriebene Sorge? Jeder Versuch eines Barristers, sich der Sympathien eines Solicitors zu versichern, sei es mit Geschenken, Gastfreundschaft oder Vergünstigungen anderer Art, ist ein eklatanter Verstoß gegen den Verhaltenskodex unseres Standes. Und selbst wenn man es vor dem Disziplinarausschuss der Anwaltskammer verbergen kann, können wir wohl kaum hoffen – auch wenn natürlich jeder von uns die Angelegenheit nur unter dem striktesten Siegel der Verschwiegenheit erwähnen würde –, dass man es ganz und gar geheim halten könnte. In Lincoln’s Inn wird so furchtbar getratscht. Sollte der arme Cantrip es in Zukunft zu beruflichem Erfolg bringen, werden böse Zungen immer behaupten, dass er ihn nur der Bereitwilligkeit verdankt, mit der er seinen auftraggebenden Solicitors auf unangemessener Weise willfährig war.«
Selena blieb gelassen. Wenn wir uns überhaupt um etwas sorgen sollten, meinte sie, dann sei es die unwahrscheinliche Möglichkeit, dass Clementine Cantrips Anwesenheit auf Jersey deshalb wünsche, weil sie irrigerweise meinte, dass er sich mit Steuerrecht auskenne. Was solle er nur tun, wenn die Mandantschaft ihn bat, sie bezüglich des § 478 des Steuergesetzes zu beraten oder ein Doppelbesteuerungsabkommen auszulegen?
»Für diese Eventualitäten haben wir eine Vereinbarung«, sagte Julia. »Er trifft sich morgen mit den Mandanten, um zu erfahren, wo das Problem liegt, und soll ihnen am Montag eine Antwort präsentieren. Sollte das Ganze auch steuerrechtliche Aspekte haben, schickt er mir am Samstag ein Telex und ich berate ihn, so gut ich kann.«
Selena wirkte zum ersten Mal etwas beunruhigt. »Glaubst du denn, dass Cantrip freien Zugang zu einem Telexgerät haben wird?«
»Aber natürlich«, gab Julia zurück. »Ein Offshore-Finanzzentrum wie Jersey ist natürlich mit dergleichen ausgestattet. Ich habe ihm geraten, die Leute im Hotel darauf vorzubereiten, dass er vielleicht wichtige Nachrichten per Telex versenden muss, wenn die Bürokraft des Hotels schon Feierabend hat. Wenn er sie selbst schickt, hat man bestimmt nichts dagegen.«
»Ach du meine Güte«, seufzte Selena. »Du weißt doch, Julia, welche Wirkung ein Telexgerät auf Cantrip hat, nicht wahr?«
Der Antrag auf Anschaffung eines Telexgerätes für die Kanzlei in Nr. 62 New Square war nach langen Monaten der Debatten, Verhandlungen und Intrigen seitens der Befürworter und Gegner im vergangenen Januar endgültig abgeschmettert worden. Zumindest wurde das allgemein angenommen. Selena gehörte zu den entschlossensten Anhängern dieser neuen Technologie und dank ihrer wie üblich geschickten Argumentation schien die pro-Telex-Partei das Rennen zu machen. Bis Basil Ptarmigan, der erfahrenste, eloquenteste und teuerste Seidenträger der Kanzlei, begann – nun, er begann eigentlich keine Ansprache an die Versammelten, sondern dachte vielmehr halblaut und mit honigsüßer Stimme darüber nach, dass Veränderungen nicht zwangsläufig Verbesserungen bedeuteten.
Es wurde oft behauptet (überlegte Basil weiter), dass man mit der Zeit gehen müsse. Aber wäre es nicht vielleicht weise, vorher festzustellen, in welche Richtung die Zeit sich bewegte? Man habe ihm erklärt, ein Telexgerät sei das Neueste auf dem Gebiet moderner Technologie, aber sie seien doch wohl nicht so kindisch, sich allein aus diesem Grund zu einer solchen Anschaffung hinreißen zu lassen. Man habe ihm dargelegt, dass »alle anderen« ein Telexgerät besäßen – ein Ausdruck, der sich offenbar auf die Steuerkanzlei nebenan beziehe, doch er glaube mit Fug und Recht behaupten zu können, dass man auch ohne die Segnungen einer solchen Maschine einen ebenso großen und internationalen Mandantenstamm betreuen könnte. Man habe ihm darüber hinaus erklärt, Mandanten würden heutzutage erwarten, dass ihre Anwälte über ein Telex verfügten. Vielleicht werde eine Zeit kommen, da Mandanten im Wartezimmer Coca-Cola-Automaten und Computerspiele zu ihrer Erfrischung und Zerstreuung fordern und es sei durchaus möglich, dass die Kanzlei sich ihren Wünschen dann beugen müsse. Er jedoch könne nur hoffen, dass dieser Tag in ferner Zukunft und erst nach seinem Eintritt in den Ruhestand komme.
Die pro-Telex-Partei seufzte und akzeptierte ihre Niederlage widerspruchslos. Es wurde vereinbart, dass eine endgültige Entscheidung auf einen späteren, ungewissen und vermutlich unendlich fernen Zeitpunkt vertagt werden sollte.
Im Monat darauf erhielt Basil zu nachtschlafender Zeit mehrere Anrufe von einem ehrwürdigen amerikanischen Notar, mit dem er in einem eminent wichtigen Fall zusammenarbeitete. Dieser Mann war offenbar unfähig, die Zeitverschiebung zwischen London und New York zu begreifen, und glaubte deshalb, in Anbetracht fehlender Telexverbindungen sei dies die einzig verlässliche Möglichkeit der Kommunikation. (Selena, meine Hauptinformantin in dieser Angelegenheit, hatte all dies nicht von Basil erfahren, sondern von dem New Yorker Notar, der, so erklärte sie in aller Unschuld und Aufrichtigkeit, zufällig ein alter Freund von ihr war.)