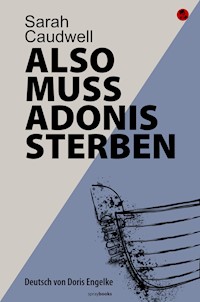6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: spraybooks
- Kategorie: Krimi
- Serie: Hilary Tamar
- Sprache: Deutsch
Hilary Tamar, mit einer Professur für Rechtsgeschichte in Oxford, reist nach London, um dort Freunde zu besuchen. Die junge Anwältin Julia wurde gerade von ihrer Tante Regina, die im idyllischen Dorf Parsons Haver lebt, um Rat in Steuerangelegenheiten gebeten: Sie hat, gemeinsam mit einigen Freunden, bei ihren Börsenspekulationen ein glückliches Händchen bewiesen – beinahe ein bisschen zu glücklich. Denn schon bald stellt sich heraus, dass die Erfolgsaktien in einen Fall von Insiderhandel verwickelt sind, der gerade Julias Freundin Selena einiges Kopfzerbrechen bereitet. Hauptverdächtige sind die beiden stellvertretenden Direktoren einer Londoner Bank. In Parsons Haver ereignet sich derweil ein seltsamer Todesfall: Die erst kürzlich zugezogene Wahrsagerin Isabella del Comino ist unerwartet verstorben. Musste Isabella sterben, weil sie tatsächlich etwas vorausgesehen hatte? Gerade, als Hilary Tamar und die Anwaltsfreunde eine heiße Spur zu haben glauben, gibt es schon die nächste Leiche im einst so friedlichen Parsons Haver … Weitere Fälle löst Hilary Tamar in Also muss Adonis sterben, Blitzschnell in den Hades und Der mörderische Gesang der Sirenen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 440
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
»Voller scharfsinnigem Witz geschrieben in tadellos ausgewogener Prosa.«
— H. R. F. KEATING, THE TIMES
»Caudwell in Bestform – furchtbar britisch, weltgewandt und kess, mit einem Sinn für Komik, den Fans von Barbara Pym zu schätzen wissen werden ... Caudwells […] Sinn für Humor [ist] so trocken wie der Sancerre, den ihre Figuren so gern trinken.«
– ROCKY MOUNTAIN NEWS
»Jeder, der raffinierte Krimi-Plots schätzt, wird die von Caudwell zu schätzen wissen. ... Sie deckt die gesamten Bandbreite des Humors ab, vom Epigramm bis zum Slapstick, und kombiniert oft beides in einem einzigen urkomischen Moment.«
– NEWSDAY
»Caudwell entwaffnet mit lapidarer Prosa, einem verwickelten Plot und ausgesprochen witzigen Figuren.«
– BOOKLIST
»Sarah Caudwells witziger und ausgefeilter Stil hat unter Kritiker*innen, Fans und Schriftsteller-Kolleg*innen eine fast kultische Anhängerschaft gefunden. ... [Sie ist] eine der allerbesten Stilisten im Krimi-Genre. Sauber, elegant, aufmerksam und geistreich – Caudwells Prosa hat nur wenig Konkurrenz im heutigen Krimi-Genre."
– WASHINGTON POST
»Orakel aus dem Grab ist ein hervorragend konstruierter Roman. Er ist skurril und boshaft-komisch, aber auch ergreifend. Vor allem jedoch hält er, wie jeder gute Krimi, den Leser bis zum Schluss in Atem.«
– EIN LESER
"Wunderbar ... Caudwells erstes Buch, Also muss Adonis sterben, wurde zu einem der hundert beliebtesten Krimis des Jahrhunderts gekürt, und [Orakel aus dem Grab] ist genauso gut, wenn nicht besser."
»Ein irrer Spaß.«
– THE SEATTLE TIMES
»Sarah Caudwell ist unbestritten die Beste von allen. Ihre Fähigkeiten in den Bereichen Komödie, mysteriöser Tod, Recht, Klassiker, Steuern und vor allem die englische Sprache sind nach meiner nicht gerade geringen Erfahrung unübertroffen.«
— AMANDA CROSS
Sarah Caudwell wurde in London geboren. Nach Abschluss ihres Jurastudiums am St. Anne’s College in Oxford wurde sie an die Chancery Bar berufen. Später arbeitete sie mehrere Jahre als Juristin am Lincoln’s Inn in London; danach trat sie in die Rechtsabteilung einer großen Londoner Bank ein, wo sie sich auf internationale Steuerplanung spezialisierte.
Die Schärfe ihrer juristischen Pointen verschaffte ihr zahlreiche Bewunderer unter Juristen, während die fröhliche Wildheit ihres satirischen Stils sie zu einem Liebling der Kritiker machte. Im New York Times Book Review wurde sie dafür gelobt, dass sie „in einem Englisch schreibt, das es seit den Tagen von Oscar Wilde nicht mehr gegeben hat.“
Im Januar 2000 starb sie im Alter von 60 Jahren.
Hilary Tamar, mit einer Professur für Rechtsgeschichte in Oxford, reist nach London, um dort Freunde zu besuchen. Die junge Anwältin Julia wurde gerade von ihrer Tante Regina, die im idyllischen Dorf Parsons Haver lebt, um Rat in Steuerangelegenheiten gebeten: Sie hat, gemeinsam mit einigen Freunden, bei ihren Börsenspekulationen ein glückliches Händchen bewiesen – beinahe ein bisschen zu glücklich. Denn schon bald stellt sich heraus, dass die Erfolgsaktien in einen Fall von Insiderhandel verwickelt sind, der gerade Julias Freundin Selena einiges Kopfzerbrechen bereitet. Hauptverdächtige sind die beiden stellvertretenden Direktoren einer Londoner Bank. In Parsons Haver ereignet sich derweil ein seltsamer Todesfall: Die erst kürzlich zugezogene Wahrsagerin Isabella del Comino ist unerwartet verstorben. Musste Isabella sterben, weil sie tatsächlich etwas vorausgesehen hatte? Gerade, als Hilary Tamar und die Anwaltsfreunde eine heiße Spur zu haben glauben, gibt es schon die nächste Leiche im einst so friedlichen Parsons Haver …
Weitere Fälle löst Hilary Tamar in Also muss Adonis sterben,Blitzschnell in den Hades und Der mörderische Gesang der Sirenen.
ORAKEL AUS DEM GRAB
EIN HILARY TAMAR-ROMAN
SARAH CAUDWELL
ÜBERSETZT VONINGRID KRANE-MÜSCHEN
Titel der englischen Originalausgabe THE SIBYL IN HER GRAVE, 2000
Copyright © 2000, 2022 by Sarah Caudwell
Copyright der deutschen Übersetzung © 2002, 2022 by Ingrid Krane-Müschen
Das Cover verwendet Fotos von Cristina Glebova (Raven) und K. Mitch Hodge (Drumadonnell Stone Cross), beide auf unsplash.com
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werks darf in irgendeiner Form ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
ISBN: 978-3-945684-37-5
eBook v1.0, Oktober 2022
Copyright © dieser Ausgabe 2022 bei spraybooks Verlag, Köln
Redaktion: Doris Engelke
Korrektorat: Ute Lüers
spraybooks Verlag Bielfeldt und Bürger GbR, Remigiusstr. 20, 50999 Köln
www.spraybooks.com
INHALT
Vorwort
Prolog
Lageplan Parsons Haver
I. Mittsommer
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
II. Große Ferien
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
III. Weihnachten
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
IV. Frühling
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Epilog
VORWORT
Im Herbst 1987 erhielt ich den Anruf einer aufgeregten Lektorin. Ich sollte wahrscheinlich dazu sagen, dass ich Literaturagent bin, knapp zwei Jahre vor diesem Telefonat meine eigene Agentur gegründet und einen gewissen Ruf für gute Kriminalliteratur hatte. Meine Freundin, die Lektorin, war bekannt dafür, dass sie ziemlich gute Krimis verlegte. Sie, ein eigentlich eher ruhiger Mensch, war geradezu atemlos vor Begeisterung.
»Sarah Caudwell ist in der Stadt«, sagte sie und ihre Stimme klang nach jeder Menge Ausrufungszeichen. »Wer?«, fragte ich.
»Sarah Caudwell! Eine erstaunliche Autorin! Sie sucht einen Agenten! Ihr müsst Euch unbedingt kennenlernen!«
Seit dem Aufkommen von E-Mails und SMS leben wir in einer Welt der Ausrufungszeichen, aber die einzigen Ausrufungszeichen, die ich je von dieser Lektoren-Freundin als Reaktion bekommen habe, waren in diesem kurzen Gespräch unüberhörbar – und außerordentlich angebracht!
Ein paar Stunden später erwähnte ich einer Schriftstellerin und Freundin gegenüber (sie half mir aus in der Agentur), dass ich hoffte, bald eine Schriftstellerin namens Sarah Caudwell zu treffen, die auf der Suche nach einem Agenten war. Meiner Freundin, die im New Yorker veröffentlichte, selbst Romane schrieb und später einen berühmten New Yorker Autor heiratete, verschlug es die Sprache, als sie das hörte.
»Wirklich? Sarah Caudwell!!«
Sie kannte Sarahs Romane, ALSO MUSS ADONIS STERBEN (Thus Was Adonis Murdered) und BLITZSCHNELL IN DEN HADES (The Shortest Way to Hades) und war hingerissen. Natürlich ging ich auf der Stelle in die nächste Buchhandlung, kaufte die Bücher, verschlang sie und wurde zum neuesten Mitglied in Sarahs Fanclub. Ein oder zwei Tage später verabredeten wir uns auf einen Drink – im Algonquin Hotel. Natürlich wohnte sie dort während ihres Aufenthaltes in New York!
Das Algonquin, im Herzen von Manhattan gelegen, ist berühmt als die Heimat des Round Table, eines literarischen Zirkels von Schauspielern, Journalisten und anderen klugen Köpfen, die sich in den 1920er Jahren täglich mehrmals dort trafen. In den Achtzigern war es immer noch ein Treffpunkt von Literaten und Künstlern. William Shawn, damals Lektor des New Yorker, war berühmt dafür, dass er dort an fünf Tagen die Woche ausgiebig frühstückte. Das Algonquin hatte keine Bar im eigentlichen Sinne, oder vielmehr eine kleine, die an die Wand der großen, eigentlich recht schäbigen Lobby geschoben worden war. Hier trafen sich Intellektuelle und Künstler und genossen ihren Drink. Polstersessel und Sofas füllten den Raum, dazu herrschte ein angenehmes Stimmengewirr.
Ich weiß nicht mehr, wie ich sie erkannte (das war lange vor den Zeiten des Internets), aber da saß Sarah, eine kleine, schmale Frau mit kurzen dunklen Haaren und einem Gesicht, das so klug wie freundlich war. Auf dem Tisch neben ihr stand eine offene Flasche Chablis und nachdem ich mich vorgestellt und in einen Sessel gesetzt hatte, der im rechten Winkel zu ihrem stand, hob sie die Flasche und zog fragend eine Augenbraue hoch. Auf mein Nicken hin goss sie einen ordentlichen Schluck in das leere Glas neben dem ihren. Dann holte sie ihre Pfeife hervor (sie war eine berühmte Pfeifenraucherin), stopfte sie, zündete sie an und wir kamen ins Reden!! Wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht, tranken wir mindestens noch ein Flasche Chablis, oder vielleicht waren es auch eher zwei. Irgendwann, es war kurz vor Mitternacht und die Putzleute saugten bereits die Lobby. waren wir die letzten Gäste. Ich war eigentlich mit meinem damaligen Partner zum Abendessen verabredet und rannte zu einem öffentlichen Telefon (es gab noch keine Handys) entschuldigte mich wortreich und versicherte ihm, dass ich nicht verunglückt war.
Noch nie in meinem Leben hatte ich jedes Zeitgefühl verloren – ich bin ein nüchterner Mensch, und ein wenig reserviert. Aber von Sarah ging etwas aus, was ihr Gegenüber entspannte und öffnete und sie weckte den freudigen Gesprächspartner in mir. Anfangs sprachen wir natürlich über ihre Bücher. Wie sie auf die Idee gekommen war, wie ihr erster Roman entstanden war. Von da aus gingen wir über zu den Büchern, die wir gerade lasen, und welche wir danach lesen wollten. Wir sprachen über unsere Familien. Ihre Mutter, Jean Ross, war Christoph Isherwoods beste Freundin in Berlin gewesen, und die Figur der Sally Bowles in seinen Berliner Geschichten basiert auf ihr. (Im Laufe der Jahre erfuhr ich, dass Jean Ross auch Kritikerin und Autorin und politische Aktivistin, und während des Spanischen Bürgerkriegs Kriegsreporterin gewesen war). Sarahs Vater war Claud Cockburn, kommunistischer Journalist in England. Wir sprachen über die Universität. In Oxford hatte sie Jura studiert und eine zentrale Rolle dabei gespielt, dass Frauen zur Oxford Union zugelassen wurden, dem hoch renommierten Debattierclub. Als uns schließlich klar wurde, wie spät es war, stand Homer im Zentrum unseres Gesprächs – sie war eine unbeirrbare Anhängerin der Ilias und ich werde ein Anhänger des Odysseus sein, bis ich sterbe.
Sarah wurde meine Klientin – und eine liebe Freundin. Leider ist sie viel zu jung gestorben – im Jahr 2000 mit nur 60 Jahren. Aber sie lebt weiter in den 4 wunderbaren Romanen, die sie uns hinterlassen hat. Im Mittelpunkt ihrer Kriminalromane stehen das Liebesleben, der Witz und der juristische Scharfsinn einer Gruppe junger Rechtsanwälte, Mitglieder der Chancery Bar am Lincoln’s Inn in London, erzählt von Hilary Tamar, Oxford Professor für Rechtsgeschichte. Sarahs außerordentliche Intelligenz, Ironie und listige Lebensfreude werden Ihnen auf jeder Seite ihrer Romane begegnen.
PS: Vielleicht wird Ihnen Sarahs überraschend moderner literarischer Trick, eine der Hauptfiguren betreffend, auffallen. Ob Sie das bemerken oder nicht, wird Ihnen eine Menge verraten über Ihre Fantasie.
Barney Karpfinger im Mai 2021
Alle in diesem Buch beschriebenen Charaktere und Ereignisse sind frei erfunden. Jede Ähnlichkeit mit lebenden Personen oder tatsächlichen Vorfällen ist rein zufällig.
Für Anne,
die zwischen mir und
dem Chaos steht
PROLOG
Für einige meiner akademischen Kollegen – ich widerstehe der Versuchung, in diesem Zusammenhang die Finanzverwaltung der Universität, die Quästur zu erwähnen – scheint Eigenwerbung der vornehmliche Zweck des Publizierens zu sein. Träfe dies auch auf mich zu, würde ich zweifellos meinen Bericht über die seltsamen Ereignisse, die sich unlängst in Parsons Haver zugetragen haben, so modifizieren, dass ich in einem besseren Licht erscheine. An mehr als nur einem Punkt habe ich bezüglich dieser Ereignisse Schlüsse gezogen, die sich im Nachhinein als falsch erwiesen haben. Erst nach dem letzten von drei mysteriösen Todesfällen begriff ich, was wirklich geschehen war.
Ich fürchte jedoch, dass ich die Wissenschaft nicht in den Dienst persönlicher Eitelkeit und weltlicher Ambitionen stellen darf. Sie ist die Dienerin der Wahrheit und schuldet niemandem sonst Gefolgschaft. Obwohl ich damit vielleicht weniger zur Förderung meiner Reputation beitrage als erhofft, und auch das Prestige meines Colleges weniger fördere, als es einige für meine Pflicht halten, kann ich, liebe Leser, nur einen gänzlich wahrheitsgemäßen Bericht der genannten Ereignisse liefern. Wenn ich hierdurch den Quästor verstimme, muss ich mich damit abfinden und sein Missfallen erdulden.
Darüber hinaus glaube ich, dass es die Berichterstattung über diese Ereignisse mir nicht erlaubt, mich so darzustellen, als hätte ich eine tragende Rolle gespielt. Ich darf mich meinen Lesern nicht aufdrängen wie ein Laienschauspieler in der Rolle eines Lanzenträgers, der in unpassender Weise das Rampenlicht sucht. Der Platz des Erzählers ist nicht im Zentrum der Bühne, sondern im Schatten der Seitenkulisse, wo er die Handlungen der Protagonisten beobachtet und erklärt. Aus diesem Grunde werde ich Ihre Zeit und Aufmerksamkeit nicht mit irgendwelchen Beschreibungen meiner Person vergeuden.
Einige meiner Leser, das ist wahr, äußerten zwar den Wunsch, mehr über mich zu erfahren – wie ich aussehe, wie ich mich kleide, wie ich meine Freizeit verbringe und weitere Details persönlicher oder gar intimer Natur. Ich bezweifele jedoch nicht, dass diese Nachfragen aus reiner Höflichkeit erfolgen und sie wörtlich zu nehmen ein ebenso schwerer Fauxpas wäre wie die höfliche Frage: »Wie geht es Ihnen?« mit einem ausführlichen Bericht über den Zustand meines Verdauungsapparates zu beantworten. Welches Interesse könnte der Leser eines historischen Werkes daran haben, ob der Verfasser groß oder klein ist, dünn oder dick, hell- oder dunkelhäutig? Mir würde es impertinent erscheinen, die Aufmerksamkeit meiner Leserschaft auf solche Trivialitäten zu lenken. Ich wahre daher die bescheidene Zurückhaltung, die meiner Meinung nach angemessen ist, und werde weiter nichts von mir preisgeben, als dass mein Name Hilary Tamar ist und ich einen Lehrstuhl für Rechtsgeschichte des St. George’s College in Oxford innehabe.
Insbesondere werde ich nicht erklären, aus welchen Gründen ich kurz nach Ende des Sommertrimesters beschlossen hatte, ein paar Tage in London zu verbringen. Der Hinweis möge genügen, dass der Quästor sich noch im St. George befand, und damit gut. Wie ich an anderer Stelle bereits berichtete, hat Timothy Shepherd, mein ehemaliger Student, der heute am Kanzleigericht praktiziert, eine angenehm gelegene Wohnung am oberen Ende der Middle Temple Lane. Da ich seine Großzügigkeit kenne, rief ich ihn in der begründeten Hoffnung an, dass er mir seine Gastfreundschaft anbieten werde.
Timothy bedauerte, dass er in dem von mir genannten Zeitraum abwesend sei und sich daher nicht persönlich um mich kümmern könne. Er hatte einen Gerichtstermin in Manchester oder Brüssel oder einem ähnlichen Ort, bat mich jedoch, die Wohnung während seiner Abwesenheit als die meine anzusehen, und versprach, die Schlüssel bei Selena Jardine zu hinterlegen, einer Kollegin in seiner Kanzlei. Ich könne diese dort abholen.
Gegen vier Uhr am Donnerstagnachmittag vor Mittsommer stieg ich die Stufen zum Haus Nr. 62 New Square hinauf und öffnete die Tür zum Büro, um Henry, den Bürovorsteher, zu bitten, Selena meine Ankunft mitzuteilen.
Lageplan Parsons Haver
von Regina für Besucher zur leichteren Orientierung gezeichnet
MITTSOMMER
1
Die beiden Männer, die auf dem Boden des Vorsteherbüros miteinander rangen, waren äußerst unterschiedlich: einer jung, schmächtig, in Pulli und Jeans, mit eher langen, honigfarbenen Haaren und Gesichtszügen von angenehmer Zartheit; der andere, in den Sechzigern, neigte zu Korpulenz, trug einen Nadelstreifenanzug, hatte das runde, rosafarbene Gesicht eines schlecht gelaunten Babys und fast keine Haare mehr. Sie rollten hierher und dorthin, wie es schien unentwirrbar miteinander verflochten, stießen unverständliche Stöhn- und Ächzlaute aus, ob vor Schmerz oder Vergnügen war nicht ohne Weiteres festzustellen. Eine Leiter war ebenfalls in die Vorgänge verwickelt.
Nach einem kurzen Moment entschied ich, dass ihre Verstrickung weder feindseliger noch amouröser Natur war, sondern sehr wahrscheinlich das Ergebnis einer von beiden unbeabsichtigt herbeigeführten Kollision zwischen dem älteren Herrn und der Leiter, gerade in dem Moment, als der junge Mann, vielleicht nicht perfekt ausbalanciert, auf einer der oberen Sprossen gestanden hatte.
»Sir Robert – Sir Robert, haben Sie sich verletzt?«
Selena hastete herbei, um dem älteren Herrn auf die Füße zu helfen. Ihre Stimme vermittelte eine taktvolle Mischung aus Ehrerbietung, Entschuldigung und Betroffenheit – bestimmt war er einer ihrer Mandanten. Falls das stimmte, war jetzt nicht der Zeitpunkt, ihre Aufmerksamkeit zu beanspruchen. Ich zog mich zurück und beschloss, auf eine angenehme halbe Stunde lang Julia Larwood in der Steuerrechtskanzlei nebenan zu besuchen.
Ich fand Julia im Haus Nr. 63 an ihrem Schreibtisch sitzend vor, umgeben von Akten, Steuernachschlagewerken, halb leeren Kaffeetassen und überquellenden Aschenbechern; mehr denn je ähnelte sie einer besonders aufgelösten Heldin in einer griechischen Tragödie. Sie arbeitete offenbar an einer Sache von einiger Bedeutung.
»Ja«, sagte Julia und deutete einladend auf einen Sessel. »Ja, stimmt. Ich schreibe gerade meiner Tante Regina. Sie braucht dringend meinen Rat.« Sie klang ein wenig defensiv, ahnte offenbar, dass ich ihre Behauptung unwahrscheinlich finden würde.
Julias Tante Regina hatte verschiedene Abschnitte ihres Lebens in entfernteren Teilen der Erde verbracht und vor kurzem entschieden, wie ich mich erinnerte, sich in Parsons Haver, West Sussex, niederzulassen – einem bezaubernden kleinen Ort am Ufer des Arun oder vielleicht auch Adur, der genauso war, wie Londoner sich ländliche Einfachheit vorstellen. Im Mittelalter als Seehafen aufgeblüht, war er heute dank der veränderten Küstenlinie längst jeder wirtschaftlichen Bedeutung beraubt; aber seine Kopfsteinpflasterstraßen, seine Bruchstein-Cottages und die prächtige normannische Kirche ziehen immer noch anspruchsvolle Touristen an und jene, die auf der Suche nach einem idyllischen Alterssitz sind.
Regina Sheldon, der zu begegnen ich ein oder zwei Mal das Vergnügen gehabt hatte, erinnerte mich an eine Person aus dem Mittelalter. Als Mädchen hatte sie wahrscheinlich eher an einen Knappen am Hofe eines Plantagenets erinnert. Heute, obwohl ihre Figur nicht mehr jungenhaft und ihr dunkles, kastanienbraunes Haar weniger der Natur als ihrem Frisör zu verdanken war, konnte man sie sich immer noch als denselben Knappen vorstellen, herangewachsen zu einem Botschafter oder einem eher weltlichen Kardinal. Nachdem sie viermal verheiratet gewesen war und zwei Söhne großgezogen hatte, war das Thema Ehe für sie erledigt. Das Hauptbetätigungsfeld für ihre Talente und ihre außergewöhnliche Energie war nun ein kleines Antiquitätengeschäft, das an das diskret modernisierte Cottage grenzte, in dem sie lebte.
Ich konnte mir nur wenige Bereiche vorstellen, für die sie Julias Wissen und Erfahrung benötigt haben könnte.
»Sie hat ein Steuerproblem«, erklärte Julia. »Wenn du darüber lesen möchtest, während ich zu Ende schreibe …«
Sie reichte mir einen Brief von mehreren Seiten Länge, in eleganter, aber gut lesbarer Handschrift verfasst.
24 High Street
Parsons Haver
West Sussex
Montag, 14. Juni
Liebe Julia,
lies diesen Brief bitte sorgfältig, sobald du ihn geöffnet hast, anstatt ihn an einen sicheren Ort zu legen und dann zu vergessen. Es gibt etwas, wobei ich deinen Rat brauche – ich denke, es ist eine Angelegenheit, in der du dich vielleicht auskennst –, und die Sache ist viel zu kompliziert, um sie am Telefon zu erklären.
Alles begann im Februar letzten Jahres, als Maurice, Griselda und ich im Newt and Ninepence saßen. Und stell dich bitte nicht dumm, Julia, du weißt ganz genau, wer Maurice und Griselda sind. Falls nicht, solltest du dich schämen.
Maurice Dulcimer ist der Vikar von St. Ethel. Also, gewissermaßen – die Kirchenoberen haben beschlossen, dass St. Ethel zu klein ist für einen Vollzeitvikar, also haben sie ihn zum Hilfskuraten rationalisiert, wobei sie ihn jedoch weiterhin im Pfarrhaus des Vikars wohnen lassen. Im Ort nennt ihn trotzdem weiterhin jeder »Vikar«. Ich lade ihn immer zum Essen ein, wenn du hier bist, und ihr scheint euch jedes Mal gut zu amüsieren.
An Griselda kannst du dich bestimmt erinnern – Griselda Carstairs, meine Nachbarin, die für andere Leute die Gärten pflegt und Katzen hat. Als ihr euch zum ersten Mal begegnet seid, war sie gerade dabei, meine Rosenbeete zu jäten, und du hast zehn Minuten lang mit ihr geflirtet, bevor dir klar wurde, dass sie eine Frau und kein junger Mann war. Ich finde schon, Julia, obwohl ich natürlich nicht möchte, dass du eines dieser von Sex besessenen Mädchen bist, dass du inzwischen in der Lage sein solltest, den Unterschied zu erkennen. Nur weil Griselda kurze Haare hat und Hosen trug …
Wir saßen also wie üblich samstagmorgens im Newt beisammen, halfen uns gegenseitig bei unseren Kreuzworträtseln und plauderten über dies und jenes. Es stellte sich heraus, dass wir alle ein klein wenig reicher geworden waren, jeder um sage und schreibe vier- oder fünfhundert Pfund. Maurice hatte für eine angesehene Zeitung einen Artikel über Vergil geschrieben und war dafür recht ordentlich bezahlt worden. Griselda war von jemandem, um dessen Garten sie sich gekümmert hatte, eine kleine Erbschaft hinterlassen worden. Und ein bezaubernder amerikanischer Tourist war in mein Antiquitätengeschäft geschlendert und hatte ein paar Dinge erworben, die zu verkaufen ich schon keine Hoffnung mehr gehabt hatte.
Also bestellten wir eine Extrarunde zum Feiern und sprachen darüber, was wir mit dem Geld anfangen wollten. Nach und nach jedoch wurde uns klar, dass es nicht ganz reichen würde, um etwas Aufregendes zu unternehmen. Als Maurice und ich in deinem Alter waren, hätte man mit fünfhundert Pfund beinahe sein Leben auf den Kopf stellen können. Und sogar als Griselda so alt war wie du jetzt, was nicht ganz so lange her ist, wäre es immer noch eine beträchtliche Summe gewesen. Aber heutzutage … dennoch schien es eine Schande, das Geld einfach auf die Bank zu bringen und nach und nach für Alltägliches schwinden zu sehen.
»Es wäre doch schrecklich schön«, meinte Griselda, »wenn es ungefähr doppelt so viel wäre.« Und damit sprach sie uns allen aus der Seele.
Maurice meinte, wir könnten es anlegen, und dafür Zinsen bekommen. Wir haben dann ausgerechnet, wie lange es dauern würde, unser Geld auf diese Weise zu verdoppeln, und waren ein wenig deprimiert über das Ergebnis, als Ricky Farnham hereinkam.
Erinnerst du dich an Ricky? Breites Kreuz und rotes Gesicht, mit einem ausgeprägten Lenkstangenschnurrbart, der der Welt zeigen soll, dass er einmal der königlichen Luftwaffe angehört hat, und einem eher gewagten Krawattengeschmack. Er ist einmal zum Essen gekommen, als du hier warst, und hatte großen Gefallen an dir gefunden – wenn ich mich recht erinnere, beruhte das nicht auf Gegenseitigkeit. Überhaupt nicht dein Typ, der arme Ricky, selbst wenn er nicht dreißig Jahre zu alt für dich gewesen wäre. Du magst eher die geschmeidigen, nicht wahr? Und das ist er weiß Gott nicht. (Ich vermute, Maurice wäre dein Typ gewesen, als er jünger war – er muss ziemlich geschmeidig gewesen sein.) Trotzdem, Ricky ist kein übler Kerl, solange man ihm gegenüber hart bleibt. Ich mag ihn eigentlich ganz gern, obwohl seit ein paar Monaten …
Aber das tut hier nichts zur Sache. Tatsache ist, dass er bis zu seiner Pensionierung sein Leben zum Großteil damit verbracht hat, sich mit Rentenfonds, Investmenttrusts und dergleichen zu beschäftigen. Er schien genau der Richtige zu sein, um uns bei unserem Problem zu beraten. Er war von der Idee mit dem Sparkonto nicht besonders begeistert.
»Schnaps«, sagte er, »das kann ich verstehen. Teure Restaurants kann ich verstehen. Anspruchsvolle Frauen und lahme Pferde, Gott weiß, dass ich das verstehen kann. Aber euer Geld einem Banker anzuvertrauen – das nenne ich pure Verschwendung.«
Was wir bräuchten, meinte Ricky, wären Kapitalbeteiligungen, womit er wohl Anteile an Firmen meinte. Und da das Geld, worüber wir sprachen, nicht unsere Lebensersparnisse waren, sondern eher ein kleines Himmelsgeschenk, das uns nicht viel nützte, solange wir es nicht ein bisschen zum Wachsen brächten, handelte es sich bei seinem Vorschlag nicht um Kapitalbeteiligungen bei großen Firmen, von denen jeder schon einmal gehört hat, sondern um solche, die er »verdoppeln oder verduften-Firmen« nannte. Womit er offenbar meinte, dass sie entweder in kurzer Zeit großen Erfolg haben würden oder pleite gingen. Und er hatte gerade von einer gehört, die genau die Richtige für uns sei.
Es war reiner Zufall, dass ich diejenige war, die die Anteile gekauft hat. Ricky hatte uns gesagt, dass einer der Nachteile beim Investieren kleiner Summen die hohen Nebenkosten seien. Also haben wir beschlossen, unsere Ressourcen zusammenzulegen und gemeinsam zu investieren. Ich hatte sowieso am Montagmorgen bei der Bank zu tun, also machten wir aus, dass ich gleichzeitig die Sache mit den Aktien erledigen könne.
Wir schauten jeden Morgen in die Zeitung, wie der Kurs stand, und ein oder zwei Wochen lang geschah überhaupt nichts. Dann begann der Preis plötzlich recht schnell zu steigen – was mit einer Übernahme zusammenhing, glaube ich. Als sie annähernd das Doppelte dessen wert waren, was wir bezahlt hatten, meinte Ricky, wir sollten verkaufen. Falls wir den Erlös reinvestieren wollten, kenne er eine andere Firma, die ähnlich vielversprechend aussah. Wir folgten seinem Rat, und es geschah mehr oder minder das Gleiche: Das zweite Unternehmen ging nicht ganz so gut, allerdings gut genug, um uns zu ermuntern, weiter zu investieren.
Nachdem wir drei- oder viermal reinvestiert hatten, bekam Maurice Skrupel – wahrscheinlich, weil er Geistlicher ist. All die Predigten darüber, auf Erden keine Reichtümer anzuhäufen, hinterlassen natürlich ihre Spuren, nicht wahr? Er befürchtete wohl, dass er die Sache zu wichtig nehmen und so von höheren Dingen abgelenkt werden könnte.
»Wenn ich feststelle, dass ich die Wirtschaftsseite lese, bevor ich auch nur einen Blick aufs Kreuzworträtsel geworfen habe«, erklärte er, »dann glaube ich, ist es für mich an der Zeit aufzuhören.«
Griselda und ich dachten darüber ein klein wenig anders. Ich zahlte Maurice seinen Anteil aus und investierte unsere beiden in eine Gesellschaft, die sich Giddly Gadgets nannte, Rickys neuester Tipp. Es lief nicht annähernd so gut wie bisher, wir machten fast überhaupt keinen Profit und begannen uns zu fragen, ob dies wohl eine Art Warnung davor sei, zu gierig zu werden, oder ein Hinweis darauf, dass Ricky sein glückliches Händchen verlor. Wir überlegten immer noch, wie es weitergehen solle, als ich herausfand, dass Ricky …
Aber das tut, wie ich immer sage, hier nichts zur Sache. Entscheidend ist, dass wir beschlossen aufzuhören. Wir nahmen einfach das Geld und na ja, gaben es aus.
Maurice hatte seines schon ausgegeben. Da er eine Schwäche für alte Bücher und Handschriften hat, war er für einen Tag nach London gefahren und der Versuchung erlegen: Das illuminierte Frontispiz eines Gedichtbandes von Vergil – venezianisch, fünfzehntes oder sechzehntes Jahrhundert, eine Szene aus einer der Eklogen, sagt er – es ist wirklich sehr schön. (Ganz nebenbei, er brennt darauf, es dir zu zeigen – er meint, es sei etwas für dich.) Aber dann bekam er ein schlechtes Gewissen, weil er so viel Geld für ein rein persönliches Vergnügen ausgegeben hatte und machte eine großzügige Spende an den Fonds zur Erhaltung von St. Ethel. Und als er erkannte, dass diese Spende an St. Ethel ihm ebenfalls persönliches Vergnügen bereitet, spendete er den Rest an eine Wohltätigkeitsorganisation für Obdachlose – armer Maurice!
Griselda gab den Großteil ihres Geldes für ein recht großzügiges Gewächshaus und neue Körbchen für ihre Katzen aus, und ich habe mir eine neue Zentralheizung einbauen lassen.
Schließlich war nach ein paar Geschenken und Feiern gerade noch genug übrig, um nach Paris zu fahren und eine Woche bei deiner Tante Ariadne zu bleiben – was, wie du weißt, genau der Zeitraum ist, den wir miteinander verbringen können, bevor wir anfangen, uns über Politik in die Haare zu geraten.
Und wenn dies das Ende der Geschichte wäre, dann wär’s für alle Beteiligten äußerst zufriedenstellend. Ist es aber nicht.
Ich hatte eine wunderschöne Woche in Paris, habe zu viel gegessen und getrunken, alte Freunde von der Kunstakademie wiedergetroffen und kehrte mit dem Gefühl zurück, zu allem bereit zu sein. Ich dachte, das müsse ich ausnutzen, setzte mich unverzüglich hin und begann mit meiner Buchführung, um möglichst bald meine Steuererklärung abgeben zu können. (Nein, Julia, es wäre nicht besser, wenn ich mir einen Steuerberater nähme – die Buchführung für das Antiquitätengeschäft ist kinderleicht, und ich will verdammt sein, wenn ich jemanden für etwas bezahle, das ich sehr gut selbst erledigen kann.)
Als ich fertig war, brachte ich die Steuerunterlagen zum Finanzamt in Worthing – es ist immer besser, das persönlich zu machen, damit man gleich erklären kann, was die Leute dort nicht verstehen. Und um meine Hilfsbereitschaft zu signalisieren, nahm ich auch gleich meine Bankauszüge mit. Ich gab alles einem jungen Mann mit Hornbrille, der zunächst absolut vernünftig und zuvorkommend wirkte. Er bemerkte einen Eingang, der von einem der Aktienverkäufe rührte. Nachdem ich ihm erklärt hatte, worum es sich handelte, bat er mich, ihm eine Liste aller Aktien zuzuschicken, die ich im vergangenen Jahr ge- und verkauft hatte. Was ich auch tat, noch am gleichen Nachmittag.
Und jetzt will er dreitausend Pfund von mir.
Als ich seinen Brief bekam, dachte ich zunächst, es müsse sich um einen Irrtum handeln. Ich rief ihn sofort an und erklärte, dass Aktien Kapital und kein Einkommen seien, und ich keine Einkommensteuer darauf zu entrichten hätte. Aber er sagte, das mache keinen Unterschied, und es täte ihm sehr leid, wenn das ein Schock für mich wäre.
Es ist ja schön und gut, wenn er behauptet, es tue ihm leid – was ich ihm ganz und gar nicht glaube – was meint denn der, wo ich dreitausend Pfund hernehmen soll?
Wenn ich das Maurice und Griselda erzähle, werden sie ihren Beitrag irgendwie aufbringen, genau wie ich. Aber es ist für uns alle etwas schwierig – zunächst einmal ist es doppelt so viel wie wir zu Beginn hatten, und, wie gesagt, haben wir alles ausgegeben, vornehmlich für Dinge, für die wir das Geld nicht zurückbekommen können. Ich glaube schon, dass Maurice das Vergil-Frontispiz verkaufen könnte, aber ich fürchte, es würde ihm das Herz brechen.
Also bevor ich Angst und Verzweiflung verbreite, wüsste ich gar zu gern, ob du mir zustimmst oder dem jungen Mann mit Hornbrille. Ich lege eine Kopie der Liste, die ich ihm geschickt habe, und seinen garstigen Brief bei. Da ich am Samstag Maurice und Griselda im Newt treffen werde, wäre ich dir sehr dankbar, wenn du mich bis dahin wissen lassen könntest, was du dazu meinst.
Wäre ich nicht so hilfsbereit gewesen, dann hätte der gemeine junge Mann nie etwas erfahren. Das macht mich unendlich wütend.
In Liebe,
Reg
* * *
Ich war ein bisschen besorgt um Julia. Mir war klar, dass sie die Frage aus der Sicht der pflichtbewussten und hingebungsvollen Nichte betrachten wollte. Deshalb fürchtete ich, dass gewisse Bestimmungen oder Ähnliches in den Steuergesetzen sie daran hindern könnten. So wenig ich von diesen Dingen auch verstehe, meine ich doch mich zu erinnern, dass es eine Steuer gibt, die Kapitalertragsteuer genannt wird. Und es schien nur allzu wahrscheinlich, dass genau diese bei Kapitalerträgen zur Anwendung kam.
»Ja«, bestätigte Julia, lehnte sich zurück und zog an ihrer Zigarette. »Ja, da hast du recht, Hilary. Die von dir erwähnte Steuer gibt es tatsächlich. Und durch ein Versehen seitens der Legislative gilt die tatsächlich auch für meine Tante Regina. Trotzdem bin ich froh, sagen zu können …«
Ihre Ausführungen wurden von Selena unterbrochen, die mein kurzes Erscheinen nebenan bemerkt und erraten hatte, dass sie mich bei Julia finden würde. Nachdem sie mir die Schlüssel zu Timothys Wohnung übergeben hatte, sank sie mit erkennbarem Überdruss in den verbliebenen Sessel. Ihr hellblondes Haar, normalerweise glänzend und glatt gebürstet, war liebenswert zerzaust, und ein wenig Staub zierte ihre Nase. Sie erinnerte an eine Perserkatze, die einen unerfreulichen Nachmittag hinter sich hatte.
Auf Julias mitfühlende Nachfrage hin beschrieb sie den Vorfall, den ich gerade im Vorsteherbüro beobachtet hatte: Bei dem jungen Mann, der von der Leiter gefallen war, handelte es sich um den Schreiner, der unlängst von ihrer Kanzlei beauftragt worden war, neue Schränke und Regale anzufertigen. Offenbar hatte er einem plötzlichen Impuls nachgegeben, etwas auszumessen, und der Gentleman, auf den er sodann stürzte, war ihr wichtigster Mandant.
»Der Schreiner?« Julia schaute besorgt. »Meinst du etwa den jungen Mann mit den langen Wimpern und dem Renaissancemund? Du liebe Güte, ich hoffe, er hat sich nicht verletzt.«
»Der Schreiner«, entgegnete Selena, »ist ein kerniger und agiler junger Mann, der die eine Hälfte seiner Zeit damit verbringt, auf Leitern zu klettern, und die andere Hälfte damit, von Leitern herunterzufallen. Ein geeigneteres Objekt deiner Besorgnis wäre mein unglücklicher Mandant, der ein Handelsbankier Mitte Sechzig ist und sehr wenig Erfahrung darin hat, von herabfallenden Schreinern getroffen zu werden.«
Es war natürlich äußerst bedauerlich, dass ein solcher Mensch, der zweifellos häufig anwaltlichen Rat benötigte und ebenso zweifellos über die notwendigen Mittel verfügte, um diesen zu bezahlen, in den Räumlichkeiten von Nr. 62 New Square jene Unannehmlichkeit erlitten hatte. Jedoch schien er keinen ernsthaften Schaden davongetragen zu haben. Weder Julia noch ich konnten uns vorstellen, dass er wegen eines so unbedeutenden Missgeschicks in Zukunft auf Selenas fachkundigen Rat verzichten würde.
»Hm«, machte Selena, rümpfte die Nase und schien wenig Trost aus unseren ermunternden Kommentaren zu ziehen.
Es wurde bald klar, dass der wahre Grund für ihre Unzufriedenheit mit dem bisherigen Verlauf des Nachmittags nicht der Vorfall mit dem Schreiner und der Leiter war, der eher den krönenden Abschluss der Ärgernisse darstellte. Die Besprechung mit ihrem Mandanten war schlecht verlaufen; soll heißen, das Problem war nicht gelöst und sie hatte jetzt das Gefühl, er sei enttäuscht von ihr.
»Was für ein Problem war es denn?«, fragte Julia, bereit, voller Entrüstung für ihre Freundin Partei zu ergreifen.
»Er will sich vom Vorstandsvorsitz seiner Bank zurückziehen und weiß nicht, wen er zu seinem Nachfolger ernennen soll.«
»Oh, aber das ist doch absurd. Es geht ganz offensichtlich um keine juristische Frage. Wie kann er von dir erwarten, ihn zu beraten?«
»Nun, es steckt noch mehr dahinter. Er hat Grund zu der Annahme, dass einer der beiden potenziellen Kandidaten … Ich muss wohl kaum erwähnen, dass all dies strikt vertraulich ist.« Sie unterbrach sich, rutschte in ihrem Sessel herum, und blickte aus irgendeinem Grunde recht streng in meine Richtung. »Ich werde keine Namen nennen. Mein Mandant, im Folgenden einfach ›Mandant‹ genannt, ist der Vorsitzende einer kleinen, aber hoch angesehenen Handelsbank, im Folgenden ›die Bank‹ genannt. Wenn er in Ruhestand geht, wird seine Stimme bei der Wahl eines Nachfolgers ausschlaggebend sein. Es gibt zwei aussichtsreiche Kandidaten, beide bereits im Vorstand, nachfolgend A und B genannt. Mein Mandant hat Grund zu der Annahme, dass einer von beiden sich eines … ziemlich schweren Vergehens schuldig gemacht hat.«
Sie schwieg wieder – anscheinend waren die Details zu schockierend, um in Worte gefasst zu werden. Julia hob eine Augenbraue, ermunterte sie, doch fortzufahren.
»Die Aufgabe der Bank besteht unter anderem darin, Vorschläge für Firmenübernahmen auszuarbeiten. Wenn eine Firma darüber nachdenkt, eine andere zu übernehmen, bittet sie die Bank um Rat bei der Vorgehensweise und um einen Vorschlag für die Höhe des Angebotes. Theoretisch fällt der Kunde die finanzielle Entscheidung, aber in der Praxis wird fast immer dem Vorschlag der Bank gefolgt. Und, wie ihr natürlich wisst, folgt der Verlautbarung eines Übernahmeangebots immer ein Kursanstieg der Aktien des anvisierten Unternehmens – bisweilen ist es ein dramatischer Anstieg. Also siehst du, Hilary, eine Möglichkeit sehr reich zu werden bestünde darin, dass du im Vorfeld herausfindest, was die Bank empfehlen wird.«
»Meine liebe Selena«, antwortete ich, »es ist ja sehr freundlich von dir, dass du an mich denkst. Aber ich vermute, es gibt dabei wohl einen Haken?«
»Na ja, der Haken besteht darin, dass die Bank alle erdenklichen Anstrengungen unternimmt, um sicherzustellen, dass du es nicht herausfindest. Sie verfährt, wie mein Mandant es gerne ausdrückt, nach dem Prinzip: ›Keiner weiß mehr als unbedingt nötig‹. Einem Laufburschen ein Eis zu kaufen oder einer Sekretärin Pralinen oder selbst einen Topmanager im Savoy zum Essen einzuladen, wird dir also gar nichts nützen, weil keiner von ihnen die Informationen besitzt, die du brauchst. Bis vor einer Woche war mein Mandant der Überzeugung, dieses System funktioniere einwandfrei, und er lebte glücklich und zufrieden in diesem Glauben. Doch dann …«
»Doch dann?«, wiederholte Julia, weil sie erkannte, dass eine weitere Ermutigung vonnöten war.
»Doch dann beschloss einer der Computerexperten der Bank, der eine neue Software ausprobieren wollte, eine Analyse der Übernahmen durchzuführen, die die Bank in den letzten zwei Jahren betreut hatte. Und das Ergebnis war ausgesprochen beunruhigend, weil es zeigte, dass in mindestens acht Fällen ein beträchtlicher Anstieg von Aktienkäufen der zu übernehmenden Firmen zu verzeichnen gewesen war, und zwar unmittelbar bevor der Take-Over bekannt gegeben wurde.«
»Puh«, entfuhr es Julia. »Und keiner hat etwas davon bemerkt? Weder die Börsenaufsicht noch die Handelskammer oder sonst jemand?«
»Bisher nicht. Es ist ein wahres Lehrstück über den Wert der Mäßigung. Versteht ihr, wenn man jeden Fall einzeln betrachtet, waren die Beträge nicht hoch genug, um Alarm auszulösen – nie mehr als einhunderttausend Pfund. Erst wenn man feststellt, dass es derselben Bank mehrfach passiert ist …«
»Einmal könnte Pech gewesen sein, zweimal sieht nach Unachtsamkeit aus, und achtmal …«
»… muss Insiderhandel sein – was natürlich kein Kavaliersdelikt ist, sondern eine Straftat darstellt. Und die einzigen Personen, die über alle acht Übernahmen informiert waren, abgesehen von meinem Mandanten und seiner persönlichen Assistentin, die seit zwanzig Jahren für ihn arbeitet und der er uneingeschränkt vertraut, waren seine beiden potenziellen Nachfolger. Das heißt ›A‹ und ›B‹.«
Diese Entdeckung stellte ihren Mandanten vor ein äußerst schmerzliches Dilemma. Konnte er die Bank am Ende einer langen und verdienstvollen Karriere in Hände geben, die sich möglicherweise eines solchen Verbrechens gegen englisches Recht und Kaufmannsehre schuldig gemacht hatten? Undenkbar. Ebenso undenkbar war es, eine offizielle Untersuchung durch die Börsenaufsicht ins Rollen zu bringen, die per se ruinöse Folgen für den Ruf und die Interessen der Bank haben könnte. Die einzige Lösung für sein Problem bestand darin, den Verantwortlichen zu identifizieren, wobei Selena ihm allerdings nicht hatte helfen können.
»Dass er so etwas von mir erwartet, finde ich ein wenig unvernünftig von ihm. Aber als er zum ersten Mal mit einer eher unbedeutenden Sache zu mir kam, war ich in der Lage, ihm zu helfen, und er war offensichtlich ziemlich beeindruckt. Seither tut er so, als wäre es eine unfehlbare Lösung für nahezu jedes Problem, meinen Rat einzuholen. Eine Einstellung, die man natürlich gerne bei seinen Mandanten sieht und die sich sehr positiv auf meinen Kontostand ausgewirkt hat. Also will ich nicht, dass er seine Illusionen bezüglich meiner Fähigkeiten verliert.«
»Soweit ich mich erinnere«, bemerkte Julia, »gehört Wahrsagerei nicht zu den Fachgebieten, die unter deinem Namen im Anwaltsverzeichnis stehen. Du bist, wie allgemein bekannt, in unserer Generation die konkurrenzlose Expertin in Wirtschaftsrecht, aber du bist nicht Madame Louisa.«
»Nein«, antwortete Selena. »Wer ist Madame Louisa?«
»Madame Louisa schreibt die Horoskope im Daily Scuttle und besitzt erstaunliche Fähigkeiten. Heute Morgen hat sie zum Beispiel vorhergesagt, dass du Frustrationen am Arbeitsplatz erleben könntest.«
»Ihre größte Gabe ist die Untertreibung, würde ich sagen«, warf Selena ein. »Was hat sie über dich geschrieben?«
»Dass ich in eine schwierige geschäftliche Situation geraten könnte, die möglicherweise mit einem Verwandten zu tun hat, und dass vielleicht juristischer Rat angezeigt sei. Auch das hat sich als erstaunlich treffende Vorhersage erwiesen. Ich hoffe allerdings, den juristischen Rat selbst erteilen zu können.« Julia berichtete von der Meinungsverschiedenheit zwischen ihrer Tante und dem wenig hilfsbereiten jungen Mann vom Finanzamt.
»Aber Julia«, wandte Selena ein. Sie schien verwirrt und zeigte die Zurückhaltung von jemandem, der fürchtet, in das Fachgebiet eines Freundes einzudringen. »Was ist mit dem Freibetrag? Sind nicht die ersten sechstausend Pfund Kapitalerträge pro Jahr steuerfrei?«
»Ja, natürlich«, bestätigte. »Deshalb vergessen die Leute ja so oft, dass es die Kapitalertragsteuer überhaupt gibt. Die Gewinne von Kleinanlegern liegen normalerweise unterhalb der Freibetragsgrenze.«
»Aber dann …«
»Steuerpflicht besteht für Einkünfte über sechstausend Pfund. Unglücklicherweise wurden alle Gewinne im selben Steuerjahr realisiert.«
»Aus einer Anlage von anfänglich fünfzehnhundert Pfund?«
»Ja, ungefähr.«
»Aber Julia, das hieße ja, dass die Kapitalerträge in der Größenordnung von tausend Prozent in einem Jahr gelegen haben müssen.«
»Ja«, meinte Julia. »Ja, wenn du es so siehst, ist es ganz schön beeindruckend, nicht wahr?«
»Im selben Zeitraum haben die erfolgreichsten Investmenttrusts Erträge von knapp dreißig Prozent erzielt. Wie in aller Welt hat sie das fertiggebracht?«
»Einen Moment, ich zeige dir die Liste der Aktien, die sie gekauft hat.« Nach einer relativ kurzen Suche in den Papierbergen auf ihrem Schreibtisch wurde Julia fündig und reichte Selena die Liste. »Aber sie hat dem Mann vom Finanzamt anscheinend nicht gesagt, dass sie das Geld für sich und zwei weitere Leute angelegt hat. Dann nämlich sehe ich nicht, wie er leugnen will, dass ihnen der Freibetrag dreimal zusteht. Solange also Maurice und Griselda keine weiteren steuerpflichtigen Kapitalerträge erzielt haben und solange der Bursche vom Finanzamt nicht versucht zu behaupten …«
Selena blickte auf das Papier in ihrer Hand, und auf ihrem Gesicht zeichnete sich ein Ausdruck größter Verwunderung, man hätte fast sagen können, Entsetzen ab.
»Julia, bist du ganz sicher, dass dies die Liste ist, die deine Tante dir geschickt hat?«
»Ja«, antwortete Julia, »wieso sollte sie es nicht sein?«
»Vorhin hat mein Mandant mir eine Liste der Firmen übergeben, deren Aktien anscheinend Gegenstand von Insiderhandel geworden sind. Und alle Namen auf deiner Liste hier stehen auch auf seiner.«
2
In dem Café, wo ich am folgenden Morgen, einem Dienstag, auf dem Weg zum Public Record Office frühstückte, hatte jemand die neueste Ausgabe des Daily Scuttle, aufgeschlagen im Lokalteil, liegen lassen. Ein Foto sprang mir sofort ins Auge. Ich konnte mich gar nicht irren: Dies waren eindeutig die Züge jenes Gentleman, den ich gestern auf dem Boden des Vorsteherbüros in unfreiwilliger Umarmung mit dem jungen Schreiner gesehen hatte. Sofort studierte ich den begleitenden Text.
Sir Robert Renfrew, Vorstandsvorsitzender der Renfrew Bank, ist hier zu sehen bei seiner Rede vor der ehrenwerten Zunft der Fingerhut- und Stiefelknopfmacher anlässlich eines Dinners in der Guildhall, zu dem er als Ehrengast geladen war.
Es war allgemein erwartet worden, dass der siebenundsechzigjährige Sir Robert diesen Anlass nutzen werde, um Hinweise auf seinen Nachfolger abzugeben, ein Thema, zu dem es beträchtliche Spekulationen gegeben hat. Stattdessen war er bemüht klarzustellen, dass Überlegungen in diese Richtung verfrüht seien: Er erwähnte, dass er sich bester Gesundheit erfreue, und betonte, seine Aufgaben mehr denn je zu genießen.
Die Renfrew Bank ist immer noch ein Familienunternehmen, was in der Ära multinationaler Giganten fast schon als Anachronismus gesehen werden kann. Seit der Gründung im frühen neunzehnten Jahrhundert ist immer ein Renfrew oder ein Albany Vorstandsvorsitzender gewesen; beide Familien sind durch Heirat eng miteinander verbunden. Traditionalisten, unter ihnen einige der wohlhabendsten und angesehensten Kunden des Bankhauses, hoffen, dass der in Eton und Cambridge ausgebildete direkte Nachfahre des Bankgründers und aktueller stellvertretender Vorstandsvorsitzende Edgar Albany (51) zu Sir Roberts Nachfolger ernannt werden wird.
Die meisten institutionellen Anleger würden es jedoch vorziehen, wenn Geoffrey Bolton, der brillante, achtundvierzigjährige Leiter des Firmenkundengeschäfts, die Renfrew Bank ins einundzwanzigste Jahrhundert führen würde. Geboren und aufgewachsen in Lancashire, war Bolton vor fünf Jahren von der Leibnitz Bank of New York abgeworben und nach London geholt worden, um neuen Schwung in die Investment-Abteilung zu bringen, die bis dahin eher ein Schattendasein führte. Sein Erfolg auf diesem Gebiet ist ein persönlicher Triumph für Sir Robert, der Bolton selbst rekrutiert hatte.
So geschah es, dass ich völlig unbeabsichtigt die Identität von Selenas Mandanten und der beiden Männer erfuhr, die er verdächtigte.
Die überraschende Tatsache, dass die Namen derselben Firmen auf beiden Listen erschienen, war für Selena und Julia zu bemerkenswert, um sie als Zufall abzutun: Für beide stand praktisch fest, dass Ricky Farnham seine Informationen von jemandem erhalten haben musste, der auf die eine oder andere Weise in den Insiderhandel verstrickt war.
Damit standen sie vor einem Dilemma. Sie hatten ihre Schlüsse auf der Basis von Beweisen gezogen, die sie aus zwei verschiedenen und vertraulichen Quellen erhalten hatten. Welchen Nutzen, wenn überhaupt, konnte man aus diesen Beweisen ziehen in Zusammenhang mit jenem Problem, das Selenas Mandanten bekümmerte? Selbstverständlich keinen, der Mrs. Sheldon auch nur ansatzweise in Verlegenheit bringen könnte. Aber es konnte nicht schaden, dachte Julia, wenn sie ihrem Brief einen taktvoll formulierten Absatz hinzufügte, in dem sie ihre Tante nach der Quelle von Ricky Farnhams Informationen fragte.
Während ich die Chancery Lane Richtung Public Record Office hinunterging, überlegte ich, ob sie wohl schon eine Antwort erhalten habe. Der Artikel im Scuttle hatte meine Neugier diesen Fall von Insiderhandel betreffend weit mehr angeregt als zu dem Zeitpunkt, da die zwei Verdächtigen nichts weiter als Buchstaben des Alphabets waren. Ich konnte es kaum erwarten zu erfahren, ob Mrs. Sheldon wohl etwas Licht ins Dunkel zu bringen vermochte.
Selena hatte mich freundlicherweise zu einem Treffen des »Nr. 62 New Square Renovierungskomitees« eingeladen, das um die Mittagszeit im Corkscrew abgehalten werden sollte. Dieses Komitee, so erfuhr ich, bestand aus den drei jüngsten Mitgliedern der Kanzlei – Selena, Desmond Ragwort und Michael Cantrip – und war für die gesamte Organisation bestimmter Renovierungen verantwortlich, die während der großen Ferien in der Kanzlei durchgeführt werden sollten. An dem Treffen sollte auch eine Repräsentantin ihrer Nachbarn im Hause Nr. 63 New Square teilnehmen, nämlich Julia. Die Tagesordnung sah auch ein Mittagessen vor. Aus diesem Grund hatten sie mich eingeladen teilzunehmen.
Der Architekt des Corkscrew, das habe ich bereits an anderer Stelle erwähnt, schien sich nicht sehr viel aus Tageslicht und Fenstern gemacht zu haben. Als ich kurz nach zwölf dort eintraf, musste ich für einen Moment im Eingangsbereich innehalten, bis sich meine Augen nach dem strahlenden Sonnenschein draußen an das Dämmerlicht im Inneren gewöhnt hatten.
Selena saß an einem der runden Eichentische zwischen zwei jungen Männern, die sich irgendwie ähnelten – beide schmal und blass, kontrastierten sie auf erfreuliche Weise, als seien sie von zwei unterschiedlichen Künstlern geschaffen: Ragwort von einem, der mit Aquarellfarben arbeitete, um die feinen Farbtöne des Herbstes zu vermitteln; Cantrip von einem nicht weniger begabten, aber doch merklich ungeduldigeren Maler, der nur ein paar Holzkohlestriche auf weißem Karton braucht. Man hatte bereits eine Flasche Niersteiner erworben, und mein Glas wurde gefüllt, sowie ich an den Tisch trat.
»Was genau ist der Grund für die Renovierung, für die ihr beide verantwortlich seid?«, fragte ich und hoffte, man werde mir nicht vorwerfen, dass ich sie von ihrer Arbeit abhalte.
»Wir werden modernisiert«, erklärte Cantrip triumphierend. »Fließend heiß und kalt in jeder Hinsicht und dazu topmoderne Kommunikationssysteme. Wenn uns das einundzwanzigste Jahrhundert einholt, holen wir aus.«
»Die Kanzlei soll wieder die schlichte, aber würdevolle Eleganz verliehen bekommen, die, sagen wir, in Lincoln’s Inn während der Regentschaft der späten Stuarts geherrscht hat«, erklärte Ragwort.
Diese beiden Ziele schienen mir unvereinbar zu sein. Ich fragte, ob es nicht weise wäre, sich für eines zu entscheiden, bevor man Handwerker engagierte.
»Ganz und gar nicht«, entgegnete Selena. »Es ist nur eine Frage des Blickwinkels, verstehst du? Auf der einen Seite, und ich hoffe, das weißt du, Hilary, lassen wir uns unseren Respekt vor den großartigen Traditionen der englische Anwaltschaft von niemandem ausreden. Andererseits ist uns irgendwann aufgegangen, dass es doch wohl möglich sein muss, gewisse kleine Verbesserungen in unserem Arbeitsumfeld zu realisieren, ohne besagte Traditionen in bedenklicher Weise zu kompromittieren.«
»Wie beispielsweise eine Zentralheizung, die tatsächlich funktioniert«, meinte Ragwort.
»Und ein anständiges Computersystem«, ergänzte Cantrip, »statt ein paar Laptops, die unser Bürogehilfe irgendwo billig erstanden hat, weil sie schon seit zehn Jahren völlig überholt sind.«
»Vielleicht sogar einen Ort, wo man duschen kann, bevor man abends ausgeht«, seufzte Selena wehmütig. »Aber wann immer wir etwas in dieser Richtung vorschlagen … Ich weiß nicht, Hilary, ob du jemals Basil Ptarmigan das Wort ›Modernisierung‹ hast aussprechen hören?«
»Selten«, gab ich zu. »Und wenn, dann nur im Ton des allergrößten Missfallens, so als fasse er mit Fingerspitzen einen unappetitlichen Gegenstand an und halte ihn so weit wie möglich von sich weg.« Ich konnte mir vorstellen, dass Basil Ptarmigan, der ehrwürdigste aller Kronanwälte, wenig Sympathie für Vorschläge dieser Art aufbrachte.
»Basil ist der Ansicht«, erklärte Ragwort, »dass Modernisierung und Reform Hand in Hand gehen, und wir alle wissen, wohin das führt. Einige der älteren Mitglieder unserer Kanzlei neigen dazu, ein wenig konservativ zu denken.«
»Ihrer Meinung nach«, sagte Cantrip, »ist seit der Nichtigkeitserklärung des auf Shelley’s Case aus dem Jahre 1581 zurückgehenden Rechtsgrundsatzes alles gründlich den Bach runtergegangen. Und das war 1925.«
»Und natürlich wollten wir uns immer ihrer Weisheit und Erfahrung fügen«, sagte Ragwort.
»Weil sie den Großteil der erforderlichen Kohle aufbringen müssen«, ergänzte Cantrip.
Lange Zeit schien die Lage aussichtslos und es sah so aus, als müssten die Träume von Duschen und Computersystemen bloße Träume bleiben. Die Möglichkeit einer Lösung ergab sich völlig unerwartet, als Ragwort zu einer kleinen Party bei Benjamin Dobble eingeladen wurde …
»Den du natürlich kennst«, wandte Ragwort sich an mich, weil Benjamin ein Kollege und, wie ich hoffentlich sagen darf, ein Freund von mir ist. Ich habe ihn an anderer Stelle vorgestellt, und er spielt in dieser Erzählung eine zu kleine Rolle, als dass eine Wiederholung seiner Beschreibung gerechtfertigt wäre.
Anlass der Party war der Abschluss der Renovierungsarbeiten in seiner Wohnung in der Grafton Street. Von den Gästen wurde vor allem erwartet, seine eichenfurnierten Schränke und Bücherregale im jakobinischen Stil zu bewundern, welche die Ansammlung von Akten, Computern, Druckern, Faxgeräten und anderem Ballast, der heutzutage bei der Suche nach Wissen unverzichtbar erscheint, verhüllen sollten. Der Handwerker, der für den Entwurf und die Ausführung verantwortlich war, hieß Terry Carver. Er war noch jung und natürlich Ehrengast.
Als Ragwort Terry Carver zu seiner Arbeit beglückwünschte, fühlte er sich inspiriert, diesen zu fragen, ob er Interesse habe, einen ähnlichen Auftrag in Nr. 62 New Square durchzuführen.
»Also kam Terry nach Lincoln’s Inn«, erzählte Selena, »maß aus und fotografierte und so weiter. Er schien begeistert und meinte, er denke an etwas in der Richtung von Inigo Jones.«
»Inigo Jones?«, fragte ich. »Ist das nicht ein bisschen früh für New Square?« Diesen Einwand, der als nicht konstruktiv abgeschmettert wurde, zog ich selbstverständlich auf der Stelle zurück.
»Schließlich schickte er uns einige Zeichnungen, die bewiesen, dass wir so viele Duschen und Computerterminals haben könnten, wie wir wollen, und die Kanzlei trotzdem so aussähe wie einst die von Lord Nottingham, als er den Rechtsgrundsatz des Verbots einer zeitlich unbegrenzten Verfügungsgewalt über Eigentum ersonnen hat. Wir zeigten die Zeichnungen Basil und den anderen Kollegen, und sie waren noch beeindruckter, als wir gehofft hatten.«
»Absolut von den Socken«, meinte Cantrip. »Sie konnten es gar nicht mehr abwarten.«
»Also beehrten sie uns«, sagte Ragwort und schaute zur Decke »mit der Organisation des Projekts.«
»Nun ja«, meinte Selena. »Weil natürlich klar war, dass irgendjemand eine ganze Menge Arbeit damit haben würde, das alles in Gang zu bringen. Und was immer man über die älteren Mitglieder unserer Kanzlei sagen mag, dumm sind sie jedenfalls nicht. Also haben wir ein paar anstrengende Monate hinter uns. Anfertigen von Einzelteilen, Einholen der Genehmigungen von Lincoln’s Inn, Ausschreibungen und so weiter. Aber schließlich hatten wir für alles eine Lösung, und die Bauarbeiten können Ende nächsten Monats beginnen.«
»Meine liebe Selena«, wandte ich ein, »meinst du etwa, der ganze Trubel sei überstanden, sowie die Handwerker da sind. Das entspricht nicht der allgemeinen Erfahrung.«
»Nun, es wird bestimmt Lärm und Unordnung geben, solange sie hier am Werk sind. Aber sie haben versprochen, Ende der großen Ferien fertig zu sein, also sollte es nicht allzu zermürbend werden.«
Sie lehnte sich zurück und trank ihren Wein mit der gelassenen Zuversicht einer jungen Frau, die mit zufriedenstellenden Ergebnissen rechnet und überzeugt ist, über einen realistischen Zeitplan zu verfügen. Sie hatte offenbar noch nie zuvor Handwerker im Haus gehabt.
»Es sieht ganz so aus, als sei der junge Mann, Terry Carver, der Dreh- und Angelpunkt des ganzen Unternehmens«, gab ich zu bedenken. »Seid ihr sicher, dass er zuverlässig ist?«
»Er hat ein oder zwei kleine Schwächen. Sein Hang, zum Beispiel, derart mit den Wimpern zu klimpern, dass er Julia von ihren Steuergesetzen ablenkt. Und natürlich seine Angewohnheit, von der Leiter herunter auf meine Mandanten zu fallen. Aber er baut einfach unübertroffene Bücherregale.«
»Nach Aussage von Benjamin«, ergänzte Ragwort, »ist er nicht nur einer der besten Handwerker Londons, sondern auch äußerst zuverlässig.«
Wenn man bedenkt, dass Benjamin, was Wimpern angeht, ebenso empfänglich ist wie Julia, fürchte ich, dass es um sein Urteilsvermögen vielleicht nicht allzu gut bestellt ist. Aber ich spürte, dass auch dies als ein nicht konstruktiver Kommentar angesehen würde.
Bald darauf stieß Julia zu uns, mit einem weiteren Brief ihrer Tante, den diese offenbar auf dem Weg zu einem neuerlichen Gespräch mit dem jungen Mann vom Finanzamt eingeworfen hatte. Julia hatte versucht, ihre Tante telefonisch nach dem Verlauf des Gesprächs zu befragen, musste aber feststellen, dass Mrs. Sheldons Nummer fortwährend besetzt war.
»Ich nehme nicht an, dass ihr Brief irgendwelche Informationen zu diesen Aktien enthält?«, erkundigte sich Selena.
»Doch«, antwortete Julia. »Soll ich euch den Brief während des Essens vorlesen?«
»Nun …« Selena blickte besorgt in meine Richtung. Sie war der merkwürdigen Auffassung, dass man vertrauliche Informationen ausschließlich in Gegenwart von Mitgliedern der Anwaltschaft erörtern dürfe.
Ich erklärte ihr, wie schon zuvor meinen Lesern, dass ich rein zufällig den Namen ihres Mandanten erfahren hatte. Sie warf mir einen recht eindringlichen Blick zu, doch nach vielfältigen Ermahnungen, die hier nicht wiederholt werden sollen, war sie bereit, auf meine Diskretion zu vertrauen.
24 High Street
Parsons Haver
West Sussex
Montag, 21. Juni
Liebe Julia,
dein Brief hat einen etwas seltsamen Unterton, wenn ich so sagen darf – fast so, als hätte ich etwas Unrechtes getan. Dabei habe ich doch nur ein paar Aktien gekauft und wieder verkauft – weiter nichts. Befindest du dich vielleicht gerade in einer sozialistischen Phase? Falls ja, schreib Ariadne und teile es ihr mit – sie wäre begeistert.
Aber natürlich bin ich sehr glücklich, dass ich deiner Meinung nach dem abscheulichen jungen Mann keine dreitausend Pfund bezahlen muss. Heute Nachmittag habe ich einen Termin mit ihm, wo ich ihm erklären werde, dass die Aktien zum Teil Maurice und Griselda gehören. Danach kommen beide zu mir zum Abendessen, um zu erfahren, was er darauf gesagt hat. Wir finden, dass du uns sehr geholfen hast, und wollen dich bei deinem nächsten Besuch ins beste Restaurant von West Sussex einladen.
Hoffentlich hältst du mich nicht für undankbar, wenn ich Ricky lieber nicht fragen möchte, woher er seine Informationen über die Aktien hat. Die Sache ist nämlich die, dass ich derzeit nicht sonderlich gut auf Ricky zu sprechen bin und nichts tun möchte, das ihn dazu verführt zu glauben, daran hätte sich etwas geändert.