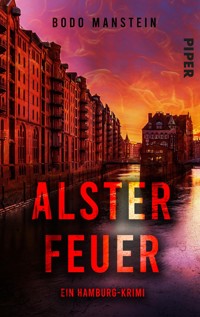5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper Spannungsvoll
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Hinter dem Hauptbahnhof lauert der Tod: Erik van der Kolk ermittelt im Hamburger Drogenmilieu »Patrick Frahm sah auf. Er bemerkte eine bedrohliche Gleichgültigkeit, die die Augen seines Gegenübers ausstrahlten, als sich ihre Blicke trafen. Und in diesem Moment wurde ihm klar, dass es für ihn hier und heute enden würde. Dann hob der Mann langsam die Pistole.« In Hamburg wird ein Taxifahrer erschossen. Kriminalhauptkommissar Erik van der Kolk und sein Team nehmen die Ermittlungen auf, die sie erneut in das Drogenmilieu von St. Georg führen. Doch nicht nur sie sind dem Täter und seinen Hintermännern auf der Spur: Irgendjemand spielt van der Kolk die Tatwaffe zu und der Fall nimmt plötzlich eine unerwartete Wendung. Neue Hinweise führen zu einer rechtsextremen Gruppe, die einen verheerenden Anschlag plant ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher: www.piper.de
Wenn Ihnen dieser Krimi gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Alstersturm« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
© Piper Verlag GmbH, München 2022
Redaktion: Michaela Retetzki
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Covergestaltung: Alexa Kim »A&K Buchcover«
Covermotiv: Bilder unter Lizenzierung von Shutterstock.com genutzt
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Piper Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Prolog
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Epilog
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Prolog
Bisher verlief alles planmäßig. Trotzdem machte Peter Hoyer sich nach den Ereignissen der letzten Tage Sorgen, es könnte doch noch etwas schiefgehen.
»Alles klar, Peter?« Torge Lohmann, sein alter Parteifreund aus Mecklenburg-Vorpommern, sah ihn fragend an, während sie gemeinsam die Treppe zum Foyer des Hamburger Rathauses hinabstiegen.
»Ich bin nur noch mal in Gedanken die Agenda der Tagung durchgegangen«, sagte Hoyer mit einem entschuldigenden Lächeln, während er den obersten Jackettknopf seines dunkelblauen Businessanzugs schloss. »Es ist immerhin die erste Innenministerkonferenz unter meiner Federführung.«
»Bei der du gleich mal das Programm auf den Kopf stellst. Das gemeinsame Essen auf den ersten Tag zu legen ist ziemlich ungewöhnlich.«
»Vergiss die Alsterrundfahrt nicht«, sagte Hoyer mit aufgesetzt wichtiger Miene.
»Wie könnte ich?« Torge klopfte ihm anerkennend auf die Schulter. »Du hast vollkommen recht, man muss auch mal mit alten Traditionen brechen.«
»Ich dachte, dass es so ein idealer Icebreaker wäre, der von Anfang an eine gute Atmosphäre schafft«, sagte Hoyer. »Mal sehen, wie die anderen es aufnehmen.«
»Das hängt wahrscheinlich davon ab, wie sehr der Kahn gleich schaukelt.« Torge warf ihm einen schelmischen Seitenblick zu. »Nur dass wir alle die norddeutschen Bundesländer vertreten, heißt ja nicht, dass auch niemand seekrank wird.«
Zusammen mit ihren Amtskollegen aus Niedersachsen, Bremen und Schleswig-Holstein traten sie aus dem Haupteingang des Rathauses, und sofort steckte Hoyer die Nase in die Luft.
»Wird schon gut gehen«, sagte er. »Es weht ja kaum ein Lüftchen.«
Draußen wurde die kleine Gruppe von uniformierten Beamten der Bereitschaftspolizei erwartet, die einen ungefähr zehn Meter breiten Korridor frei hielten; laut dem Sicherheitskonzept, das sein Stab ausgearbeitet hatte, der äußere Sicherheitskreis. Den inneren bildeten die Personenschützer des Landeskriminalamtes Hamburg sowie deren mit angereisten Kollegen der anderen Bundesländer. Insgesamt zehn Beamte, die im schwarzen Anzug, mit Knopf im Ohr und Sonnenbrille auf der Nase für die unmittelbare Sicherheit der Politiker sorgten.
»Ist es weit?«, fragte Torge.
Hoyer musterte schmunzelnd den kleinen Spitzbauch seines Freundes, der aus dem geöffneten Jackett hervorlugte.
»Ein bisschen Bewegung tut dir mal ganz gut, mein Lieber«, sagte er. »Doch keine Angst, es sind nur knapp dreihundert Meter.« Er wies über den Rathausmarkt, der jetzt, am frühen Nachmittag, noch zum größten Teil im Schatten des prachtvollen Rathauses lag, das im Stil der Neurenaissance Ende des 19. Jahrhunderts erbaut worden war.
»Dass du es schaffst, trotz vollem Terminkalender so fit zu bleiben, verstehe ich nicht. Läufst du noch viel?« Torge sah ihn fragend an.
»Auch nicht mehr so viel wie früher«, sagte Hoyer. »Und in der letzten Zeit fast nur noch am Wochenende, zusammen mit meiner Frau.«
Torge blickte ihn erstaunt an und feixte: »In Hamburg hat der Innensenator wohl noch Wochenende?«
Lachend gingen sie weiter.
Das warme und sonnige Wetter hatte viele Menschen in die Innenstadt gelockt, von denen eine große Zahl zwischen Alsterarkaden und Mönckebergstraße den Rathausmarkt kreuzten. Immer mehr blieben stehen und reckten die Hälse, um zu sehen, was es mit dem ungewöhnlichen Polizeiaufgebot auf sich hatte.
»Dahinten liegt der Reesendamm, an den sich der Jungfernstieg anschließt«, sagte Hoyer. »Dort befinden sich die Anlegestellen der Alsterdampfer.«
Die dreißigköpfige Gruppe setzte sich in Bewegung. Nachdem sie ein Drittel der Strecke hinter sich gelegt hatte, zog plötzlich ein surrendes Geräusch über ihren Köpfen ihre Aufmerksamkeit auf sich.
»Diese Dinger gehen mir so auf den Keks«, sagte Torge mit einem kurzen Blick zum Himmel, wo eine Drohne aus Richtung der U-Bahn-Station Rathaus auf sie zuflog. »Du hast ja kaum noch Ruhe vor denen. Schrecklich.«
»Das kannst du laut sagen.« Hoyer drehte sich zu Kriminalhauptkommissar Arne Dinkel vom Fachkommissariat Personen- und Veranstaltungsschutz des LKA um, der den Einsatz leitete und ständig in seiner Nähe war.
»Dinkel, was ist da los?«
»Ein unangemeldeter Flug.« Der Beamte presste einen Finger an seinen In-Ear-Kopfhörer und behielt mit routiniertem Rundumblick die Gesamtlage und seine Kollegen im Auge. »Die Einsatzzentrale prüft das gerade.«
Hoyer wandte sich an Torge.
»Hast du gehört?«, fragte er und fügte mit unverhohlener Ironie an: »Die prüfen das gerade. Und die Drohne fliegt weiter munter auf uns zu. Ohne dass irgendjemand etwas unternimmt. Stell dir nur mal vor, das Ding da oben würde eine Sprengladung tragen. Und dann? Hauptsache, die Einsatzzentrale prüft.«
Kaum hatte er ausgesprochen, wurden die Motoren der Drohne lauter. Sie stieg steil nach oben, ging kurz darauf in eine leichte Rechtskurve und flog zurück in die Richtung, aus der sie gekommen war.
»So weit ist alles wieder sicher, Herr Senator«, sagte Dinkel. »Der Flug war tatsächlich weder angemeldet noch genehmigt. Die Einsatzzentrale hat alle in der Nähe befindlichen Streifen auf die Suche nach dem Piloten geschickt.«
Hoyer bedankte sich kurz bei seinem Sicherheitschef, bevor er sich wieder an seinen Freund wandte.
»Hamburger Drohnenabwehr«, sagte er spöttisch. »Streifenpolizisten jagen eine Drohne, die von wer weiß woher gesteuert wird, in der Hoffnung, den Piloten zu finden. Ist doch aberwitzig, oder? Es gibt nicht mal GPS-Jammer, um die Dinger abzufangen, bevor sie Schaden anrichten können.«
»Läuft bei euch nicht bereits ein Projekt zur Drohnenabwehr?«
»Du meinst das Abfangsystem Falke?«
Torge zuckte die Achseln.
»Keine Ahnung. Heißt das so? Ich meine das System, das ihr am Flughafen erprobt.«
»Das ist Falke«, sagte Hoyer. »Allerdings ein ziemlich flügellahmer.«
»Wieso?«
»Weil sich die Abstimmungen zwischen der Flugsicherung, dem Hamburger Flughafen, der Bundespolizei und dem Bundesverkehrsministerium hinziehen. Muss ich noch mehr sagen?«
Torge schüttelte den Kopf.
»Also mal wieder das übliche Kompetenzgerangel und die obligatorischen Dauerprüfschleifen. Stimmt’s?«
»So ist es«, sagte Hoyer. »Wahrscheinlich muss mal wieder erst etwas passieren, bevor das Thema ernst genommen wird.«
* * *
Nicht weit entfernt, von einem Gebäude am Ballindamm, beobachtete Klaus Wengler mit einem Fernglas das Geschehen am Jungfernstieg.
»Pünktlich wie die Maurer«, sagte er leise zu sich selbst, nahm das Glas herunter und schloss das Dachfenster. Eilig durchquerte er den Trockenboden, auf dem er sich befand, und trat auf das Flachdach, das nach hinten an das kleine Satteldach des Vorderhauses anschloss.
»Okay, Leute, dreizehn dreißig. Wir beginnen mit Phase drei.«
Andreas Belig und Christoph Doorn, die wie er einen Arbeitsanzug der Zimmerei Schmidt trugen, traten ihre Zigaretten aus und gingen zu einer Drohne, die abflugbereit auf dem Boden stand.
Belig nahm das Steuerpult auf, das neben ihr lag, und hängte es sich um.
»Ich bin so weit«, sagte er, nachdem er einige Knöpfe gedrückt hatte.
Wengler beugte sich zu dem Quadrocopter hinunter, an dessen Unterseite eine Antipersonenmine angebracht war, und aktivierte die Zündeinrichtung.
»Scharf«, sagte er knapp, trat einen Schritt zurück und prüfte dabei mit einem raschen Rundumblick die Umgebung. Nirgendwo war jemand zu sehen, der ihnen jetzt noch hätte in die Quere kommen können. Zuletzt warf er einen Blick auf die Drohne. Sie stand optimal und hatte nach allen Seiten genügend Abstand zu möglichen Hindernissen wie Antennen, Satellitenschüsseln, Abluftrohren oder Schornsteinen. Selbst ein unerwartet aufkommender Wind würde einem reibungslosen Start nicht entgegenstehen.
»Andi?« Wengler sah Belig fragend an, der sofort den Daumen hob.
»Dann warten wir nur noch auf das Signal.«
»Alles klar.« Belig legte die Hand wieder an den rechten Joystick des Steuerpults. Alle drei lauschten gespannt. Und nach der Ewigkeit von einer Minute ertönte in der Ferne endlich das Signalhorn eines Alsterdampfers.
»Es ist so weit«, sagte Wengler, hob den Arm und sah auf seine Taucheruhr. »X minus fünf. Lassen wir sie noch etwas hinausfahren und das schöne Wetter genießen, bevor es ihnen so richtig heiß wird.«
1.
11 Tage zuvor
»Warum schaust du nicht einfach mal bei uns vorbei, Tommi?«
Renate Binder sah ihn fragend an und tupfte sich mit einem Handtuch den Schweiß von der Stirn. »Unsere Sache scheint dich ja wirklich mächtig zu interessieren.«
»Ist das so offensichtlich?«, fragte Thomas Jansson, der eine Gymnastikmatte aufrollte. »Ich hoffe, dass ich mit meinen Fragen nicht vom Training abgelenkt habe.«
Renate winkte ab.
»Frag, so viel du willst«, sagte sie und schlang sich das Handtuch um den Nacken. »Wir freuen uns über jeden neuen Anhänger.«
»Na, so weit sind wir ja noch nicht.« Er legte die Matte in das dafür vorgesehene Regal, das an der Wand des Trainingsraums stand. »Es ist nur, weil mir unsere Heimat am Herzen liegt und viele Punkte eures Programms mich durchaus ansprechen.«
»Das freut mich. Ich erklär dir wirklich gern in unserer Geschäftsstelle alles, was du wissen möchtest. Ist doch besser als hier zwischen Tür und Angel. So jemanden wie dich können wir übrigens bei uns gut gebrauchen.«
»Versprich dir nicht zu viel. Falls ihr einen redeschwingenden Anzugträger braucht, bin ich absolut nicht der Richtige.«
»Von denen haben wir meiner Meinung nach sowieso viel zu viele.« Sie ließ ihren Blick über seinen muskulösen Oberkörper wandern und sah ihm anschließend tief in die Augen. »Was uns eindeutig fehlt, sind Männer, die sich abseits der großen Bühnen im Hintergrund halten und auch mal zupacken können, wenn es nötig ist. Mit verweichlichten Maulhelden werden wir niemals erreichen, dass wieder Recht und Ordnung in Deutschland einkehren. Die Leute lassen sich nicht nur mit Worten überzeugen, sondern wollen auch Taten sehen.« Sie nahm ihr Handtuch aus dem Nacken, bückte sich zu ihrer Sporttasche hinunter, stopfte es hinein und richtete sich langsam wieder auf. Dabei strich sie ihre schweißnassen, schulterlangen blonden Haare mit beiden Händen nach hinten.
Jansson musterte sie. Renate war für Mitte dreißig äußerst gut in Form. Das wusste sie und kleidete sich entsprechend. Wie gewöhnlich steckte sie auch heute wieder in einem knappen Tanktop und einer dreiviertellangen Tight, deren schwarz glänzender Stoff wie eine zweite Haut ihren Körper umspannte. Dazu trug sie neongrüne Fitnessschuhe. Schon häufiger hatte Jansson beobachtet, wie sie es genoss, dass ihr die Blicke der Männer im Studio folgten, wenn sie zu ihrem Trainingsraum ging.
Doch auch außerhalb des Fitnessstudios stand Renate Binder gern im Mittelpunkt und zelebrierte förmlich ihre Auftritte in der Öffentlichkeit. Sie war unverkennbar nicht nur stolz auf ihren Körper, sondern auch auf das, was sie bisher in der Politik erreicht hatte. Seit Kurzem gehörte sie als Abgeordnete der Partei Deutsche Nationaldemokraten dem Landtag von Sachsen an.
»Ich überleg’s mir«, sagte er.
»Vielleicht ist dir ja ein Treffen auf neutralem Boden erst mal lieber?« Sie warf ihm einen vielsagenden Blick zu. »Zum Beispiel bei einem schönen Essen zu zweit?«
Renate Binder ließ wirklich nichts anbrennen.
»Eure Parteikasse scheint ja gut gefüllt zu sein, wenn ihr jeden Interessenten gleich zum Essen einladet.«
»Jetzt beleidigst du mich«, sagte sie mit gekränkter Stimme und schob die Unterlippe vor. »Das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun. Außerdem habe ich dich eingeladen und nicht die Partei.«
»Wenn das so ist, komme ich natürlich gern.« Jansson hob den Zeigefinger. »Allerdings nur, wenn ich dich einladen darf. Ich kenne da ein niedliches Lokal in der Nähe der Frauenkirche.«
Renate Binder stemmte die Hände in die Hüften und sah ihn grübelnd an.
»Also gut«, sagte sie schließlich. »Die Einladung gilt jedoch nur für das Essen.« Sie lächelte herausfordernd. »Den restlichen Abend bist du mein Gast.«
Jansson zögerte einen Moment, um die Gedanken zu sortieren, die ihre Ansage bei ihm ausgelöst hatte. Dann willigte er ein.
»Einverstanden. Morgen Abend? Halb sieben im Elbschlösschen?«
»Halb sieben im Elbschlösschen.« Sie nahm ihre Tasche. »Und sei bitte pünktlich. Ich hasse es, auf andere warten zu müssen.« In einer schwungvollen Bewegung drehte sie sich um und verließ mit langen dynamischen Schritten den Trainingsraum.
Jansson lächelte zufrieden. Mit dieser Einladung hatte er mehr als nur einen Fuß in der Tür zur Landesspitze der PDN in Sachsen, die erst kürzlich bei den Landtagswahlen nicht nur hier, sondern auch in Brandenburg überraschende Erfolge verzeichnen konnte. In beiden Landtagen hatte sie sich zur zweitstärksten Kraft entwickelt und mit diesem unerwarteten Wahlergebnis in weiten Teilen der Republik ein regelrechtes Entsetzen ausgelöst. Grund dafür war in erster Linie der Umstand, dass die PDN seit Längerem vom Verfassungsschutz beobachtet wurde und Splittergruppen der Partei aufgrund extremistischer Bestrebungen sogar zum Verdachtsfall erhoben worden waren. Gerade Letzteres hatte dazu geführt, dass er in die Szene eingeschleust werden sollte.
Bevor Jansson den Trainingsraum verließ, steckte er sein Smartphone ein und warf einen Blick auf den Kursplan, der neben der Tür an einem Info-Board hing. Um vierzehn Uhr begann die Crossfit-Anfängergruppe, die er leitete. Bis dahin blieb ihm eine knappe Stunde. Eine gute Gelegenheit, um sich mit einem Proteinshake in der Fitnesslounge zu erfrischen, bevor sich der Laden füllte. Jetzt, am Freitagmittag, befanden sich die meisten Mitglieder des Fitnessclubs entweder noch bei der Arbeit oder erledigten bereits ihre Wochenendeinkäufe. Ab fünfzehn Uhr würde sich das rapide ändern.
In der Fitnesslounge stellte sich Jansson an die Theke, hinter der Isabell Franke die Regale mit neuen Dosen auffüllte, die Zauberpülverchen zum Muskelaufbau enthielten.
»Hallo, Isa«, sagte er. »Machst du mir einen Erdbeershake?«
»Sofort, Tommi.«
Jansson zog sein Smartphone hervor und öffnete die App der Hamburger Morgenzeitung, während er auf sein Getränk wartete. Außer der Elbe, die sich hier in Dresden durch die Stadt schlängelte, stellte die tägliche Lektüre der Hamburger Morgenzeitung die letzte Verbindung zu seiner alten Heimat dar. In der aktuellen Ausgabe empfing ihn auf der Titelseite ein Postkartenmotiv: ein Foto der Binnenalster mit der bekannten Alsterfontäne und der Lombardsbrücke im Hintergrund. Zusammen mit der Kennedybrücke bildete sie die Grenze zur Außenalster.
Die Kennedybrücke. Gedankenverloren ließ er das Smartphone für einen Augenblick sinken und dachte daran, wie im letzten Jahr genau dort die Ereignisse ihren Lauf genommen hatten, die ihn letztendlich nach Dresden verschlagen und ihm ein neues Leben beschert hatten. Ein neues Leben, das jedoch nicht unbedingt besser war.
»Ein Erdbeershake.« Isabell legte einen Untersetzer auf den Tresen und stellte ein hohes Glas darauf. »Lass es dir schmecken.«
»Danke, Isa«, sagte Jansson, trank einen Schluck und warf wieder einen Blick in die Hamburger Morgenzeitung. Er überflog die Schlagzeilen am linken Rand der Seite, die auf Artikel im Inneren der Zeitung verwiesen, denen die Redakteure eine besondere Bedeutung zuschrieben. Einer dieser Beiträge fiel ihm sofort ins Auge.
Wieder mehr Drogentote.
Mit raschen Wischbewegungen rief er die angegebene Seite auf und las:
Nach zuletzt 71 Drogentoten in 2018, liegt die Zahl im laufenden Jahr, kurz vor Ende des ersten Halbjahrs, bereits bei 40 und bleibt damit auf einem erschreckend hohen Niveau. Jüngstes Opfer ist die zwanzigjährige Annalena F., die Ende Mai tot in einer Absteige in St. Georg aufgefunden wurde. Damit steuert Hamburg …
Annalena F. Sein Blick verharrte auf dem Namen, gleichzeitig spürte er, wie es ihm die Kehle zuschnürte. Schweiß bildete sich auf seiner Stirn.
»Lenchen«, sagte er mit leiser Stimme. »Nicht jetzt du auch noch.«
* * *
Nicole Uthland warf einen verstohlenen Seitenblick nach rechts. Seit ihrer Abfahrt in Seevetal saß Erik van der Kolk stumm auf dem Beifahrersitz und starrte gedankenverloren vor sich hin.
»Wenigstens hat das Wetter mitgespielt«, sagte sie, nur um das nervende Schweigen zu beenden, das nun schon eine halbe Stunde anhielt. »Wenn ich da an die Beerdigung meiner Mutter im Januar zurückdenke … Sturm, Nieselregen und dazu diese grauenhafte Kälte.« Sie schüttelte sich demonstrativ. »Patrick und seine Frau konnten sich heute immerhin in Ruhe von Annalena verabschieden. Wir waren damals froh, als wir endlich das Grab verlassen und wieder ins Warme konnten.«
»Ex-Frau.«
Sie sah ihn fragend an, doch mehr kam nicht von ihm. Erik starrte weiter auf jenen imaginären Punkt weit vor ihnen auf der Autobahn.
»Dann eben Annalenas Mutter, wenn dir das lieber ist«, sagte sie bissig. Vor ihr scherte in diesem Moment ein Lastwagen auf der dreispurigen Fahrbahn aus, um einen langsameren Truckerkollegen zu überholen. »Idiot.« Sie zog ihren Mini nach links, nachdem sie in die Spiegel gesehen hatte, und widmete dem Lastwagenfahrer eine Hupsinfonie, als sie das Führerhaus passierte. Der Fahrer revanchierte sich mit seiner Lichthupe, während sie vor ihm wieder auf die rechte Fahrbahn wechselte. Sie hob den Mittelfinger. »Du mich auch.«
»Warum so gereizt?«, fragte Erik und sah zu ihr hinüber.
»Ich gereizt? Meinst du, es ist schön, wenn du die ganze Zeit nur stumm dasitzt und Löcher in die Luft starrst?«
»Entschuldige bitte, Niki, dass mich Annalenas Tod einfach nicht loslässt«, sagte er leise.
»Denkst du, mich?«, fragte sie ärgerlich. »Ich war übrigens diejenige, die sie letztes Jahr nach ihrer Entführung ins Krankenhaus begleitet hat. Bei mir hat sie damals auf der Fahrt ihr Herz ausgeschüttet.«
»Ich weiß«, sagte Erik. »Tut mir leid. Ich wollte nicht …«
Nicole Uthland unterbrach ihn. Die ganze Zeit hatte er den Mund nicht aufbekommen, und jetzt redete erst mal sie.
»Ich erinnere mich gut, wie sie nach dem kalten Entzug während ihrer Gefangenschaft gehofft hatte, endlich ganz von den Scheißdrogen wegzukommen. Zu sehen, dass sie es nun doch nicht geschafft hat, ist so furchtbar.« Tränen traten ihr in die Augen, die sie mit der Handfläche wegwischte. »Aber …«, sie warf einen Blick zu Erik, »… man kann das doch nicht einfach totschweigen. Also ich jedenfalls nicht.«
Er strich ihr sanft mit der Hand über die Wange.
»Du hast ja recht. Es ist wirklich unfassbar. Dieses junge Ding. Wir alle haben doch gedacht, dass sie diesmal clean bleibt. Patrick, du, ich …«
»Was war eigentlich überhaupt mit Patrick los?«, fragte sie schniefend. »Ihr habt ja kaum miteinander gesprochen. Und dann sein merkwürdiger Abgang nach der Beerdigung. Er war ja einer der Ersten, die gefahren sind.«
Erik seufzte.
»Ich weiß es auch nicht. Das geht im Grunde schon seit er nach Bremen versetzt wurde so. Zuerst habe ich ihn bewusst in Ruhe gelassen, damit er den Tod seines Bruders und die Strafversetzung etwas verarbeiten kann. Nachdem ich dann nach vier Wochen noch immer nichts von ihm gehört hatte, habe ich mehrmals vergeblich versucht, ihn zu erreichen. Erst bei einem Anruf in seiner neuen Dienststelle hatte ich ihn an die Strippe bekommen. Allerdings nur kurz. Angeblich hatte er einen wichtigen dienstlichen Termin. Danach kam nichts mehr von ihm. Funkstille.«
»Und seitdem habt ihr überhaupt nichts mehr voneinander gehört?«, fragte sie verwundert.
»Nein. Nichts. Nada. Bis letzten Dienstag, als ich ihn angerufen habe, um ihm zu kondolieren. Bis dahin wusste ich ja nicht einmal, dass er inzwischen geschieden ist.«
Mittlerweile hatten sie das Dreieck Norderelbe passiert und fuhren weiter in Richtung Zentrum.
»Der arme Kerl«, sagte Nicole Uthland. »Irgendwie kann ich verstehen, dass er den Glauben an die Menschheit verloren hat. Erst der Tod seiner Eltern, dann sein Bruder und jetzt auch noch Annalena.« Sie wies mit einem Kopfnicken nach links, wo der Hamburger Hafen auftauchte. »Und wenn ich dann auch noch daran denke, wie viel von diesen Drogen seitdem genau in dieser Sekunde dort ankommt, könnte ich im Strahl kotzen.«
Van der Kolks Blick folgte ihrem.
»Man müsste den Dreckskerlen ihr Dreckszeug, mit dem sie sich eine goldene Nase verdienen, in den Hals stopfen, bis die genauso elendiglich verrecken wie ihre Kunden«, sagte er. »Keine langwierigen Ermittlungen mehr, die letztlich doch nur dazu führen, dass irgendwelche Schmierenanwälte die Wichser wieder rauspauken. Verhaften, Drogen fressen lassen und fertig. Schicht im Schacht. Hasta la vista.«
»Und dann?« Sie warf ihm einen skeptischen Blick zu. »Sobald du einen erledigt hast, steht der Nächste auf der Matte, um die Geschäfte weiterzuführen. Egal ob es um Drogen, Prostitution oder Menschenhandel geht. Solange du dich dumm und dämlich verdienen kannst, wird das so weitergehen. Oder hat sich in St. Georg irgendetwas geändert, nachdem letztes Jahr der Mirakaj-Clan hochgenommen wurde?«
»Sag ich doch. Man muss denen einfach mal ordentlich auf die Fresse hauen. Und zwar so, dass sich jeder zweimal überlegt, nicht lieber die Finger davon zu lassen. Einfach mal die Glacéhandschuhe im Spind lassen.«
»Soso, mal ordentlich auf die Fresse hauen«, sagte sie verwundert. Derartige Töne häuften sich in letzter Zeit bei ihm. »Oder gleich die Rübe ab? So wie bei Störtebeker? Und dann die Köpfe vor den Stadttoren zur Abschreckung aufspießen?«
»Wenn’s hilft.«
Sie zeigte ihm einen Vogel.
»So langsam piept es wirklich bei dir, Erik. Bei allem Verständnis, solche radikalen Ansichten kenne ich überhaupt nicht von dir. Wo ist der Erik van der Kolk, der für unseren Job brennt und unser Rechtssystem immer wieder verteidigt hat? Du warst doch immer derjenige, der mich auf den Boden zurückgeholt hat, wenn ich mich darüber aufgeregt habe, dass nichts passiert.«
Erik warf ihr einen betroffenen Blick zu.
»Vielleicht bin ich nach so vielen Jahren einfach müde geworden«, sagte er seufzend. »Ich hab echt keinen Bock mehr, immer und immer wieder gegen die Windmühlen anzureiten.«
»Geht mir doch genauso. An Tagen wie heute möchte ich auch am liebsten alles hinschmeißen.« Sie lächelte mitfühlend. »Unter Umständen hätte ich das längst gemacht, wenn du mich nicht immer wieder aufgebaut hättest und es nicht hier und da mal Erfolge geben würde. Trotz allem gibt es die ja zum Glück. Ich frage mich in solchen Phasen immer, was wäre, wenn wir alles stehen und liegen lassen würden. Wenn wir die Menschen im Stich lassen, die auf uns zählen. Dann bin ich doch lieber weiterhin der stete Tropfen, der den Stein höhlt.«
Inzwischen hatten sie ihr Ziel erreicht und Nicole Uthland lenkte ihren Mini an den Bürgersteig vor dem Altbau, in dem Erik van der Kolk wohnte.
»Vielleicht hast du recht und es ist einfach im Moment alles zu viel«, sagte er leise. »Annalena, dann die Sache mit Najuma, in der ich einfach nicht weiterkomme …«
Sie warf ihm einen vorwurfsvollen Blick zu.
»Was du ja auch nicht musst. So furchtbar die Geschichte um ihren Tod ist, vergiss nicht, dass der Fall nicht umsonst ein Cold Case ist.«
»Tu ich nicht«, sagte er. »Allerdings verjährt Mord auch nicht.« Er löste den Gurt. »Kommst du noch kurz mit rauf?«
Sie schüttelte den Kopf.
»Ich will Peer nicht länger als nötig warten lassen, wo er mich schon für die Dauer der Beerdigung vertreten hat.«
»Gut, Niki«, sagte er und gab ihr einen Kuss. »Wir telefonieren dann.«
Er stieg aus und beugte sich noch einmal zu ihr herunter.
»Ruhigen Dienst.«
»Und du lässt jetzt erst mal alles sacken«, sagte sie und sah ihn ernst an. »Wäre vielleicht gut, wenn du morgen oder übermorgen mal Patrick anrufst. Ein Gespräch nach so langer Zeit und nach dem, was passiert ist, tut euch beiden bestimmt gut.««
* * *
Obwohl die Abzweigung zwischen den dicht stehenden Bäumen leicht zu übersehen war, verfehlte Patrick Frahm sie nicht. Er bog nach rechts ab, hielt jedoch seinen Wagen nach wenigen Metern an.
»Was ist das denn?« Er betrachtete das Verkehrsschild am Straßenrand, das die Durchfahrt untersagte, ein Zusatzschild begründete das Verbot: Privatbesitz. Er war sich sicher, dass es vor einem Jahr noch nicht dort gestanden hatte. War das dahinter liegende Gelände nun endlich verkauft worden?
Er vergewisserte sich, den ersten Gang eingelegt zu haben, und fuhr weiter. Der neue Besitzer würde sicher nichts dagegen haben, wenn er trotzdem seinem alten Elternhaus einen kurzen Besuch abstattete, um dort in Ruhe Annalena zu gedenken. Auf dem Friedhof hatte er das nicht gekonnt. Nicht nur, weil Annalenas Mutter, die dämliche Kuh, zur Beerdigung gekommen war, auch die vielen tröstenden Worte hatte er nicht mehr ertragen. Zwar waren sie mit Sicherheit alle lieb gemeint, doch vermochten sie nicht ansatzweise seinen Schmerz zu lindern. Eher im Gegenteil. Und er trug immer noch ihren Namen, den er bei der Hochzeit angenommen hatte. Frahm. Warum habe ich nach der Scheidung nicht gleich wieder meinen alten Namen angenommen?, fragte er sich, obwohl er die Antwort kannte. Er hatte weiterhin den gleichen Nachnamen wie seine Tochter tragen wollen, um ihr zu zeigen, dass sie beide trotz allem eine Familie blieben. Auch ohne Britta. Annalena war nun tot. Sie lag bei seinen Eltern und seinem Bruder im Familiengrab der Fitschens. Und so wollte auch er wieder heißen. Patrick Fitschen.
Er lenkte den Wagen gemächlich den schmalen asphaltierten Weg hinauf und dachte daran, wie Nils und er als Kinder auf ihren Fahrrädern den kleinen Berg hinuntergerast waren. Wie die Motorradrennfahrer aus dem Fernsehen hatten sie sich in die engen Kurven gelegt. Vor ihm tauchte die Teufelskehre auf. So hatten sie die Haarnadelkurve getauft, in deren Scheitelpunkt das Haus der Schröders im Schatten dicht belaubter und eng stehender Bäume lag. Die schwierigste Stelle der Strecke. Frahm hielt an und betrachtete die Hecke, in die sie mehr als einmal ein Loch gerissen hatten, nachdem sie den letzten Bremspunkt verpasst hatten. Der alte Schröder hatte jedes Mal fürchterlich geschimpft, pflegte und hegte er die Ligusterhecke doch mit Hingabe. Das war lange her. Der penible Formschnitt war genauso verschwunden wie die Löcher. Jetzt wucherte die Hecke ohne menschlichen Eingriff.
Ob die Schröders überhaupt noch lebten? Kurz nach dem Tod seiner Eltern vor vierzehn Jahren waren sie in ein Altersheim bei Buxtehude gezogen.
Frahm gab wieder Gas. Da der neue Besitzer das kleine Haus der Schröders nicht abgerissen hatte, hoffte er, dass auch sein Elternhaus noch stand.
Er erreichte das Ende des Weges, wo sich der Wald etwas lichtete und die ehemaligen Parkflächen auftauchten, die am Straßenrand lagen. Auch der alte Bolzplatz war anhand der verrosteten Tore und des Basketballkorbs zu erkennen, obwohl die Spielfläche überwuchert war. Langsam fuhr er weiter und genau auf das große L-förmige Hauptgebäude zu, in dem seine Eltern über lange Jahre ein Gästehaus der evangelischen Kirche geführt hatten. Es stand also noch.
Er ließ den Wagen ausrollen und stoppte hinter dem Sprinter einer Zimmerei, der vor der Treppe parkte, die zum Haupteingang des Hauses hinaufführte. Offensichtlich waren noch Handwerker hier. Frahm beugte sich etwas vor und sah zu dem Fenster neben dem Eingang hinauf, hinter dem das kleine Büro gelegen hatte, in dem seine Eltern die anreisenden Gäste empfangen und die abreisenden verabschiedet hatten.
Er schaltete den Motor aus, verließ seinen Wagen und sah sich um. Die Arbeiten am Haus mussten gerade erst begonnen haben, denn viele Veränderungen konnte er nicht erkennen. Das Gebäude und die Außenanlagen machten denselben verwahrlosten Eindruck wie vor einem Jahr. Die Hausfassade war schmutzig, die Fensterscheiben blind von Dreck und Staub oder zersplittert. Von der Holzverkleidung des Dachstuhls blätterte die Farbe ab und zwischen den Steinen der gepflasterten Wege wucherte Unkraut. Einzig auf der Terrasse, die weiter unten vor dem kurzen Schenkel des Hauses lag, hatte jemand den Wildwuchs beseitigt und die zerbrochenen Dachziegel, die überall verstreut herumlagen, entfernt.
Merkwürdig. Der neue Besitzer schien sonderbare Prioritäten zu setzen, gab es doch genug andere Schäden, deren Beseitigung sicher dringlicher war.
Ein schnell lauter werdendes Summen irgendwo über den Baumwipfeln ließ ihn aufhorchen. Zweifellos stammte das Geräusch von Elektromotoren. Er blickte suchend nach oben und entdeckte sogleich eine Drohne, die hinter den Wipfeln einiger Tannen auftauchte und für einen Moment ungefähr acht Meter über der Terrasse im Schwebeflug verharrte. Dabei drehte sie sich langsam um ihre eigene Achse.
Frahm reckte neugierig den Hals und trat einen Schritt vorwärts. Arbeiteten die Zimmerleute heutzutage etwa mit Drohnen, um nach Schäden auf Dächern zu suchen?
Mit einem Mal wurde das Motorengeräusch wieder lauter und die Drohne raste im Tiefflug auf ihn zu. Instinktiv duckte er sich und wich zurück. Keine fünf Meter vor ihm stoppte das Fluggerät und schwebte, leicht hin und her schwankend, in Augenhöhe vor ihm. Dabei war das Objektiv der Kamera an seiner Unterseite auf ihn gerichtet.
Mit einer beschwichtigenden Geste hob er die Hand, richtete sich wieder auf und sah sich vorsichtig nach jemandem um, der das Ding steuerte.
»War das Schild nicht groß genug?«, fragte unvermittelt eine Stimme rechts neben ihm. Gleichzeitig löste sich eine bullige Gestalt mit Bürstenhaarschnitt aus dem Schatten des Hauses. »Zutritt verboten. Das hier ist Privatbesitz.«
Frahm drehte sich zu dem Mann um, bei dem es sich nicht um den Drohnenpiloten handelte, da er nicht das notwendige Steuerpult mit sich führte. An der Arbeitskleidung und dem über der rechten Brusttasche angebrachten Firmenlogo war zu erkennen, dass es sich um einen der Handwerker handeln musste.
»Es tut mir leid«, sagt er mit einem entschuldigenden Lächeln. »Ich dachte, es sei kein Problem, wenn ich trotzdem mal kurz hierherfahre. Wir haben einen Trauerfall in der Familie, und ich habe hier als Kind viele Jahre gewohnt.«
»Was du nicht sagst.« Der Mann sah ihn gleichgültig an. »Du hast also mal in dieser Bruchbude gewohnt?« Er musterte ihn von Kopf bis Fuß und nickte anschließend in Richtung der Drohne, deren Rotoren daraufhin hörbar die Drehzahl erhöhten. Offensichtlich hatte der Pilot das Zeichen verstanden. Frahm sah, wie die Drohne wieder an Höhe gewann und zur Terrasse zurückflog, wo jetzt zwei weitere Männer standen. Vermutlich waren sie aus dem Keller gekommen, dessen Tür sich dort in der Nähe befand. Die Drohne landete und das Motorengeräusch erstarb abrupt. Einer der beiden winkte kurz zu ihnen herauf, bevor er die Drohne aufnahm und beide Männer in Richtung Kellereingang davongingen.
Frahm wandte sich wieder an den Mann, der einige Schritte entfernt stehen geblieben war und ihn abwartend ansah.
Irgendetwas stimmte hier nicht. So ablehnend, ja fast schon feindselig, wie der Typ auftrat, verhielt sich doch kein normaler Handwerker.
»Meine Eltern hatten hier lange Zeit ein Gästehaus, und da ich in der Nähe war, habe ich einfach einen kleinen Abstecher gemacht. Das letzte Mal war ich vor einem Jahr hier.« Frahm warf einen kurzen Blick in Richtung des Hauses. »Viel hat sich seitdem ja nicht getan. Was ist denn hier geplant?«
»Das ist Privatsache und geht dich gar nichts an«, sagte der Mann mit abweisender Stimme.
»Schon gut, schon gut.« Er hob beschwichtigend die Hände und wandte sich zum Gehen. »Ich verschwinde ja schon wieder.«
»Nicht so schnell«, sagte der Mann und nahm eine drohende Haltung ein. »Meinst du, du könntest hier einfach so auftauchen, herumschnüffeln und wieder verschwinden?«
Frahm wurde es jetzt langsam zu bunt. Was nahm sich der Typ eigentlich heraus? Er machte einen Schritt auf ihn zu.
»Nun beruhigen Sie sich mal ganz schnell wieder. Es stimmt, dass ich hier unberechtigterweise hergekommen bin, trotzdem ist das kein Grund für so einen Aufstand.« Er wies auf den Sprinter. »Sie gehören doch zu der Zimmerei. Was halten Sie davon, wenn ich Ihren Chef anrufe und ihm erzähle, wie Sie sich hier aufführen?«
Der Mann sah ihn ausdruckslos an.
»Nur zu. Zufällig gehört ihm auch das Gelände. Mal sehen, was er dazu sagt, dass hier jemand rumschnüffelt.«
»Ich schnüffel nicht.« Frahm wurde nun lauter. Der Kerl ging ihm inzwischen richtig auf die Nerven. »Ich habe Ihnen gesagt, warum ich hier bin. Wenn Sie das nicht glauben, ist das nicht mein Problem. Ich verschwinde jetzt. Sie können sich ja mein Kennzeichen aufschreiben und Ihrem Chef geben.« Frahm wandte sich ab, um zu seinem Wagen zu gehen.
»Du gehst nirgendwohin.«
Frahm öffnete den Mund, um zu widersprechen, doch ein ratschendes Geräusch hinter ihm, das er nur zu gut kannte, hielt ihn davon ab. Stattdessen hob er langsam die Arme und drehte sich um. Er hatte sich nicht getäuscht, der Kerl hatte eine Pistole durchgeladen und auf ihn gerichtet.
»Ganz ruhig«, sagte er mit ruhiger Stimme. »Es ist alles in Ordnung. Ich bin Polizist. Nehmen Sie die Waffe runter.«
»Ein Bulle?«, fragte der Mann und zielte weiter auf seine Brust.
»Genau. Ich hole jetzt meinen Ausweis heraus.« Frahm führte die rechte Hand langsam zu seiner Hosentasche, ohne sein Gegenüber aus den Augen zu lassen.
»Keine Mätzchen.« Der Mann fasste die Pistole noch einmal nach.
Frahm zog seinen Dienstausweis aus der Tasche und hielt ihn dem Mann entgegen.
»Die Hände bleiben da, wo sie sind.« Er nahm eine Hand von der Waffe, machte einen Schritt auf ihn zu und entriss ihm den Ausweis. Rasch trat er wieder zurück und blickte abwechselnd auf die Ausweiskarte und zu ihm. Dann steckte er mit einem breiten Grinsen den Ausweis ein.
»Sieh an, ein echter Bulle. Das ändert natürlich alles.«
* * *
Erik van der Kolk schloss die Wohnungstür hinter sich und ging in sein Multifunktionszimmer, wie er den Raum, der im Grundriss der kleinen Zweizimmerwohnung eigentlich als Schlafzimmer ausgewiesen war, nannte. In seinen Augen stellte ein Zimmer, das den ganzen Tag leer stand und nur nachts zum Schlafen verwendet wurde, eine absolute Verschwendung dar. Und selbst wenn Niki bei ihm übernachtete, bot die Schlafcouch nebenan im Wohn- und Esszimmer genug Platz für sie beide.
Er ging zu seinem Kleiderschrank, zog sein Jackett aus und hängte es mit einem Kleiderbügel zum Auslüften an eine der Schranktüren. Danach schlüpfte er aus seinen Schuhen und öffnete die Anzughose, deren ungefütterter Stoff unangenehm an der immer noch schweißnassen Haut seiner Beine klebte. Auf dem Friedhof hatten Niki und er in der prallen Sonne gestanden. Der klimatisierte Innenraum in ihrem Mini hatte zwar für etwas Abkühlung gesorgt, jedoch nicht den Schweiß trocknen können.
»Verdammtes Ding.« Fluchend hüpfte er auf einem Bein vor dem Schrank auf und ab, während er umständlich das andere aus dem klebrigen Hosenbein zog. Erst nachdem er auch das weiße Oberhemd, das feucht an Rücken und Brust gepappt hatte, ausgezogen hatte und wieder in Jeans und T-Shirt steckte, fühlte er sich wohler. Er knüllte das Hemd zusammen, warf es in den überquellenden Wäschekorb, der rechts neben dem Schrank stand, und ging zu seinem Schreibtisch an der gegenüberliegenden Seite des Zimmers, wo er einen Blick aus dem Fenster hinunter auf die Straße warf.
Die Bürgersteige waren voller Leben. Wie jeden Freitagnachmittag gingen Menschen durch die umliegenden Geschäfte, um für das bevorstehende Wochenende einzukaufen, bevor es am Samstag zu voll wurde. Van der Kolk entdeckte einen Mann, der gerade erfolglos versucht hatte, einen Bus zu bekommen, und nun wild gestikulierend an der Haltestelle stand. Auf der Straße drängelten sich Radfahrer durch den Verkehr, begleitet vom gelegentlichen Hupen der Autofahrer, die mit diesem Fahrstil nicht einverstanden waren. Er schloss das gekippte Fenster, und sofort wurde es still in seiner Wohnung. Normalerweise störte ihn das nicht, insbesondere, wenn er sich auf seine Arbeit konzentrierte, doch heute hatte die Ruhe etwas von einer Totenstille. Van der Kolk öffnete das Fenster wieder und ließ seinen Blick über das Tohuwabohu auf und rund um den schmalen Schreibtisch wandern, auf dem ausgedruckte Fotos, vollgekritzelte Notizblöcke und Kopien aus Ermittlungsakten lagen, an denen Haftnotizen oder Markierungen in unterschiedlichen Farben klebten. Über die gesamte Breite des Tisches hing eine Pinnwand aus Kork, die mit Zeitungsausschnitten, Notizen und Fotos zugepflastert war, die sich um ein großes Bild gruppierten: das Profilfoto von Najuma Heita.
Van der Kolk mochte das Foto. Es zeigte Najuma, die sich in der Prostituiertenszene von St. Georg Betty genannt hatte, mit dem für sie so typischen unbeschwerten Lachen, das pure Lebensfreude ausstrahlte. Er wüsste niemanden, der sie jemals schlecht gelaunt erlebt hatte.
Vor fast sechs Jahren war er Najuma das erste Mal in St. Georg begegnet, nachdem sie, kurz nach ihrer Ankunft in Hamburg, unweit des Hauptbahnhofs mit einer Freundin bei ihm in eine Routinekontrolle geraten war. Zu der Zeit hatte er als Milieuaufklärer beim Polizeikommissariat 11 am Steindamm gearbeitet. Fröhlich und offen hatte die achtzehnjährige Namibierin bei der Personenüberprüfung erzählt, dass sie nach Deutschland gekommen sei, um hier Medizin zu studieren.
Dann, einige Monate später, inzwischen hatte er zum LKA 41, der Hamburger Mordkommission, gewechselt, hatten sie sich das zweite Mal getroffen. Im Goedeke Michel, einer Kneipe am Hansaplatz, in der er regelmäßig sein Feierabendbier trank, hatte sie an jenem Abend hinter der Theke gestanden.
»Hab jetzt Job bei Piet«, hatte sie stolz erklärt und dabei dem Wirt einen dankbaren Blick zugeworfen.
Später hatten sie sich regelmäßig unterhalten, soweit es der Betrieb in der Kneipe zuließ. Najuma hatte ständig etwas zu berichten, und wenn es nur um die scheinbar nicht enden wollenden Behördengänge oder ihre akribische Vorbereitung auf die Feststellungsprüfung ging. Diese war die Voraussetzung für ausländische Studienanwärter, um überhaupt eine Zulassung beantragen zu dürfen, die zu einem Studium an einer Hamburger Universität berechtigte.
Ein Dreivierteljahr war das so gegangen, bis Piet ihm eines Abends mitgeteilt hatte, dass Najuma gekündigt habe. Angeblich habe sie einen Job gefunden, mit dem sie schneller und mehr Geld verdienen könne.
»Ach Najuma, warum hast du nicht auf mich gehört?«, fragte er leise. Damals hatte er sofort gewusst, um welche Art Job es sich gehandelt hatte und sie tatsächlich ein paar Tage später in der Brennerstraße getroffen. Mehrmals hatte er ihr klarzumachen versucht, wie riskant es sei, in einem Sperrbezirk anzuschaffen, nicht nur für Leib und Leben. Doch auch sein Hinweis, dass sie straffällig würde, wenn man sie erwische, und sie ihr Studium dann vergessen könne, hatte sie nicht davon abgehalten, weiter der Sexarbeit nachzugehen.
Sein Blick schweifte zu dem Kartenausschnitt, der rechts neben Najumas Foto hing, auf dem viele kleine Kreuze die Orte rund um die Alster markierten, an denen im Januar des letzten Jahres Jogger und Spaziergänger in Müllsäcke verpackte Leichenteile gefunden hatten. Wie sich schnell herausgestellt hatte, stammten sie von ihr.
Aufgrund seiner guten Milieukenntnisse hatte der Leiter der Mordkommission die Ermittlungen van der Kolk und seinen Leuten von der Mordbereitschaft 5 übertragen. Doch trotz aller Bemühungen hatten sie den Fall bis heute nicht aufklären können, und so war er vor wenigen Wochen bei der Cold-Case-Einheit des Landeskriminalamtes gelandet. Kurz vorher hatte sich van der Kolk heimlich Kopien aus den Ermittlungsakten gezogen. Noch zu Beginn der Ermittlungen hatte er sich geschworen, nicht eher zu ruhen, bis ihr Mörder zur Strecke gebracht worden war. Von dem Zeitpunkt an widmete er nahezu jede freie Minute seinen Recherchen nach einem Täter, der aus Hamburg oder der näheren Umgebung kommen und über die Möglichkeit verfügen musste, einen menschlichen Körper nicht nur verschwinden zu lassen, sondern ihn auch einzufrieren und dann zu zersägen. Ein Täter, der einen dunklen Kombi fuhr. Ein Täter, der nach wie vor die Nadel im Heuhaufen war.
Van der Kolk seufzte und riss sich von den Gedanken an Najuma los. Für heute hatte er genug von Toten und ihren Schicksalen. Er musste weg. Irgendwohin, wo es Ablenkung gab. War er anfangs noch froh gewesen, dass Niki an diesem Wochenende Bereitschaftsdienst hatte und er mit seinen Gefühlen allein sein konnte, vermisste er jetzt ihre Gesellschaft.
Auf dem Weg ins Wohnzimmer dachte er an ihre Worte und nahm sein Smartphone von dem niedrigen Couchtisch, wo er es nach seiner Rückkehr abgelegt hatte. Vielleicht wollte Patrick ja jetzt mit ihm sprechen. Er wählte aus der Kontaktliste seine Nummer, doch bereits nach dem vierten Freiton sprang die Abwesenheitsnachricht an.
»Dann eben nicht.« Er steckte das Smartphone in die Hosentasche und nahm seinen blauen Hoodie vom Haken an der Garderobe. Was er jetzt brauchte, waren ein paar Schnäpschen unter Leuten.
Er zog das Haargummi aus seinen schulterlangen lockigen Haaren, strich sie mit beiden Händen zurück und band sie erneut hinter dem Kopf zu einem Zopf zusammen. Dann setzte er seine verfilzte Dockermütze auf, ohne die er so gut wie nie aus dem Haus ging, und verließ die Wohnung.
Im Erdgeschoss begegnete er einem jungen Pärchen, das vor den Hausbriefkästen stand und sich mit einem Mann im Anzug unterhielt, der einen Aktenkoffer trug. Offenbar handelte es sich bei ihnen um Interessenten für die seit Kurzem frei stehende Erdgeschosswohnung und den Makler.
»Das geht gar nicht«, sagte die Frau verärgert. »Sie wollen uns im Ernst eine solche Bruchbude anbieten?« Ihr Blick fiel auf van der Kolk. Sie verzog abschätzig ihr Gesicht, während sie ihn musterte. »Das ist nun wirklich nicht unser Niveau.«
Ihr Begleiter nickte zustimmend.
Van der Kolk hob im Vorbeigehen den Daumen.
»Wie recht Sie haben«, sagte er. »Hier wohnen nämlich Menschen mit Charakter.«
Er öffnete die Haustür, warf den dreien noch einen kurzen belustigenden Blick zu und trat auf die Straße.
»Das ist nun wirklich nicht unser Niveau«, sagte er mit gekünstelter Stimme. Sucht euch doch woanders eine Wohnung, dachte er. Warum drängten auf einmal alle nach St. Georg? Noch vor Kurzem hätten solche Leute nicht im Traum daran gedacht, ihren Fuß überhaupt in das bunte und multikulturelle Viertel hinter dem Hauptbahnhof zu setzen, das von Drogenhandel, Prostitution und Clankriminalität geprägt war. Meinte man tatsächlich, dass sich das so einfach änderte, wenn nur ein Gebäude aus der Vor- und Nachkriegszeit nach dem anderen abgerissen wurde und modernen Neubauten mit Eigentumswohnungen Platz machten? Zwar schossen bereits jetzt überall die Mietpreise in die Höhe und vertrieben alteingesessene Bewohner, die sich das nicht mehr leisten konnten, jedoch nicht diejenigen, die sich im Milieu eine goldene Nase verdienten. War das das neue St. Georg, in dem gut situierte Familien mit Drogenbaronen und Menschenhändlern Seite an Seite, Haus an Haus lebten?