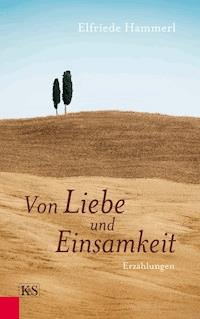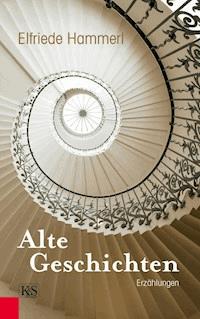
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Kremayr & Scheriau
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Zwischen Melancholie, Aufbegehren und Wut: Elfriede Hammerl sucht nach den verdrängten Ängsten, Nöten und Wünschen ihrer langsam in die Jahre kommenden Figuren. Wenn die Zeit, die noch bleibt, weniger wird, kommen Abgründe zum Vorschein: Ob Beate, Carola oder Kurt – sie alle kämpfen an gegen verpasste Chancen, Rollenbilder und die Erinnerung an die Verflossenen. Im Verborgenen werden die Säbel gewetzt und auf dem Parkett der schon lang erloschenen Zuneigung wird Stellung bezogen – Mann gegen Frau, Töchter gegen Mütter, Ehefrau gegen Ex-Geliebte, Jung gegen Alt. Die Erzählungen in "Alte Geschichten" widmen sich den unangepassten Alten, den Angepassten, die aus ihrer Rolle ausbrechen wollen, und den gerade noch Jüngeren, die sich fragen, wie sie mit dem Näherrücken des Alters umgehen sollen. Und natürlich geht es auch um die alten Geschichten, die irgendwann einmal die Soll- und Habenseite einer Lebensbilanz ausmachen. Elfriede Hammerls "Alte Geschichten" betreiben literarische Feldforschung auf dem Territorium des Lebensabends.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 246
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Elfriede Hammerl
Alte Geschichten
Erzählungen
www.kremayr-scheriau.at
eISBN: 978-3-218-01117-4
Copyright © 2018 by Verlag Kremayr & Scheriau GmbH & Co. KG, Wien
Alle Rechte vorbehalten
Schutzumschlaggestaltung: Sophie Gudenus
Unter Verwendung eines Fotos von Justyna Troc / shutterstock
Typografische Gestaltung und Satz: Michael Karner, Gloggnitz
Inhalt
Die Zeckenimpfung
Campari Orange
Die bessere Gefährtin
Das andere Leben
High Society
Die Nachbarin
Hass
Das Interview
Die Feinde
Die Zeckenimpfung
In den vergangenen Tagen habe ich gleich zweimal Männer erblickt, die aussahen wie Bruno, große, behäbige Männer mit dunklen Haaren und einem dunklen Schnauzbart, und mit dieser heiteren, soliden, zuverlässigen Ausstrahlung, die Bruno für mich hatte. Das klingt ein wenig seltsam, denn ich kann nicht erklären, wie es kam, dass zwei wildfremde Menschen einen solchen Eindruck auf mich machten, aber es war so.
Schnauzbärte haben ja leicht etwas Lächerliches und auch an Bruno hat das dicke Büschel schwarzer Haare unter seiner Hakennase ein wenig komisch gewirkt, aber irgendwie passte es zu ihm, zu seiner liebenswerten, kauzigen Art und seinem offenkundigen Mangel an schnöselhafter Eitelkeit.
Beide Male, als die Männer, die mich an Bruno erinnerten, zufällig in mein Blickfeld gerieten, zuckte ich kurz zusammen, obwohl keiner der Männer wirklich Bruno sein konnte, denn Bruno ist tot. Ich weiß das, weil ich auf seine Todesanzeige gestoßen bin, zufällig, nachdem ich viele Jahre nichts von ihm gehört und nicht an ihn gedacht hatte. Seine Todesanzeige in der Zeitung, für die er jahrelang gearbeitet hatte, sprang mir in die Augen, und ich spürte einen sehr persönlichen Schmerz. Ich ertappte mich sogar bei dem Gedanken: Wenn damals etwas geworden wäre aus uns beiden, dann wäre ich jetzt Witwe. Dann hätte dieser Tod mein Leben gerade schlagartig verändert, ich säße nicht gelassen bei meinem Frühstückskaffee, mit heiteren (na ja, vergleichsweise heiteren) Plänen für den Abend, sondern tränenblind, betäubt vom Kummer. Und dennoch tat es mir leid, dass nichts aus uns geworden war; mit ihm gelebt zu haben, wäre wahrscheinlich schön gewesen, dachte ich mir.
Nicht, dass zwischen uns jemals etwas vorgefallen wäre, das Anlass zu solchen Fantasien geboten hätte. Bruno war ein Kollege, mehr nicht, älter als ich und ranghöher, er imponierte mir durch sein Können und durch die Gelassenheit, mit der den Überblick behielt, auch wenn wieder einmal der Hut brannte. In den Redaktionskonferenzen lobte er meine Arbeit und hörte mit offenkundigem Wohlwollen meinen Diskussionsbeiträgen zu.
Privat gab es keine Annäherung, und doch dachte ich, dass ich ihm gefiele und dass er Interesse an mir hätte. Sagen wir so: Ich wartete nicht direkt darauf, dass er die Initiative ergriff, aber ich hätte mich nicht gewundert, wenn er es getan hätte. Unsere Beziehung (sofern dieses Wort überhaupt dafür passt) war in einem allenfalls andeutungsweisen Stadium, das alles offen ließ, ich ging spielerisch durchs Leben damals und hatte viele Eisen im Feuer, Bruno war vielleicht eine Option unter mehreren, vielleicht auch nicht. Dass ich selber initiativ geworden wäre, war undenkbar, das wurden Mädchen zu jener Zeit nicht, schon gar nicht, wenn sie hübsch und umschwärmt waren. Außerdem war ich schüchtern.
Bruno war, vermute ich, auch schüchtern. Vielleicht dachte er, er hätte keine Chancen bei mir. Vielleicht kam ich ihm zu flatterhaft vor. Vielleicht war ich ihm zu glamourös.
Das klingt jetzt eingebildet, aber so ist es nicht gemeint, denn ich selber empfand mich nie als glamourös. Doch ich habe später von etlichen Männern, mit denen ich Jahre zuvor studiert oder gearbeitet hatte, zu hören bekommen: Du hast mir gut gefallen damals, aber ich habe mich nicht an dich herangetraut. Du bist mir so unerreichbar erschienen.
Das lag an meiner Schüchternheit, die ich angestrengt zu tarnen versuchte. Ich gab viel Geld für Kleidung aus (zu viel Geld, gemessen an meinem Einkommen) und bemühte mich, unbefangen und lässig zu wirken. Ich spielte die Tochter aus gutem Haus, perfekt gestylt, eloquent, sarkastisch, selbstsicher, und offenbar spielte ich diese Rolle überzeugend, obwohl ich mich ständig im Verdacht hatte, durchschaubar zu sein.
Meine Kindheit und meine Schulzeit waren alles andere als glamourös gewesen, ich trug die abgelegte Kleidung meiner älteren Schwester auf und musste, wenn ich aus dem Haus ging, meine kleine Schwester und meine Pflegebrüder mit mir schleppen. (Nicht immer dieselben, denn die Pflegebrüder – aus unerfindlichen Gründen landeten stets Jungen bei uns – wechselten.) In unserer ordentlichen, an christlichen Werten orientierten Familie ging es streng und karg zu. Meine Eltern sahen es nicht gern, dass ich mich, kaum erwachsen, einem Milieu zuwandte, das in ihren Augen fragwürdig war – Kunstschaffende, Zeitungsmenschen, Filmleute –, aber sie legten mir keine Steine in den Weg. Das hielt ich ihnen zugute.
Von Bruno hörte man dann auf einmal, dass er mit einer Reporterin verbandelt sei, die für eine regionale Tageszeitung arbeitete. (Wir von der überregionalen Presse schauten immer mit einer Spur Herablassung auf solche Blätter.) Ich fand sie mäßig hübsch und ein bisschen langweilig, aber vielleicht war das der Grund, warum er ihr gegenüber nicht schüchtern war. Ich gebe mich natürlich nicht dem Wahn hin, dass Bruno in Wahrheit mich liebte und sie zweite Wahl für ihn war, aber ich halte es für möglich, dass sich Bruno in mich verliebt hätte, wenn es mir eingefallen wäre, ihn zu ermutigen, bevor er sich in sie verliebte.
Ehe man sich’s versah, waren die zwei verheiratet. Brunos Frau hängte ihren Beruf an den Nagel und schenkte dem Gatten drei Söhne. Ich hätte nicht mit ihr tauschen mögen. Aber vielleicht wäre es, denke ich heute, gar nicht nötig gewesen, dass sie ihren Beruf aufgab, Bruno hätte sich bestimmt auch für eine andere Lösung gewinnen lassen.
Für mich blieben die Draufgänger, die Glücksritter, die Eroberer. Die ließen sich von meinem vermeintlichen Glamour nicht abschrecken, im Gegenteil. Solche wie Bruno machten einen Bogen um mich, solche wie Frank blieben an mir dran und kriegten mich herum. Ich wollte mich ja hingeben, ich wollte ja nicht allein bleiben, ich war ja gar nicht unerreichbar.
Es hätte mit einer einfachen Antwort auf eine einfache Frage abgetan sein können.
Warst du schon bei der Zeckenimpfung?
Ja, war ich.
Oder: Nein, aber ich gehe nächste Woche.
Stattdessen sagt Frank: Nein, das brauch ich nicht.
Was soll das heißen?
Nicht notwendig.
Sagt wer?
Sage ich. Alles nur Panikmache. Alle diese Impfungen und was weiß ich. Reine Abzockerei. Ich mache da nicht mit.
Du hast plötzlich ideologische Bedenken gegen die Zeckenschutzimpfung?
Und keine Zeit.
Ich schaue ihn verblüfft an. Frank hat sich mit seiner Arbeitgeberin, der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt, vor zwei Jahren auf eine Art Teilpensionierung geeinigt, was ihn in die Lage versetzt, bei ausreichenden Bezügen ausgiebig Golf zu spielen. Dass ein Impftermin seine Agenda sprengt, ist schwer vorstellbar.
Du bist so sehr mit wichtigen Verpflichtungen zugepflastert, dass du keine Zeit für eine Zeckenimpfung hast?, frage ich.
Wir sitzen in einem griechischen Lokal, der Abend hat entspannt begonnen, wenn man davon absieht, dass Frank säuerlich angemerkt hat, ich hätte nicht unbedingt bei einem Griechen reservieren müssen, wo wir uns doch beide nichts aus Souvlaki machen.
Jetzt seufzt er ungeduldig. Geh mir nicht auf den Sack. Ich habe mich erkundigt. Es gibt keine wirksame Impfung gegen Borreliose.
Richtig. Die Zeckenimpfung schützt ja auch vor FSME.
Ist das nicht dasselbe?
Nein. FSME ist die Abkürzung für Frühsommer-Meningo-Enzephalitis.
Machst du jetzt auf Medizinerin?
Nein, aber du hast …
Er unterbricht mich. Ist doch egal, wie das Zeug heißt. Wer kriegt das schon? Die Borreliose ist das Gefährliche, das weiß ich, die hat meinem Cousin fast das Kniegelenk zerstört. Aber davor schützt deine wunderbare ABC-Impfung ja leider nicht.
Ich höre, wie sich meine Stimme ein wenig in die Höhe schraubt. Es ist mir unangenehm, doch ich kann nichts dagegen machen. Meningo-Enzephalitis bedeutet Hirnhautenzündung, sage ich. Wenn du Pech hast, bist du danach gelähmt und ein Pflegefall.
Frank lacht auf. Mein Gott, das wird ja immer ärger mit dir. Du bist eine professionelle Schwarzseherin, weißt du das? Sei doch einmal ein bisschen locker. Freu dich zur Abwechslung am Leben. Geht das nicht?
Unsere alte Rollenverteilung. Ich vorsichtig, korrekt, informiert. Er der sorglose große Junge, der Sprunghafte, der Kreative. Jedenfalls seiner Selbstdefinition nach.
Die Draufgänger erobern Terrain. Sie belegen dich mit Beschlag. Sie machen dir deinen Glamour streitig. Sie wollen im Vordergrund stehen. Sie wollen die Glamourösen sein. Ich hätte mich von Frank trennen sollen, als ich merkte, wie mein Lack abblätterte an seiner Seite. Aber meiner Erfahrung nach wäre Frank ohnehin nur von einem weiteren Frank abgelöst worden. Inzwischen war ich auf Männer abonniert, die mich wieder zu dem machten, was ich hinter meiner schicken Fassade immer gewesen war: die brave, umsichtige große Schwester. Und die kleine Schwester, die einsichtig die Kleider der älteren aufträgt, dazu. Bis heute bin ich Franks Stimme der Vernunft. Frank braucht mich, damit er unvernünftig sein kann, spontan, leichtlebig. Er ist unbekümmert, weil ich das Sich-Kümmern übernehme.
Obwohl: kreativ? Was hat er denn geschaffen in all den Jahren? Wo sind die Früchte seines angeblichen Talents?
Ein paar Jahre hindurch hat er eine nicht besonders tiefsinnige TV-Sendereihe moderiert, das hat ihm eine gewisse Popularität eingetragen. Er sah gut aus (sieht gut aus, sollte ich wohl sagen, aber ehrlich, auch an ihm nagt unübersehbar der Zahn der Zeit) und was er präsentiert hat, stellte keine großen intellektuellen Anforderungen an sein Publikum. Dafür wurde er, wie ich mittlerweile finde, unverhältnismäßig gut bezahlt, was in ihm leider die Überzeugung festigte, dass er das viele Geld wert sein muss.
Lange war ich der Meinung, dass er seine Schwächen durch seinen Charme wettmacht. Frank ist ein gutes Gegengewicht zu mir, sagte ich mir, er bringt mich dazu, das Leben spielerischer anzugehen.
Ohne mich würdest du in Arbeit ertrinken, behauptet Frank gern, ich tue dir gut. Nein, falsch, wörtlich sagt er: Ohne mich würdest du in deiner Arbeit ertrinken, ich tue dir gut.
Das Possessivpronomen macht den Unterschied. Ich ertrinke ja nicht in irgendeiner Arbeit, sondern in meiner. Meine Arbeit ist etwas, das ich mir mache. Freiwillig. Eigentlich wäre es nicht nötig, aber ein innerer Zwang treibt mich. Du machst dir zu viel Arbeit.
Frank sorgt dafür, dass ich meine Arbeit auch einmal auf die leichte Schulter nehme. Er nimmt sie mir nicht ab, aber er packt sie mir auf die leichte Schulter.
Der Abend ist so schön, sagt er, jetzt vergiss diesen Auftrag doch für ein paar Stunden, setz dich mit mir ans Wasser, wir trinken was, wir schauen in den Sonnenuntergang, entspann dich einfach. Und am nächsten Tag sagt er: Gib zu, das war eine gute Idee, gib zu, du hast es genossen.
Und ich sage ja, ich habe es genossen, und rede nicht darüber, dass ich anschließend, als er schon im Bett lag, bis zum Morgen an dem Artikel geschrieben habe, den ich auf sein Geheiß hin vergessen sollte, der aber zeitgerecht fertig sein musste. Während ich schrieb, redete ich mir ein, der Ausflug ans Wasser sei die durchwachte Nacht wert gewesen, aber tatsächlich bin ich nicht mehr in einem Alter, in dem man durchwachte Nächte locker wegsteckt.
Frank steht offen zu seinen Schwächen. Er kann schwach sein, weil ich stark bin. Wieso hast du mich nicht erinnert?, ruft er, wenn er vergessen hat, sein Auto zeitgerecht zur jährlichen Begutachtung zu bringen oder einem seiner alten Freunde zum Geburtstag zu gratulieren oder seinen Pass erneuern zu lassen, wieso hast du mich nicht erinnert, du weißt doch, dass du mein Gedächtnis bist, ohne dich bin ich hilflos.
So ergänzen wir einander in seinen Augen: Er ist ohne mich hilflos, ich würde ohne ihn in meiner Arbeit untergehen; er bringt mich dazu, meine Arbeit liegen zu lassen, im Gegengeschäft soll ich die Aufgaben wahrnehmen, die aus seiner Hilflosigkeit erwachsen. Du weißt doch, ich kann mit meiner Mutter nicht reden, nach zehn Minuten streiten wir, sagte er, als seine Mutter noch lebte, du gehst viel besser mit ihr um, besuch du sie doch.
Im Zweifelsfall soll ich nicht in meinen Pflichten aufgehen, sondern in seinen.
Frank ist es nicht gegeben, sich mit Sachen zu beschäftigen, die Geduld erfordern, Genauigkeit, Zähigkeit, Durchhaltevermögen. Frank ist ein Bruder Leichtfuß, liebenswürdig, oberflächlich und bequem, und über weite Strecken seines Lebens ist er damit durchgekommen. Ich kann nicht behaupten, dass meine Vorsicht belohnt und seine Sorglosigkeit vom Schicksal bestraft wurde. Frank hat sich zeit seines Berufslebens nie überanstrengt und es sind ihm keine Nachteile daraus erwachsen. Er vergisst, die Wohnungstür abzusperren, doch es kommen keine Einbrecher des Weges. Er spaziert auf gut Glück zum Konzerthaus und kriegt einen Parkettsitz für einen ausverkauften Abend, weil ihm eine Besucherin die Eintrittskarte ihrer erkrankten Freundin günstig abtritt. Ich wäre in so einem Szenario die erkrankte Freundin: Tickets rechtzeitig bestellt und trotzdem daheim.
Zur Sicherheit nehme ich bei prognostizierter Schauerneigung einen Schirm mit, doch wenn dann ein Wolkenbruch herunterprasselt, werde ich nass, weil der Schirm nichts taugt, während Frank, gerade in der U-Bahn, vom Gewitter gar nichts mitbekommt.
Frank hält sich also nicht ganz zu Unrecht für Gustav Gans. Wenn ihn sein Glück aber doch einmal verlässt, dann bin ich dran mit der Schadensbegrenzung. Na sowas, sagt er erstaunt, als die Kunststoffschüssel, die er auf der heißen Herdplatte abgestellt hat, stinkend mit dem Ceranfeld verschmilzt. Er betrachtet irritiert, was er da angerichtet hat. Fürs Abtragen der eingebrannten Plastikmasse fühlt er sich jedoch nicht zuständig. Wenn es nach ihm ginge, hätte der Herd in Zukunft einfach eine Kochfläche weniger. Aber er kann sich darauf verlassen, dass es nicht nach ihm geht – ich bin ja auch noch da. Ich bekämpfe Schäden, weil ich nicht mit ihnen zu leben vermag. Sie stören mich. Ich halte sie nicht aus. Frank ist da ganz locker. Frank hat die besseren Nerven. Locker kann er mit Schäden leben, weil ich es nicht kann. Wie lange würde er es aushalten mit einem devastierten Herd? Ich möchte es gar nicht herausfinden.
Bevor wir in diese leidige FSME-Debatte gerieten, sagte ich: Christoph will morgen Abend vorbeikommen.
Wieso?, fragte Frank, der sich Souvlaki bestellt hatte, um mir vor Augen zu führen, welches Opfer ihm meine gedankenlose Reservierung beim Griechen abverlangte.
Um uns zu sehen, nehme ich an, antwortete ich.
Kommt Margret mit?
Nein, Margret fährt zu ihren Eltern. Die wir übrigens endlich wieder einmal einladen sollten.
Frank verzog das Gesicht. Wenn du dir die Mühe machen willst …
Nein, will ich nicht. Aber es würde sich gehören.
Was für langweilige Schwätzer. Verlorene Zeit.
Du kannst schlecht verlangen, dass Christoph seine Freundinnen danach aussucht, ob uns ihre Eltern gefallen, sagte ich lachend.
Frank lachte auch. Na gut. Wie du glaubst. Aber rechne nicht mit meiner Hilfe beim Kochen.
Du warst mir noch nie eine Hilfe beim Kochen, sagte ich. Und wenn du mich weiter ärgerst, gibt es Souvlaki.
Wir haben einen Sohn, er ist inzwischen erwachsen. Frank war unserem Kind ein fröhlicher, aber etwas unberechenbarer Spielkamerad, darauf bedacht, ihn an lustigen Einfällen zu übertreffen. Regeln sind dazu da, dass man sie missachtet!, predigte er und war stets auf Christophs Seite, wenn sich dessen Regelverstöße gegen andere richteten, zum Beispiel gegen mich, gegen seine Lehrerinnen, gegen Polizisten, gegen amtliche Jugendverbote aller Art. Sobald unser Sohn jedoch Frank den Gehorsam verweigerte, wurde Frank sehr schnell sehr ungehalten. Dann wandte er sich von ihm ab und empört mir zu: Kannst du mir erklären, was in dem Burschen vorgeht? Wie ein enttäuschendes Spielzeug warf er ihn mir gewissermaßen vor die Füße: Da, nimm du ihn, ich will ihn nicht mehr. Das sagte er nicht mit diesen Worten, aber sein Verhalten lief darauf hinaus. Ich war, mehr oder weniger, eine alleinerziehende, verheiratete Mutter, und so ist es geblieben.
Bis heute wendet sich Christoph in ernsten Angelegenheiten und wenn er etwas braucht, an mich. Papa ist für unbeschwerte Kumpel-Unternehmungen zuständig. Falls Papa Zeit hat, denn anders als ich war Frank nie bereit, seine Zeitpläne auf die Bedürfnisse unseres Sohnes abzustimmen. Christoph nimmt es ihm jedoch nicht übel. Er hat ja eine verfügbare Mutter.
War ich betrübt, als Bruno mit dieser Kollegin eine Familie gründete? Nein, nicht die Spur. Ich fand mich damals viel zu jung, um schon an Familiengründung zu denken, ich wollte noch etwas erleben, ich wollte Spannung und Abwechslung und Aufregung und Abenteuer. Na ja, Abenteuer erlebte ich nicht wirklich, eigentlich war dieses Herumziehen und Festefeiern und Neue-Leute-Kennenlernen, von dem ich hoffte, dass es abenteuerlich wäre, nicht wirklich aufregend, aber eine Zeit lang ganz unterhaltsam.
Nach meiner damaligen Überzeugung beneideten mich die Frauen der Brunos um meine spannenden Erlebnisse an der Partyfront und um die tollen Männer, die mich umschwirrten und von denen am Ende einer dann Frank war, nachdem sich zwei stadtbekannte Womanizer als beziehungsunfähig erwiesen hatten. (Ich bin beziehungsunfähig, sagten sie, als wäre das ein eleganter genetischer Defekt, der auf eine erlesene Ahnenreihe von bereits beziehungsunfähigen Herzensbrechern verweist.) Frank war auch ein Womanizer, aber zum Glück beziehungsfähig.
Wir einigten uns auf eheliche Treue, als wir heirateten, und hielten dieses Versprechen insofern ein, als wir unserer Ehe treu geblieben sind. Ich hatte in all den Jahren ein paarmal bedeutungslosen Sex mit anderen Männern, und ich vermute, dass auch Frank fremdgegangen ist, aber da wir uns nicht mit gegenseitigen Geständnissen quälten, leben wir nach wie vor in aufrechter ehelicher Gemeinschaft. Die Frauen rannten Frank während seiner Glanzzeit zwar geradezu die Tür ein, doch ich kann mir vorstellen, dass das in gewisser Weise kontraproduktiv war. Frank möchte erobern und nicht zu Fall gebracht werden.
Ein paarmal habe ich mich von Frank in Gedanken getrennt, denn das mit dem Charme, der die Waage letztlich zu seinen Gunsten ausschlagen lässt, klappt schon lange nicht mehr, zumal er an mich kaum noch Charme verschwendet.
Wenn ich mir dann aber überlegte, wie es wäre, ohne ihn zu leben, wurde mir bang. Er ist mir vertraut, ich bin an ihn gewöhnt, und ich dachte, dass ich ihn vermissen würde. Ich habe keine Ambitionen, noch einmal von vorn anzufangen. Dass mir in meinem Alter einer über den Weg läuft, für den sich die Mühen eines Neubeginns lohnen, ist sowieso unwahrscheinlich.
Die Vorstellung, dass Frank zu einem Fremden würde, dem ich eines Tages begegnete wie einem flüchtigen Bekannten, trieb mir Tränen in die Augen.
Nein, ich gehe nicht zu dieser blöden Impfung, sagt Frank jetzt. Und nun lass mich damit in Ruhe.
Lass mich damit ich Ruhe. Ein oft gehörter Satz.
Deine Mutter wird die Badewanne nicht mehr benützen können, wenn sie aus dem Krankenhaus kommt. Wir sollten uns um eine Dusche kümmern.
Ach was, das klappt schon. Kannst du mich jetzt bitte in Ruhe lassen?
(Es klappte nicht. Nachdem sie dann beim Versuch, in die Wanne zu steigen, stürzte und sich zwei Rippen brach, sorgte ich für den Einbau einer Dusche.)
Du musst das mit der Einkommensteuer klären. Was du zusätzlich verdienst, musst du deklarieren.
Ich hab jetzt wirklich Wichtigeres im Kopf als diesen bürokratischen Kleinkram. Lass mich bitte in Ruhe.
(Die Steuernachzahlung fiel geschmalzen aus. Wir stornierten unseren Urlaub in der Camargue. Frank klagte, ich hätte ihn warnen sollen.)
Bist du sicher, dass du diesen Werbespot machen darfst? Hast du dir deinen Rundfunkvertrag angeschaut?
Den muss ich mir nicht anschauen. Natürlich geht das. Kannst du bitte einmal Ruhe geben?
(Der Werbespot wäre fast das Ende von Franks Fernsehkarriere gewesen.)
Frank lässt sich also nicht impfen. Na und? Seine Entscheidung. Trotzdem erfüllt mich plötzlich eine unbändige Wut. Seine Entscheidung? Von wegen. Wahrscheinlich hat er ja Glück und es passiert ihm nichts. Was aber, wenn doch?
Blitzschnell beginnt mein Hirn Bedrohungsszenarien abzuspulen, ich kann es nicht verhindern. Ich sehe mich an Franks Krankenbett, am Bett eines hilflosen Pflegefalls. Sein Leben ist verpfuscht, meines auch. Und nur, weil er sich weigert, zu einer simplen Impfung zu gehen.
Er ist leichtsinnig und ich muss es vielleicht büßen.
Er setzt seine Gesundheit aufs Spiel, und wenn er verliert, verliere ich auch. Niemand fragt mich, ob ich mitspielen will, aber alle werden erwarten, dass ich bei ihm bleibe, mich um ihn kümmere, ihn versorge, mich seiner Pflege widme, wenn er bei diesem Spiel die Arschkarte zieht.
Man würde glauben, dass ich froh sei, ihn pflegen zu dürfen, weil ich froh wäre, dass er wenigstens am Leben ist. Ich würde aber nicht froh sein. Vielleicht wäre ich ganz im Gegenteil froh, wenn er nicht mit dem Leben davonkäme. Vielleicht wäre ich froh, wenn wenigstens sein Leben als Pflegefall bald zu Ende ginge. Und zwar nicht um seinet-, sondern um meinetwillen.
Aber ich dürfte zu niemandem etwas darüber sagen. Ich müsste verschweigen, dass es mich nicht freut, dass er wenigstens am Leben ist. Ich müsste verschweigen, dass ich ihn hasse, weil ich ihn pflegen soll. Ich müsste meine Schuldgefühle verschweigen. Auch dafür würde ich ihn hassen.
Vielleicht würde ich ihn ja in ein Heim geben können. Ich könnte ein gutes Pflegeheim für ihn suchen. Das wäre teuer. Aber lieber Tag und Nacht arbeiten, um einen guten Heimplatz bezahlen zu können, als Tag und Nacht an einen Pflegefall gekettet zu sein.
Freilich müsste ich mit Vorwürfen rechnen, wenn ich ihn in ein Heim gäbe. Tag und Nacht würde ich für ihn arbeiten und wäre doch eine herzlose Schlampe, die ihn in seinem Unglück allein lässt, auch wenn er sein Unglück leichtfertig provoziert hat.
Was anderes wäre es ja, wenn er nicht mutwillig, sondern ohne sein Verschulden ins Unglück geriete. Durch einen Unfall zum Beispiel. Ich würde ihn auch dann nicht pflegen wollen, aber ich würde es tun, ohne ihn dafür zu hassen. Das wäre ein Unterschied. Bestimmt. Ich wäre wütend auf das Schicksal, aber nicht auf ihn.
Wäre ich dann froh, dass er mit dem Leben davongekommen ist?
Ich weiß es nicht. Je nachdem. Ist einer, von dem nur noch physische Überreste da sind, überhaupt mit dem Leben davongekommen? Und überträgt sich die Zuneigung, die man für den hatte, der er vorher war, automatisch auf das, was von ihm noch übrig ist?
Ich kann es mir nicht vorstellen. Aber in diesem Fall hätte ich das Gefühl, ich wäre es Frank schuldig, so zu tun als ob.
Einem Frank hingegen, der sich ohne Notwendigkeit einem Risiko aussetzt, für das ich dann hafte, dem bin ich doch wohl gar nichts schuldig.
Schau nicht so böse, sagt Frank kauend. Dafür, dass er Souvlaki nicht mag, schaufelt er ganz beherzt in sich hinein.
Ich sehe, es schmeckt dir, sage ich.
Er grinst. So bin ich. Immer freudig zu einem Opfer bereit.
Bruno hat sich bestimmt regelmäßig impfen lassen, ganz ohne Trara. Die Brunos sind verantwortungsbewusst. So wie ich. Ich bin ein weiblicher Bruno. Aus Bruno und mir konnte nichts werden, weil wir aus dem gleichen Holz geschnitzt waren. Bruno hat mich nicht zu glamourös gefunden, sondern sich zu ähnlich. Er hat mich durchschaut. Eine wie ich. Kenne ich schon. Das fand er vielleicht langweilig. Obwohl ich nicht begreife, was an seiner Frau aufregender gewesen sein soll.
War Bruno pflegebedürftig, bevor er starb? Hat Brunos Frau ihn gerne gepflegt, falls er gepflegt werden musste, froh darüber, dass er noch da war, solange er da war? Ach nein, er sei plötzlich und unerwartet gestorben, hieß es in der Todesanzeige.
Trotzdem. Hat Brunos Frau ihn ohne aufgestauten Zorn umsorgt und geliebt, weil Bruno liebenswerter war als Frank? Oder weil sie ein besserer Mensch war als ich? Oder sammelt sich in jeder langen Beziehung unabänderlich zerstörerischer Groll an, der lange im Hinterkopf verräumt wird, bis plötzlich ein Anlass, ein scheinbar nichtiger vielleicht, ihn hervorbrechen lässt? Das vergesse ich dir nie, das verzeihe ich dir nie, sowas? Vielleicht sterben manche einfach, ehe der Anlass da ist, der den finalen Grollausbruch provoziert, und das Ganze gilt dann als lange, glückliche Ehe?
Wenn du dir die Mühe machen willst. Nein, will ich nicht. Ich will mir keine Mühe machen. Ich will in keiner Arbeit mehr ertrinken, egal, wer sie mir macht.
Wenn du nicht zur FSME-Impfung gehst, verlasse ich dich, sage ich zu Frank.
Er lacht. Er hält es für einen Scherz.
Campari Orange
Campari Orange, den hat meine Frau auch immer genommen.
Dieser Satz, gleich zu Beginn ihrer Bekanntschaft, hätte ihr zu denken geben sollen, fand Beate.
Den hat meine Frau auch immer genommen! Wehmütig. Der Abend blasslila und lau, aber jeder schöne Moment der Erinnerung an die Verblichene geweiht. Er sagte nicht meine verstorbene Frau, sondern meine Frau, obwohl sie zu diesem Zeitpunkt schon mehrere Jahre tot war. Na ja. Drei, genau genommen. Zweieinhalb, noch genauer. Treue über den Tod hinaus.
Zweieinhalb Jahre, das war eine angemessene Trauerzeit, hatte Beate ursprünglich gedacht, nicht zu wenig und nicht zu viel, nach zweieinhalb Jahren Trauer konnte man bereit sein für einen Aufbruch ins Neue. So verhieß es jedenfalls die Küchenpsychologie. Beate fehlte eine derartige Erfahrung. Zwar waren zwei Männer, mit denen sie eine Liebesbeziehung gehabt hatte, mittlerweile gestorben, aber da es sich um Ex-Lover handelte, riss ihr Tod keine allzu schmerzliche Lücke in ihr Leben. Man war nur noch in losem Kontakt gewesen. Manchmal, wenn ihr einfiel, dass sie Jürgen oder Bernd nie wiedersehen würde, überkam sie sanftes Bedauern; im Grunde galt es aber mehr der bestürzenden Einsicht in die Endlichkeit des Lebens als dem Verlust der beiden.
Sie war nicht auf eine Ferienbekanntschaft aus gewesen, als Paul sie auf der Hotelterrasse ansprach. Darf ich Sie auf einen Drink einladen?
Warum nicht?, antwortete sie.
Er war ihr schon nach ihrer Ankunft aufgefallen, denn er war ein attraktiver Mann. Aber sie war für ein paar Tage ans Meer geflogen, um allein zu sein und in Ruhe genau das zu tun, wonach ihr gerade war. Sie hatte sich danach gesehnt, einmal nicht reagieren, antworten, Erwartungen entsprechen, funktionieren zu sollen. Sie hatte einen fordernden Beruf und Kinder, die zwar längst keine Kinder mehr waren, aber immer noch ihre Aufmerksamkeit beanspruchten. Ihre letzte Beziehung zu einem Mann lag zwei, drei Jahre zurück, sie hatte sich unter Wut und Tränen von ihm getrennt. Als die Wut verraucht war, bemerkte sie, dass es ihr gut ging allein. Sie wollte keine Familie mehr gründen. Sie brauchte sich und anderen nicht mehr zu beweisen, dass sie imstande war, einen Mann an sich zu binden. Es gab keine Notwendigkeit mehr, eifersüchtig und misstrauisch zu sein, auch das war erleichternd. Und Sex war ihr nicht mehr so wichtig wie ehedem. Der Verzicht auf die Suche nach einem potenziellen Partner – die ihre Single-Phasen meistens dominiert hatte – war so etwas wie eine Befreiung.
Warum nicht?, sagte sie zu Paul, und so war es auch gemeint. Es sprach nichts dagegen, mit einem attraktiven Mann einen Sundowner zu trinken, und es sprach nichts dafür, dieser Einladung eine besondere Bedeutung beizumessen. Aber genau darauf war es hinausgelaufen. Zu seiner Mitteilung, auch seine Frau habe immer Campari Orange genommen, hatte sie höflich gelächelt und sich einen Kommentar verkniffen. Campari Orange war ja nun wirklich keine besonders originelle Wahl. Dass Pauls verstorbene Frau ihn gern getrunken hatte, zeugte nicht von Seelenverwandtschaft und sagte nichts über sie aus.
Der selige Zustand der Ahnungslosigkeit, was die Lebensgewohnheiten von Pauls Frau betraf, war Beate allerdings nicht lange erhalten geblieben. Bald wusste sie mehr über ihre Vorgängerin, als sie jemals erfahren hatte wollen. Keine schmutzigen Geheimnisse, leider. Vielmehr war sie überinformiert, was vergangene Alltagsbanalitäten betraf. Der Alltag seiner verstorbenen Frau war an die vierzig Jahre auch Pauls Alltag gewesen, und wenn Paul über sein Leben sprach, dann sprach er über sein Leben mit Melanie (so hatte seine Frau geheißen) und Melanies Eltern, Brüdern, Schwägerinnen, Nichten und Neffen. Die Familie war Melanie und Paul sehr wichtig gewesen, und da sie keine eigenen Kinder hatten, investierten sie ihre elterlichen Gefühle in die Kinder von Melanies Brüdern. Beates Kinder weckten keine väterlichen Gefühle in Paul, die kannte er ja auch nicht lange genug.
Paul hatte Beate vom ersten Moment an umworben. Zielstrebig war er davon ausgegangen, dass sie sich wie er nach Zweisamkeit sehnte. Er hatte sie, das wurde ihr erst später klar, bedauert, weil sie allein unterwegs gewesen war. Während sie ihm ahnungslos gegenübersaß, fröhlich, selbstsicher, unabhängig (so zeigte sie ihr Selbstbild), hatte er beschlossen, sie aus ihrer vermeintlichen Einsamkeit zu retten. Er sah sich als Erlöser.
Beate nahm es ihm zunächst nicht übel. Wenn einer vier Jahrzehnte symbiotisch mit einer Ehefrau verbunden gewesen war, kann er, sagte sie sich, vielleicht nicht anders, als in der Symbiose die einzig natürliche Lebensform zu sehen.
Aber warum bemerkte er noch immer nicht, dass Beate aus einem anderen Holz geschnitzt war? Inzwischen hätte er doch herausgefunden haben müssen, dass ihr Leben, ehe sie ihn traf, keineswegs unglücklich gewesen war.
Okay, ganz falsch lag er nicht mit seiner Selbsteinschätzung als in gewisser Weise rühmliche Ausnahme. Die Männer, an denen Beate in der Vergangenheit Gefallen gefunden hatte, zeichneten sich nicht unbedingt durch Treue oder Verlässlichkeit aus. Sie waren originell, interessant, charmant, egozentrisch und häufig unaufrichtig. Beate hatte einen Hang zu Partnern, die diese Bezeichnung nicht wirklich verdienten.
Einen Hang oder einfach kein Talent zum Aufspüren der Braven, Zuverlässigen, mit denen man unbeschadet zusammenleben konnte? Früher hatte Beate dazu geneigt, sich für unbegabt zu halten, was den sicheren Griff nach anständigen, für stabile Beziehungen geschaffenen Männern betraf. Seit einiger Zeit hegte sie jedoch Zweifel, dass ihr die Windhunde bloß passiert waren. Windhunde hatten ihre Qualitäten. Zum Beispiel hüteten sie sich, einen mit Erzählungen über ihr Vorleben zu strapazieren.