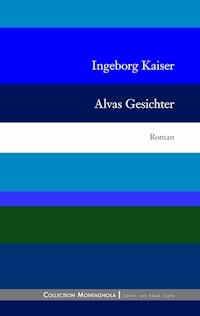
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ingeborg Kaisers Roman kreist um die Themen Vergänglichkeit, Tod, Alter und Sucht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 139
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
1
Die rasenden Scheibenwischer erinnern an das vergebliche Gezappel eines Insekts im Wassersog. Ich sehe zu, als sei es ein Kampf zwischen Natur und Technik, sein Ausgang offen. Ein dichter Schnurregen verhängt die Sicht, macht den Fahrer wie blind, und es scheint, das Taxi nähme die Haarnadelkurven ganz ohne Regie. Rasche Wasser überfluten die Bergstrasse, machen das Auto zum Amphibienfahrzeug.
Vermutlich erreichen wir das Ziel, aber möchte ich ankommen? Meine Neugier braucht keinen Ortswechsel. Lieber würde ich wie ein Baum anwurzeln und am Ort den Stürmen widerstehen. Doch soll es im südamerikanischen Dschungel eine Baumart geben, die ihren Standort wechsle, sich weiterbewege. Womöglich kann sie nur so überleben.
Schon sehe ich mich am Rand der Strasse das Gepäck buckeln und die wenigen, aber hohen Tritte zum Tor nehmen. Der Löwe am Eingang ist zu übersehen, ein starrer Wächter, der seinen erhobenen Schweif bestaunt. Das schmiedeeiserne Tor lässt sich aufstossen, gähnt vernehmlich dabei. Ein Granitpfad führt tiefer in den Garten, steigt unmerklich an. Ich komme mir als Lastesel vor, der sich überladen Schritt für Schritt vorschiebt. Palmkolonien am Weg, mächtiger Bambus, Kamelien und Lorbeer. Das hohe Gras regengepeitscht. Feigenbäume vom Efeu umklammert. Bergseitig ein steil ansteigender Mischwald, von einer Zyklopenmauer abgewehrt.
Mein Gefühl, aus der Zeit gekippt und woanders zu sein.
Ein Haus taucht auf, wie aus dem Berg gewachsen mit seinen verschiedenen Ebenen und Treppchen, der Loggia und einem Balkon, von dem eine Julia winken könnte. An seiner schmalen Frontseite ein verwaschenes Fresko, auf einer Palme zwei Tauben, spiegelgleich angeordnet, darunter ein lagernder Löwe. Ich suche den Eingang zum Haus. Eine übervolle Regentonne plätschert, erschrocken jagen zwei Katzen aus dem Schutz der Loggia in die Tiefe eines Bambusgestrüpps. Gleich werden sie ihren Platz zurückerobern, denn mein Schlüssel passt nicht, ich stehe vor der falschen Tür, was mich heiter stimmt. Der Fayencelöwe auf dem Granitpfeiler scheint mir zuzusehen, doch sein alter Blick gibt nichts preis.
Vorsichtig überquere ich das glitschige Brückchen über den Bach, ein tosendes, schlammfarbenes Untier, das sich abwärts wälzt. An einem hölzernen Geländer ziehe ich mich die steilen Granittritte höher in die Dämmerung alter Bäume. Ihre langen Astfinger sind verkrallt, ein Baumdach, auf das der Regen hämmert. Es wird flacher, die Bäume bleiben zurück, und wie durch ein Lichttor zeigt sich wieder ein Haus. Ich entledige mich des Gepäcks und setze mich, vom Dach des Hauses geschützt, auf die Granitbank. An der Hauswand befindet sich eine gusseiserne, bekränzte Mänade als Türklopfer, lange am Verwittern. Es macht keinen Sinn damit zu lärmen, niemand erwartet mich, und der Schlüssel wird diesmal die Tür öffnen. Aber es eilt nicht, ins Haus zu kommen, nichts eilt mehr. Gleichmütig fällt der Regen, verhängt den Blick, macht angenehm träge. Von fern die Glockenschläge, einzeln und spröd, denen ich gespannt nachhorche, eine stockende Erzählung, die mittendrin abbricht, neugierig auf ihre Fortsetzung macht.
Etwas hindert mich, ins Haus zu gehen, erinnert an eine andere Geschichte, in der die Erzählerin einen Zug beim Halt auf freier Strecke verlässt und durch ein kniehohes Schneefeld auf ein einzelnes Haus mit geschlossenen Läden zustapft. Sie weiss nicht, was sie dazu bewegte, es aufzusuchen, ein fremdes Haus, ein Verhandlungsort, zu dem es keinen Schlüssel gibt. Die Vernunft muss kapitulieren, aber nicht die Vorstellung, durch sie kommt die Erzählende ins Haus.
Meine Hand sucht den Schlüssel in der Tasche, umschliesst ihn, als gebe er mir die Gewähr, nicht endlos hier festzusitzen, gebannt vom Rauschen des Regens und bleiern geworden, als würde jemand auf mir hocken, keine Bewegung erlauben. Die Bäume sind nebelverschleiert; feierliche Gestalten, versenkt in sich. Ich möchte schreien, anschreien gegen ihre Geschlossenheit und meine Ohnmacht. Auch die Erzählerin schrie in die Öde, den Eishimmel, ging zur Haustür, die unvermutet nachgab, und stand in einer Halle mit poliertem Pflasterboden. Ich meine zu schreien wie sie, aber die Stimme tönt kraftlos, wie ausgedünnt, und ich fühle mich der Erzählenden von damals unterlegen.
Bemerke den beobachtenden Blick aus dem Blättergewirr. Augen, die mich unverwandt anschweigen und die ich anschweige. Tieraugen, Menschenaugen?, die lautlos wegtauchen, womöglich nur Einbildung waren. Aufgestört gehe ich zur Haustür aus Panzerglas, Vierecke in weissen Rahmen, und schliesse auf.
Noch immer meine ich, dass mir Blicke folgen, aber die langgezogene Diele ist leer, nur das Klopfen des Regens durchschlägt die Stille. Auf beiden Seiten wandhohe Bücherschränke mit Glastüren. Die Bibliothek des Hausherrn, der ein erfolgreicher Maler und Schriftsteller gewesen sei. Eine Fotografie zeigt ihn respektabel und weisshaarig in Hemd und Pullover, nachdenklich eine Pfeife in der Hand. Bei seinem Tod habe man an den Händen noch die Farbspuren seiner letzten Pinselstriche bemerkt.
Das kleine, ebenerdige Haus habe er selbst entworfen. Und die weite Rundterrasse mit dem dreidimensionalen Postkartenblick auf den See, seine Inselchen, besiedelten Ufer, nahen Bergflanken habe er dem steilen Gelände abgetrotzt und dafür riesige Mengen Erde bewegen lassen. Habe mit seiner Frau hier gute Jahre verbracht, von langen Studienreisen durchs Abendland, wie er es genannt habe, unterbrochen. Nach ihrem Tod sei er vereinsamt. Er habe eine Anzahl seiner Werke im Kaminfeuer seines Ateliers verbrannt, doch trotz der Lebenszäsur weitergearbeitet und noch grosse Aufträge ausführen können. Bis zu seiner Reise ohne Wiederkehr. Seitdem ständen Haus und Atelier Künstlern zu Arbeitsaufenthalten offen, wie es sein Vermächtnis bestimmt habe.
Eine lange Karawane von Einzelnen, die sich ins Gästebuch eintragen, ohne nachhaltig Spuren zu hinterlassen, als würde sich über jede Spur eine weitere legen und dadurch alles unleserlich werden. Noch fühle ich mich als Eindringling, noch ist das Haus mit seiner Vergangenheit stärker als meine Gegenwart. Die spanischen Stühle mit den hohen, schwarzen Lehnen um den ovalen, hölzernen Esstisch kommen mir wie eine geschlossene Gesellschaft vor, die keine Besucher braucht. Ich muss ihre Ordnung stören, packe Schreibsachen, Bücher und Power-Book auf den Tisch, das handgeschriebene Ringbuch mit blau gemasertem Kartondeckel, das mich kurz vor der Abreise als anonymer Brief erreichte. Lediglich ein Stempel mit zwei grossen A weist auf den Absender hin. Vermutlich werde ich bald textgierig durch die Seiten wildern und Nonnas Geschichte für Selim hintan stellen.
Damals das Kind auf der Fussbank nahe dem Herd, dem Wassereimer – ein Wasseranschluss fehlte – , in den es kleine Zuckerstücke tauchte, sie aussog und Nibelungensagen las. Zu rasch für den Vater. Auch wenn ihn die Nacherzählung zufrieden stellte, sollte das Kind sich angewöhnen, langsam und vernehmlich zu lesen.
Die Fensterfront, nachtgeschwärzt, spiegelt das Interieur. Ich sehe die strengen spanischen Stühle, einen Kamin, antike Schränke, zwei steife Polstersessel am runden Tisch, seine drei geschweiften Füsse, eine Bauhauslampe und die Lesende im Sessel, die aufschaut und sich und den Raum gespiegelt findet. Ein beleuchtetes Tableau mit einer stillen Darstellerin, das Draussen wegretuschiert, von den Wassermassen ertränkt. Terrasse, Süddschungel, Sterne und See, die Stimmen und Geräusche der Nachttiere. Wie früh oder spät es ist, ob der Tag kommt oder die Nacht bleibt, ist mir eins, ist mir belanglos geworden. Als sei meine Zeit endlos wie ein Ewigkeitsstrom, als seien die Uhren ausser Dienst und gäbe es keine Kalender, würde es genügen zu sagen, dass wieder Herbst sei.
2
Die anonymen Aufzeichnungen sind datiert, aber ohne eine Jahreszahl. Es war der Person wohl nicht wichtig oder nicht klar, dass sie das Ringbuch, made in Sweden, mehr als nur zwölf Monate führen könnte. Doch wurde es sorgfältig ausgesucht, auf Design und Papier geachtet. Auf der ersten Seite wieder der Stempel mit den zwei A-Initialen, Anonymus oder Anonyma? Das Schriftbild in schwarzer Tinte, alterslos und entschieden, kommt mir wie eine Wortmauer vor, die das Gesicht der Person überdeckt. Als ihr vertrautes Gegenüber das Ringbuch, das sie mein Papierväterchen nennt.
Hinter den A-Initialen vermute ich die Gleiche, von der in der dritten Person berichtet wird, als handle es sich um eine andere. Anonyma will sich von ihrer Sucht, von der Trinkerin distanzieren, die sie ablehnt. Und erinnert an eine Bekennende im Beichtstuhl, die gleichzeitig ihr Beichtiger wäre, seine Fragen nach: wann, wie viel, wie oft, allein oder mit anderen? gewissenhaft beantwortete. Das Journal wurde zu ihrer Beichtbibel, in der sie auf der linken Seite buchhalterisch vermerkte, was sie jeweils trank. Täglich das Auflisten von Menge und Art oder einfach: zu viel. Die Wiederholungen stumpfen ab wie eine Litanei, die nicht endet. Aber eindringlich die Aufzeichnungen und Kommentare auf der rechten Seite. Als würde da jemand ständig gegen Stäbe anrennen und ständig verlieren, ohne aufzugeben. Sie trank, ohne zu geniessen, sah der raschen Trinkerin zu, immer wieder befremdet von ihrer blinden Sucht, die zu ihrem Arbeitsleben, zu ihrer Person wenig zu passen schien. Niemand würde in ihr eine Trinkerin vermuten, ausser Lauer. Und vielleicht war es Lauer, seine ständige Nähe, die sie nicht mehr ertrug, den sie als Besetzer, Bewacher empfand. Lauer schien überall zu sein, seinem Kontrollblick schien nichts zu entgehen, was sie ass, wie lange sie schlief oder arbeitete, wen sie traf. Er sei noch imstande, notierte sie, durch die geschlossene Tür ihre Herzschläge zu zählen. Eigentlich lebe Lauer gar nicht oder nur über das Leben anderer. Er sei ein gründlicher Wiederkäuer aktueller Nachrichten, hole sich Sportereignisse, globalen Terror, Naturkatastrophen ins Haus und gebe eingespeichelt alles wieder von sich. Früh wie spät könne er in die immer gleiche Kulisse mit gepflegten Häusern und geparkten Autos spähen, über das hirnrissige Tun ihrer Besitzer lästern, die ständig ihre Autos bewegten oder welken Blättern mit einer Lärmmaschine nachjagten, ihre Gärtchen gegen die Natur trimmten.
Während des Schreibens habe sie laut mitgeredet, es plötzlich bemerkt und erschrocken eingehalten, bis ihr eingefallen sei, dass Lauer sich abgemeldet habe. Lauer melde sich immer ab, hinterlege einen Selbstklebezettel mit einem Stichwort auf der Gangkommode. Gleich habe sie in der Küche ein Wasserglas mit Kochwein gefüllt und gegen Lauer angetrunken, sich wohl gefühlt, als habe sie ihn eben betrogen. Sie betäube sich mit kleinen Schlucken, aber rasend schnell, schrieb sie, wer dazu berauschen sage, betreibe Kosmetik.
Auch Lauer sei wieder aufgetaucht mit irgendwelchen Geschichten, die sie kaum mitbekommen habe, seit langem fungiere sie lediglich als Folie für Lauers Küchenmonologe. Ihre Antwort oder Gegenfrage würde ihn zu verstiegenen Kontras herausfordern – eine Wortspirale, in der beide zu Verlierern würden.
3
Der Regen endlos, als wolle der Himmel die Erde ertränken, ein düsterer Morgen, höhlengleich. Das Haus scheint mir wie eine Arche auf dem Berg, die von einem Paar und seinem Pudel behaust war, aber nun blind zwischen Wolkenbergen treibt. Vor den Fenstern das Wolkengeschiebe, sie stossen aufeinander, türmen sich betondunkel auf, mauern, stürzen ein, zerflattern. Eine Weile zeigt sich das weite Rund einer Terrasse, ein Vordeck, Vorhof vor der jähen Tiefe, die ein Bambusdickicht verdeckt, gegen die Bergseite ein vielarmiger Feigenbaum, seine Tatzenblätter schon gelblich verfärbt. Den steilen Wald wehrt eine hohe Mauer ab, über die geschossartig die stacheligen Kugeln der Kastanien fliegen, dann auf die Granitplatten knallen und ihre schimmerbraunen Früchte enthüllen.
Ich muss lange im Ringbuch der Unbekannten gelesen haben, nahe dem Bett ein volles Glas Wein, die leere Flasche am Boden. Sie mahnte mich an einen Abschnitt im Buch über die toten Trinker. Ihre unerlösten Seelen würden keine Ruhe finden und mit ihrer Sucht die Lebenden heimsuchen, sich an ihrem Trinken erlaben. Noch sehe ich den schemenhaften Menschen vor mir, der in der Dämmerung im Zimmer stand, ein Traumbild, das mir nachhängt. Und ich sträube mich gegen meinen Gedanken, der anonymen Trinkerin zu gleichen, die mir das Journal anvertraute, meine Adresse kennt, während sie bedeckt bleibt, wenn auch nur notdürftig. Das Ringbuch erzählt von ihrer Person und manchen Lebensumständen, als Steckbrief zu lesen, und ihr Gesicht erahnbar wie ein Wasserzeichen in der Schrift. Sie könnte Alva heissen oder Anna, in beiden Vornamen gibt es zwei A, aber Alva ist mir näher, ich höre ihrer Morgen- oder Nachtstimme zu, den sehr verschiedenen Alvas.
Am Morgen beschreibt sie ihre neuerliche Verwüstung wie eine unabwendbare Katastrophe, die sie heimgesucht habe. Brechmüde hasse sie das graue Gesicht im Spiegel, und es würde wohl neuen Wein brauchen, weissen, roten, Bier, egal, um es zu beleben. Ihr aufgetriebener Bauch lasse sie an eine Wasserleiche denken, was sie sehr störe, aber sie sei am Absaufen, könne es nicht ändern.
Spätestens um sechzehn Uhr schleiche Er sich an, erinnere an den ersten Schluck, das Wohlgefühl, an kühne Gedankenflüge. Er hocke im Gedächtnis und sei längst kein Gast mehr, habe sich eingenistet, breit gemacht, eine vielarmige Krake, ein Kill. Nun habe er einen Namen, sei nicht länger anonym. Der Gedanke heitere sie auf und lasse sie Lauer überhören, der wie gewohnt sein Glas ansetze und sieben grosse Schlucke nehme, bevor er es geräuschvoll abstelle, genüsslich erkläre, dass man im Bier baden könne, ein Satz, der den jungen Lauer beeindruckt habe, ihm geblieben sei.
Und zum Wochenende könne Lauer ein Fläschchen aus seinem Depot holen und den Inhalt genau mit ihr teilen, gerne bemerken, dass sie schneller als er trinke, aber Wein doch ein Genussmittel sei. Es mache keinen Spass, mit Lauer zu trinken, sei ernüchternd wie alles mit Lauer, der sich bei allem viel Zeit lasse, sie hinhalte, bis sein Glas geleert sei, ihr Warten auskoste, sich beherrscht erlebe und massvoll, sein leises Spielchen treibe, das sie scheinbar hinnehme, Lauers Taktik ignoriere, die sie aber treffe. Und sie verachte all die Spalter, Kleinmacher, Lebensgeizer, die so gerne damit missionierten und ihre Lebensängstlichkeit als gesunde Vorsicht empfänden. Lauer informiere sich vorbeugend über Zugverspätungen, stornierte Flüge und Staus auf den Autobahnen, ohne gleich verreisen zu wollen. Er versperre gegen Mitternacht Türen und Fenster, mache alles dicht und geistere mit einer Taschenlampe durch die Räume, leuchte auch das Terrain vor den Fenstern nach Verdächtigem ab, nenne es einen guten Brauch, durch Vorausdenken einen möglichen Schaden zu begrenzen.
»Valentinstag«, schrieb Alva, »das Fernsehen zeigt glückliche Paare, die alt und rundlich auf dem Sofa sitzen und ihr Leben ausbreiten.« Ein seltener Abend, den Alva geniesse, denn Lauer habe sich gegen seine Gewohnheit früher schlafen gelegt, und nun feiere sie mit Clark Gable und Lana Turner, trinke mit den beiden. Der Champagner sei bei ihr ein Landwein, den sie auch zum Kochen verwende, sie habe den beiden damit zugeprostet und schliesslich von Lauer erzählt, dem schlafenden Lauer. Gewöhnlich brauche Lauer nach dem Essen etwas Süsses und seinen Whisky, lege sich hin und schlafe bis in den frühen Abend. An sich sei ihr der schlafende Lauer lieber als der wache, obwohl es störe, dass er seine Zimmertür offen lasse und sie ihn atmen höre. Heute habe es Lauer mit seinem Gängeln übertrieben. Sie habe den verwilderten Vorgarten erwähnt, dass sie die Büsche kappen wolle und er darin einen Revierkampf vermutet, angedroht, dass es dann Krieg gäbe.
Unvermittelt habe sie an das Fleischmesser gedacht. Sich vorgestellt, wie sie es aus der Küche holen gehe, die Lauer sonst besetzt halte, und den schlafenden Lauer aufsuche. Eine Wahnidee, von der sie so besessen gewesen sei, dass sie sich gedanklich der Tat angenähert habe und schliesslich zu Lauer gegangen sei und ihn gebeten habe, nicht länger zu schlafen. Aber ihre Unrast sei geblieben, einer Wölfin im Gehege gleich, die ständig ihr Revier ablaufe, ständig an Zäune stosse. Bei Nacht ihre stillen Hilferufe, vielleicht höre sie ihr Engel, auch meine sie dann, das Kichern der Toten, ihr Lästern zu vernehmen.
Es habe sie erleichtert, mit Lana und Clark darüber zu sprechen und ihnen zuzuprosten, es sei ein ausserordentlich vergnügter Abend gewesen.
4
Die Zerrstimmen der Pfauen tönen lang gezogen und verzweifelt von der Insel, als wären sie Verbannte. Ein Sehnsuchtsschmerz, sage ich in Gedanken zu Alva, ortlos, echolos.
Mir träumte von einer welligen Parklandschaft im Südlicht. Auf einem der Hügel das grosse Haus, aus dem eine Herrin in weissen, gestickten Kleidern mit ihrer Dienerin kam. Alles an ihr war hellfahl. Sie ging auf die Kinder und mich zu, die in einer Reihe am Boden hockten, entfernte Verwandte vielleicht, gab ihnen die Hand und zog aus den Taschen ihres weiten Kleides ein Perlmuttschälchen und andere kleine Geschenke. Mir gab sie Geld. Ich rätselte, ob ich die 120 Euro zwischen allen aufteilen sollte, als eine andere Frau mir befahl, alle Kinder zu töten. Sie waren nur noch fingergross, es ging rascher als Nüsse zu knacken, wunderlich leicht, bis zuletzt. Ich sah auf das schlafende Kind und weigerte mich den Sohn zu töten. Sie nickte. Und verschwörerisch bekannte die fahle Herrin, dass sie voller Würmer sei.





























