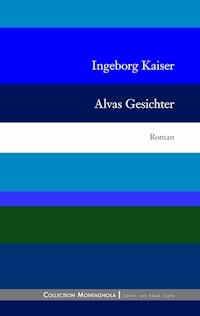Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine literarische Spurensuche nach zwei großen Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts, die auf eine subtile Weise miteinander verbunden sind.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 113
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sagen wir Berlin und Ostbahnhof, ein Sonntag im Januar, lieber Jakow Bradkin. Fahles Mittagslicht drang durch die Wolkendecke, fiel auf Ihre gross gewachsene Gestalt, das markante Gesicht mit dem Tolstoibart. Sie stützten sich auf einen Stock und den Arm Ihrer Begleiterin. Ihre blauen Augen auf mich gerichtet, sagten Sie abschiednehmend: »Ich warte auf Ihr Buch.«
Während der zweitägigen Konferenz der internationalen Rosa-Luxemburg-Gesellschaft in Berlin, zum Jahrestag des Meuchelmordes, war Rosa L. gegenwärtig, ihre Aktualität im 21. Jahrhundert das Thema der Historiker. Sie hielten ein Referat aus internationaler Sicht, und ich war unter den aufmerksamen Gästen im grossen Saal.
Wir steuerten mit unseren Mittagstellern den gleichen Stehtisch an, Sie kannten mein Buch »Róża und die Wölfe«, und ich wusste, dass Sie dem Forschungszentrum für deutsche Geschichte in Moskau vorstehen. An was ich schreibe, fragten Sie, und ich gab Stichworte zum Filmemacher Rainer W. Fassbinder, der in seiner Todesnacht, Juni 1982, an einem Filmprojekt über Rosa Luxemburg gearbeitet und jäh aus der Nase geblutet habe, so dass sein Blut das Manuskript signierte. Ein Bild, das mir nachgehe wie der nächtliche Landwehrkanal, in den die ermordete Rosa L. geworfen wurde. Dass ich beides zusammenbringen, den Szenen schreibend nachspüren möchte. Vielleicht eine fixe Idee, mir eine Begegnung des Filmers mit Rosa L. in seiner Todesnacht vorzustellen? Sein Drogenkonsum mache meine Fiktion möglich, auch sei es kein Zufall, dass Fassbinder auf Rosa L. gekommen sei; trotz gegensätzlicher Biografien hätten meine Ermittlungen verwandte Wesenszüge gefunden, die mich faszinieren wie beider Nachleben.
Sie hörten zu, schienen eher skeptisch, stellten aber keine Fragen, und wir brachten unsere halbvollen Teller zurück. Jane Fonda, sagte ich noch, sei für die Hauptrolle engagiert gewesen, dann wurden Sie von anderen Teilnehmern belegt.
Beim späteren Podiumsgespräch dominierte die junge Politikerin Sahra, ihre dunklen Augen, dunklen Haare, luxemburgsch gescheitelt, ihre druckreifen Pistolensätze erinnerten an die Rednerin Rosa L., die Säle füllen konnte.
Zierlich und schlagkräftig wie Sahra stand sie die Agitationstouren, Parteitage, Kundgebungen durch. Die Fotografien zeigen eine gepflegte Frau mit eleganten Hüten, die in ihren Briefen an Leo, den lebenslangen Gefährten, ihre modischen Erneuerungen nicht ausliess. Wollte sie Leo, der studienhalber in Zürich geblieben war, ihre Person mit der Beschreibung ihrer Kleider, Schuhe, Hüte bildhaft näherbringen?
Ich habe meinen Hut lackiert, er ist wie neu.
Vor Hannover ersetze ich auch am Hut (dem blauen aus Zürich) das Band durch ein neues weisses, denn das ist schmutzig.
Die kämpferische Sahra, nach den Hüten befragt, fand diese das Uninteressanteste an Rosa. Doch die Auftritte an Parteitagen der Deutschen Sozialdemokraten – vor überwiegend männlichen Genossen – erforderten die passende Garderobe. Ein Hut vervollkommnete ihre Erscheinung, schien ihre zierliche Person gegen die unzimperlichen Angriffe der Genossen zu stärken. Für Sahra lag die Wilhelminische Zeit zu fern, waren Rosas Hutprobleme nicht mehr nachvollziehbar.
Ich lese gern in Rosas Briefen an Leo, die vom politischen Tagesgeschäft handeln, ebenso von Seidenstoffen, den Rechnungen der Schneiderin, einem neuen Korsett.
(…) das alte platzte in der ganzen Länge und lässt sich nicht reparieren.
Auch die Straf- und Schutzhaftgefangene war um ihre Kleider und Accessoires besorgt, die Mathilde Jacob, ihre aufopfernde Freundin, zu beschaffen hatte. Am Abend der rechtswidrigen Verhaftung nähte sie im Hotel Eden ihren heruntergerissenen Rocksaum, während ihre Ermordung schon abgesegnet war.
Bald ein Jahrhundert zwischen damals und jetzt und R. Lu. noch immer die bekannteste Unbekannte, geliebt wie verdammt, Legende, demokratische Sozialistin oder blutige Rosa? Ihr Bild wie ein Puzzle, das nicht aufgeht. Als könnten die zusammengewürfelten Teilchen kein Ganzes ergeben.
Früher Morgen, zum Abschluss der Tagung eine thematische Stadtrundfahrt auf den Spuren Rosas. Noch stand ich am Fenster meines Zimmers im sechsten Stock, eine Krähenhorde wischte dunkle Rätsel in den Milchhimmel, in gleichmässigen Abständen die Lichtsignale des Fernsehturms am Alexanderplatz, als würden sie eine dringliche Botschaft morsen. Ich musste an die Schutzhaftgefangene denken, die wegen Beleidigung eines Aufsichtsbeamten, der sie während einer Sprechstunde provoziert hatte, vom Frauengefängnis in das Polizeigefängnis am Berliner Alexanderplatz überstellt worden war. Die Zelle klein und schmutzig, eine Eisenpritsche, das Klo ohne Wasserspülung, kein elektrisches Licht. Es war Herbst, Oktober 1916, und früh dunkel. Im ständigen Gedonner der Stadtbahn, deren Züge mit teuflischem Konzert vorbeiratterten, die Wände bebten, Fenster klirrten, sagte sie sich halblaut Mörikes Gedichte vor. Diese qualvollen Herbstwochen hinterliessen für immer Risse in den Nerven, meinte sie, ihr Haar sei darüber grau geworden.
Geschichte geworden wie Alfred Döblins »Berlin Alexanderplatz« und Franz Biberkopf, der am Ende nach Ruhe und Ordnung schreit und sich schon bald im braunen Netz der Heilrufer verfangen könnte. Sehr viel später, 1979, das sechzehnstündige Filmepos »Berlin Alexanderplatz« des Filmemachers Rain. Ein Valse d’amour der Verlierer, der im Spätprogramm des Fernsehens verpuffte. Er war siebenunddreissig, als er starb, sein Filmprojekt Rosa L. nicht mehr realisieren konnte, aber über vierzig Filme geschaffen hatte. Mehr Filme als Lebensjahre, ein Werk, monolithisch, im Mahlstrom der Zeit. Auch Rosa zwang sich trotz ihrer Depressionen, der Migräne, den Magenproblemen in die Pflicht, ignorierte ihren Kadaver. Kein Zufall, dass der Filmer sich für Rosa und ihr Schicksal interessierte.
Noch stand ich am Fenster, mit Sicht auf den Fernsehturm, das Areal verlassener Industriebauten, den nahen Ostbahnhof, die Doppeldeckerzüge, lange, rasche Lichtraupen mit Reisenden. Damals die Zeit der Dampflokomotiven, unbequemen Holzbänke, und gewiss gab es für Rosa keinen Schlafwagen.
Die Fahrt nach Königshütte dauert zwölf Stunden!! und kostet 23 M III. Klasse und 33 M II. Klasse. Ich habe die Absicht, zweite zu fahren und der Partei die dritte zu berechnen, d. h. 10 M von uns auszulegen. Ich nehme in dem Köfferchen (das mir die Kusine geborgt hat) einige Kleider, Wäsche, den Kocher etc. mit.
Der Bus mit den Tagungsteilnehmern war Stunden unterwegs, um die wichtigsten Orte von Rosa L. anzusteuern, die nur den jungen Asiatinnen neu waren. Die Erklärungen der Hostesse auf Deutsch überforderten sie, umso eifriger ihr Ablichten der vorbeiziehenden Zeitmonumente. Reichstagsgebäude, Zeitungsviertel, die Ruine des Anhalter Bahnhofs, Reststücke der Berliner Mauer, Springerhochhaus, die SPD-Zentrale auf der Roten Insel, einem Arbeiterquartier, zwischen Bahnsträngen gelegen, wo schon August Bebel gewohnt habe. Sie waren im Bus, Jakow, seine hohen Tritte beim Aus- und Einsteigen für Sie beschwerlich, doch leerte sich der Bus bei jedem Zwischenhalt, zog unsere nostalgische Pilgerrotte zum Haus im bürgerlichen Friedenau. Ein Klinkerbau mit Spitztürmchen, wo Rosa ihre erste eigene Wohnung bezog, mit Erker und Loggia, und dem Untermieter Leo Jogiches. 1906 würde der junge Kostja sein grünes Zimmer belegen, die Liebessache mit Leo, nach siebzehn Jahren, zu Ende sein. Wir starrten zur Loggia, als stände da Rosa mit Kostja im Winterlicht, beide in dunklen Mänteln, auf ihrem Gesicht ein zartes Lächeln.
Und schliesslich der Landwehrkanal. Wir schlitterten über Eiswege bis zu der Abschussrampe aus Bronze, einer Gedenktafel, die an einen Mord erinnert, der nie verjährt. Blumenbouquets zu Rosas Jahrestag, fahles Licht auf dem langsam fliessenden Wasser, der Eisinsel, auf der tiefrote Rosen wegzogen, dem einzelnen Schwan, unseren Wintergesichtern. Unsere stehende Gruppe schien für die Sonntagsgeher ein Hindernis, das sie erbost aufbrachen.
»Ich warte auf Ihr Buch«, sagten Sie, ohne meine Zweifel zu kennen, die Umwege, das aufgehäufte Material zu R. Lu. und Rain, das mir den Zugang verstellte.
Rains Skript zu Rosa Luxemburg mit dem Blutstempel liege heute in der Foundation RWF, Berlin. Die langjährige Cutterin und Geliebte Rains verwalte das künstlerische Erbe, das ihr Rains Mutter kurz vor ihrem Ableben überlassen habe. Aber die Toten sind nicht wehrlos, sie hinterlassen ihre Lebensschrift und bedienen sich der Stimmen der Lebenden. In Ihrem Buch »Die Aufrechten« sind Rosa L. und ihre Mitstreiter Karl Liebknecht, Clara Zetkin und Franz Mehring vielstimmig vernehmbar, als wäre Jetztzeit für sie.
Das Vergangene ist nicht tot, es ist nicht einmal vergangen. (William Faulkner)
Von der Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen lese ich, dann ist wieder oder noch der zehnte Juni 1982, und Mitternacht vorbei. Im Haus Clemensstrasse 16, München brennt noch Licht.
Rain sitzt am breiten, überladenen Tisch und schreibt atemlos, als würde ihm jemand diktieren. Ausgeblendet die farbigen Stimmen der Grossstadt, die Zigarette glimmt, er leert das Whiskyglas, giesst nach, braucht seine Helfer. Die Szene gespiegelt im Nachtfenster, aber er sieht nicht auf. Die Arbeit sein Antrieb, Motor, von Drogen beschleunigt, ein Rennen gegen die Zeit und seine Erschöpfung.
Schlafen kann ich, wenn ich tot bin.
Ein Bildschirm grellt ohne Ton, die Aschenbecher am Überquellen, alte Zeitungen um das zerwühlte Bett. Vielleicht beschleicht ihn das Gefühl, als Einziger wach geblieben zu sein, die Schlafenden hingestreckt, heimgesucht von Träumen. Überfällt ihn wieder die Verlassenheit, Angst vor dem Tod. Das Wort Ölberg schleicht sich ein, ich lasse es stehen. Ahne die Körperlosen im Raum, von Rain berufen, die zu ihrer Zeit die deutsche Geschichte mitgeprägt haben. Ihre Leben abgebrochen, nicht zu Ende erzählt, ihr Wissen, ihre Wahrheit, ihr Menschsein mitgemordet.
Hinter Rains Augen die Bildfolgen, als wären sie schon abgedreht, immer sein Kino im Kopf, vor, zurück. Denkt sich ein Haus, aus seinen Filmen gebaut, einige wären der Keller, andere ergäben die Wände und wieder andere die Fenster. Erhofft sich am Ende ein Ganzes. Noch ist er mittendrin, drängt es ihn von Projekt zu Projekt. Nach der Verfilmung von Jean Genets »Querelle« : Rosa Luxemburg.
10. November 1918: Die kleine, zerbrechlich scheinende Frau sass unbeachtet auf ihrem Koffer im Korridor des von Truppen überfüllten Zuges – nach vierzig Monaten Zellenleben unterwegs ins revolutionäre Berlin. Die Hohenzollern hatten abgedankt, Arbeiter- und Soldatenräte waren gewählt worden, die Arbeitermassen formierten sich.
Am Vortag ihre Rede auf dem Breslauer Domplatz, dichtgedrängt die Menschen, hörten der Einzelnen hoffnungsvoll zu, als sei sie eine Erlöserin. Ihre klare Stimme befeuerte die Zuhörenden, das Haar war weiss geworden, die Wangen eingefallen, ihre Augen dunkel umrandet, aber sie schien ungebrochen, voller geistiger Energien und Arbeitslust. Sass nun auf dem Koffer, vertrauter Begleiter bei den strengen Agitationsreisen und durch die Jahre der Haft. Befreiend der Blick auf die wegziehende Landschaft, so viel Wechsel, Weite, Raum. Ungeduldig, dass es noch dauerte, bis sie spätabends am Schlesischen Bahnhof ankommen würde, und dann?
R. Lu. habe nach anfänglicher Unsicherheit den Koffer in die Gepäckaufbewahrung gegeben, dann telefoniert. Habe am gleichen Abend mit Mathilde Jacob die Redaktionsräume der »Roten Fahne« aufgesucht, wo die zweite Ausgabe in Vorbereitung gewesen sei. Habe Leo Jogiches angetroffen, neben Karl Liebknecht, Paul Levi und anderen Spartakisten. Mathilde Jacob habe, trotz der Ausgangssperre und ohne Passierschein, den Koffer ausgelöst und ins Hauptquartier der Spartakisten »Hotel Excelsior« gebracht, das Stichwort »Rosa Luxemburgs Koffer« habe alle Kontrollposten durchlässig gemacht.
Um sich ständig austauschen zu können, sei vereinbart worden, zusammenzubleiben. Also keine Rückkehr in die lang entbehrte Wohnung in Südende für R. Lu., vielleicht war der Koffer in den folgenden zehn unruhevollen Wochen ein Garant der Hoffnung auf eine Zeit, in der sie endlich ihren Koffer leeren, sich zuhause einrichten könnte? Ich denke an einen Reisekorb, den die junge Rosa in Berlin erstand, weil die Kleider weniger zerknittert ankämen, sie endlich einmal menschlich reisen wollte. Dazu ein ledernes Handnecessaire und einen Sonnenschirm für zwei Ferienwochen mit Leo. War sie nicht lebenslang eine Reisende, auch in der Schutzhaft, wenn sie in ihren Briefen vergangene Reisebilder beschwor, beim Studium wissenschaftlicher Werke in ferne Zeitepochen tauchte, aus der Gegenwart der Zelle floh? War es Kostja, mit dem sie das Massailand, den Kaukasus, Zentralasien oder Südafrika bereisen wollte? Und die Sehnsuchtsreisen in den Briefen an ihren Freund Hans Diefenbach, die sie nach dem Krieg realisieren würden. Aber Diefenbach fiel Oktober 1917 in Frankreich, und mit ihm starb die Hoffnung auf gemeinsame Unternehmungen.
Ihr Satz am Ostbahnhof, Jakow, bereits Vergangenheit. Sie entfernten sich mit Ihrer Begleiterin, und ich blieb zurück, vermisste die Freunde Rosa Luxemburgs, die aus vier Kontinenten angereist waren und sich wieder verstreuten. Mittag vorbei, doch die Imbissstationen von späten Essern umlagert, die geduldig auf ihren Schlag Pommes mit Currywurst warteten, auf ein schäumendes Bier vom Fass oder mehr. Die melancholische Zecherin vor einem Glas Vino Nobile di Montepulciano, in Gedanken bei Jakow, dem Brief an Jakow, der das abgebrochene Gespräch fortsetzen, zu Ende führen sollte.
Pünktlich der Easy-Jet, die Passagiere, wie Schafe in Pferchen vorgeordnet, strömten beim Öffnen des Tors zur Gangway A und B. Ein Reisekorb längst museal, vielleicht auch die Vorstellung des menschlichen Reisens.
10. Juni 1982: Hinter den Augen Rains wischen rasend schnell Szenen vorbei, nicht aufzuhalten oder zu steuern. Die Zeit für ihn aufgehoben, das Vergangene gegenwärtig.
November 1918: Rosa L. im brodelnden Berlin. Von vierzig Monaten Haft geschwächt, doch täglich ihre Stimme zu Revolution und Gegenrevolution in der »Roten Fahne«. Aufklärend. Fordernd. Beschwörend. Kämpferisch.
War es zu idealistisch anzunehmen, dass sie mit ihren täglichen Leitartikeln die Sprachtauben, die vom Krieg gezeichneten Soldaten und Arbeiter erreichen und geistig bewegen könne? Dass die proletarische Masse in Bewegung komme, keine regierte Masse mehr sein würde und sich ohne Putsch und Blutzoll, Schritt für Schritt, selbst befreie? Statt der Ausbeuter und Ausgebeuteten eine sozialistische Gesellschaft, die auch die Freiheit der Andersdenkenden toleriere? Sind Menschen als Masse erfassbar oder eine unbekannte Grösse? Gesichtslos. Lenkbar. Missbrauchbar.
Trotz der revolutionären Bewegung, von Kieler Matrosen und Soldaten November 18 ausgelöst, die in der Folge das Land erfasste und Berlin erreichte, blieben die revolutionären Energien zersplittert. Das Wolffsche Telegrafenbüro wurde geschlossen, der Eisenbahnverkehr eingestellt, die Verbindung zur Provinz verhindert. Rosa L.s Vertrauen auf die revolutionäre Entschlusskraft der Massen und ihrer Führer war nicht realistisch. Und die fünfhunderttausend Aufständischen im insularen Berlin wurden wie die Mitglieder des Spartakusbundes eine gejagte Minderheit.
Hauptmann Waldemar Pabst habe damals, Januar 1919, an einer KPD-Versammlung teilgenommen, auf der Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht gesprochen hätten. Habe sie als die geistigen Führer der Revolution gesehen – die Gefährlichkeit der Frau Luxemburg erkannt, gefährlicher als alle anderen – und beschlossen, sie umbringen zu lassen. Man habe vom Rechtsstandpunkt abweichen müssen, erklärte der gewesene Waffenhändler 1962 in einem SPIEGEL-Interview, zweiundachtzigjährig, und fand Verständnis.