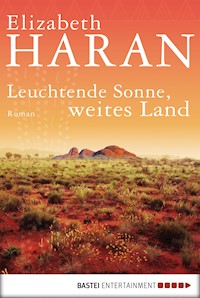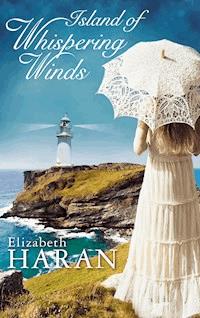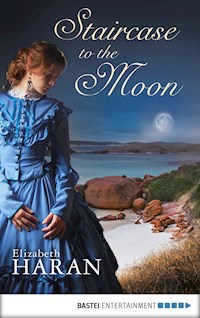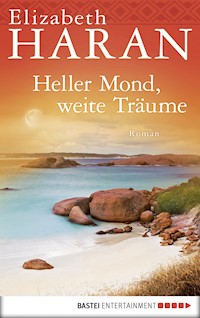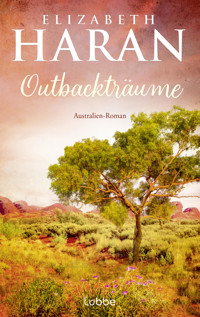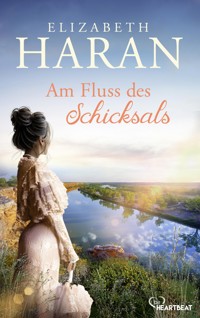
7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Große Emotionen, weites Land - Die Australien-Romane von Elizabeth Haran
- Sprache: Deutsch
Das abenteuerliche und geheimnisvolle Schicksal einer starken Frau auf dem Roten Kontinent.
Australien, 1883: Francesca kehrt Melbourne den Rücken, um nach Echuca am Murray River zu ziehen, wo ihr Vater Joe einen Raddampfer betreibt. Dieses Schiff ist ihr Zuhause gewesen, bis sie nach dem Tod ihrer Mutter auf ein Internat nach Melbourne geschickt wurde.
Doch sie erwartet eine böse Überraschung: Das Transportgeschäft läuft schlecht für ihren Vater. Silas Hepburn will ihn aus dem Geschäft drängen. Aber als er Joes Tochter kennenlernt, kommt ihm eine andere Idee ...
Francesca hat ihr Herz inzwischen an den jungen Monty verloren. Doch zwei Menschen versuchen, ihre Verbindung zu Monty unter allen Umständen zu zerstören. Und ihr Vater verbirgt ein großes Geheimnis vor ihr ...
Ein fesselnder Landschaftsroman für Fans von Di Morrissey, Christiane Lind und Tamara McKinley.
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 807
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Inhalt
Cover
Grußwort des Verlags
Über dieses Buch
Titel
Widmung
Prolog
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Über die Autorin
Weitere Titel der Autorin
Impressum
Liebe Leserin, lieber Leser,
herzlichen Dank, dass du dich für ein Buch von beHEARTBEAT entschieden hast. Die Bücher in unserem Programm haben wir mit viel Liebe ausgewählt und mit Leidenschaft lektoriert. Denn wir möchten, dass du bei jedem beHEARTBEAT-Buch dieses unbeschreibliche Herzklopfen verspürst.
Wir freuen uns, wenn du Teil der beHEARTBEAT-Community werden möchtest und deine Liebe fürs Lesen mit uns und anderen Leserinnen und Lesern teilst. Du findest uns unter be-heartbeat.de oder auf Instagram und Facebook.
Du möchtest nie wieder neue Bücher aus unserem Programm, Gewinnspiele und Preis-Aktionen verpassen? Dann melde dich für unseren kostenlosen Newsletter an: be-heartbeat.de/newsletter
Viel Freude beim Lesen und Verlieben!
Dein beHEARTBEAT-Team
Melde dich hier für unseren Newsletter an:
Über dieses Buch
Australien, 1883: Francesca kehrt Melbourne den Rücken, um nach Echuca am Murray River zu ziehen, wo ihr Vater Joe einen Raddampfer betreibt. Dieses Schiff ist ihr Zuhause gewesen, bis sie nach dem Tod ihrer Mutter auf ein Internat nach Melbourne geschickt wurde.
Doch sie erwartet eine böse Überraschung: Das Transportgeschäft läuft schlecht für ihren Vater. Silas Hepburn will ihn aus dem Geschäft drängen. Aber als er Joes Tochter kennenlernt, kommt ihm eine andere Idee …
Francesca hat ihr Herz inzwischen an den jungen Monty verloren. Doch zwei Menschen versuchen, ihre Verbindung zu Monty unter allen Umständen zu zerstören. Und ihr Vater verbirgt ein großes Geheimnis vor ihr …
Elizabeth Haran
Am Flussdes Schicksals
Aus dem australischen Englisch vonClaudia Geng
Ich widme dieses Buch den Männern in meinem Leben.
Meinem Mann Peter, der mir Kraft gibt und mir immer zur Seite steht, und meinen Söhnen Damien und Mark, die das Beste sind, was mir je passiert ist.
Meinem Bruder Peter Haran, der ebenfalls Schriftsteller ist und mir eines Tages beiläufig vorschlug, ich solle doch auch mal ein Buch schreiben.
Mein ganz besonderer Dank gilt Michael Meller, der das Potenzial meines ersten Manuskriptes erkannte und meine Karriere ins Laufen brachte.
PROLOG
Echuca, 1866
Ein schriller Pfiff kündete von der Einfahrt des Zuges aus Melbourne in den geschäftigen Hafen von Echuca am Murray River, der hier die Grenze zwischen Victoria und New South Wales bildete. Als fauchend eine Dampfwolke aus dem Schornstein der Lok emporschoss und sich im Dickicht aus Eukalyptusbäumen verlor, das sich am Fluss entlang erstreckte, flatterten auf der anderen Uferseite, in New South Wales, die Kakadus mit protestierendem Kreischen von ihren Ruheplätzen in den Ästen der Bäume.
Der Bahnsteig befand sich neben dem dreistöckigen, von Eukalyptusbäumen gesäumten Pier – eine hässliche Konstruktion, eine Viertelmeile lang und mehr als sechs Meter hoch. Hier herrschte rege Betriebsamkeit. Die Hafenarbeiter – kräftige, narbengesichtige Raufbolde mit einer Schwäche für Rum und Faustkämpfe – waren damit beschäftigt, Holz, Tabak, Mehl, Tee, Wein, Branntwein und Weizen von den gut fünfzig Raddampfern zu löschen, die am Pier ankerten, oder die Schiffe mit Wolle, Stoffen und Gerätschaften zu beladen. Es war vier Uhr nachmittags, kurz vor Feierabend, und viele Arbeiter warfen sehnsüchtige Blicke zum Star Hotel an der Hafenpromenade, in dem sich die nächste der über zwanzig Schänken und Bars der Stadt befand.
Ein paar Dampfer nahmen vom Pier aus Kurs nach Westen, nach Wentworth, wo die Flüsse Murray und Darling zusammenströmten. Die Wollballen auf den Güterwagons am Ende des Zuges sollten per Raddampfer zur Mündung des Murray transportiert werden, wo sie auf Frachter umgeladen wurden, die dann die Märkte in London ansteuerten. Auch Schafscherer nutzten die Raddampfer, um zu einer der zahlreichen Stationen überzusetzen, die den mehr als tausendsechshundert Meilen langen Fluss säumten – von der Quelle in den Snowy Mountains bis nach Goolwa, wo der Murray in den Pazifik mündete.
Unter den Zugpassagieren waren Joe und Mary Callaghan. Sie waren nach Echuca gekommen, um einen Raddampfer zu übernehmen, dessen Bau sie vor einem Jahr in Auftrag gegeben hatten. Nachdem ihre Reisekiste vom Zug abgeladen war und sie ihre Koffer in den Händen hielten, schafften sie es kaum, sich einen Weg durch das Gewimmel auf dem überfüllten Bahnsteig zu bahnen, während die Arbeiter sich daranmachten, die Fracht von den hinteren Wagons abzuladen. Es war Marys erster Aufenthalt in Echuca, während Joe bereits vor einem Jahr in der Stadt gewesen war, um eine Kaution zu hinterlegen und die Baupläne für den Raddampfer zu besprechen; zuletzt war er einen Monat zuvor in Echuca gewesen, um mit Ezra Pickering, dem Schiffbauer, die letzten Einzelheiten zu klären.
Nach harten Jahren auf den Goldfeldern konnte Mary der Anblick der derben, heruntergekommenen Gestalten auf dem Pier nicht mehr schockieren, und auch nicht die Dirnen, die auf der Promenade umherstolzierten und auf Kunden warteten. In den vergangenen zwei Jahren hatte Mary genug davon gesehen. Sie freute sich auf ihr neues Leben, auf die friedliche Atmosphäre am Fluss und darauf, in einem richtigen Bett zu schlafen, ohne jeden Morgen vom Scharren der Schaufeln und dem Murren verkaterter Männer geweckt zu werden.
Beim letzten Besuch Joes im Hafen von Echuca hatte es geregnet, doch heute funkelte die Sonne auf der friedlichen grünen Wasseroberfläche des Flusses, auch wenn eine stürmische Brise wehte. Tief im Herzen hoffte Joe, dass dies ein gutes Zeichen war.
Es war der aufregendste Tag im Leben von Joe und Mary Callaghan – und das Ende eines zwei Jahre währenden Albtraums auf den Bendigo-Goldfeldern. Die ersten sechs Monate hatten sie in einem kleinen, geflickten Zelt geschlafen und oft knöcheltief im Schlamm gestanden, um mit den anderen Schürfern, unter denen die Ruhr und das Fieber grassierten, nach angeschwemmtem Gold zu suchen. Als sich zeigte, dass es viel länger als erwartet dauern würde, auf eine Goldader zu stoßen, errichteten Mary und Joe eine Hütte aus Holzabfällen mit festem Bretterboden. Dennoch war ihr Leben eine Qual gewesen, besonders für Mary, die im Winter jämmerlich fror, während ihr im Sommer die Gluthitze zusetzte. Es war ihr vorgekommen, als würde ihr Leben sich nur noch um drei Eimer drehen: Der erste voller Trinkwasser, der zweite, um sich selbst und die Wäsche zu waschen, während der dritte als Toilette diente. Jeden Tag, wenn Joe auf den Goldfeldern bis zur Erschöpfung arbeitete, kümmerte Mary sich um das Feuer und die drei Eimer, die sie ständig leerte und füllte, leerte und füllte, immer wieder, bis sie glaubte, stumpfsinnig zu werden. Hätten sie und Joe nicht das Ziel gehabt, sich einen Raddampfer zu erarbeiten – Mary hätte es keine drei Wochen auf den Goldfeldern ausgehalten.
Vor seinem Weggang nach Bendigo hatte Joe drei Jahre lang im Hafen von Melbourne gearbeitet. Als ihm die Blockadetaktik der Gewerkschaft zu viel wurde, nahm er trotz geringerer Bezahlung eine Stelle im nahen Governor Hindmarsh Hotel an. Nachdem er alles gelernt hatte, was zur Leitung eines Hotels erforderlich war, sahen er und Mary sich nach einem anderen Hotel um, das bessere berufliche Aufstiegschancen bot. Die Wahl fiel auf das Overland Corner Hotel an der Anlegestelle Cobdogla, nahe der südaustralischen Stadt Barmera. Erst mit der Errichtung dieses Hotels, das zugleich als Haltestation der Postkutsche auf der Strecke zwischen Adelaide und Wentworth diente, waren die ersten Europäer in der Gegend erschienen. Joe wurde neuer Geschäftsführer, nachdem seinem Vorgänger, Bill Thompson, die Leitung eines Hotels in der Stadt angeboten worden war. Da seine Ehefrau sich geweigert hatte, »in den Busch« zu ziehen, hatte Thompson die neue Stelle ohne Zögern angenommen. Mary hingegen sah es ganz anders als Mrs Thompson. Die Aussicht, in der Nähe des Flusses zu leben, begeisterte sie ebenso sehr wie Joe.
Das Overland Corner Hotel war aus Kalkstein erbaut. Die Mauern waren einen halben Meter dick – eine perfekte Isolierung gegen die trockene Sommerhitze –, und die Böden waren aus Eukalyptusholz. An dem Tag, als Mary und Joe Callaghan dort eintrafen, hatten sich fast dreihundert Aborigine-Frauen versammelt, um Joes »weiße Gefährtin« zu sehen. Damals war eine weiße Frau in dieser Gegend ein sehr seltener und exotischer Anblick, und Mary war irritiert von all dem Aufsehen, das um sie gemacht wurde. Zudem erkannte sie schnell, dass es auch Nachteile hatte, eine Art Berühmtheit zu sein, besonders, wenn die Hausarbeit liegen blieb, weil die Frauen der Aborigines ständig an der Hintertür zur Küche nach ihr riefen, um ihre Haare anzufassen und ihre Kleider zu betasten. Das Gelände, auf dem das Hotel stand, war tausende von Jahren von den Aborigines bewohnt gewesen. Sie hatten dort ihre Lager aufgeschlagen, primitive Verschläge errichtet und von dem gelebt, was der Fluss hergab. Als die Europäer kamen, begannen die Ureinwohner, mit dem hochwertigen Ocker zu handeln, den sie auf den nahen Klippen sammelten. Mary benutzte ihn, um die Kamine im Hotel mit roter Farbe zu verschönern.
Als Joe die Leitung des Overland Corner Hotels übernahm, gab es bereits den großen Holzladeplatz in der Nähe des Ufers, wo die hungrigen Kessel der anlegenden Raddampfer gefüttert wurden. Außerdem gab es einen Zeltplatz für Viehtreiber, die ihre Rinder oder Schafe an der saftigen Flachküste weiden lassen konnten, bevor sie weiter nach Adelaide zogen. Kurz nach seiner Fertigstellung wurde das Hotel zu einer Zwischenstation für die Postkutsche auf der Strecke zwischen Wentworth und Südaustralien. Doch die wachsende Zahl der Raddampfer auf dem Murray ließ Joe erkennen, dass die Geschäfte für Schiffseigner blühten, und er wollte daran teilhaben.
Er beschloss, für ein eigenes Schiff zu sparen. Da er wusste, dass er dieses Ziel mit seinem bescheidenen Lohn als Direktor eines kleinen Hotels niemals erreichen konnte, beschloss er, gemeinsam mit Mary auf den Goldfeldern sein Glück zu versuchen – ein riskantes Unterfangen, das Mary viel abverlangte. Aber nach drei Jahren im Hotel hatte sie genug von betrunkenen Viehtreibern und Schafscherern.
Doch das Leben auf den Goldfeldern erwies sich als Hölle auf Erden. Diebstähle, Schlägereien, selbst Morde waren an der Tagesordnung. Beim allabendlichen Ritual der Soldaten, die Schläger und Trunkenbolde außerhalb des Goldgräberlagers zusammenzutreiben und zu verprügeln, zitterte Mary jedes Mal wie Espenlaub und betete um ein Wunder.
Nach einem Jahr war sie am Ende und drohte Joe, ihn zu verlassen. Doch noch am selben Tag wurden sie fündig. Sie entdeckten einen ansehnlichen Goldklumpen, der es ihnen ermöglichte, eine Anzahlung auf den ersehnten Raddampfer zu leisten, der nach fast einem Jahr – das ihnen wie eine Ewigkeit vorkam – fertig war. Der Dampfer war weder besonders groß noch sonst wie außergewöhnlich, aber er war ihr erstes richtiges Zuhause. Ihr Glück wäre vollkommen gewesen, hätte auch ihr Wunsch nach einem Kind sich erfüllt, doch nach fünfzehn Jahren Ehe hatten die Callaghans die Hoffnung auf eigene Kinder begraben.
Jedenfalls sah Joe nun die Chance, beruflich auf eigenen Füßen zu stehen. Der Transport von Holz aus den Wäldern bei Barmah zu den Schiffswerften bot ihm und Mary die Möglichkeit, zu bescheidenem Wohlstand zu gelangen, zumal in den wachsenden Städten am Fluss immer mehr Sägemühlen den Betrieb aufnahmen. Wie seine Eltern, stammte auch Joe aus County Donegal in Irland; seine Familie war nach England gezogen, als Joe erst zwei Jahre alt war, und er hatte seine Kindheit an der Themse verbracht, die sein Vater als Kapitän eines Frachtkahns befuhr, bis er 1848 an einer Lungenentzündung starb.
Als Joe alt genug war, trat er aus Liebe zur Schifffahrt der Handelsmarine bei. Nachdem er sein Kapitänspatent erworben hatte, kehrte er nach England zurück und lernte Mary kennen. Nach der Hochzeit im Jahre 1851 wanderte das Paar nach Australien aus. Doch Joe hatte nie seine Liebe zu Schiffen verloren. Zwar wollte er nicht wieder zur See fahren – zumal es bedeutet hätte, dass er immer wieder für längere Zeit von Mary getrennt wäre –, doch der Murray River zog ihn magisch an.
Deshalb erschien es ihm nun, bei der Ankunft in Echuca, um seinen Raddampfer zu übernehmen, als wäre er an den einzigen Ort zurückgekehrt, an dem sein Herz und seine Seele glücklich waren.
Joe und Mary quartierten sich für die Nacht im Bridge Hotel ein, das nur einen Steinwurf vom Bahnhof entfernt war und Silas Hepburn gehörte, dem Gründer von Echuca und mächtigsten Mann der Stadt. Joe hatte erfahren, dass Hepburn zudem zahlreiche Geschäfte an der High Street gehörten sowie große Flächen Land in der Umgebung der Stadt, sodass er gespannt darauf war, diesen offenbar tüchtigen und erfolgreichen Mann kennen zu lernen.
Mary war der Ansicht, sie könnten sich ein solches Luxushotel nicht leisten, in dem die Übernachtung fünf Pfund kostete – dreimal so viel wie in einer Pension. Doch Joe erklärte, dass sie ein weiches, warmes Bett verdient habe, nachdem sie zwei Jahre lang in einem schmutzigen Zelt und einer primitiven Hütte gehaust hatte.
Das Bridge Hotel befand sich unweit vom Hafenplatz, wo sich die Karren reihten, um den Murray River auf einer Pontonbrücke zu überqueren, die ebenfalls Silas Hepburn gehörte. Das Hotel war ein zweistöckiges Gebäude aus weinroten Ziegelsteinen, mit weiß getünchter Veranda und einem Balkon, der von Holzpfählen getragen wurde. Zwei eingeschossige Seitenflügel erstreckten sich zwischen der High Street und der Promenade. Die Schankstube war ein beliebter Treffpunkt der Viehzüchter.
Als Joe und Mary am Tag ihrer Ankunft im Hotel zu Abend aßen, machten sie die Bekanntschaft von Silas Hepburn und dessen Frau Brontë, die sich als fröhlich und hilfsbereit erwies. Doch was Silas Hepburn selbst betraf – kaum hatte er den Mund aufgemacht, wurde offensichtlich, dass er arrogant, egoistisch und raffgierig war. Joe gewann den Eindruck, dass Silas ihn aushorchte, um sich zu vergewissern, dass er ihm mit seinem zukünftigen Geschäft keine Konkurrenz machte. Als Joe erklärte, er sei Besitzer und Kapitän eines neuen Raddampfers, beglückwünschte Silas ihn und bot ihm großzügig Hilfe in Form eines »Darlehns« an, sollte sich die Notwendigkeit ergeben. Joe wurde misstrauisch. Geldverleiher vom Schlage Silas Hepburns waren ihm schon immer suspekt gewesen.
Bei Joes letztem Aufenthalt in der Stadt einen Monat zuvor hatte er einen Mann namens Ned Gilford angeheuert und mit ihm vereinbart, sich an dem Abend, wenn er und Mary in der Stadt ankämen, im Hotel zu treffen. Mary wusste nur zu gut, dass Joe sehr empfänglich war für Menschen, die im Leben gestrauchelt waren. Nicht dass er naiv gewesen wäre; es war vielmehr so, dass er für jeden Mitmenschen, dem ein hartes Leben beschieden war, Mitgefühl aufbrachte. Deshalb war Mary nicht überrascht gewesen, als Joe ihr das erste Mal von Ned erzählt hatte.
Da Joe mit der Binnenschifffahrt nicht vertraut war, hatte er beschlossen, einen Matrosen anzuheuern, der sich mit dem Fluss und mit Raddampfern auskannte. Er war im Hafen gewesen und hatte dort verkündet, dass er nach einem fähigen Matrosen suche, als er eine Gruppe Arbeiter bemerkte, die johlend einen Mann umringte, der gerade versuchte, die Vorderräder eines voll beladenen Ochsenkarrens anzuheben. Der Mann war Ned. Er sah aus, als habe er die fünfzig schon überschritten, war aber noch fit für sein Alter – es gelang ihm tatsächlich, die Räder der Vorderachse vom Boden zu heben. Zuerst hielt Joe ihn für einen betrunkenen Angeber, erkannte aber gleich darauf, dass es sich um eine Kraftprobe handelte. Joe sah aber auch, dass Ned einen verzweifelten und traurigen Eindruck machte und seine Anstrengungen verspottet wurden. Bevor er sich verletzen konnte, trat Joe auf ihn zu und fragte ihn, ob er als Matrose für ihn arbeiten wolle – ein Angebot, das Ned mit sichtlicher Erleichterung und Dankbarkeit annahm. Sie vereinbarten ein Treffen im Hotel, um alles Weitere zu besprechen.
Allerdings tauchte Ned Gilford nicht zum vereinbarten Zeitpunkt auf und hatte auch keine Nachricht bei Mrs Hepburn hinterlassen, die das Hotelpersonal beaufsichtigte. Joe war enttäuscht; er war sicher gewesen, dass Ned ihn nicht im Stich ließ.
»Vielleicht ist er aufgehalten worden«, sagte Joe am nächsten Morgen zu Mary, nachdem sie vom Einkauf der Vorräte zurückgekehrt war, die aufs Schiff gebracht werden sollten, darunter Grundnahrungsmittel für die Speisekammer sowie Tischwäsche und Geschirr.
»Oder jemand hat ihm ein besseres Angebot gemacht«, entgegnete Mary.
»Tja, leider können wir nicht länger warten«, sagte Joe. Sie konnten sich keine weitere Nacht in dem Hotel leisten, zumal nicht nur das Zimmer, sondern alles in Echuca dreimal so teuer war wie auf den Goldfeldern.
Vor ihrer Abreise hinterließ Joe bei Brontë Hepburn eine Nachricht: Für den Fall, dass Ned doch noch auftauchte, sollte er sich am Flussufer in der Nähe der Werft bei ihnen einfinden.
Joe und Mary mieteten sich eine Kutsche, um mit ihrer Reisekiste, den Koffern und den Vorräten zur Werft zu gelangen. Auf ihrer Fahrt entlang des Flusses, auf dem Schaufelraddampfer in jeder Form und Größe zu bewundern waren, kamen sie an einem Ponton vorüber, der Silas Hepburn gehörte, wie der Kutscher ihnen erzählte. Hunderte von Schafen waren darauf zusammengepfercht, um von New South Wales hinüber nach Victoria transportiert zu werden.
»Schlachtvieh für hungrige Goldsucher«, bemerkte der Kutscher.
»Wie hoch ist die Transportgebühr, die Mr Hepburn von den Viehtreibern verlangt?«, fragte Joe.
»Bei den Schafen hängt es von der Anzahl ab. Bei Rindern verlangt er zwischen drei und sechs Pennys pro Tier, bei Pferden sechs Pennys.«
»Da wäre es besser, ans andere Ufer zu schwimmen«, sagte Joe, empört über diesen Wucher.
»Oh, auch das kostet. In diesem Fall verlangt Silas Hepburn einen Penny pro Tier für die Bereitstellung erfahrener Fährmänner, die sie hinübergeleiten. Die Fährmänner behaupten, sämtliche Strömungen und Untiefen zu kennen, und erzählen so manche Schauermärchen, um zweifelnde Viehzüchter zu überzeugen. Dabei wissen die Züchter, dass sie hereingelegt werden, aber sie können es sich nicht leisten, ein Risiko einzugehen.«
Joes erster Eindruck, dass Silas Hepburn ein gerissener Geschäftsmann war, bestätigte sich – was er dem Kutscher auch sagte.
»Ja, für einen ehemaligen Sträfling aus Port Arthur hat er sich ganz schön gemausert«, erwiderte der Kutscher und lachte beim Anblick der verdutzten Gesichter Joes und Marys laut auf.
Als Joe den Raddampfer am Dock der Werft erblickte, rief er: »Das ist er!« Auch wenn es bestimmt nicht das größte Schiff auf dem Fluss sein würde, fiel es wegen seiner breiten, schrägen, nach oben gewölbten Radkästen für die Schaufelräder auf – eine Idee, die Joe und Ezra gekommen war, als sie die Baupläne entworfen hatten.
»Bist du sicher, dass es unser Dampfer ist?«, fragte Mary.
Joe nickte bloß und lächelte.
Mary ließ sich von der Begeisterung ihres Mannes anstecken. »Ich kann es gar nicht abwarten, an Bord zu gehen.«
Zügig lud Joe ihr Gepäck und ihre Vorräte aus der Kutsche. Nachdem der Kutscher bezahlt worden war und sich wieder auf den Weg gemacht hatte, stellte Joe das Gepäck am Flussufer ab, nahm den Arm seiner Frau und sagte: »Komm, schauen wir uns unser neues Zuhause an.« Wie lange hatte er diesem Tag entgegengefiebert! Der Himmel war bewölkt, und es sah nach Regen aus, aber selbst ein heftiger Wolkenbruch hätte Joes Stimmung nicht trüben können.
Mary hielt inne. »Dürfen wir denn einfach so an Bord?«, meinte sie unsicher. »Müssen wir nicht zuerst die Erlaubnis einholen?«
Joe lachte. Mary hatte eine angeborene Scheu vor Autoritätspersonen, und das Leben auf den Goldfeldern hatte ihre Furcht nur noch verstärkt. Er wusste, dass es Zeit brauchte, um Mary die Erfahrungen der letzten zwei Jahre vergessen und ihr Selbstvertrauen wachsen zu lassen.
Mary war ein wenig rundlich und reichte Joe gerade bis zur Schulter. Ihr Haar, das sie stets zusammengebunden trug, war braun und lockig, und ihre Gesichtszüge waren eher durchschnittlich, doch Joe hatte sich in die Wärme in ihren Augen und in ihr sanftes Lächeln verliebt, bei dem sein Herz stets höher schlug.
»Wir brauchen keine Erlaubnis, an Bord gehen zu dürfen, Mary«, sagte er nun. »Es ist unser Schiff.«
Als sie den Niedergang erreichten, erschien der Schiffbauer Ezra Pickering mit einem Notizbuch und einem Stift in der Hand vor ihnen. Er war ein ruhiger, pflichtbewusster Mann, der mit Joe eine unstillbare Leidenschaft für Schiffe teilte. Zuvor hatte er Joe erzählt, dass er seinen ersten Dampfer aus den Holz- und Eisenresten eines schrottreifen Pferdekarrens gebaut hatte, und Joe war von Ezras Liebe zum Detail und seinem unverhüllten Stolz auf seine Arbeit sehr beeindruckt gewesen. Die Schiffe wurden am Ufer gefertigt, wo es leicht abschüssig war, sodass man sie beim Stapellauf ins Wasser gleiten lassen konnte. Ezra hatte soeben kontrolliert, ob die Arbeiter seine allerletzten Anweisungen befolgt hatten. Er gehörte nicht zu den Leuten, die irgendetwas dem Zufall überließen.
»Guten Morgen, Joe«, grüßte er. »Kommen Sie an Bord.« Er ergriff Joes ausgestreckte Hand und begrüßte anschließend auch Mary.
An Bord wandte Joe sich seiner Frau zu. »Willkommen an Bord der Marylou, mein Schatz.«
Mary stockte der Atem, und sie blickte ihren Ehemann mit weit aufgerissenen Augen an. »Du hast ... unser Schiff Marylou getauft?«
»Ja, nach dir. Nach meiner Mary Louise!« Joe legte den Arm um ihre Schulter. »Komm und sieh selbst.« Er führte sie zum Bug und drehte sie in Richtung Ruderhaus. Dann zog er an einem Seil, an dem ein Stück Stoff befestigt war. Der Stoff flatterte herunter, und unter dem Fenster des Ruderhauses stand in großen Buchstaben: P. S. Marylou.
Mary war zu Tränen gerührt. »Oh, Joe. Du bist immer wieder für Überraschungen gut.«
Ezra Pickering kam zu ihnen. »Ich möchte Sie ein wenig mit den Daten der Marylou vertraut machen«, sagte er voller Stolz. »Sie ist für achtundfünfzig Tonnen Fracht ausgelegt. Ihre Länge beträgt dreiundzwanzig Meter, die Breite fünfeinhalb Meter. Sie hat einen Tiefgang von siebzig Zentimetern ...«
»Was bedeutet das?«, fragte Mary.
»Sie kann in Gewässern unter einem Meter Tiefe fahren, weil sie einen flachen Rumpf hat«, erklärte Joe. »Aber meist ist der Fluss viel tiefer.«
»Oh.« Mary beschlich ein ungutes Gefühl. Sie fürchtete sich vor tiefen Gewässern und konnte wie die meisten Neuankömmlinge in Australien nicht schwimmen, aber Joe hatte versprochen, es ihr beizubringen. »Gibt es denn Untiefen im Fluss?«, fragte sie Ezra.
»Ja«, erwiderte Ezra. »Man muss sich vor Sandbänken, seichten Stellen und im Wasser treibenden Baumstämmen in Acht nehmen. Und im Sommer trocknen bestimmte Flussabschnitte regelmäßig aus. Aber ich habe im Ruderhaus Karten hinterlegt.« Er sah Joe mit ernstem Blick an. »Ich schlage vor, Sie studieren diese Karten, und zwar gründlich. Aber für den Notfall ist das Schiff mit einer dampfbetriebenen Seilwinde ausgestattet, wie abgesprochen.« Er wandte sich um und wollte Mary die drei Kajüten zeigen, doch ihre Aufmerksamkeit wurde vom Maschinenraum gefesselt, der sich mitten auf dem Schiff befand und von einem Geländer umgeben war. Ein Schild am Dampfmotor stach ihr ins Auge: Marshall & Söhne, Gainsborough, England.
»Sieh mal, Joe, die Maschine kommt aus unserer Heimat«, sagte Mary.
»Das ist eine Dampfmaschine mit sechsunddreißig Pferdestärken«, geriet Ezra ins Schwärmen. »Sie ist erst vor zwei Monaten hier eingetroffen. Am Ufer liegt eine Tonne Feuerholz, was für den Anfang genügen dürfte, aber beim Zerkleinern und Verladen werdet ihr auf Hilfe angewiesen sein. Ihr habt doch einen Matrosen angeheuert, oder?«
Joe zog die Stirn kraus und warf einen besorgten Blick zu seiner Frau. »Ja, er soll hier zu uns stoßen.«
»Gut«, entgegnete Ezra. »Es wird mehrere Stunden in Anspruch nehmen, bis der Kessel genügend aufgeheizt ist, dass ihr ablegen könnt. Ich schlage vor, ihr fahrt heute flussabwärts bis zum Campaspe-Delta und anschließend wieder zurück. Sollte es dann Probleme oder Fragen geben, können wir darüber reden.«
Joe warf erneut einen Blick auf die Uhr. Es war zwar noch früh, aber wenn Ned nicht bald erschien, musste er einen Ersatzmann für ihn suchen, und zwar rasch.
Die Callaghans besichtigten gerade die Kajüten, als Ezra rief, dass jemand am Flussufer Joe zu sprechen wünsche.
»Bestimmt euer Matrose«, sagte er, als Joe und Mary am Niedergang erschienen, von wo sie einen Mann am Ufer erblickten.
»Wer ist das?«, fragte Mary. Sie hielt es für ausgeschlossen, dass der Fremde ihr Matrose war. Er sah wesentlich älter aus, als sie erwartet hatte.
»Das ist Ned Gilford«, erwiderte Joe. Auch ihm kam Ned jetzt älter vor, als er ihn in Erinnerung hatte, aber gleichzeitig fiel ihm wieder ein, wie dankbar Ned darüber gewesen war, dass man ihm Arbeit angeboten hatte, sodass es Joe sehr verwundert hätte, wenn er nicht erschienen wäre. Mary hörte die Erleichterung in der Stimme ihres Mannes, doch ihre Bedenken blieben bestehen. Joe brauchte einen kräftigen und fähigen Mann. Sie hatte gehofft, dass er wenigstens einmal auf seinen Verstand statt auf sein Herz hören würde, doch Neds Anblick ließ sie zweifeln.
Ned stand am anderen Ende des Niedergangs, den Hut in der Hand. Als Joe auf ihn zuging, bemerkte er, dass Neds Gesicht gerötet und erhitzt war. Er fragte sich, woher Ned gerade kam und ob er sich zu Fuß zur Werft aufgemacht hatte, bepackt mit seinem großen Seesack.
»Mr Callaghan«, stieß Ned keuchend hervor. »Tut mir Leid, dass ich so spät komme. Ich hatte für ein paar Tage Arbeit im Wald von Barmah, und ... und ich brauchte das Geld. Entschuldigen Sie, dass ich nicht schon früher kommen konnte ...« Doch Joe war nicht verärgert, ganz im Gegenteil freute er sich, Ned zu sehen. »Jetzt bist du ja da, Ned«, sagte er. »Willkommen an Bord der Marylou.«
Joe stellte Ned seiner Frau und Ezra Pickering vor.
»Sie kennen sich doch mit Dampfmaschinen aus, Mr Gilford?«, fragte Ezra.
Ned sah zu Joe und errötete. Nervös drehte er den Hut in der Hand. Selbst Mary hatte Mitleid mit ihm.
»Ich ... nun ja, nein ... Ich kann ein bisschen von allem ... eigentlich bin ich Holzfäller, aber ... ich lerne rasch ...« Ned war so blass geworden, dass Joe befürchtete, er würde jeden Moment in Ohnmacht fallen.
Ezras buschige Brauen waren so dicht zusammengezogen, dass sie wie eine haarige Raupe über seinen tief liegenden Augen wirkten. Er sah Joe über seine Zweistärkenbrille hinweg an. »Sie hätten jemanden anheuern sollen, der sich mit Dampfmaschinen auskennt, Mr Callaghan.«
»Ich habe noch nie Flüsse befahren und muss noch viel lernen, genau wie Ned. Aber gemeinsam schaffen wir das schon«, erwiderte Joe zuversichtlich. »Wir werden uns ein paar Tage Zeit lassen, um uns mit dem Schiff und dem Fluss vertraut zu machen.« Joe warf einen Blick auf Ned, der einen völlig verdutzten Eindruck machte. »Ned ist kräftig, sodass es nicht lange dauern wird, bis wir das Holz geladen haben. Stimmt’s, Ned?«
Ned wollte seinen Ohren nicht trauen. Als Ezra gesagt hatte, es sei ein Fehler gewesen, ihn, Ned, anzuheuern, hatte er bereits damit gerechnet, wieder fortgeschickt zu werden. »Ja ... ja, Sir«, murmelte er.
Ezra wandte sich an Joe. »Wie ich weiß, ist es schon eine Weile her, dass Sie zur See gefahren sind. Deshalb werde ich Ihnen einen meiner Männer zur Verfügung stellen, der Ihnen die grundlegenden Funktionen der Maschine und der Pumpen erklärt, sobald das Holz aufgeladen ist, damit Sie und Ihr ... Matrose sich mit der Marylou vertraut machen können. Es war ein Vergnügen, mit Ihnen Geschäfte zu machen, Mr Callaghan. Ich wünsche Ihnen viel Glück für die Zukunft.« Erneut bedachte er Ned mit einem Blick, als hätte er Angst um Joe.
»Sie haben gute Arbeit an der Marylou geleistet, Mr Pickering«, sagte Joe. »Verdammt gute Arbeit.« Er liebte den Geruch des frisch lackierten Holzes, und er genoss aus vollem Herzen, endlich wieder einmal Schiffsplanken unter den Füßen zu haben.
Bei Joes letztem Aufenthalt in der Stadt hatte die Marylou noch am Ufer gelegen. Er hatte sie gründlich inspiziert und mit Ezra die letzten Details abgesprochen, was den Anstrich, das Schmieren und die Anordnung bestimmter Maschinenteile betraf. Nun war er sehr stolz, Besitzer eines so großartigen Schiffes zu sein. Tatsächlich war es sogar der stolzeste Tag in seinem Leben, abgesehen von dem Tag, an dem er Mary geheiratet hatte.
»Es freut mich jedes Mal, wenn meine Kundschaft zufrieden ist«, erwiderte Ezra. Während Joe und Ned sich ans Ufer begaben, um den Holzstapel in Angriff zu nehmen, wandte Ezra sich Mary zu. »Wie wär’s, wenn ich Ihnen die Kombüse zeige?«
»Kombüse?«
»Das ist die Küche auf einem Schiff, aber Sie können sie nennen, wie Sie wollen«, erklärte Ezra lächelnd.
Mary strahlte bei dem Gedanken an eine eigene, nagelneue Küche. Ihre Töpfe und Küchenutensilien waren in der Reisekiste verstaut. Nachdem sie zwei Jahre lang Gold gewaschen hatte, freute sie sich nun, dass ihre Hände in Zukunft nicht mehr so aussehen würden, als müsste sie für ihren Lebensunterhalt Lehmziegel formen.
Während sie Ezra zur Kombüse folgte, überkam sie ein Gefühl der Zuversicht, das angesichts der Umstände nicht unbedingt angemessen war. Das Schiff hatte ihre gesamten Ersparnisse verschlungen, und sie wussten nicht einmal genau, worauf sie sich einließen. Sie hatte keine Ahnung von den Preisen für Brennholz, geschweige denn von den Wartungskosten für das Schiff. Dennoch verspürte Mary Zuversicht, weil sie und Joe endlich ein Dach über dem Kopf hatten, ein Zuhause, das sie ihr Eigen nennen konnten.
Auf dem Niedergang bemerkte Joe, dass Ned leicht humpelte. »Alles klar, Ned?«, fragte er.
»Alles in Ordnung, Mr Callaghan.«
Joe jedoch hatte den Eindruck, Ned würde die Zähne zusammenbeißen. Er sah aus, als ginge es ihm gar nicht gut. »Sag Joe zu mir, Ned. Schließlich werden wir von nun an auf engstem Raum zusammen leben und arbeiten. Wir können auf Förmlichkeiten verzichten.«
Ned nickte, glaubte jedoch, Bedauern in Joes Stimme zu hören. Er versuchte sich einzureden, dass es bloß Einbildung sei, doch es gelang ihm nicht, und er hielt den Blick gesenkt, als könne er Joe nicht in die Augen schauen.
Joe befielen erste Zweifel. Er fragte sich, ob er überstürzt gehandelt hatte, als er Ned angeheuert hatte. Schließlich war er ein Fremder. Er musste an die Männer denken, die ihm auf den Goldfeldern begegnet waren. Viele von ihnen hatten eine zweifelhafte Vergangenheit, und Joe kam der leise Verdacht, dies könne auch auf Ned zutreffen. Außerdem brauchte er einen Matrosen mit Erfahrung, und das beschränkte sich nicht allein auf die Dampfmaschine. Es wäre hilfreich gewesen, einen Mann an Bord zu haben, der sich mit der Flussschifffahrt auskannte. Einen flüchtigen Augenblick lang fragte sich Joe, ob er eine zusätzliche Kraft anheuern sollte, verwarf diesen Gedanken aber sofort wieder. Das konnte er sich nicht leisten. Andererseits brachte er es nicht übers Herz, Ned zu sagen, er habe es sich anders überlegt und könne ihn doch nicht einstellen. Sie mussten eben gemeinsam das Beste aus ihrer Zusammenarbeit machen und rasch dazulernen.
»Richte Mary bitte aus, dass ich heute Nacht am Ufer schlafe«, sagte Ned. »Ich habe einen eigenen Schlafsack dabei und übernachte gern unter freiem Himmel. Ich will dir und deiner Frau keine Umstände machen.«
Joe sah ihn verblüfft an. Er wollte ihm eine Kajüte anbieten, hielt es jedoch für klüger, zuvor Marys Meinung einzuholen. Doch Joe brauchte nichts zu sagen; Ned hatte auch so verstanden. »Ich bin dir für diese Arbeit sehr dankbar, Joe«, sagte er und trat verlegen von einem Fuß auf den anderen, wobei er ein Bein zu entlasten schien. »In meinem Alter bekommt man nicht so leicht eine Anstellung, aber ich bin kräftig und halte mich in Form. Ich werde dich nicht enttäuschen. Wenn es dir hilft, kannst du mir ja eine Probezeit von einem Monat geben.«
Joes Bedenken legten sich wieder. Was immer mit Ned gewesen war – er verdiente die Chance, sich zu bewähren.
»Ich habe dich angeheuert, Ned, und ich stehe zu meinem Wort.« Dennoch spürte Joe, dass Ned ihm etwas verheimlichte. »Jeder hat eine Chance verdient«, fügte er hinzu. »Ich möchte, dass es mit meinem Schiff gut läuft. Und ich will Mary das Leben bieten, das sie verdient hat. Nur das zählt für mich. Verstehst du, Ned?«
Ned nickte. »Du wirst es nicht bereuen, dass du mich angeheuert hast, Joe, das schwöre ich.«
Joe nickte seinerseits und betrachtete die Schweißperlen in Neds Gesicht. »Bist du zu Fuß hierher gekommen?«
»Nein, Barmah ist mehr als vierzig Meilen entfernt. Ich bin auf einem Dampfer bis Moama mitgefahren und habe von dort auf Silas Hepburns Fähre ans andere Ufer übergesetzt, zusammen mit einer Schafherde.«
»Wir sind vorhin an der Stelle vorbeigefahren«, bemerkte Joe.
»Ja, ich hab die Kutsche gesehen und dich erkannt«, entgegnete Ned. »Ich dachte mir gleich, dass ihr auf dem Weg zur Werft wart.«
»Dann bist du mit deinem Gepäck von der Anlegestelle aus gelaufen?«, sagte Joe. »Das ist mehr als eine Meile.«
Ned nickte. Sein Magen knurrte, doch die Schmerzen im Fuß machten ihm am meisten zu schaffen. Der Marsch war ihm wie zehn Meilen vorgekommen, und sein Fuß fühlte sich an, als drohe er im Stiefel zu platzen.
»Möchtest du etwas trinken, bevor wir loslegen?«
Ned zog die Jacke aus und krempelte die Hemdsärmel hoch. »Nein, danke ... obwohl es heute Morgen ganz schön heiß ist«, meinte er, wischte sich den Schweiß von der Stirn und ergriff die Axt.
Joe kam es gar nicht so warm vor, sodass er vermutete, dass mit Ned etwas nicht stimmte, aber er wollte ihn nicht mit Fragen unter Druck setzen. Er wollte nur eins: dass alles reibungslos lief.
Während er ebenfalls die Jacke auszog, sagte er: »Ich schaffe erst einmal die Reisekiste und die Vorräte an Bord, damit Mary sich einrichten kann. Dann gehe ich dir zur Hand.«
In Hochstimmung legte Joe in der Abenddämmerung mit der Marylou an einem Uferstück an, das in seinen Karten als Boora Boora gekennzeichnet war. Am Zusammenfluss von Murray und Campaspe River hatte Joe nicht Halt machen oder umkehren wollen und deshalb dem Kapitän eines anderen Raddampfers zugerufen, er solle Ezra Pickering ausrichten, dass sie weitergefahren seien – für den Fall, dass Ezra auf den Gedanken kam, die Marylou wäre in Schwierigkeiten.
Nachdem Ned das Schiff an Bäumen am Ufer vertäut hatte, stellte er die Maschine ab. Obwohl sie auf dieser Jungfernfahrt von ernsten Zwischenfällen verschont geblieben waren, war der Nachmittag nicht ganz reibungslos verlaufen. Joe hatte im Ruderhaus das Schiff gesteuert, während Ned im Kesselraum dafür gesorgt hatte, dass das Feuer nicht erlosch. Es gab Abstimmungsprobleme, als Ned nicht sicher war, ob sie vorwärts oder rückwärts fahren sollten, nachdem Joe einige unfreiwillige Wendemanöver eingeleitet hatte, da er sich öfter mit den Steuerungshebeln irrte. Während Joe sich auf der rechten Uferseite hielt, behielt er gleichzeitig die Karten im Auge, um Klippen, Sandbänken und überhängenden Bäumen auszuweichen, die in den Karten eingezeichnet waren. Außerdem musste er sich in Erinnerung rufen, ob er ein-, zwei- oder dreimal die Dampfpfeife betätigen musste, wenn er den Kurs änderte oder sich einer Flussbiegung näherte, die man nicht einsehen konnte. Deshalb war es nicht verwunderlich, dass er das Schiff zweimal fast auf Grund gesetzt hätte. Doch als der Tag sich dem Ende zuneigte, spürte Joe, dass er sich allmählich an die Marylou gewöhnte, und auch Ned kannte sich bereits ein wenig mit der Dampfmaschine aus.
Sie ankerten an einer Stelle, in deren Nähe sich nach der Karte ein Holzladeplatz befand. Üblicherweise wurde der Holzhandel auf Vertrauensbasis abgewickelt. Das gefällte Holz wurde am Ufer der nächsten Anlegestelle gestapelt, und wenn ein Raddampfer festmachte, um Brennholz nachzuladen, und gerade niemand zugegen war, hinterlegte man einfach das Geld. Obwohl sie mit geringer Geschwindigkeit gefahren waren und Joe sein Bestmögliches getan hatte, dem Schiffsverkehr aus dem Weg zu gehen, schien der Dampfkessel eine erschreckende Menge Holz zu verbrauchen. Während Ned staunte, wie rasch eine Tonne Holz aufgebraucht war, hielt Joes Verwunderung sich aufgrund seiner langjährigen Erfahrung mit Dampfschiffen bei der Handelsmarine in Grenzen.
Zur Mittagszeit hatte Mary die beiden Männer mit Brot, Käse und Tee versorgt, was auch fürs Abendessen vorgesehen war, da Mary nichts anderes an Bord hatte. Doch kaum hatten sie angelegt, ging Ned mit seinem Seesack an Land und richtete sich ein Lager her. Kurze Zeit später breitete sich der verlockende Geruch von gebratenem Fisch aus.
Mary und Joe traten an Deck, um nachzusehen, woher der Geruch kam.
»Wollt ihr zum Abendessen frischen Dorsch?«, rief Ned freundlich herüber. »Für mich allein ist es zu viel.« Dabei hob er eine ziemlich große Pfanne hoch. Sie war nicht groß genug für den Fisch, dessen Kopf und Schwanz über die Ränder ragte und der offensichtlich ein schwerer Brocken war. Ned musste die Pfanne mit beiden Händen halten.
»Hast du diesen Prachtburschen eben erst gefangen?«, rief Joe verwundert.
»Aye. Von Hand, mit einer Schnur«, rief Ned zurück. »Vor langer Zeit habe ich von den Aborigines einige Kniffe gelernt, auch was das Angeln und die Jagd angeht. Seither habe ich nie mehr Hunger gelitten.«
»Kannst du das Joe beibringen?«, fragte die sichtlich begeisterte Mary.
»Ja, sicher. Sobald der Fisch gar ist, bringe ich ihn an Bord.«
Es wurde rasch dunkel. Mary hielt sich an der Reling fest und ließ den Blick über den Fluss schweifen. Ohne das Glitzern der Sonne auf der Wasseroberfläche wirkte er düster und unheimlich, aber sie würde sich schon daran gewöhnen. Aus dem Schilf am Uferrand vernahm sie das Zirpen von Grillen, und am pechschwarzen Himmel stieg ein silbern glänzender Mond empor. Der Schein von Neds Feuerstelle erleuchtete sein bescheidenes Lager; dahinter bildeten die Bäume eine undurchdringliche Mauer der Finsternis. An Bord zündete Joe gerade Öllaternen an.
»Hier ist es so friedlich«, sagte Mary, glücklich darüber, das Leben auf den Goldfeldern, auf denen sie die Nächte stets gefürchtet hatte, hinter sich gelassen zu haben. Nur der Traum von einem zukünftigen Leben auf ihrem eigenen Schiff und der Beschaulichkeit des Flusses hatten sie durchhalten lassen. Joe legte ihr die Arme um die Taille. »Ja, hier ist es wundervoll friedlich, nicht wahr?« Er war ein wenig abgelenkt, da er zu Ned am Flussufer hinüberspähte, der gerade mit der Fischpfanne zum Schiff kam. Selbst im Schein des Lagerfeuers konnte Joe erkennen, dass Neds Humpeln sich verschlimmert hatte. Er fragte sich, ob Ned irgendeine alte Verletzung zu schaffen machte, wenn er sich überanstrengte.
Beim Abendessen versuchten die Callaghans, den stets schweigsamen Ned zum Reden zu bewegen, doch nur mit mäßigem Erfolg. Mary erzählte ihm, dass sie und Joe seit fünfzehn Jahren verheiratet seien und keine Kinder hätten und dass die Marylou ihr erstes richtiges Zuhause sei. Dann stellte Joe ein paar persönliche Fragen, aber da Ned nur widerstrebend von sich erzählte, erfuhren die Callaghans lediglich, dass er niemals geheiratet hatte und nach seiner Reise von Cornwall nach Australien von der Port Phillip Bay bis zur Spitze von Cape York weitergezogen war, ohne jemals irgendwo Fuß gefasst zu haben. Offenbar hatte er sich mit jeder erdenklichen Arbeit verdingt, angefangen vom Schlangenfänger bis zum Wollpacker. Einmal, erzählte er mit dem Anflug eines Lächelns, sei er sogar mit der Aufgabe betraut worden, die Flöhe aus dem Fell der Hunde eines Farmers zu klauben. Dies sei einer der Tiefpunkte in seinem Leben gewesen.
Joe und Mary bekamen den Eindruck, dass es viele solcher Tiefpunkte gegeben hatte. Sie fragten sich, ob Ned jemals ein so genannter »Gast der Krone« gewesen war, wie man die Exsträflinge scherzhaft nannte, zumal mehr als die Hälfte der australischen Einwohner ehemalige Strafgefangene waren. Dieser Verdacht drängte sich ihnen auch deshalb auf, weil Ned nicht erwähnte, mit welchem Schiff – und wann – er eingetroffen war, und sie wollten ihn nicht direkt danach fragen.
»Boora Boora ist ein seltsamer Name, Ned. Weißt du, was er bedeutet?«, fragte Mary, nachdem sie den Fisch verzehrt hatten und den Saft mit Brot auftunkten.
»Vor ein paar Jahren habe ich als Hilfsarbeiter auf einer Farm mit einem Ureinwohner aus dem ansässigen Yortta-Yortta-Clan zusammengearbeitet, und der hat mir mal eine kreisförmige Boora-Stätte gezeigt. Wenn ich’s mir genau überlege, könnte es sogar hier in der Gegend gewesen sein. Aber ich habe damals einen großen Bogen darum gemacht, weil der Ureinwohner sagte, dass sein Volk dort Zeremonien abhielte. Boora Boora ist wahrscheinlich eine heilige Stätte der Ureinwohner.«
»Und was für Zeremonien werden in diesem Boora-Kreis abgehalten?«, wollte Mary wissen, der schreckliche Bilder von Tier- und Menschenopfern in den Sinn kamen.
»Um ehrlich zu sein«, entgegnete Ned, »wollte ich es damals nicht wissen, und daran hat sich bis heute nichts geändert. Ich glaube, es ist am besten, sich von solchen Dingen fern zu halten.«
Mary sah Joe an. »Vielleicht hätten wir nicht hier anlegen sollen.«
»Wir stören ja niemanden«, erwiderte Joe.
»Mach dir keine Sorgen, Mary. Uns passiert schon nichts«, meinte auch Ned und rieb sein Bein. »Ich haue mich jetzt aufs Ohr.«
Im Lampenschein konnten Mary und Joe erkennen, dass Neds Gesicht verzerrt und bleich war. Auf seiner Stirn schimmerte ein Schweißfilm. Allmählich machten die Callaghans sich Sorgen um ihn, doch sie wussten, dass Ned abstreiten würde, krank zu sein, wenn sie ihn darauf ansprächen.
Mary warf einen ängstlichen Blick aufs dunkle Ufer. Neds beiläufige Beteuerung, dass nichts passieren könne, beruhigte sie kein bisschen – geschweige denn die Sorglosigkeit ihres Mannes, obwohl sie sich in der Nähe einer Kultstätte der Ureinwohner befanden.
»Morgen fahren wir früh los«, sagte Joe. »Danke für den Fisch, Ned. Er war köstlich.«
»Ja, er hat großartig geschmeckt«, pflichtete Mary ihm bei. »Und ich kann immer noch nicht fassen, wie riesig er war.«
»Es heißt, im Murray gibt es Dorsche, so groß wie Menschen«, sagte Ned und rappelte sich mühsam auf.
Wieder blickte Mary in sein schmerzverzerrtes Gesicht, und diesmal fragte sie geradeheraus: »Alles in Ordnung, Ned?«
»Ja«, presste er leise hervor. »Hab nur einen leichten Krampf im Fuß. Gute Nacht.«
»Warum schläfst du nicht in einer Kajüte?«, bot Mary an, als Ned sich zum Gehen wandte. Sie wusste, dass sie sich um ihn sorgen würde, wenn er mutterseelenallein am Ufer lag, zumal es ihm nicht gut zu gehen schien. »Es sind noch zwei Kajüten frei. Da macht es doch keinen Sinn, am Ufer zu schlafen. Man kann ja nie wissen, wer sich da draußen herumtreibt.« Erneut warf sie einen Blick auf das finstere Baumdickicht und schauderte.
»Ich komme schon zurecht, Mary«, erwiderte Ned. »Ich bin es gewohnt, unter freiem Himmel zu schlafen.«
»Aber es sieht nach Regen aus«, wandte Joe in nüchternem Tonfall ein, aus dem dennoch seine Sorge herauszuhören war.
»Falls es regnet, komme ich an Bord und schlage mein Lager an einer geschützten Stelle an Deck auf«, sagte Ned und humpelte davon.
Mary und Joe folgten ihm und stellten sich an die Reling, während er vom Schiff ans Ufer sprang. Obwohl er versuchte, trotz der Schmerzen die Zähne zusammenzubeißen, hörten die Callaghans seinen unterdrückten Aufschrei, als er auf den Füßen landete. Dann beobachteten sie, wie er zu seinem Lager humpelte.
Verstört blickten sie sich an, waren aber unschlüssig, was sie sagen oder tun sollten. Außerdem übermannte sie nun die Erschöpfung nach diesem langen, anstrengenden Tag.
Ned zog sich derweil eine Decke über, nachdem er sich neben sein erlöschendes Lagerfeuer gelegt hatte. Sein Fuß bereitete ihm Höllenqualen, aber er wusste, wenn er den Stiefel auszöge, würde er ihn nie wieder anbekommen.
Eine Stunde später hatte er immer noch keinen Schlaf gefunden. Die Schmerzen wurden schlimmer, und ihm war kalt, nachdem sein Feuer erloschen war. Dennoch hatte er weder die nötige Energie noch den Willen, nach Feuerholz zu suchen.
Eine weitere Stunde verstrich, und die Schmerzen wurden fast unerträglich. Ned setzte sich auf und massierte sein Bein. Er hätte nichts lieber getan, als den Stiefel auszuziehen, dachte aber an den nächsten Morgen: Joe erwartete von ihm, dass er Holz hackte und es aufs Schiff trug. Ned beschloss, Joe nichts von seinen Schmerzen zu erzählen, aus Angst, seine Stelle zu verlieren.
Plötzlich vernahm er ein Geräusch im Schilf hinter ihm – ein Rascheln, gefolgt von einem gedämpften Schluchzen. Ganz in der Nähe befand sich eine kleine Bucht, und das Geräusch schien aus dieser Richtung gekommen zu sein.
Ned verharrte regungslos und spitzte die Ohren. Zuerst dachte er an nistende Enten im Schilf, aber das würde das gedämpfte Schluchzen nicht erklären, das sich wie von einem Menschen angehört hatte. Nach einigen Augenblicken, als alles wieder ruhig war, fuhr Ned mit der Massage seines Beins fort – und vernahm erneut einen gedämpften Laut. Dieses Mal klang es wie ein unterdrückter Schrei der Verzweiflung.
»Das ist keine Einbildung«, murmelte Ned und beschloss, der Sache auf den Grund zu gehen. Stöhnend rappelte er sich auf und humpelte zum Ufer. Der silberne Mondschein warf einen Lichtstreifen auf die Wasseroberfläche, und in den dunklen Schatten unter den überhängenden Bäumen nahe der Stelle, wo der Bach in den Fluss mündete, schien sich etwas zu bewegen. Obwohl Ned nur eine verschwommene Silhouette ausmachen konnte, spähte er weiter angestrengt dorthin. Jetzt war er sicher, das verzweifelte Schluchzen einer Frau gehört zu haben, vermutlich einer Aborigine. Dann vernahm er ein Geräusch, kein Platschen, sondern eher eine Bewegung auf dem Wasser. Während er in die Dunkelheit starrte, überkam ihn die Gewissheit, dass irgendetwas vom Ufer ins Wasser gestoßen worden war, etwas Unförmiges, nicht besonders groß, aber für ein Boot eindeutig zu klein.
Gespannt beobachtete Ned den Gegenstand, der sich dem Lichtstreifen des Mondes auf der Wasseroberfläche näherte. Als er ins Licht eintauchte, erkannte Ned, dass es sich um eine kleine Badewanne handelte, über die ein Tuch in hellen Farben drapiert war, dessen Zipfel ins Wasser hingen. Ned verstand überhaupt nichts mehr. Es war mehr als unwahrscheinlich, dass ein Ureinwohner eine Kinderwanne besaß.
Während Ned beobachtete, wie die kleine Wanne auf dem Wasser trieb, rätselte er, was er davon halten sollte. Im nächsten Moment blieb ihm vor Entsetzen der Mund offen stehen, weil er ein Baby weinen hörte. Wieder blickte er zu der Stelle, wo er die Silhouette unter den Bäumen erspäht hatte, doch wer immer es gewesen sein mochte, die Person hatte sich mittlerweile aus dem Staub gemacht. Ned kam der Gedanke, dass das Baby in der Wanne absichtlich ausgesetzt worden war – aber aus welchem Grund? Das war doch verrückt!
Ned handelte instinktiv. Ohne die Schmerzen im Fuß zu beachten, humpelte er zur Marylou, wo er an Bord kletterte und nach Joe rief. Als Joe und Mary kurz darauf erschienen, sahen sie Ned weit über die Reling gebeugt.
»Holt eine Laterne«, rief Ned. »Da treibt irgendwas im Fluss. Es sieht aus wie eine Wanne ... und ich glaube, ein Baby liegt darin.«
Joe und Mary, mit einem Schlag hellwach, wechselten einen bestürzten Blick.
»Beeilt euch!«, rief Ned.
Er klang so verzweifelt, dass Joe rasch eine Laterne anzündete und sich neben ihn stellte. Auch Mary spähte in die Dunkelheit. Zunächst konnte Ned die kleine Wanne nicht mehr entdecken, da sie aus dem Lichtkegel des Mondes verschwunden war, sodass er sich ängstlich fragte, ob sie bereits gekentert war.
»Wie kommt denn eine Wanne mit einem Baby in den Fluss, Ned?« Mary fragte sich insgeheim, ob Ned geträumt hatte.
»Ich dachte, ich hätte eine Frau gehört ...«
»Eine Frau?«, rief Mary erschrocken.
»Es war zwar zu dunkel, um sie zu erkennen, aber es hörte sich an, als hätte sie Schmerzen oder wäre verzweifelt. Als Nächstes habe ich ein Geräusch im Wasser gehört, als würde ein Boot vom Ufer aus hineingeschoben ... aber es war kein Boot, sondern eine kleine Wanne. Mir war das Ganze unerklärlich, bis ich ein Baby hab weinen hören ...« Ned wurde bewusst, dass seine Worte sich ziemlich verrückt anhörten, und er fragte sich unwillkürlich, ob er sich das Weinen des Babys tatsächlich nur eingebildet hatte. Es schien unfassbar, dass jemand ein Baby im Fluss ausgesetzt hatte.
»Bist du sicher, dass es kein Tier war, Ned?«
»Ich weiß, wie ein Tier klingt«, gab Ned ein wenig eingeschnappt zurück. Er wusste, wie fantastisch seine Geschichte sich anhörte, doch ihm missfiel die Vorstellung, dass Joe und Mary ihn für übergeschnappt halten könnten.
Joe und seine Ehefrau wechselten stumme Blicke. Sie wussten nicht, ob sie Ned glauben sollten. Mit einem Mal wurde die Stille vom erstickten Schrei eines Babys unterbrochen. Sofort wandten die drei sich um und spähten wieder aufs Wasser.
»O Gott«, stieß Mary hervor, die Hand vor den Mund geschlagen. »Da draußen ist tatsächlich ein Baby.«
Joe hielt die Laterne hoch, die einen schwachen, aber großen Lichtkreis auf das Wasser warf. Fassungslos beobachteten die drei, wie die Wanne mit dem Baby geräuschlos am Schiff vorüberglitt, von der Strömung getrieben. Ein Gefühl der Hilflosigkeit überkam sie, denn die Entfernung war zu groß, um die Wanne mit einer Stange einzuholen.
Als das Baby erneut jammerte, geriet Mary in Panik. »Wir müssen etwas tun!«, wandte sie sich an Joe. »Das arme Kind ertrinkt, wenn die Wanne kentert!«
Bevor Mary und Joe wussten, was Ned vorhatte, streifte dieser bereits seine Jacke ab und sprang unbeholfen über die Reling.
Instinktiv wollte Joe ihn zurückhalten, doch Ned tauchte bereits in die trüben Tiefen des Flusses ein und verschwand unter der Wasseroberfläche.
Marys Blick schweifte übers Deck. »Er hat seine Stiefel noch an, Joe«, rief sie. »Er wird ertrinken!«
Erneut hielt Joe die Laterne hoch, und gebannt verfolgten er und Mary, wie Ned wieder auftauchte und zur Mitte des Flusses schwamm, der kleinen Wanne hinterher, die von der Dunkelheit rasch verschluckt wurde.
Joe rief laut nach Ned, doch alles, was er und Mary hören konnten, war das Platschen von Neds Armen und Beinen, während er der Wanne hinterherschwamm.
Mehrere qualvolle Sekunden später rief Ned: »Ich ... hab sie.« Seine Stimme klang schwach, da er sich bereits ein gutes Stück von der Marylou entfernt hatte.
»Gegen die Strömung kann er den Weg zurück unmöglich schaffen«, sagte Joe zu Mary. »Nicht mit den Stiefeln an den Füßen.«
»Dann werden er und das Baby ertrinken«, stieß Mary verzweifelt hervor. »Was können wir tun, Joe?« Mary konnte es nicht fassen, dass ihre erste Nacht an Bord so schrecklich verlief. Es war ein Albtraum.
»Ich hole ein Seil«, entschied Joe und stieg hastig in seine Stiefel.
Mit dem Seil und der Laterne sprang er von Bord und rannte am Fluss entlang, wobei er Ned zurief, er solle zum nächsten Ufer schwimmen. Joe wusste, dass Neds Kleidung und seine Stiefel ihn unter Wasser ziehen würden, und er gab ihm und dem Baby nur geringe Überlebenschancen.
In der Finsternis konnte Joe lediglich Neds Kopf und die dahintreibende Wanne erkennen. Er sah, dass Ned versuchte, zu einem umgestürzten Baum am Ufer zu gelangen, der seine Äste wie rettende Hände zu ihm ausstreckte. Doch er kam nur langsam voran, sein Kopf tauchte mehr als einmal unter Wasser.
Irgendwie schaffte es Ned, die dünne Spitze des nächsten Astes zu erreichen. Er schnellte zurück, als er danach griff. Joe watete ins seichte Wasser und warf das Seil aus, doch die Strömung riss es fort, bevor Ned es packen konnte. Als Joe das Seil eingeholt hatte, rollte er es schnell auf und band ein Ende um den Stamm des umgestürzten Baumes. Das Seil in der Hand, watete er dann bis zur Taille ins Wasser und warf das aufgerollte Ende noch einmal zu Ned hinaus. Wie durch ein Wunder landete es neben ihm. Doch in der Dunkelheit konnte Joe nicht erkennen, ob Ned danach griff.
Mary erschien, eine Decke in den Armen. Sie blieb am Ufer neben der Laterne stehen, die Joe dort abgestellt hatte, und beobachtete entsetzt, wie die Wanne zu kippen drohte. »Zieh ihn raus, Joe«, rief sie voller Angst, Ned und das Baby könnten in dem dunklen, trüben Wasser des Flusses versinken.
Als Joe Neds Gewicht am Seil spürte, zog er aus Leibeskräften daran. Die Wanne kam ein kleines Stück näher, doch von Ned war keine Spur zu sehen. Plötzlich bemerkte Joe Neds Hand, die aus dem Wasser ragte und mit der er sich seitlich an der Wanne festhielt. Joe sollte es ewig ein Rätsel bleiben, dass Ned die Wanne nicht zum Kentern gebracht hatte. Er watete weiter hinaus, bis das Wasser ihm unter die Achselhöhlen reichte, während er sich an den Ästen des umgestürzten Baumes und am Seil festklammerte. Schließlich erspähte er Ned, und es gelang Joe, ihn an der Schulter zu packen.
Marys Herz klopfte wild. Tränen der Erleichterung liefen ihr über die Wangen, als Joe Ned und die kleine Wanne ans sichere Ufer zog.
Dort wickelte Mary als Erstes Ned in die Decke und hob dann die kleine Wanne mit dem Baby darin hoch. Joe half Ned auf die Beine, indem er ihn mit der Schulter stützte. Obwohl Ned geschwächt war und viel Flusswasser geschluckt hatte, gelang es Joe, ihn wieder auf die Marylou zu befördern. Nachdem alle an Bord waren, nahm Mary das Baby aus der Wanne, hielt es ins Licht der Lampe und wickelte behutsam das Tuch auseinander, in das es gehüllt war. Eigentlich hatten sie damit gerechnet, einen kleinen Ureinwohner zu Gesicht zu bekommen, sodass sie fassungslos das weißhäutige Baby anstarrten. Ein winziges Mädchen, erst wenige Stunden alt. Die Nabelschnur war unbeholfen mit einem Stück Faden abgebunden worden, und es war noch blutig von der Geburt.
»Armes Würmchen«, sagte Mary mit Tränen in den Augen, als das winzige Kinn des Babys plötzlich zu zittern anfing. Rasch wickelte Mary es wieder ins Tuch und hielt es schützend an die Brust, um ihm Wärme zu spenden. »Was ist das für eine Mutter, die ihr Neugeborenes in einem Fluss aussetzt!«
»Ich werde mal schauen, ob ich die Frau finden kann«, sagte Joe und zündete eine weitere Laterne an. »Vielleicht steckt sie in Schwierigkeiten.« Er vermutete, dass sie womöglich in eine der heiligen Zeremonien der Ureinwohner verwickelt war.
»Alles in Ordnung, Ned?«, fragte Mary, nachdem Joe sich auf den Weg gemacht hatte. »Was hast du dir eigentlich dabei gedacht, mitsamt den Stiefeln ins Wasser zu springen? Es ist ein Wunder, dass ihr nicht ertrunken seid, du und das Kleine.«
»Ich musste die Gelegenheit beim Schopf packen, Mary. Hätte ich nichts unternommen, wäre dieses süße kleine Mädchen bestimmt ertrunken oder tagelang auf dem Fluss getrieben und jämmerlich verdurstet.«
»Du hast Recht. Sie verdankt dir ihr Leben. Aber wir müssen unbedingt Milch für sie auftreiben. Ich weiß nicht, ob dein Verhalten tapfer oder dumm war, aber du musst einen Schutzengel gehabt haben, sonst hättest du es nie zurück ans Ufer geschafft.«
»Ob ich einen Schutzengel hatte, kann ich nicht sagen, aber ohne Joe hätte ich es bestimmt nie geschafft.«
Plötzlich sah Mary, dass wässriges Blut aus einem von Neds Stiefeln sickerte. »Du hast dich verletzt!«
Ned folgte ihrem Blick und wurde blass. »Nein ... das ist nichts. Ich hab ein bisschen Wasser geschluckt, aber das bringt mich nicht um.« Er zog seinen Stiefel zurück, um ihn zu verbergen.
»Zieh den Stiefel aus, Ned. Ich möchte sehen, woher das Blut kommt.«
»Es ist nichts, Mary, ehrlich. Wahrscheinlich nur ein Kratzer am Bein.«
Nicht zum ersten Mal spürte Mary, dass Ned irgendetwas verheimlichte. »Für einen Kratzer blutet es zu stark. Zieh jetzt den Stiefel aus, Ned«, wiederholte sie in einem Ton, der keinen Widerspruch duldete.
Ned gab sich geschlagen, zumal er keine Kraft mehr hatte, sich zu widersetzen. Da die Schmerzen in seinem Fuß schlimmer waren als zuvor, hatte er im Grunde ohnehin keine andere Wahl, als den Stiefel auszuziehen. Das würde ihn zwar seinen Job kosten, aber es musste sein.
Als Ned langsam den Stiefel abstreifte, stöhnte er laut vor Schmerz. Es fühlte sich an, als würde ihm das Fleisch von den Knochen gezogen. Es war eine Wohltat, als er den Stiefel endlich vom Fuß hatte und der unerträgliche Druck nachließ, doch gleich darauf erschrak er beim Anblick seiner Socke. Sie war mit Blut getränkt. Als er die Socke vorsichtig von seinem Fuß abschälte, erschrak Mary heftig.
»Oh, Ned ...« Auf dem Fußrücken war eine tiefe, klaffende Wunde. »Du lieber Himmel, wie ist denn das passiert?« Es war offensichtlich, dass Ned sich die Verletzung nicht im Wasser zugezogen haben konnte.
»Der Axtstiel ist abgebrochen, und die Klinge schlug mir in den Stiefel. Ich kann von Glück sagen, dass sie keinen Knochen erwischt hat.«
»Vor allem kannst du von Glück sagen, dass du noch alle Zehen hast. Wann ist das passiert?«
»An dem Morgen, als ich zu dir und Joe kommen sollte. Ein Mann, mit dem ich zusammengearbeitet habe, hat mir dieses Paar alte Stiefel geschenkt. Es hat eine Ewigkeit gedauert, bis ich den Fuß drinhatte. Darum bin ich zu spät zum vereinbarten Treffpunkt gekommen.«
Jetzt verstand Mary, weshalb Ned die Stiefel nicht einmal zum Schlafen ausgezogen hatte. »Du musst dich ja furchtbar gequält haben«, sagte Mary leise.
Ned begnügte sich mit einem kurzen Nicken.
»Warum hast du nichts gesagt?«
»Ich hatte großes Glück, dass ich diese Arbeit hier bekommen habe. In meinem Alter findet man nicht so schnell eine Anstellung.«
»Du kannst in den nächsten Tagen keinen Stiefel tragen, Ned. Sonst könnte sich die Wunde am Fuß entzünden und Wundbrand entstehen.«
In Neds Gesicht breitete sich Enttäuschung aus. »Aber ich kann ohne Stiefel nicht arbeiten, Mary.«
»Du wirst auch nicht arbeiten, Ned, sondern zusehen, dass du wieder gesund wirst.« Mary blickte in seine blauen Augen und wusste, was er gerade dachte. »Wenn es darauf ankommt, ist auf Joe Verlass, Ned.«
Bevor Ned etwas entgegnen konnte, tauchte Joe auf.
»Ich hab zwar niemanden gefunden, aber im nassen Sand am Ufer waren Schuhabdrücke, ganz in der Nähe der kleinen Bucht. Für einen Mann waren sie zu klein, und da die Ureinwohner keine Schuhe tragen, liegt der Verdacht nahe, dass sie von einer weißen Frau stammen.« Joe machte ein betretenes Gesicht. »Da waren auch frische Spuren von einer Geburt ...« Plötzlich fiel sein Blick auf Neds Fuß. »Du lieber Himmel. Das sieht ja schlimm aus, Ned.«
Als Ned keine Antwort gab, berichtete Mary ihrem Mann, was geschehen war. »Der Griff von seiner Axt ist abgebrochen, und die Klinge ist durch den Stiefel in seinen Fuß gedrungen«, erklärte sie. »In den nächsten Tagen kann er keinen Stiefel tragen.«
»Ja. Du musst schlimme Schmerzen haben, Ned, und ich kann dir nicht mal einen Schluck Whisky anbieten.«
Ned war sprachlos. Offenbar verschwendete Joe keinen Gedanken daran, dass er, Ned, jetzt als Arbeitskraft ausfiel.
Jetzt begriff Joe, weshalb Ned die ganze Zeit gehumpelt hatte. Und nun erkannte er auch, dass Ned die Verletzung verschwiegen hatte aus Angst, seine Arbeit zu verlieren. »Mary kann dir den Fuß verbinden, Ned«, sagte er.
»Das Holzhacken schaffe ich schon noch«, meinte Ned und klammerte sich an einen Hoffnungsschimmer.
»Nichts da. Das Holzhacken übernehme ich.«
Ned ließ den Kopf hängen.
»Du bleibst an Bord, Ned. Wie wär’s, wenn du den Kessel anfeuerst? Dafür brauchst du keine Stiefel an den Füßen«, sagte Joe, denn er wusste, dass Ned nicht untätig herumsitzen konnte.
Neds Gesicht hellte sich auf, als wäre ihm eine Zentnerlast vom Herzen gefallen.
»Wir brauchen uns nicht zu beeilen, um das Holz aufzuladen«, fuhr Joe fort. »Außerdem müssen wir ohnehin einen Zwischenstopp in Echuca oder Moama einlegen, um das Baby den Behörden zu übergeben.« Er sah zu dem kleinen Mädchen, das Mary mit einem für sein Alter ungewöhnlich aufmerksamen Blick betrachtete.
»Wie konnte ihre Mutter sie verstoßen?« Mary schüttelte den Kopf, während sie dem Baby in die Augen sah. »Kinder sind etwas Heiliges ... ein Segen ...« Jahrelang hatte sie gebetet, dass ihr Wunsch nach einem Kind sich erfüllen möge; umso weniger konnte sie begreifen, dass jemand sein eigenes, hilfloses Töchterchen verstieß.
»Eine Fügung des Schicksals hat dieses kleine Mädchen zu uns geführt«, sagte Joe mit Ehrfurcht in der Stimme.
»Die Wege des Herrn sind unergründlich«, sagte Ned in sanftem Ton. Er hatte das Gefühl, von einer gütigen Macht hierher geführt worden zu sein, zumal es ein unglaublicher Glücksfall war, zwei so großherzigen Menschen wie Mary und Joe begegnet zu sein.
»Du hast Recht, Ned«, entgegnete Mary. »Die Mutter hat ihr Kind ausgesetzt und einer ungewissen Zukunft überlassen. Hättest du nicht darauf bestanden, am Ufer zu schlafen, hätten wir gar nicht mitbekommen, dass die Kleine in einer Wanne auf dem Fluss treibt.«
»Und wärst du nicht ins Wasser gesprungen, um sie zu retten, und zwar im richtigen Moment, wäre sie jetzt fort«, fügte Joe hinzu. Er schaute auf das Kind und wusste, dass es mit großer Sicherheit ertrunken wäre. Dank einer Verkettung unglaublicher Zufälle – darunter auch der, dass sie ausgerechnet bei Boora Boora angelegt hatten –, hatte das kleine Mädchen überlebt.
»Ich habe immer schon geglaubt, dass wir nicht alleine für unser Schicksal verantwortlich sind«, sagte Ned und richtete den Blick auf Mary. »Und nun glaube ich, dass dieses kleine Mädchen für euch bestimmt ist.«
Mary schaute Ned an. Seine Worte hatten ihr die Sprache verschlagen.
»Willst du damit sagen, wir sollten sie gar nicht den Behörden übergeben, Ned?«, fragte Joe. Das hatte er noch gar nicht in Erwägung gezogen. Liebend gern hätte er das Kind behalten, doch er wusste, dass es ungesetzlich wäre, die Behörden zu übergehen.
Ned schwieg. Er musste an seine eigene Kindheit denken, und ein solches Schicksal wollte er dem Baby ersparen – jedem Kind. »Wenn ihr sie abgebt, setzt ihr sie einem Leben aus, das viel schlimmer sein könnte, als wäre sie weiter auf dem Fluss getrieben.«
Ungläubig starrten Mary und Joe Ned an. Obwohl sie schwere Zeiten durchgestanden hatten und das Geld oft knapp gewesen war, hatten beide eine wundervolle Kindheit