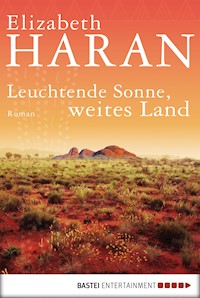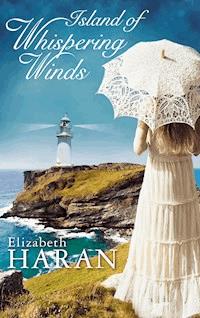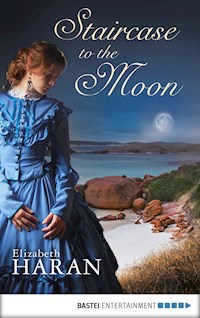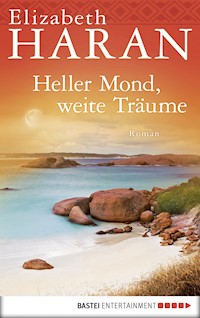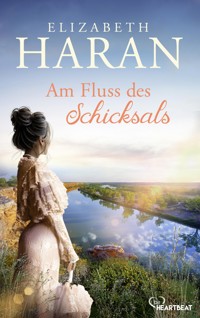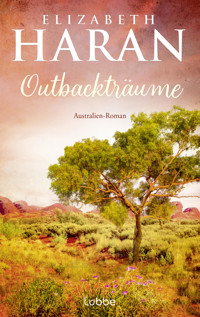
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine mitreißende Liebes- und Familiengeschichte, die vom Leben im Outback erzählt
1946: Die junge Rosa verlässt Italien mit Herzklopfen, um in Australien einen Farmer zu heiraten. Doch als sie in Daly Waters ankommt, stellt sie fest, dass es nicht ihr künftiger Ehemann war, mit dem sie all die Monate einen wunderschönen Briefwechsel geführt hat ...
1967: Die junge Ella kehrt in ihren Heimatort Daly Waters zurück. Sie hat ihre Arbeit im Zoo von Darwin aufgegeben, um für ihre genesende Mutter Rosa da zu sein. Sie wird zu Hause freudig empfangen - auch von Simon, einem Freund aus Kindheitstagen. Ihr Glück ist perfekt, als sie eine Tierauffangstation im Ort gründet. Aber bald muss sie feststellen, es in der beschaulichen Kleinstadtidylle ganz schön brodelt ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 553
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über das Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
Kapitel 1 – Vor der Küste von Darwin, Australien – Ende Juni 1946
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12 – Daly Waters, Australien – Dezember 1946
Kapitel 13
Kapitel 14 – Daly Waters, Australien – August 1959
Kapitel 15
Kapitel 16 – Darwin, Australien – Oktober 1967
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20 – Daly Waters, Australien – Juni 1968
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33 – Daly Waters, Australien – Januar 1976
Über das Buch
Eine mitreißende Liebes- und Familiengeschichte, die vom Leben im Outback erzählt
1946: Die junge Rosa verlässt Italien mit Herzklopfen, um in Australien einen Farmer zu heiraten. Doch als sie in Daly Waters ankommt, stellt sie fest, dass es nicht ihr künftiger Ehemann war, mit dem sie all die Monate einen wunderschönen Briefwechsel geführt hat …
1967: Die junge Ella kehrt in ihren Heimatort Daly Waters zurück. Sie hat ihre Arbeit im Zoo von Darwin aufgegeben, um für ihre genesende Mutter Rosa da zu sein. Sie wird zu Hause freudig empfangen – auch von Simon, einem Freund aus Kindheitstagen. Ihr Glück ist perfekt, als sie eine Tierauffangstation im Ort gründet. Aber bald muss sie feststellen, es in der beschaulichen Kleinstadtidylle ganz schön brodelt
Über die Autorin
Elizabeth Haran wurde in Simbabwe/Afrika geboren, als es noch Südrhodesien hieß. In den 1960er-Jahren zog ihre Familie nach England. Später wanderten sie nach Australien aus. Ihr erster Roman wurde im Jahr 2001 veröffentlicht. Für ihre Recherchen besucht sie stets die Orte, die als Kulisse für ihren nächsten Roman dienen. Elizabeth lebt mit ihrer Familie und vielen Tieren an der Küste Südaustraliens. Nach dem Schreiben ist Kochen, vor allem von Curry-Gerichten, ihre zweite Leidenschaft.
Australien-Roman
Übersetzung aus dem australischen Englischvon Charlotte Lyne
Vollständige eBook-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Titel der australischen Originalausgabe:
»Spirit of the Wild«
Für die Originalausgabe:
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2024 by Elizabeth Haran
Published by arrangement with Elizabeth Haran-Kowalski
Dieses Werk wurde vermittelt durch
die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2025 by
Bastei Lübbe AG, Schanzenstraße 6 – 20, 51063 Köln
Vervielfältigungen dieses Werkes für das Text- und Data-Mining bleiben vorbehalten.
Die Verwendung des Werkes oder Teilen davon zum Training
künstlicher Intelligenz-Technologien oder -Systeme ist untersagt.
Textredaktion: Marion Labonte, Labontext
Kartengestaltung: Reinhard Borner
Umschlaggestaltung: Christin Wilhelm, www.grafic4u.de
Einband-/Umschlagmotiv: © Sina Ettmer Photography/shutterstock;
Photodigitaal.nl/ shutterstock; FiledIMAGE/ shutterstock; Vaclav Sebek/shutterstock
eBook-Erstellung: Dörlemann Satz, Lemförde
ISBN 978-3-7517-7530-4
luebbe.de
lesejury.de
Kapitel 1
Vor der Küste von Darwin, Australien – Ende Juni 1946
Dominica Vozzo stand an der Reling der SS Misr und blickte hinaus auf das fremde Land, das sich vor ihr erstreckte, mit dieser wilden, üppigen Vegetation, die sich so sehr von der in ihrer Heimat unterschied.
Sie legte den Arm um die Schultern ihrer jungen Mitreisenden. »Ist es nicht wunderbar, dass unsere Reise sich dem Ende nähert, Rosa! Endlich erreichen wir Darwin! Ich kann es kaum erwarten, diese schwimmende Blechkiste hier zu verlassen. Ich schwöre, ich werde nie wieder auch nur einen Fuß an Bord eines Schiffes setzen.«
Mit ihren zweiundvierzig Jahren hatte Dominica sich zur Anstandsdame der zwanzigjährigen Rosa ernannt und sie seit ihrer Abreise aus Italien vor den amourösen Annäherungen der Männer aus der Mannschaft beschützt. Sie stammten beide aus dem Norden Italiens und waren – einander unbekannt – in Neapel an Bord des Schiffes gegangen, wo man ihnen Plätze in derselben Kabine im Zwischendeck zugeteilt hatte. Dominica, die ihre Tochter im jugendlichen Alter durch eine Lungenentzündung und ihren Mann im Krieg verloren hatte, war das Leben sinnlos erschienen, nun jedoch hatte ihre Schwester sie um Hilfe in ihrem Frischwaren-Laden gebeten, den sie gemeinsam mit ihrem Mann in einem Vorort von Darwin betrieb.
Das Schiff pflügte sich seinen Weg durch die Timorsee etwa zwei Meilen vor Darwin, hinter sich eine Spur schäumender weißer Gischt. Die Sonne brannte erbarmungslos, die Luft war drückend und windstill und die Frauen in Schweiß gebadet.
Rosas Lächeln fiel in sich zusammen. »Ich bin sicher, so empfindet jeder an Bord«, murmelte sie aufgewühlt. »Ich jedenfalls tue es.«
Mit einem Mal zogen innerhalb von Minuten schwarze Wolken auf, dann grollte Donner bedrohlich. Als ein Blitz über dem Himmel aufleuchtete und gleich darauf ein heftiger Regenguss niederging, schrien die Passagiere an Deck auf und flohen in die nächstgelegene Deckung. Rosa trug einen Sonnenschirm bei sich, der ihre Haut eigentlich vor der starken Sonne schützen sollte, und nun drängte Dominica sich mit ihr darunter.
»So nah und doch so fern«, murmelte sie und betete, dass das Schiff in der Lage sein würde anzulegen, sobald es den Hafen erreichte. »Es wäre wirklich Pech, so kurz vor dem Ufer zu havarieren.«
»Sag doch so etwas nicht, Dominica! Die Rettungsboote wirken kaum seetüchtig, außerdem gibt es viel zu wenige davon.« Rosa schluckte. »Und wir können nicht schwimmen.« Das Becken an Bord war seit einem stürmischen Seegang leer, und so hatten sie nicht die Gelegenheit gehabt, schwimmen zu lernen.
Dann aber verebbte der Schauer ebenso plötzlich, wie er sich über sie ergossen hatte, die Wolken lösten sich auf, und die Sonne zeigte sich wieder.
»Na, das war wirklich eigenartig.« Dominica wischte sich den Schweiß von der Stirn. »Vielleicht können wir nun doch bald am Kai anlegen.«
Rosa seufzte erleichtert auf.
Der Regen hatte keinerlei Abkühlung bewirkt. Wenn überhaupt, dann hatte er die Luft noch drückender gemacht, innerhalb kürzester Zeit waren die Decks getrocknet, als hätten die Frauen sich den Schauer nur eingebildet.
Ein Viertel aller Passagiere aus Europa hatte das Schiff bereits beim Halt im Hafen von Fremantle verlassen, viele von ihnen wollten zu den Minen im Westen Australiens. Ein weiteres Viertel würde in Darwin von Bord gehen, wo das Schiff vor seinem weiteren Weg entlang der Ostküste gereinigt und mit Treibstoff sowie frischen Vorräten versehen werden würde. Halt machen würde es zudem in Sydney, Melbourne und Adelaide, um Passagiere von Bord zu lassen und neue aufzunehmen, bevor es nach Europa zurückkehrte.
Rosas Magen zog sich zusammen, als sie voller Nervosität an den Grund für ihre Reise nach Australien dachte: ihr zukünftiger Ehemann! Ein Mann, dem sie noch nie begegnet war!
Brieflich korrespondierten sie seit zwölf Monaten miteinander, seit sie auf eine Anzeige in der örtlichen Zeitung geantwortet und er ihr in der Folge ein wundervolles Leben auf seiner Farm versprochen hatte. Seine warmherzigen Briefe hatten ein Bild in ihrem Kopf entstehen lassen, in das sie sich schließlich verliebt hatte – ein Bild von dem künftigen Leben, das sie mit ihm teilen wollte, und der Kinderschar, die sie zusammen aufziehen würden. Und so hatte sie bis zu genau diesem Moment das Gefühl gehabt, Lugh Varden bereits zu kennen. Jetzt aber, nur Minuten, bevor sie ihm persönlich begegnen würde, holte die Wirklichkeit sie ein, und Verlegenheit und Nervosität traten an die Stelle ihrer Vorfreude. Sie waren Fremde! Sie wusste nicht einmal, wie er aussah, obwohl sie ihn mehrere Male um eine Fotografie gebeten hatte. Sie selbst hingegen hatte ihm eine Fotografie von sich geschickt, und er hatte zurückgeschrieben, sie sei hübsch, aber das mochte nichts als Höflichkeit gewesen sein. Und was, wenn er am Kai gar nicht auf sie wartete, wie er es versprochen hatte?
Dominica las ihre Gedanken. »Es wird alles gut gehen, mia cara. Glaub mir, in dem Moment, in dem er dein Gesicht sieht, so bellissima, wird er meinen, schon die Weihnachtsglocken läuten zu hören.« Insgeheim betete sie, dass Rosa dasselbe mit ihm erleben würde, denn das war keinesfalls selbstverständlich.
»Was ist, wenn er mir nicht gefällt?«, gab Rosa zurück und gestattete sich damit zum ersten Mal, diese Möglichkeit auch nur in Betracht zu ziehen. »Was, wenn er hervorstehende Zähne hat oder stinkt wie ein toter Fisch und seine Ohren abstehen? Ich weiß, dass das vielleicht oberflächlich klingt, aber ich möchte schließlich auch eine Familie gründen …«
Dominica brach in Gelächter aus, und Rosa starrte sie schockiert an. »Tut mir leid, cara, ich hatte nur plötzlich ein Bild vor Augen.«
»Genauso ging es mir auch, und jetzt habe ich auf einmal schreckliche Angst.«
»Ich bin sicher, er sieht gut aus«, beharrte Dominica so überzeugend, wie sie konnte. »Und du warst die ganze Reise über guter Dinge, woher also kommen diese plötzlichen Zweifel?«
»Ich weiß es nicht. Aber jetzt werde ich gleich tatsächlich vor ihm stehen, jetzt wird das alles Wirklichkeit, und das macht mir Angst.«
Voller Mitgefühl drückte Dominica ihr die Hand.
»Versteh mich nicht falsch. Ich erwarte keinen Mann, der aussieht wie ein Filmstar. Er muss nicht einmal sonderlich attraktiv sein, ich will nur nicht, dass ich jedes Mal, wenn ich ihn ansehe, in Tränen ausbreche«, sagte Rosa. Vermutlich war es besser, nicht so hohe Erwartungen zu haben.
Dominica gelang es nur mit Mühe, ein erneutes Lachen zu unterdrücken.
Rosa blickte an sich hinunter. »Ich wollte bei meiner Ankunft einen guten Eindruck machen, aber sieh dir nur dieses Kleid an! Ich habe es so oft gewaschen, dass der Blauton nicht mehr hübsch ist, und der Stoff ist so dünn, dass er geradezu durchsichtig wirkt.«
Da es in den überfüllten Quartieren an Bord so wenig Platz gab, hatten die Passagieren lediglich ein paar Kleidungsstücke aus ihren Koffern im Gepäckraum des Schiffes entnehmen dürfen und fortan mit dem, was sie ausgesucht hatten, zurechtkommen müssen.
»Du könntest einen alten Jutesack tragen und würdest immer noch bellissima aussehen, bella.« Sanft hob Dominica mit dem Finger Rosas Kinn. »So oder so, lass uns diesen Augenblick genießen«, fügte sie betont fröhlich hinzu. »Die Reise war von Zeit zu Zeit doch recht beschwerlich. Aber wir haben es geschafft, nicht wahr?«
»Das allein ist schon ein Wunder.« Rosa dachte an die raue See und die Momente, die sie, in ihrer Kabine dicht aneinandergedrängt, durchlebt hatten, voller Furcht, ihrem nassen Grab entgegenzutreiben, während die gebirgshohen Wellen das Schiff herumschleuderten wie ein Gebilde aus Papier. Im Indischen Ozean waren sie in grauenhafte Stürme geraten, bei denen Menschen verletzt worden und umgekommen waren. Auch zwei Kinder befanden sich unter den Toten, und sogar ein Mitglied der Mannschaft war in einer dunklen, stürmischen Nacht über Bord gespült worden, ohne die geringste Hoffnung auf Rettung.
»Das stimmt, cara«, stimmte Dominica ihr zu. Sie beide hatten viele Male daran gezweifelt, dass sie Australien überhaupt je zu sehen bekommen würden. »Aber jetzt sind wir hier. Überlebende, die kurz davor sind, ein neues Land zu betreten.«
Der Hafen von Darwin bestand aus einem zerklüfteten Becken mit drei Hauptarmen, der Kai sah von der Reling des einfahrenden Schiffes wie das Bein eines Hundes aus. Um den starken Gezeitenschwankungen zu trotzen, die hier ganze acht Meter umfassten, war er auf hohe Holzpfähle gebaut. Damit erschien er ein wenig merkwürdig, aber er war gewiss nicht das Einzige, was den Neuankömmlingen zunächst seltsam vorkommen würde.
»Ich kann immer noch nicht glauben, dass wir wirklich hier sind.« Rosa konnte nicht fassen, dass der Moment, über den sie so oft nachgedacht hatte, tatsächlich gekommen war.
»Ich kann es kaum erwarten, die verschiedenen tropischen Früchte zu probieren und in frisches Gemüse zu beißen«, bekundete Dominica sehnsüchtig.
»Ja, die Speisefolge an Bord war mit der Zeit ein wenig eintönig.« Rosa dachte an die beständige Darreichung von Getreideflocken und Räucherfisch. »Vor allem, als die Rationen knapp wurden. Umso mehr freue ich mich darauf, auf der Farm ein paar Lieblingsgerichte meiner Familie zuzubereiten. Ossobucco zum Beispiel. Natürlich erst, wenn Lugh und ich verheiratet sind.« Sie lächelte verlegen. Es fühlte sich seltsam an, an sich selbst als verheiratete Frau zu denken, als Gemahlin eines Fremden. Gleichzeitig war der Gedanke aber auch aufregend.
Dominica lächelte, dann wandte sie ihren Blick auf das Ufer vor ihnen, das rasch näher kam. »Ich hatte ein paar höhere Gebäude erwartet. Aber die Männer von der Mannschaft haben erzählt, dass man in Darwin noch mit dem Wiederaufbau der Stadt beschäftigt ist, nachdem die Japaner sie vor vier Jahren bombardiert haben. Im Moment sieht es so aus, als würden sich die Häuser und Geschäfte regelrecht in die üppige Vegetation hineinducken.«
Die Crew hatte den Passagieren berichtet, in Darwin gebe es eine gute Auswahl an Lokalen, darunter auch das Victoria Hotel, das dem Kai am nächsten lag. Domenica hatte sogar den Eindruck gewonnen, die Männer verbrachten ihre gesamte Freizeit an Land dort. Gerade in diesem Moment schritt einer von ihnen vorbei. »Mr Agostini«, hielt Dominica ihn zurück, »was für Pflanzen sind das dort entlang der Küste?«
»Mangroven,« antwortete er und blieb bei den beiden Frauen stehen.
»Das sieht alles so üppig und tropisch aus«, sagte Dominica begeistert.
Matteo Agostino schnaubte. »Mangrovenwälder bieten den perfekten Nährboden für Mossies.«
»Mossies? Sie meinen doch nicht etwa … Moskitos?«
»Doch, genau die meine ich. Hat Ihnen noch niemand von denen erzählt? Die Moskitos sind hier so groß wie Vögel.«
»Das kann ich gar nicht glauben!« Dominica runzelte die Stirn und senkte den Blick auf ihre nackten Arme.
»Das sollten Sie aber. Und bedecken Sie sich«, beharrte Matteo. »In der Morgendämmerung ist es am schlimmsten. Zu dieser Tageszeit greifen sie erbarmungslos an.«
»Ich freue mich schon darauf, im Meer zu schwimmen, nachdem ich nun mehr als einen Monat darauf verbracht habe«, rief ihnen ein halbwüchsiger Junge zu, der an der Reeling stand.
»Davon muss ich dir dringend abraten«, erwiderte Matteo Agostino streng.
»Warum denn? Ist die Strömung hier etwa zu stark? Ich bin ein guter Schwimmer.«
»Sie ist sehr stark, und die Gezeiten kommen schnell, aber das sind nicht die einzigen Gefahren. Vor den Krokodilen und den Haien musst du dich in Acht nehmen, ganz zu schweigen von den Würfelquallen.«
»Quallen? Die sind doch wohl harmlos.« Der Junge klang enttäuscht.
»Würfelquallen sind tödlich. Zwischen November und April ist die schlimmste Zeit, da schwimmen sie im seichten Wasser und in der Tiefe.«
»Wie kann denn eine Qualle tödlich sein?«, fragte Dominica.
»Der Stich der Würfelqualle ist der giftigste der Welt. Und sie sind so gut wie durchsichtig, sodass sie im Wasser schwer auszumachen sind. Oben im Norden des Territory, am Top End, und im Norden von Queensland sterben jedes Jahr bis zu zwanzig Menschen daran.«
»Zwanzig! Und ich hatte mich darauf gefreut, im Meer zu planschen«, murmelte Dominica. »Aber ich denke, das lasse ich dann lieber bleiben. Krokodile gibt es im Meer doch aber bestimmt nicht«, wandte sie ein. Vermutlich wollte Mister Agostino ihnen nur einen Schrecken einjagen. »Das habe ich jedenfalls noch nie gehört.«
»Krokodile bekommt man im Meer sogar häufiger zu Gesicht.
Die Tiere haben auch schon Menschen und Hunde an den Stränden angegriffen. Ein großes Salzwasser-Krokodil kann fünfzehn Fuß lang werden, und denken Sie bloß nicht, es könnte sich nicht schnell bewegen, denn das kann es sehr wohl. Krokodile können einen Büffel töten und verschlingen, sie würden also auch jede von Ihnen im Handumdrehen in eine appetitliche Mahlzeit verwandeln.«
Jemand rief nach Mister Agostino, und so ließ er die Gruppe mit offenen Mündern zurück.
»Ich glaube ihm kein Wort«, verkündete Dominica. »Er macht sich vermutlich einen Spaß mit uns als Einwanderinnen.«
»Und wenn es doch stimmt, was er sagt?«, entgegnete Rosa.
»Niemand hat bei unserem Antrag auf Einwanderung irgendwelche gefährlichen, menschenfressenden Kreaturen in Australien erwähnt«, beharrte Dominica. »Warum wohl? Weil dann niemand herkommen würde?«
»Vielleicht übertreiben die Männer von der Crew einfach, um uns Angst einzujagen«, schlug Rosa vor.
»Ich denke, genau das ist der Fall«, antwortete Dominica.
»Ich gehe lieber kein Risiko ein«, bekundete der Junge. »Ich bin nicht so weit gereist, um mich dann von Haien, Krokodilen oder stechenden Quallen töten zu lassen. Ich hoffe, in Darwin gibt es ein Schwimmbad.« Er ging das Deck hinunter, auf der Suche nach seiner Familie, der er nun eine haarsträubende Geschichte erzählen konnte.
Während das Schiff sich dem Kai näherte, ließ Rosa ihren Blick über die Menschenansammlung schweifen, auf der Suche nach ihrem Verlobten. Er hatte gesagt, er würde zur Erkennung einen Hut mit einem gelben Band tragen, aber als das Schiff endlich längs des Kais anlegte, konnte sie niemanden mit einem solchen Hut ausmachen. Sogleich überkamen sie erneut Zweifel. Was sollte sie tun, wenn er nicht hier war? Sie hatte kaum Geld und wusste auch keinen Ort, an den sie gehen könnte.
Schon bald war sie von Passagieren umringt, die darauf brannten, das Land zu betreten, das ihr neues Zuhause werden sollte. Viele hatten nach der langen Reise gemischte Gefühle, aber alle konnten es kaum erwarten, wieder festen Boden unter den Füßen zu spüren.
Die Mannschaft vertäute das Schiff, und die Gangway wurde heruntergelassen.
Rosa wandte sich ihrer Freundin zu. Sie hatte diesen Moment des Abschieds gefürchtet. »Ich werde dich vermissen, Dominica«, sagte sie und kämpfte gegen die Tränen an.
Auch Dominica hatte Angst vor dem Abschied gehabt und wurde nun von Gefühlen überwältigt. »Ich werde dich auch vermissen, mia cara.« Sie umarmte Rosa fest. »Vergiss nicht: Wenn du mich brauchst, such nach mir. Ich weiß nicht, wo genau der Gemüsehandel meiner Schwester ist, aber es sollte nicht allzu schwer sein, ihn zu finden, wenn du herumfragst. Versprichst du es mir?« Rosa nickte. »Ich hoffe, all deine Träume gehen in Erfüllung, mia cara, und ich bete, dass dein Lugh genau so ist, wie du es dir immer gewünscht hast.«
»Das tue ich auch«, flüsterte Rosa.
In diesem Moment wurde Dominicas Aufmerksamkeit abgelenkt von jemandem, der ihren Namen rief und ihr vom Kai aufgeregt zuwinkte. Sie bemerkte ihre Schwester Sofia, die sie seit Jahren nicht mehr gesehen hatte. Dominica winkte zurück, überwältigt und aufgeregt von diesem so besonderen Moment. Sie drehte sich nach Rosa um, küsste sie auf die Wange und umarmte sie noch einmal. »Viel Glück, bella.«
»Dir auch. Und jetzt geh«, forderte Rosa sie auf und schluckte schwer. Sie sah zu, wie Dominica über das Deck und die Gangway hinunterging, das Ufer betrat und ihrer Schwester in einer überschwänglichen Begrüßung in die Arme fiel.
Rosa verharrte auf der Stelle und trocknete ihren Tränen, während die Passagiere an Land strömten. Auf dem Kai mussten sie warten, bis die Männer der Mannschaft schließlich begannen, die Koffer aus dem Gepäckraum des Schiffes zu entladen. Dominicas Koffer war einer der ersten, die zum Vorschein kamen. Der Mann ihrer Schwester nahm ihn und lud ihn auf einen Karren. Dann machten die drei sich auf den Weg den Kai hinunter, wobei sich Dominica bei ihrer Schwester einhakte.
Erst als die letzten Passagiere die Gangway betraten, setzte auch Rosa sich auf wackligen Beinen in Bewegung. Sie ließ ihren Blick über die Gesichter der Menschen gleiten, die auf dem Kai versammelt standen, und ihr sank das Herz, als sie auch jetzt nirgendwo einen gutaussehenden jungen Mann entdeckte, der eifrig nach ihr Ausschau hielt.
Die Menge zerstreute sich rasch, sobald die Leute in dem Stapel aus Gepäckstücken, der sich auf dem Kai gebildet hatte, ihr Hab und Gut entdeckt hatten. Auch Rosa konnte ihren Koffer schließlich ausmachen.
»Sind Sie vielleicht Miss Vienetta?«, fragte eine männliche Stimme.
Zutiefst erleichtert drehte Rosa sich um, in der Hoffnung, beim Anblick ihres zukünftigen Ehemanns sofort eine Verbindung zu ihm zu spüren. Stattdessen fand sie sich einem Mann im Alter ihres Vaters gegenüber, der gut und gerne sechs Zoll kleiner war als sie. Ihr Lächeln verschwand im Handumdrehen. »Ja …«, sagte sie vorsichtig. Sie musterte seinen Aufzug und bemerkte als Erstes, dass seine Stiefel staubig waren und Essensflecken auf seinem Hemd prangten. Seine Hosen wurden durch einen Strick zusammengehalten. Erst dann fiel ihr auf, dass er einen verbeulten Hut in den Händen hielt, den zu ihrem Entsetzen ein verstaubtes gelbes Band zierte.
»Hallo«, grüßte er mit einem nervösen Lächeln, das unregelmäßige Zähne entblößte. Zudem war er nicht sonderlich gut rasiert. »Es ist schön, Sie endlich kennenzulernen.« Er musterte sie mit offensichtlichem Wohlgefallen, dann aber stieß er hervor: »Sehr robust sind Sie nicht gerade, oder?«
»Wie bitte?« Rosa war fassungslos.
»Ich hatte erwartet, dass Sie etwas besser für die Arbeit auf einer Farm geeignet sein würden«, erklärte er. »Aber keine Sorge, wir werden Sie schon ordentlich mästen.« Er setzte an, Rosa auf die Wange zu küssen, und sie trat eilig einen Schritt zurück. Im ersten Augenblick hatte sie gedacht, Lugh Varden hätte vielleicht einen seiner Farmarbeiter geschickt, um sie abzuholen, aber so viel würde sich ein Arbeiter sicher nicht herausnehmen. Als Nächstes kam ihr in den Sinn, dass dieser Mann möglicherweise ihr künftiger Schwiegervater war.
Sie blickte über seine Schulter hinweg. »Konnte Lugh heute nicht kommen?«, fragte sie.
»Ich bin doch Lugh«, erwiderte er mit gerunzelter Stirn, dann wies er auf den rasch schrumpfenden Stapel von Gepäckstücken. »Welcher von diesen ist denn Ihrer?«.
Rosa erstarrte. Wie konnte dieser ältliche Mann denn ihr dreißigjähriger Verlobter sein? Hier lag doch ganz sicher irgendein Missverständnis vor. »Sind Sie Lugh Senior?«, fragte sie mit wild klopfendem Herzen. Es war die einzige plausible Erklärung.
»Lugh Senior? Wenn Sie damit meinen Vater meinen, der ist vor zehn Jahren in Italien gestorben«, antwortete er sichtlich verwirrt.
»Oh!« Rosa wurde mit einem Mal schwindlig. Sie musste den Blick abwenden, weil sie fürchtete, ihr Gesichtsausdruck könnte ihre wahren Gefühle verraten. Immerhin gelang es ihr, auf ihren Koffer zu weisen.
Der Kai glich einem wimmelnden Ameisenhaufen, nachdem noch ein weiteres Schiff neben der SS Misr angelegt hatte.Ein kleiner Zug transportierte Waren von und zu den Schiffen, die Passagiere schwatzten aufgeregt auf ihrem Weg entlang des Hafens zur darübergelegenen Stadt, zugleich wurden Waren auf die Schiffe getragen, Säcke mit Mehl und Zucker, Kisten mit frischem Obst und Gemüse. Der Lärm traf geradezu ohrenbetäubend auf Rosas zutiefst erschütterten Verstand. Das alles ergab keinen Sinn. Sie beobachtete, wie Lugh Varden ihren Koffer auf einen Karren hievte und sie mit einer Geste aufforderte, ihm zu folgen, und erschauderte. Das Bild, das sie im Geist von dem Mann hatte, mit dem sie im vergangenen Jahr Briefe gewechselt hatte, kam dem Mann, den sie vor sich sah, nicht einmal nahe. Sie würde nicht mit ihm gehen. Sie konnte nicht!
Rosa setzte an, Lugh Varden mitzuteilen, dass sie nicht seine Frau werden konnte, nachdem er ein falsches Bild von sich gezeichnet hatte, als plötzlich laute, zornige Stimmen ihre Aufmerksamkeit erregten. Auf dem Kai war ein Streit zwischen einigen wahrlich kräftigen Männern ausgebrochen, Raufbolden, die gerade das zweite Schiff beluden. Aus dem Streit wurde in Windeseile eine Schlägerei. Das Geräusch dreschender Fäuste widerte Rosa an, die Rohheit der Sprache ließ sie erröten. Frauen und Kinder schrien, und die Menge der Passagiere zerstreute sich in höchster Eile, während die bulligen Kerle ihr Bestes taten, einander umzubringen.
»Kommen Sie, schnell«, forderte Lugh Varden Rosa auf und nahm sie beim Arm. Ihr blieb keine Wahl, er zog sie praktisch an den kämpfenden Männern vorbei. Mehrere Constables in Uniform kamen ihnen im Laufschritt entgegengeeilt und bliesen lautstark in ihre Trillerpfeifen. Die Szenerie war ein einziges Chaos und ganz und gar nicht das Willkommen, das Rosa sich erhofft hatte.
Der Weg den Kai hinunter verschwamm vor ihren Augen. An dessen Ende zerrte Lugh Varden den Karren in Richtung eines verbeulten Wagens, der zwischen anderen geparkt stand. Es war kaum möglich, die vielen rostigen Stellen von dem rostfarbenen Staub darauf zu unterscheiden. Ehe sie ihre Einwände vorbringen konnte, hatte er ihren Koffer schon auf die offene Ladefläche geworfen, die äußerst schmutzig war, und die Beifahrertür geöffnet, die kreischend protestierte.
Angewidert blickte Rosa in das Innere des Fahrzeugs. Die Sitze waren verdreckt und abgewetzt, der Boden war mit Abfällen übersät. Die alte Klapperkiste selbst wirkte alles andere als fahrtüchtig.
»Na los, hinein mit Ihnen«, forderte Lugh sie mit einer Spur von Ungeduld auf. »Wir haben noch einen langen Weg vor uns.«
Rosa bekam es mit der Angst zu tun. »Ich möchte gern ins Victoria Hotel gehen – auf einen Drink, den ich dringend nötig habe. Ein Matrose auf dem Schiff hat erzählt, das Lokal sei sehr beliebt.« Es würde Mut brauchen, um mit Lugh Varden offen über ihre Zukunft zu reden.
»Beliebt ist es bei den Hafenarbeitern«, gab Lugh zurück, »und wie die sind, haben Sie ja gerade gesehen. Außerdem wird es in zwei Stunden dunkel, also machen wir uns besser sofort auf den Weg Richtung Süden.«
Rosa fühlte sich auf einen Schlag wie ausgelaugt und ihrer Widerstandskraft beraubt. Und so stieg sie in Lugh Vardens Wagen. All ihre Erwartungen waren zerstoben. Monatelang hatte sie sich diesen Augenblick ausgemalt, hatte sich vorgestellt, wie sie ihrer Zukunft aufgeregt entgegenblicken würde. Stattdessen hatte sie jetzt das Gefühl, förmlich in Enttäuschung zu ertrinken.
Schweigend fuhren sie los. Rosa blickte starr geradeaus, und auch Lugh sprach kein Wort und sah konzentriert auf die Straße vor ihm. Die Stille breitete sich unbehaglich zwischen ihnen aus. während sie die Stadt Darwin hinter sich ließen.
»Wie war denn die Reise, Miss Vienetta?«, fragte Lugh schließlich nach ein paar weiteren Meilen. Rosa hatte mit den Tränen gekämpft und war letztendlich froh gewesen, dass er nicht mit ihr gesprochen hatte.
Rosa wagte es, ihm ihren Blick zuzuwenden, und ihr Herz zog sich zusammen. Vom Alter her hätte er gut und gerne ihr Vater sein können. »Wie lange wird die Fahrt bis zur Farm dauern?«, entgegnete statt einer Antwort.
»Neun Stunden«, informierte er sie gut gelaunt, womöglich gefiel es ihm, dass sie offenbar darauf brannte, ihr gemeinsames Leben zu beginnen.
»Neun Stunden! Dann wird es ja Mitternacht sein, ehe wir ankommen!«
»So ist es«, erwiderte Lugh. »Es sind über dreihundert Meilen. Ich bin heute früh im Morgengrauen zu Hause aufgebrochen.«
Rosa war entsetzt. »Können wir denn unterwegs irgendwo anhalten?«
»Wozu denn?«
»Um auszuruhen und um etwas zu essen und zu trinken.« Alles war ihr recht, um das Unvermeidliche aufzuschieben und einen Weg zu finden, ihrem Schicksal zu entfliehen. Ihre Gedanken rasten, fieberhaft überlegte sie, wie sie von dort zurück nach Darwin gelangen und was sie dort ohne Geld anfangen konnte.
»Da wären nur die Orte Katharine und Mataranka, aber bis wir dort ankommen, hat sicher alles geschlossen. Also fahren wir am besten durch bis zur Farm.«
Rosa fühlte Panik in sich aufsteigen. »Wer wohnt denn noch dort?« Diese Frage hatte sie nie gestellt, denn sie war nicht davon ausgegangen, auf der Farm untergebracht zu werden, ehe sie nicht verheiratet waren.
»Nur ich. Aber einer meiner Neffen kommt rüber und hilft, wenn ich ihn brauche, meist ein paar Tage in der Woche.«
Rosa war entsetzt. Das konnte doch nicht sein Ernst sein! »Sie erwarten doch wohl nicht, dass ich dort bei Ihnen übernachte? Das werde ich auf keinen Fall«, erklärte sie entschieden.
Lugh schien von dieser Erklärung überrascht. »Warum denn nicht?«
»Weil … weil es sich nicht gehört.«
»Sich nicht gehört? Aber wer würde denn davon wissen?«
»Ich würde es wissen«, antwortete Rosa. »Ich sollte besser in einem Hotel wohnen. Bis auf Weiteres.« Sie brachte es nicht über sich, die Worte ›bis wir verheiratet sind‹ auszusprechen.
»Ich kann es mir nicht leisten, Sie in einem Hotel unterzubringen. Sofern Sie also nicht selbst das Geld dafür haben, ist die Farm Ihre einzige Wahl.« Damit war die Sache für ihn erledigt.
Rosa hatte nicht für möglich gehalten, noch tiefer enttäuscht werden zu können, aber genau das war der Fall. Ein paar Minuten lang blickte sie schweigend aus dem Fenster. »Sie haben behauptet, Ihre Farm floriert«, sagte sie schließlich und wandte sich ihm wieder zu. Dabei bemerkte sie den Höcker mitten auf seiner langen Nase.
»Habe ich das?« Er klang überrascht.
»Ja, das haben Sie. Sie haben auch behauptet, Sie wären dreißig Jahre alt, und ich möchte nicht unhöflich sein, aber dieses Alter haben Sie lange hinter sich.«
»Ich … ich kann mich nicht erinnern, gesagt zu haben, ich wäre dreißig«, sagte Lugh langsam.
»Aber ich erinnere mich«, erwiderte Rosa zornig.
Lugh zuckte mit den Schultern. »Welche Bedeutung hat schon das Alter?«
»Ich bin zwanzig Jahre alt. Jung genug, um Ihre Tochter sein zu können. Ich habe Ihnen mein Alter verraten und Ihnen eine Photographie von mir geschickt, auf der Sie auch erkennen konnten, dass ich in diesem Alter bin. Sie hingegen haben mir keine Photographie von sich geschickt, und jetzt weiß ich auch warum. Weil ich dann gewusst hätte, dass Sie in Bezug auf Ihr Alter gelogen haben. Und in Bezug auf Ihre Verhältnisse.« Rosa schluckte schwer, um die Tränen zurückzuhalten. »Wenn Sie mir die Wahrheit gesagt hätten, hätten wir beide gewusst, woran wir sind. Nun bin ich um die halbe Welt gereist zu einem Mann, der mich nicht einmal für eine kurze Zeit in einem Hotel unterbringen kann.«
»Das Leben auf einer Farm hat Höhen und Tiefen«, verteidigte sich Lugh. »Wir hatten gute Zeiten, und wir hatten schlechte Zeiten. Im Moment ist die Situation schwierig, weil es seit vielen Wochen nicht geregnet hat. Deshalb gibt es für das Vieh nicht viel Futter. Vor einer Weile habe ich den größten Teil meiner Herde verkauft, bevor sie mir vor Hunger krepiert wäre. Das Leben als Farmer kann ein harter Kampf sein, aber ich liebe mein Land und tue mein Bestes. Und Sie werden auch lernen, es zu lieben.«
Wider Willen empfand Rosa mit einem Mal Mitgefühl mit ihm in der Situation, in der er sich befand. Und offenbar hatte er den Gedanken, sie zu heiraten, trotz ihrer Einwände wegen des Altersunterschiedes keineswegs aufgegeben.
»Die Rinder sterben zu sehen ist unerträglich«, fügte er hinzu.
»Das glaube ich Ihnen gern«, antwortete sie. »Aber in Ihren Briefen haben Sie nicht viel über diese harten Zeiten preisgegeben. Ich habe nur etwas über die rosigen Seiten des Lebens auf einer Farm zu lesen bekommen.« Es war dieses Leben, auf das sie sich gefreut hatte.
»Nichts ist immer nur rosig«, sagte Lugh, und Rosa fühlte sich mit einem Mal ziemlich einfältig.
Schweigen legte sich über die folgende Stunde, in der die Sonne zu sinken begann und der Zustand der Straße sich beständig verschlechterte, sofern das überhaupt möglich war. In deren Mitte prangten tiefe Schlaglöcher, und zu beiden Seiten wallte dicker roter Staub auf. Sie kamen nur langsam voran.
Lugh fuhr konzentriert, und Rosa dachte an die vergangenen Monate, in denen sie von einem völlig anderen Szenario geträumt hatte. Ihre Gedanken schweiften ab, während die Dunkelheit sich über das Land senkte.
Plötzlich gab es einen lauten Knall, und das Auto scherte zur Seite aus, bevor es mit einem Ruck zum Stehen kam. Lugh stieß einen derben Fluch aus.
»Was ist los?«, fragte Rosa. »Ist der Motor explodiert?«
»Wir haben eine Reifenpanne«, erwiderte Lugh gereizt. »Ich gebe Ihnen jetzt eine Taschenlampe, die müssen Sie halten, während ich den Reifen wechsle.« Er stieg aus.
»Sieht nicht so aus, als hätte ich eine Wahl«, murmelte Rosa und trat zu ihm an den Straßenrand.
Sie hielt die Taschenlampe und blickte sich um, konnte in der Finsternis jedoch nichts erkennen. »Ich müsste mal austreten. Gibt es hier in der Nähe irgendwo sanitäre Anlagen?«
Verständnislos starrte Lugh sie an. »Sanitäre Anlagen?«
»Ein Bad und … eine Toilette.«
»Solche Anlagen gibt es hier überall um uns herum. Wenn ich mit dem Reifen fertig bin, können Sie die Taschenlampe nehmen und sich einen Platz zum Pinkeln suchen.«
Rosa starrte ihn mit großen Augen an. »Das ist doch wohl hoffentlich nicht Ihr Ernst«, stieß sie ungläubig hervor. »Sie erwarten, dass ich … da rausgehe?« Die Frontscheinwerfer beleuchteten die Straße lediglich ein paar Meter. Zu allen Seiten war die Umgebung pechschwarz.
»Die Aboriginal People gehen da raus.«
»Ich bin aber doch keine Aboriginal, oder?«, gab Rosa empört zurück.
»Es wird noch anderthalb Stunden dauern, bis wir in Katharine ankommen, und wahrscheinlich hat dann bereits alles geschlossen. Wenn Sie sich also nicht hier draußen einen Platz suchen wollen, werden Sie bis zur Farm durchhalten müssen.«
Rosa beschloss durchzuhalten, aber nach mehreren Meilen wurde das allzu schwierig, also bat sie Lugh widerstrebend anzuhalten. Er lenkte den Wagen an den Straßenrand und reichte ihr die Taschenlampe.
»Da draußen ist doch nichts, was mich fressen könnte, oder?«, fragte sie, während sie die Autotür öffnete.
»Nein. Sie schrecken möglicherweise die wild lebenden Tiere auf, aber fressen werden die Sie nicht.«
»Was für wild lebende Tiere denn?«, fragte sie beunruhigt.
»Kängurus, Emus, Wombats … sie fressen nur, was hier draußen wächst, und ohne Regen ist das nicht viel.«
Rosa war keineswegs beruhigt. »Und was ist mit Schlangen? Ich habe gehört, in Australien gibt es Schlangen.«
»Hier gibt es jede Menge Schlangen, aber die kommen nachts nicht raus.«
Rosa stieg aus dem Auto, schloss die Tür und blickte angsterfüllt in die Finsternis.
»Normalerweise«, murmelte Lugh.
»Entschuldigung, was haben Sie gesagt?«, fragte Rosa durch das offene Fenster.
»Ich habe nur gesagt: Achten Sie darauf, wo Sie hintreten, und entfernen Sie sich nicht zu weit«, murmelte Lugh kopfschüttelnd. Er hatte keine zweite Taschenlampe, für den Fall, dass er in der Dunkelheit nach ihr würde suchen müssen.
Rosa leuchtete mit der Lampe durch die Dunkelheit am Straßenrand. Dann setzte sie sich in Bewegung, mit vorsichtigen Schritten zwischen den Mulga-Büschen entlang. Sie musste nicht weit gehen, bis Lughs Auto außer Sichtweite war, also würde auch er sie nicht länger sehen können.
»Ich hätte nie gedacht, dass ich so etwas jemals tun würde«, murmelte sie. »Willkommen im Outback von Australien.«
Die Orte Mataranka und Katharine lagen in tiefer Dunkelheit, als sie hindurchfuhren, doch so oder so war man innerhalb eines Wimpernschlags daran vorbei. Das galt umso mehr für Rosa, der ohnehin die Augen zufielen vor Müdigkeit. Lugh hatte angehalten und aus einem der zahlreichen Kanister auf der Ladefläche seines Wagens Benzin in den Tank gefüllt, und Rosa hatte ihm erneut geholfen, indem sie die Taschenlampe hielt. Auf ihre Frage, warum er nicht an einer Tankstelle gehalten hatte, erklärte er ihr, die Tanksäulen wären über Nacht verschlossen.
Als sie schließlich weiterfuhren, fiel es Rosa zunehmend schwer, die Augen offenzuhalten. Sie war erschöpft, es war ein unendlich langer Tag gewesen. Mit einem Mal schwenkte das Fahrzeug scharf zur Seite, und sie schlug mit dem Kopf an den Fensterrahmen.
Gleich darauf fluchte Lugh leise. »Entschuldigung«, sagte er. »Ein Roo ist direkt vors Auto gesprungen, und ich musste ausweichen, um es nicht zu überfahren.«
»Ein Roo?« Mit einem Schlag war Rosa hellwach. »Meinen Sie … ein Känguru?«
»Ja, die dummen Viecher haben hier draußen allen Platz der Welt, müssen aber unbedingt in dem Augenblick, in dem ein Auto vorbeikommt, die Straße überqueren.«
»Ich wünschte, ich hätte es gesehen«, sagte Rosa. »Ich habe mich darauf gefreut, die Tiere der Wildnis zu beobachten.«
Lugh sah sie mit gerunzelter Stirn an. »Die Kängurus werden Sie im Nullkommanichts satthaben«, sagte er. »Sie fressen sämtliches Gemüse, das ich anbaue, und einer von den verfluchten Bastarden hat mir unten am Damm, als noch Wasser drin war, meinen besten Hütehund ersäuft.«
Rosa sog scharf die Luft ein.
»Ich sollte vor einer Dame nicht fluchen, aber Kängurus sind für uns Farmer eine Plage.«
Rosa starrte ihn überrascht an. Sie hatte Kängurus für kuschelige Geschöpfe gehalten, nicht für Hunde-Killer. »Ich wusste nicht, dass Kängurus gefährlich sein können«, murmelte sie.
»Das können sie durchaus sein, besonders die großen Männchen.«
»Und gibt es noch andere gefährliche Geschöpfe, über die ich Bescheid wissen sollte?«
Ungläubig sah Lugh sie an. »Das ist ein Scherz, oder?«, fragte er und begann schallend zu lachen.
Kapitel 2
Die Autotür schlug zu und schreckte Rosa auf, die eingeschlafen war. Im Licht der Scheinwerfer sah sie, wie Lugh ein großes Tor öffnete und dann zum Auto zurückkehrte.
»Oh, Sie sind wach«, sagte er und glitt auf den Sitz neben ihr. »Dann können Sie gleich das Tor schließen.« Er ließ den Motor an und fuhr den Weg entlang durch das Tor. Auf der anderen Seite bremste er und sah sie erwartungsvoll an.
Rosa starrte ihn ungläubig an. »Sie wollen, dass ich das Tor schließe?«
»Sie werden sich daran gewöhnen müssen, Tore zu öffnen und zu schließen«, gab er zurück. »Derjenige, der neben dem Fahrer sitzt, erledigt das, einschließlich Frauen und Kinder.«
Noch immer starrte Rosa ihn an. Machte er Witze?
»In Ordnung, ich mache es. Dieses eine Mal.« Lugh stieg wieder aus.
Als er zurückkam, stellte Rosa ihm die Frage, die sie beschäftigte. »Wenn Sie gar keine Rinder mehr haben, warum lassen Sie dann das Tor nicht offen?«
Lugh startete den Motor und fuhr eine lange Auffahrt hinauf. Sie war von Eukalyptusbäumen gesäumt, die im Mondlicht gespenstisch wirkten. »Die Tore zu schließen ist auf einer Farm durchaus sinnvoll. Und ich habe nicht gesagt, dass ich überhaupt keine Rinder mehr habe. Ich habe gesagt, dass ich den größten Teil meiner Herde verkauft habe, und damals hatte ich fünfhundert Stück. Außerdem habe ich noch Pferde, eine Milchkuh und ein paar Schafe, die um das Haus herum das Unkraut abfressen. Ich will nicht, dass sie auf die Straße hinauslaufen.«
»Oh. Ich verstehe«, gab Rosa müde zurück.
Auf ihrem Weg zum Haus hielt Rosa im Mondschein nach dem Gebäude Ausschau. Nach dem Zustand zu urteilen, in dem Lugh und sein Auto sich befanden, hegte sie keine großen Erwartungen, aber sie hoffte, es war wenigstens bewohnbar und behaglich. Auch wenn sie nicht sicher war, dass dieses Haus auf Dauer ihr Heim werden würde, jetzt, da ihre Zukunft auf einmal unsicher schien.
Endlich kamen mehrere Gebäude in Sicht. Stallungen und offene Schuppen, in denen vermutlich landwirtschaftliche Geräte aufbewahrt wurden. Sie bemerkte auch einige umzäunte Koppeln, die verlassen schienen, und mehrere kleinere Nebengebäude. Dann endlich war ein kleines Wohnhaus aus Holz zu sehen. Die Fassade war verwittert, und bedauerlicherweise war nicht einmal der wundervolle Schein des Mondes in der Lage, es ein wenig erfreulich wirken zu lassen. Als Lugh davor parkte, betrachtete Rosa es genauer.
»Wissen Sie nicht, wie man einen Pinsel benutzt, Mister Varden?«, brachte sie schließlich hervor.
Auf der kurzen Seite befand sich eine Veranda, die an einem Ende herabhing, und die Fenster wirkten verdreckt. »Wie es scheint, können Sie auch nicht mit einem Hammer umgehen.« Für gewöhnlich war sie nicht so unverblümt oder gar rüde, aber sie hatte es satt, ihre Worte sorgfältig zu wählen.
»Ich stehe im Morgengrauen auf, Miss Vienetta, und falle erschöpft ins Bett, wenn es dunkel ist. Wenn Sie das Haus also gern gestrichen hätten, werden Sie das selbst tun müssen, neben all Ihren anderen Aufgaben«, entgegnete Lugh ohne eine Entschuldigung.
Rosa musterte ihn und wusste nicht, was sie sagen sollte. Sie hatte noch nicht einmal einen Fuß in sein Haus gesetzt und wurde bereits als selbstverständlich betrachtet.
»Kommen Sie?«, fragte er brüsk, nachdem er den Wagen verlassen hatte.
Rosa beschlich das unangenehme Gefühl, dass das Äußere des Hauses ein deutliches Zeichen dafür war, in welchem Zustand sich das Innere befand, und somit hatte sie es ganz und gar nicht eilig, die Schwelle zu überschreiten. Sie wartete darauf, dass er ihr die Autotür aufhielt, doch er hievte ihren Koffer von der Ladefläche und schleppte ihn in Richtung der Veranda. Ihr blieb nur, ihm zu folgen. »Manieren hat er auch nicht«, murmelte sie, stieg aus dem Auto und knallte die Tür zu. »Kann das alles überhaupt noch schlimmer werden?«
Während Lugh die Haustür öffnete, betrat Rosa die linke Seite der Veranda. Unter ihr war ein lautes Knirschen zu hören, und Rosa erwartete schon fast, dass die Bretter unter ihren Füßen einbrechen würden, doch als sie den Blick zu Boden senkte, sah sie etwas vor sich entlanghuschen und hinter dem Rand der Veranda verschwinden. Es sah aus wie ein Nagetier, und vor denen hatte sie furchtbare Angst. In Panik schrie sie auf, gerade als Licht aus dem Inneren aus der geöffneten Tür strömte und einen Teil der Veranda erhellte.
Lughs Kopf erschien in der Öffnung. »Was ist los?«
»Eine große Maus oder eine Ratte … Ich bin nicht sicher, was es war … Es ist hier entlanggerannt.« Sie schüttelte sich vor Ekel.
»An die werden Sie sich schon gewöhnen«, erwiderte Lugh schlicht und verschwand.
Rosa blieb der Mund offenstehen. »Nein. Das werde ich nicht. Niemals!«, murmelte sie. Sie atmete tief durch, dann trat sie auf die Tür zu und setzte ängstlich einen Schritt ins Innere. Einen Moment lang stand sie reglos da, überwältigt von dem, was sie vor sich sah.
»Machen Sie es sich bequem, während ich die Hunde füttere«, schlug Lugh vor und strebte auf die Hintertür zu, und Rosa kam in den Sinn, dass sie in einiger Entfernung Gebell gehört hatte, auch wenn er nicht erwähnt hatte, dass er Hunde besaß. Sie hatte ebenfalls großen Hunger, ihre letzte Mahlzeit war lange her, doch offensichtlich kam sie für ihn nicht an erster Stelle.
Rosa sank das Herz, als sie sich umsah. Der winzige Raum war nicht nur trostlos, sondern zudem äußerst unordentlich, überall lagen Kleidungsstücke und Arbeitsstiefel verstreut, dazwischen dreckiges Geschirr. Augenscheinlich bestand das Cottage lediglich aus zwei Zimmern. Der Hauptraum war in eine Küche und einen Wohnbereich unterteilt. Im Wohnbereich standen zwei hölzerne Stühle vor einem offenen Kamin, und in der Küche fand sich ein winziger Tisch mit zwei Stühlen. Der Tisch war übersät mit einem Sortiment von Gewürzen und Soßen, die in ein Regal gehörten, sogar eine offene Schale mit Zucker stand dort, über die Fliegen einfach herfallen konnten. Bei dem Anblick wurde Rosa übel. Im Spülbecken stand ein Eimer, aber es gab keine Hähne, offenbar musste das Wasser von draußen geholt werden. Im Raum befand sich ein Holzofen, auf dem ein einzelner Topf stand. Alles war vollkommen farblos, nirgendwo gab es ein heimeliges Detail.
Rosa dachte an das Zuhause, das sie zurückgelassen hatte. Ihre Eltern waren arm gewesen, aber ihre Mutter hatte ihr kleines Haus mit hübschen Vorhängen, Kissen und Tischtüchern, die sie selbst gefertigt hatte, einladend gestaltet, und es war immer sauber und ordentlich. Ihr Vater hatte weitere Schlafzimmer angebaut, als ihre Familie auf fünf Mitglieder anwuchs, und das Haus innen und außen gestrichen, sodass es hell und freundlich wirkte. Sie blickte zum Fenster über dem Spülbecken, wo sie dunkle Vorhänge entdeckte, die so trist wirkten wie der Rest des Hauses.
Plötzlich wurde Rosa von Heimweh überwältigt. Tränen raubten ihr die Sicht, und sie hörte nicht, wie Lugh zurückkam. »Ich will nach Hause«, sagte sie laut und bedeckte ihr Gesicht mit den Händen.
»Aber Sie sind doch gerade erst hier angekommen«, entgegnete Lugh.
Rosa schrak zusammen und schwang herum, verlegen darüber, dass er sie gehört hatte.
»Ich weiß, mein Haus macht nicht viel her, aber dafür braucht es nur die Hand einer Frau«, sagte er fröhlich. »Sie können die Möbel so arrangieren, wie es Ihnen gefällt. Sowas machen Frauen doch gern, oder?« Er stellte einen Kessel auf den Ofen und fachte die Holzscheite darunter an.
Rosa war fassungslos. Als ob ein neues Arrangement der wenigen Möbel hier einen Unterschied machen würden! »Wo soll ich heute Nacht schlafen, Mister Varden?«, fragte sie stattdessen,
»Sie können das Bett haben. Ich schlafe hier auf dem Boden.« Lugh ging zur Schlafzimmertür und stieß sie auf.
Rosa trat zu ihm und betrachtete das Bett. Die Laken und Decken lagen wild durcheinander in einem Haufen, was sie nicht überraschte, aber dennoch enttäuschte, und sogar aus der Entfernung konnte sie erkennen, dass nichts davon frisch wirkte.
In diesem Moment brach sich die Wut in ihr Bahn. »Ich werde hier nicht schlafen«, platzte es aus ihr hervor. »Ich kann nicht fassen, dass Sie, obwohl Sie wussten, dass ich heute herkomme, sich nicht das geringste bisschen Mühe gegeben haben, das Haus zu putzen oder das Bettzeug zu waschen und das Bett zu machen.« Sie hatte eine romantische Vorstellung von einem Blumenarrangement im Haus im Kopf gehabt und kam sich jetzt sehr naiv vor.
»Das ist Frauenarbeit«, verteidigte sich Lugh. »Davon abgesehen bin ich, wie ich bereits sagte, sehr früh hier aufgebrochen. Ich hatte also gar keine Zeit, das Bett zu machen.« Er verspürte einen winzigen Anflug von Schuld, weil er das Bett nie machte. Wozu das gut sein sollte, war ihm ohnehin ein Rätsel.
Und in diesem Moment verstand Rosa, warum er im Ausland nach einer Frau gesucht hatte. Sie war wütend auf sich selbst, weil sie so unbesonnen gewesen war, ihm zu antworten und jedes Wort zu glauben, das er ihr geschrieben hatte. Sie wandte sich abrupt ab und ging hinaus auf die Veranda, wo sie mehrmals tief durchatmete, um sich zu beruhigen.
Nach wenigen Minuten bemerkte sie, dass Lugh hinter ihr stand.
»Ist es zu viel verlangt, wenn ich frage, ob Sie irgendwo eine saubere Decke haben?«, brachte sie hervor.
Lugh verschwand für ein paar Augenblicke und kam mit einer zusammengefalteten Decke zurück.
Rosa riss sie ihm aus der Hand und ging in Richtung Auto davon.
»Sie werden doch wohl nicht im Wagen schlafen, oder?«, rief Lugh hinter ihr her.
»Nein, das werde ich nicht.« Rosa holte die Taschenlampe aus dem Wagen und machte sich damit auf den Weg zu den Stallungen.
»Da drin sind jede Menge Mäuse«, murmelte Lugh. Dann zuckte er mit den Schultern und ging ins Haus.
Im Stall fand Rosa zwei Boxen mit Pferden besetzt vor, die dritte war leer. Auf dem Boden lag Heu verstreut, doch sie bezweifelte, dass es sauber war. Vor den Boxen lagen kleinere Heuballen. Rosa arrangierte sie ein wenig, dann legte sie sich darauf nieder und schlug die Decke um sich. Und auf einen Schlag strömten all die Tränen, die sie seit ihrer Ankunft zurückgehalten hatte, aus ihren Augen, als wäre ein Damm gebrochen. Die beiden Pferde sahen sie verstört an, als sie laut aufschluchzte.
Nach ein paar Minuten riss sie sich zusammen. »Ihr findet mich bestimmt wunderlich«, murmelte sie in Richtung der Pferde und tupfte sich mit einem Taschentuch die Tränen ab. »Und vielleicht bin ich das wirklich. Ich habe eingewilligt, euren Halter zu heiraten, ohne ihm je begegnet zu sein oder auch nur ein Foto von ihm gesehen zu haben, und habe mich bei so gut wie allem belügen lassen. Wenn das nicht wunderlich ist, weiß ich auch nicht.«
Nie zuvor war Rosa derart von Selbstmitleid überwältigt gewesen. Ihre Eltern hatten sich nach Kräften bemüht, ihr die Idee auszureden, einen Mann in Australien zu heiraten, dem sie nie begegnet war. Sie hätten gerne gesehen, dass sie einen Nachbarsjungen aus ihrem Dorf heiratete. Giuseppe Fontano war ein netter Kerl, doch in Rosas Augen war er zu unreif – welch Ironie! Aber sein höchstes Ziel im Leben war es, in die Fußstapfen seines Vaters zu treten und in der Schlachterei zu arbeiten. Rosa hatte argumentiert, sie wolle einen reifen Mann heiraten, der eine klare Vorstellung hatte davon, was er vom Leben wollte. Sie hatte geglaubt, genau das in Lugh Varden gefunden zu haben. Als sie daran dachte, wie sehr sie ihre Eltern enttäuscht hatte, empfand sie geradezu körperlichen Schmerz und stöhnte auf. Sie würde für immer dankbar dafür sein, dass die beiden nicht sehen konnten, dass sie in ihrer ersten Nacht auf australischem Boden in einem Stall schlief.
»Sind Sie wach?« Lugh Varden rüttelte an Rosa.
Sie öffnete die Augen und blinzelte gegen das Morgenlicht. Im ersten Moment war sie verwirrt, dann kehrte mit einem Schlag die Erinnerung zurück. Sie hatte nicht einfach nur schlecht geträumt. Dies hier war ihr wirkliches Leben. »Ich bin es jetzt«, murmelte sie. Ihr ganzer Körper fühlte sich steif an.
»Sie liegen auf dem Pferdefutter«, klagte er.
»Oh«, entfuhr es ihr. Sie machte sich daran aufzustehen, schrie entsetzt auf, als eine pelzige Kreatur auf den Heuballen neben ihren Füßen sprang.
»War das … eine riesige Ratte?« Der Gedanke, neben dem Tier geschlafen zu haben, versetzte sie in Panik.
»Das war eine Katze«, sagte Lugh, während sie sich auf die Füße rappelte.
»Sie haben mir nicht erzählt, dass Sie eine Katze haben, Mister Varden«, beklagte sich Rosa verlegen.
»Er ist ein Streuner, ich hätte nicht gedacht, dass er hierbleibt. Ich füttere ihn nicht einmal. Er lebt von dem, was er in der Scheune und im Haus zu fassen bekommt.«
»Oh! Wollen Sie damit sagen, dass … dass es hier Mäuse gibt?« Ängstlich blickte sie sich um.
»Natürlich gibt es hier Mäuse.« Lugh klang ungeduldig. »Sie hätten ja nicht hier schlafen müssen«, blaffte er sie an und brach einen der Heuballen auf.
Rosa war überrascht von seiner Feindseligkeit. »Ich hatte ja wohl nicht gerade eine Wahl«, gab sie bissig zurück.
Lugh schnaubte und wandte sich wieder der Arbeit zu. Seine Miene ließ keine Zweifel daran, dass er sie für schwierig hielt.
»Ich hätte gern eine Tasse Tee. Sie haben doch Tee, oder nicht?«, fragte Rosa, schüttelte die Decke aus und faltete sie zusammen.
»Sicher habe ich Tee. Ich habe vor einer Weile eine Kanne aufgebrüht. Sie steht auf dem Ofen, sollte also noch heiß sein«, sagte er. »Ich komme dann gleich zum Frühstück rein.«
Rosa blinzelte. »Was gibt es zum Frühstück?« Sie hatte seit dem Lunch am Vortag nichts mehr gegessen und auch keine Tasse Tee getrunken und war entsprechend ausgehungert und ungeheuer durstig.
»Was immer Sie auf den Tisch bringen können«, antwortete er ungeduldig. »Ich habe vor zwei Tagen Fladenbrot gebacken, davon ist noch ein bisschen übrig. Im Hühnerhaus war ich noch nicht, das können Sie übernehmen. Ein paar Eier sollten Sie dort schon finden. Das Klosett befindet sich hinter dem Haus, und daneben gibt es ein Bad und ein Waschhaus.«
Rosa richtete sich auf und machte sich auf den Weg zum Haus, das im morgendlichen Sonnenlicht kein bisschen ansprechender wirkte. Wenn überhaupt, dann sah es noch trostloser aus. Drinnen flackerte das Feuer unter der Herdplatte, der Kessel, der darauf stand, war dampfend heiß. Teetassen konnte sie nirgends entdecken, aber sie fand einen Blechnapf und vergewisserte sich, dass er sauber war. Dann bemerkte sie einen Krug mit schäumender Milch, Lugh hatte also die Kuh gemolken. Die Teekanne stand am Rand des Ofens, sodass der Tee zwar heiß geblieben war, aber nicht weiter gezogen hatte. Sie goss etwas davon in den Napf und fügte Milch hinzu. Während sie ihren Tee trank, stellte sie fest, dass Lugh sein Bett nicht gemacht hatte, und erschauderte bei der Vorstellung, darin zu schlafen. Dann trat sie aus der Hintertür, um nach der Toilette und dem Ort, wo sie sich waschen konnte, zu suchen.
Die Toilette befand sich etwa vierzig Fuß vom Haus entfernt. Wie zu erwarten, war sie sehr einfach und benötigte eine gründliche Reinigung, aber Rosa musste dringend. Anschließend machte sie sich auf den Weg zum Bad. Wieder blieb sie vollkommen überrascht stehen. Das Bad besaß kein Dach, und im Inneren reihten ich entlang der Wände große Behälter mit Tomaten-, Paprika- und Bohnenpflanzen, deren Ranken mit Draht an den Wänden befestigt waren. Die Tür quietschte und passte nicht richtig in den Rahmen, mehrere Latten hingen lose herunter, ihr Waschvorgang würde also alles andere als privat vor sich gehen. Im Raum gab es ein Waschbecken, eine staubige Wanne und eine Art Dusche, die aus einem aufgehängten Eimer mit Löchern darin bestand. Rosa war angewidert und spürte erneut die Tränen aufsteigen, doch sie riss sich zusammen.
»Wie ich gestern Abend schon erwähnt habe, befinden wir uns gerade in einer Dürreperiode, Miss Vienetta«, hörte sie Lugh plötzlich hinter sich sagen und fuhr zusammen.
Sie wandte sich ihm zu. »Wollen Sie damit sagen, ich kann mich nicht waschen, Mister Varden?«
»Der Wasserstand in der Regentonne ist niedrig. Das bedeutet, dass Sie beim Waschen sparsam mit dem Wasser umgehen müssen. Benutzen Sie also nicht die Wanne und verwenden Sie das Wasser, mit dem Sie sich selbst waschen, auch für Ihre Kleider. Dann gießen Sie damit die Pflanzen. Der Eimer neben der Dusche ist zum Auffangen von Wasser, das ebenfalls auf die Pflanzen kommt.«
Rosa hätte ihre Verzweiflung am liebsten laut herausgeschrien, sie hatte sich sehr nach einem Bad gesehnt.
»Ich habe ein neues Stück Seife gekauft.« Lugh holte es aus einem Regal hinter dem Waschbecken hervor. »Ich wollte, dass Sie es vor mir benutzen«, erklärte er, als wäre das eine große Gefälligkeit.
»Ohne Wasser richtet Seife nicht viel aus«, sagte Rosa, der es zunehmend schwerfiel, ihre Gefühle zu beherrschen.
Lugh zuckte mit den Schultern. »Eines Tages wird es regnen«, sagte er. »Bis dahin müssen wir einfach sorgsam mit dem Wasser umgehen, das wir haben, denn wir müssen es mit den Tieren teilen.«
»Und warum züchten Sie die Pflanzen hier drinnen?«
»Hier sind sie vor den Tieren der Wildnis geschützt. Ein kleines Problem sind die Vögel, deshalb wird meine nächste Aufgabe sein, ein Drahtnetz als Dach aufzuziehen. Aber zumindest die Kängurus, Kaninchen und Schafe kommen nicht hier rein.« Damit ging er.
Ein paar Minuten lang dachte Rosa über ihre elende Lage nach. Weinen war keine Lösung, beschloss sie. Sie musste der Realität ins Auge sehen. Sie hatte keine Möglichkeit, nach Darwin zurückzukehren, und kein Geld für ihren Unterhalt. Und die Scham war zu groß, ihren Eltern ihre Lage in einem Brief zu schildern und sie um Hilfe zu bitten. Die beiden hatten ihr bereits alles Geld, das sie aufbringen konnten, für die Schiffspassage gegeben. Sie saß hier fest. Die einzige Möglichkeit, die sie hatte, war, das Beste aus der Situation zu machen, zumindest für den Moment, Wie aber sollte ihr das gelingen?
Nachdem sie sich so gut sie konnte gewaschen und dabei das Wasser aufgefangen hatte, machte sich Rosa auf die Suche nach dem Fladenbrot. Zu ihrer Überraschung schmeckte es gar nicht schlecht, auch wenn es nicht mehr ganz frisch war. Lugh war nirgends zu sehen, also nahm sie eine Schüssel und ging zum Hühnerhaus. Dabei kam sie an der Kuh vorbei, die zwischen widerstandsfähigem Unkraut nach etwas zu fressen stöberte, dann entdeckte sie die Schafe, die auf einer nahen Koppel das Gleiche taten. Nachdem sie bei den Hühnern sechs Eier aufgesammelt hatte, fiel ihr Blick auf die Hundezwinger. Sie waren leer, also waren die Hunde wohl bei Lugh, wo immer dieser sich auch aufhielt.
Wieder im Haus, briet Rosa zwei der Eier in einer Pfanne, die sie in einem Schrank fand. Lugh kam herein, aß und verschwand wieder. Rosa begann, aufzuräumen und zu putzen. Sie zog die Vorhänge ab, wünschte, sie hätte helleren Stoff, um neue zu nähen, und wusch sie in dem Wasser, das sie aufgefangen hatte. Dann hängte sie sie über das Geländer der Veranda, und innerhalb von Minuten waren sie getrocknet und konnten wieder aufgehängt werden. Überrascht stellte Rosa fest, dass sie nun, da sie sauber waren, ein helleres Blau aufwiesen und gleich ein wenig freundlicher wirkten. Zu Mittag buk sie Brot und briet Rührei mit Tomaten. Sie hörte die Hunde bellen, und kurz darauf tauchte Lugh auf. Er gab keinerlei Kommentar zu dem aufgeräumten Haus ab, was enttäuschend war, und steckte die Gabel gleich in sein Essen.
»Wie viele Hunde haben Sie?«, fragte Rosa, als sie sich an den Tisch setzte. Immerhin hatte er mit dem Essen gewartet, bis sie auf ihrem Platz saß.
»Zwei. Rex und Bobby«, sagte er mit vollem Mund. »Wir haben draußen an der Straße ein totes Känguru gefunden«, fügte er hinzu und schaufelte sich noch mehr Nahrung in seinen ohnehin schon vollgestopften Mund. »Die Krähen hatten schon einen Teil gefressen, aber ich habe etwas davon für die Hunde gerettet.«
Rosa starrte ihn an. Sie hatte vorgehabt, ihn zu fragen, ob er Fleisch für einen Schmortopf im Haus hatte, ließ die Idee aber in Windeseile fallen.
»Kängurufleisch kann man gut essen«, erklärte Lugh, als hätte er ihre Gedanken gelesen.
Sie fragte sich, ob er wohl auf der Straße verunglückte Tiere aß, verdrängte den Gedanken aber, weil sie fürchtete, ihr würde übel werden. »Ich bin sicher, das stimmt, aber ich werde es nicht essen«, antwortete sie. »Bauen Sie im Garten irgendwelches Gemüse an?«
»Ein bisschen was könnte dort gewachsen sein, ja. Vielleicht ein paar Kartoffeln, Karotten und Zwiebeln. Ich habe Ihnen doch schon erklärt, dass die Kängurus alles fressen, was oberhalb der Erde wächst, deshalb ziehe ich so viel wie möglich im Waschhaus. Aber die Kaninchen und Wombats buddeln auch im Garten.«
Er stand auf, ohne sich für seinen Lunch auch nur zu bedanken, und ging hinaus auf die Veranda. Sie folgte ihm, und augenblicklich begannen die beiden Hunde mit wedelnden Schwänzen, sie zu beschnüffeln. Rosa streichelte sie. »Ich möchte nicht, dass jemand weiß, dass ich hier bin, Mister Varden«, erklärte sie Lugh.
»Warum nicht?«
»Ich denke, dass versteht sich von selbst.« Sie wollte nicht gezwungen sein, die Worte auszusprechen, wollte sie nicht sagen, vor allem, da sie sich unmöglich vorstellen konnte, die Eheschließung wirklich zu vollziehen. Leider aber sah Lugh nicht aus, als würde er verstehen. »Ich muss an meinen Ruf denken«, erinnerte sie ihn. »Ich bin eine alleinstehende Frau, und Sie sind ein alleinstehender Mann, und wir leben zusammen.«
»Wir schlafen nicht unter einem Dach, also sollte Ihr Ruf nicht in Gefahr sein. Es sei denn, Sie haben vor, heute im Haus zu übernachten«, sagte er.
Rosa entging der Funke Hoffnung in seiner Stimme nicht. »Ich schlafe wieder im Stall«, beschied sie.
Lugh nickte und ging seines Weges.
Kapitel 3
Rosa war auf der Suche nach dem Gemüsebeet, als sie auf einen kleinen Schuppen mit einem Schornstein auf dem Dach stieß. Die Tür war nur angelehnt, und so spähte sie neugierig hinein, konnte aber im spärlichen Schimmer des Inneren kaum etwas erkennen. Sie öffnete die Tür etwas weiter, um Licht einzulassen, und entdeckte einen kleinen, merkwürdig geformten Apparat. Daneben stand ein Fass, und die beiden Gegenstände waren durch Schläuche verbunden. Umgeben waren sie von einem intensiven, säuerlichen Gestank, der ihr nicht vertraut war. In der Annahme, das Ganze müsse etwas mit der Arbeit auf der Farm zu tun haben, schloss sie die Tür und setzte ihre Suche nach dem Gemüsebeet fort. Sie fand es schließlich inmitten von Unkraut, eingezäunt zum Schutz gegen die Schafe. Eine Schaufel lehnte am Zaun, und so begann sie zu graben. Nachdem sie eine Schicht puderigen roten Staub beseitigt hatte, wurde der Boden trocken und äußerst hart. Das Graben war schwer, und schon bald bildeten sich Blasen an ihren Händen. Schließlich fand sie ein paar Kartoffeln, Karotten und eine Pastinake, die die Tiere übersehen hatten. Mit etwas Mehl und Milch für eine Soße konnte sie damit sicher etwas Essbares zum Dinner hinbekommen.
Während Rosa ihrer Arbeit im Haus nachging, bekam sie Lugh ein paarmal durch das Fenster zu Gesicht. Er erinnerte sie an einen ihrer Nachbarn in Italien, und bei dem Gedanken verkrampfte sich ihr Magen. Alle hatten die Frau jenes Nachbarn für seine Tochter gehalten, bis sie Babys zur Welt brachte. Es stellte sich heraus, dass er fünfunddreißig Jahre älter war als sie und die Ehe arrangiert worden war, als die junge Frau noch ein Kind gewesen war. Nach zehn Kindern sah ihr Mann aus wie deren Großvater, umso mehr als sein Gesundheitszustand sich mit dem Alter verschlechterte. Die arme junge Ehefrau musste sich um ihn ebenso kümmern wie um ihre Kinder. Rosa hatte Mitleid mit ihr gehabt. Und nun würde sie sich in einer ähnlichen Situation wiederfinden, wenn sie Lugh Varden tatsächlich heiratete.
Rosa konnte sich nicht einmal vorstellen, Kinder mit Lugh Varden zu haben, und stellte fest, dass sie um das Bild des attraktiven, ihr im Alter näherstehenden Mannes trauerte, das sie so lange im Kopf gehabt hatte.
An diesem Abend saß Lugh am Tisch, ohne ein Wort zu sprechen, als sie den Gemüseauflauf vor ihn hinstellte. Er aß schweigend, leerte eilig seinen Teller, ohne Rosa auch nur anzusehen.
»Hat Ihnen das Essen geschmeckt, Mister Varden?«, fragte Rosa, als von ihm keinerlei Bemerkung dazu kam.
»Mit etwas Fleisch wäre es besser gewesen. Morgen schieße ich ein Kaninchen, für ein Stew«, sagte er, stand auf und ging durch die Hintertür hinaus. Rosa räumte gerade den Tisch ab, als er nach kurzer Zeit mit einem großen gläsernen Krug zurückkehrte, aus dem er Flüssigkeit in zwei Gläser goss. Eines davon stellte er an Rosas Platz auf den Tisch.
»Was ist das?«, fragte sie.
»Probieren Sie«, schlug er vor. »Es ist gut für die Verdauung.«
»Woher haben Sie das?«
»Ich habe es selbst gemacht.«
Sie dachte an den Apparat in dem kleinen Schuppen, und auf einmal wurde ihr klar, worum es sich handelte. »Ist das … schwarz Gebrannter?«
»Könnte man so sagen. Wir bekommen hier keine Trauben, also habe ich Buschpflaumen, Zucker und Alkohol verwendet. Probieren Sie.«
»Ich trinke keinen Alkohol, aber trotzdem vielen Dank«, sagte Rosa. Sie fühlte sich unbehaglich.
»Wie kann es sein, dass eine Frau aus Italien keinen Wein trinkt? Sogar Kinder bekommen daheim zum Essen Wein gereicht.«
»Ich habe zu Hause manchmal ein wenig Wein getrunken, aber das hier ist kein Wein, oder?«
»Es kommt dem nahe und ist trotzdem gut.« Er klang ungehalten.
»Ich möchte lieber nicht«, wiederholte Rosa. Sie hatte Wasser aus der Regentonne erhitzt, um das Geschirr zu spülen, und trat nun vor das Spülbecken, auch um Abstand zwischen sich und Lugh zu bringen.