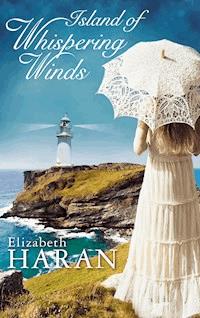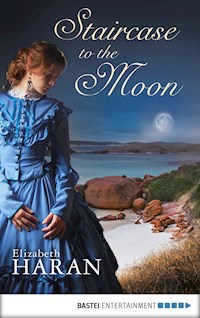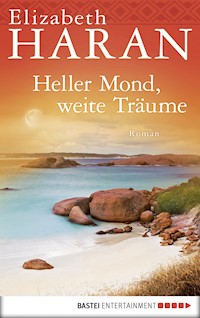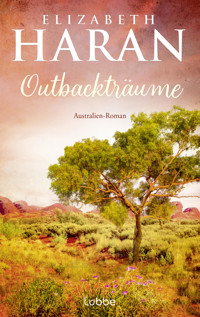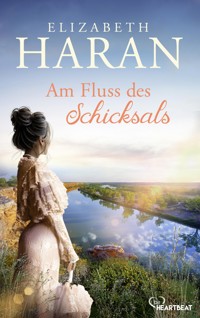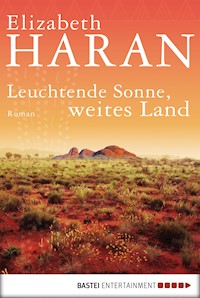
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Jacqueline und Henry haben Amerika hinter sich gelassen, um auf dem roten Kontinent ein neues Leben zu beginnen. Doch kurz vor ihrem Zielhafen Melbourne bricht für Jacqueline eine Welt zusammen: Henry verlangt plötzlich die Scheidung. Er hat an Bord eine jüngere Frau kennen gelernt, mit der er eine Familie gründen will - denn Jacqueline hat ihm in den zehn Jahren ihrer Ehe keine Kinder schenken können.
Überstürzt und tief gedemütigt verlässt Jacqueline das Schiff im Hafen von Adelaide. Nun ist sie in einem fremden Land, fast mittellos, völlig auf sich allein gestellt ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 695
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Inhalt
Elizabeth Haran
LEUCHTENDE SONNE, WEITES LAND
Roman Übersetzung aus dem australischen Englisch von Sylvia Strasser
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Titel der australischen Originalausgabe »A Faraway Place in the Sun«
Für die Originalausgabe: Copyright © 2009 by Elizabeth Haran The Author has asserted her Moral Rights.
Für die deutschsprachige Ausgabe: Copyright © 2010 by Bastei Lübbe AG, Köln Titelbild: getty images/Neil Emmerson Umschlaggestaltung: Gisela Kullowatz Lektorat: Melanie Blank-Schröder E-Book-Produktion: Dörlemann Satz, Lemförde
ISBN 978-3-8387-0358-9
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Ich widme dieses Buch meiner lieben Freundin Eleanor Robinson, die wie eine zweite Mutter für mich ist. Eleanor, wir haben immer so viel Spaß zusammen, und du bedeutest mir so viel.
PROLOG
Atlanta, Georgia Januar 1946
»Polizei! Machen Sie auf, Mr. Gordon-Smith!«, befahl eine energische Männerstimme, die den Lärm auf der Straße übertönte.
Heftig wurde gegen die Tür gehämmert. Margaret, Lionel und ihre beiden Kinder konnten die aufgebrachte Menge hören, die sich in der Dunkelheit vor dem weißen Lattenzaun versammelt hatte, der den gepflegten Garten umgab. Die Nachbarn in diesem überwiegend von Weißen bewohnten, gutbürgerlichen und sonst so ruhigen Vorort von Atlanta waren vermutlich genauso erschrocken über den Aufruhr da draußen wie Lionel und seine Familie, denen die Anfeindungen des Pöbels galten.
Begonnen hatte alles zwei Tage zuvor nach dem tragischen Tod der siebenjährigen Valmae Brown. Inzwischen hatte sich die Lage derart zugespitzt, dass die Familie um ihr Leben fürchten musste und sich nicht mehr aus dem Haus wagte.
Lionel spähte vorsichtig durch die Spitzengardinen des Fensters neben der Haustür. Im schwachen Lichtschein konnte er zwei uniformierte Männer auf der Veranda erkennen. Hinter ihnen, auf der Straße, sah er zornige Gesichter im Schein einiger Fackeln.
»Es ist wirklich die Polizei«, sagte er mit einem Blick auf das verängstigte Gesicht seiner Frau. »Ich lasse sie besser herein.«
»Warte! Bist du auch ganz sicher?«, flüsterte Margaret angespannt. Sie sorgte sich vor allem um ihre beiden Kinder, die sie auf ihr Zimmer geschickt hatte, wo sie zwischen den geschlossenen Vorhängen hindurch auf die Straße hinauslugten.
Die dreizehnjährige Jacqueline war ungewöhnlich vernünftig und pragmatisch für ihr Alter, während Mitchell, ihr achtjähriger Bruder, ein rechter Wildfang war. Die Geschwister standen einander sehr nahe. Jacqueline, die sich nicht erklären konnte, warum sich die aufgebrachten Schwarzen da draußen versammelt hatten, war starr vor Angst, aber sie versuchte, sich ihrem Bruder zuliebe nichts anmerken zu lassen.
»Von denen droht uns bestimmt keine Gefahr«, sagte Lionel nach einem weiteren prüfenden Blick aus dem Fenster.
Jetzt erst sah er, dass die beiden Polizisten keine Unbekannten waren. Er wusste, sie waren wegen Margaret gekommen. Sosehr ihn der Gedanke auch beunruhigte, dass sie sie festnehmen könnten – im Augenblick wäre sie im Gefängnis vermutlich sicherer als zu Hause.
Lionel schob den Riegel zurück, ließ die Beamten herein, schloss die Tür schnell wieder und verriegelte sie erneut. Er hatte Sergeant Riley und den jungen Officer Jellicoe bereits zwei Tage zuvor kennen gelernt, als sie Margaret wegen Valmae vernommen hatten.
»Warum unternehmen Sie nichts gegen den Pöbel da draußen?«, fragte Lionel ungehalten. Er konnte seinen Zorn kaum unterdrücken.
»Meine Männer versuchen, die Leute zu zerstreuen, Sir«, erwiderte Sergeant Riley entschuldigend und mit einem Seitenblick auf Margaret. »Ich habe angeordnet, dass die Rädelsführer festgenommen werden. Ich schätze, dann werden die anderen nach Hause gehen.«
In Wirklichkeit hielt er die Lage für so ernst, dass er Verstärkung von einem anderen Revier angefordert hatte. In den amerikanischen Südstaaten waren die als »Jim Crow« bekannten Gesetze zur Einhaltung der Rassentrennung, mit denen eine Diskriminierung der schwarzen Bevölkerung einherging, immer noch in Kraft, auch wenn sich allmählich ein Wandel bemerkbar machte. Da im Süden die Arbeitslosigkeit unter den Schwarzen sehr hoch war, hatten sich während des Zweiten Weltkriegs viele freiwillig zum Militär gemeldet. Sie waren mit Handkuss genommen worden, sodass sich die Regierung jetzt gezwungen sah, ihre scheinheilige Haltung aufzugeben: Man konnte die Schwarzen nicht länger als Bürger zweiter Klasse behandeln.
Aber unter den Weißen gab es Gruppierungen, die sich vehement gegen den Wandel sträubten und an der alten Ordnung festhalten wollten. Nachdem in der Gegend unlängst zwei Morde verübt worden waren, hatten sich die Spannungen zwischen Schwarz und Weiß verschärft. Die Schwarzen forderten Wiedergutmachung für das erlittene Unrecht. Und Valmaes Tod war in ihren Augen ein Unrecht von ungeheuren Ausmaßen. Ein weiterer Mord. Obwohl alle »Beweise« Margaret entlasteten, verlangten die Schwarzen, dass sie ins Gefängnis gesteckt wurde.
Lionel konnte es nicht fassen, dass die Polizei offenbar nicht imstande war, mehr für ihn und seine Familie zu tun. Er hätte seinem Unmut gern Luft gemacht, beherrschte sich aber, um seine Frau nicht noch mehr zu beunruhigen. In ohnmächtigem Zorn ballte er die Fäuste.
Jacqueline öffnete die Zimmertür vorsichtig einen Spalt breit und lauschte.
»Wir sind gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass die Ermittlungen abgeschlossen sind, Mrs. Gordon-Smith. Der Fall wird zu den Akten gelegt. Es wird keine Anklage gegen Sie erhoben werden«, sagte Sergeant Riley.
Jacqueline wusste nicht genau, was der Polizeibeamte damit meinte, aber sie sah, dass ihre Mutter alles andere als erleichtert wirkte, und das verwirrte sie. Der Sergeant trat näher zu ihrer Mutter hin und raunte ihr etwas zu, das Jacqueline aber nicht verstehen konnte. Das blasse Gesicht ihrer Mutter verzerrte sich vor Kummer, und sie rang nervös die Hände, was sie nur tat, wenn sie sehr aufgewühlt war.
»Es ist mir egal, was Sie sagen«, brach es aus ihr hervor. »Ich bin schuldig! Ich weiß es, und die da wissen es auch.« Sie machte eine vage Handbewegung zu der Menge draußen auf der Straße hin und begann unvermittelt zu schluchzen.
Lionel legte seiner Frau tröstend seinen Arm um die zuckenden Schultern. »Hör auf, dir Vorwürfe zu machen, Maggie. Woher hättest du wissen sollen, dass das kleine Mädchen auf dem Parkplatz war? Es war dunkel, und sie hätte um diese Zeit zu Hause sein sollen. Wenn man jemandem die Schuld an diesem schrecklichen Unglück geben kann, dann ihren Eltern.«
»Aber ich wusste, dass sie immer wieder zur Ballettschule kam«, erwiderte Margaret unter Tränen. »Ich hätte besser aufpassen müssen. Ich hätte mich vergewissern müssen, dass sie nicht in der Nähe ist.«
»Das hätte auch nichts geändert. Du warst nicht für sie verantwortlich, Maggie. Wann wirst du das endlich begreifen?«, stieß Lionel frustriert aus.
Er wusste nicht mehr, wie oft er in den letzten beiden Tagen versucht hatte, ihr ihre Schuldgefühle auszureden, aber Margaret wollte einfach nicht auf ihn hören. Als ehemalige professionelle Balletttänzerin, die an der privaten Vivienne School of Ballet unterrichtete, konnte sie die Begeisterung des kleinen schwarzen Mädchens für das Tanzen sehr gut verstehen. Sie machte sich bittere Vorwürfe, dass sie sich nicht stärker für die Kleine eingesetzt hatte, deren sehnlichster Wunsch es gewesen war, Ballettunterricht zu nehmen.
Jacqueline versuchte, sich einen Reim auf das, was sie aufgeschnappt hatte, zu machen. Offenbar gab ihre Mutter sich die Schuld am Tod eines schwarzen Mädchens, und die Schwarzen in der Stadt schienen sie ebenfalls dafür verantwortlich zu machen. Aber was genau sollte ihre Mutter getan haben? Und wie war das kleine Mädchen ums Leben gekommen? War sie überfahren worden?
Jacqueline hatte Angst, die Polizei werde ihre Mutter mitnehmen, doch es sah nicht danach aus. Sie freute sich natürlich darüber, aber sie fragte sich auch, weshalb die Menschen draußen auf der Straße so wütend waren, wenn ihre Mutter unschuldig war.
»Sie sollten wissen, dass da draußen auch einige Reporter warten«, fügte der Sergeant warnend hinzu. »Wenn die Zeitungen Wind davon bekommen, dass wegen Valmae Browns Tod keine Anklage gegen Sie erhoben wird, könnte das die Stimmung anheizen.« Er sah Lionel ernst an. »Das heißt, es könnte noch wesentlich mehr Ärger geben. Vielleicht wäre es ganz gut, wenn Sie die Stadt für eine Weile verlassen würden.«
Was er in Wirklichkeit dachte, nämlich, dass es für die Familie lebensgefährlich sein könnte zu bleiben, behielt er für sich, da Margaret sich ohnehin schon am Rand eines Nervenzusammenbruchs befand. Er brauchte nicht deutlicher zu werden. Lionel arbeitete in der britischen Botschaft, er wusste um die Brisanz der Situation.
Im gleichen Augenblick ließ ein gewaltiges Krachen und Klirren, das vom Nachbarhaus kam, sie alle zusammenfahren.
»Margaret, schau bitte nach den Kindern«, bat Lionel. Als sie außer Hörweite war, fragte er mit gedämpfter Stimme, wobei er abermals einen besorgten Blick nach draußen warf: »Was meinen Sie, werden wir jemals in unser Zuhause zurückkehren können?«
»Ich wollte Ihre Frau nicht unnötig beunruhigen, Sir, aber ich an Ihrer Stelle würde die Stadt so schnell wie möglich verlassen. Ich habe nicht genug Leute, um Sie und Ihre Familie im Ernstfall schützen zu können, und der Pöbel da draußen will Blut sehen.« Der Sergeant senkte seine Stimme zu einem Flüstern. »Die Ballettschule, wo Valmae Brown ums Leben kam, wurde vor ein paar Stunden in Brand gesetzt, und am Everglade Drive sind zwei Geschäfte überfallen und verwüstet worden. Bei einigen Ihrer Nachbarn sind die Fenster eingeworfen worden. Die Lage wird von Stunde zu Stunde brenzliger. Berichten die Zeitungen erst einmal darüber, dass auf eine Anklage gegen Ihre Frau verzichtet wird, könnten Sie und Ihre Familie ernsthaft in Gefahr sein.«
Lionel nickte. Ihm war der Ernst der Situation völlig klar. »Sie haben Recht. Ich werde Ihren Rat befolgen.«
»Gibt es einen Hinterausgang?«
»Ja. Von der Garage gelangt man auf eine kleine Straße hinter dem Haus.«
»Gut. Dann sehen Sie zu, dass Sie so schnell wie möglich von hier wegkommen«, riet der Sergeant.
Margaret kam vom Kinderzimmer zurück. Im gleichen Moment war draußen ein dumpfes Scheppern zu hören. Der Sergeant lugte aus dem Fenster. Auf dem Fußweg vom Bürgersteig zur Haustür lag eine Statue, die von ihrem Sockel im Vorgarten gestoßen und zerbrochen war. Einige Polizisten versuchten, die aufgebrachte Menge zurückzudrängen.
»Ich muss zu meinen Leuten«, sagte der Sergeant. Er nickte Lionel mit einer knappen Kopfbewegung zu. »Viel Glück, Sir. Ma’am.«
Lionel ließ ihn hinaus und sperrte die Tür sofort wieder zu.
»Wir sind in großer Gefahr, nicht wahr?«, wisperte Margaret, der die düstere Miene des Polizeibeamten und sein unheilvoller Tonfall nicht entgangen waren.
»Pack schnell ein paar Sachen zusammen, Maggie«, sagte Lionel. »Der Sergeant hat Recht. Wir können nicht hierbleiben.«
»Was wird aus dem Haus?« Sollten sie alles, was sie besaßen, alles, woran sie hingen, einfach zurücklassen?
»Das Haus ist nicht so wichtig. Das Leben unserer Kinder steht auf dem Spiel.«
Lionel bemühte sich, einen kühlen Kopf zu bewahren, aber innerlich schäumte er. Es erboste ihn, dass die Polizei nicht imstande war, seine Familie und sein Zuhause zu schützen.
»Ich lass schon mal den Motor warmlaufen.« Er wollte es nicht riskieren, dass der Wagen nicht ansprang und sie einem wütenden Pöbel ausgesetzt waren.
Lionel warf sich seinen Mantel über und eilte durch die Hintertür zur Garage. Margaret kehrte ins Kinderzimmer zurück, wo sie Jacqueline und Mitchell, die beide schon bettfertig waren, befahl, sich wieder anzuziehen.
»Aber warum denn, Mom? Gehen wir fort? Wohin gehen wir?«, fragte das Mädchen.
»Ich weiß es nicht«, antwortete Margaret kopfschüttelnd. »Frag nicht so viel, beeilt euch lieber!«
Ein lautes Poltern ließ sie zusammenzucken. Sie spähte ängstlich aus dem Fenster und sah, dass etwas auf die vordere Veranda geschleudert worden war. Sie dachte an ihren Garten, den sie so liebevoll gepflegt hatte, an die Steinfiguren und die Blumen in den bunten Übertöpfen, die ihn im Sommer schmückten. Sie glaubte nicht, dass irgendetwas davon übrig bleiben würde. Ihr war nach Weinen zumute, aber sie riss sich um ihrer Kinder willen zusammen.
»Bleibt von den Fenstern weg, hört ihr?« Margarets Stimme zitterte.
Hastig raffte sie ein paar Kleidungsstücke aus den Schubladen der Kommode zusammen und warf alles in eine Tasche. Dann lief sie in ihr Schlafzimmer, um ein paar Sachen von sich und Lionel einzupacken. Als sie ein Schubfach aufzog, fiel ihr Blick auf ihre Fotoalben. Sie nahm zwei heraus, die Fotos der Kinder enthielten, und legte sie in den Koffer. Kleidung konnte man ersetzen, die Fotos nicht. Nach kurzer Überlegung warf sie auch ihr Tagebuch hinein. Sie hoffte, Lionel würde sie verstehen.
Als er wenige Minuten später wieder hereinkam, hatte sie eine Tasche und einen Koffer gepackt. Die Kinder waren dick eingemummelt. Es war bitterkalt, so kalt wie lange nicht mehr, und es schneite seit einigen Stunden ununterbrochen. Lionel nahm die Tasche in die eine Hand, den Koffer in die andere.
»Seid ihr so weit?«
Margaret nickte und sah ihre beiden Kinder besorgt an. Mitchell hielt seine hölzerne Spielzeuglok an sich gepresst. Er hatte die Eisenbahn zu seinem achten Geburtstag wenige Wochen zuvor geschenkt bekommen.
»Möchtest du nicht eine von deinen Puppen mitnehmen, Jacqueline?« Ihre Tochter spielte schon seit langem nicht mehr mit ihren Puppen, aber Margaret dachte, dass sie vielleicht ein Andenken an ihre Kindheit mitnehmen wolle. Immerhin war es möglich, dass sie ihr Zuhause bei ihrer Rückkehr nicht mehr vorfinden würden.
»Nein«, erwiderte das Mädchen ernst. »Ich bin zu alt zum Puppenspielen, Mom.«
Diese Worte brachen Margaret schier das Herz. Ihre Tochter musste viel zu schnell erwachsen werden, dabei war sie mit ihren dreizehn Jahren doch noch ein Kind, das auf ihren Schutz und ihre Fürsorge angewiesen war.
»Wohin gehen wir, Daddy?«, fragte Mitchell. Er war noch zu klein, um den Ernst der Situation erfassen zu können. Für ihn war der unvorhergesehene Ausflug ein spannendes Abenteuer.
»Ich weiß es noch nicht, mein Sohn.«
Lionel klemmte sich die Reisetasche unter den Arm und ergriff Mitchells Hand. Der Junge blickte vertrauensvoll zu ihm auf. Lionel gab es einen Stich. Er würde lieber sterben, als zuzulassen, dass seiner Familie ein Leid geschah.
Das Splittern von Glas schreckte sie auf. Margaret stieß einen Entsetzensschrei aus, als sie den rötlichen Lichtschein bemerkte, der aus dem Wohnzimmer fiel. Die Fensterscheibe war mit einem Brandsatz eingeworfen worden, einer mit Benzin gefüllten Flasche, die mit einem Lumpen zugestopft war, den man angezündet hatte. Der Boden war mit Scherben übersät. Schon hatten die Flammen auf die schweren Vorhänge übergegriffen und züngelten über den Teppich.
Margaret drückte ihre beiden völlig verängstigten Kinder fest an sich, während sie mit weit aufgerissenen Augen auf die gespenstische Szenerie starrte. Durch das zerbrochene Fenster konnte sie dunkle Gestalten durch den Vorgarten schleichen sehen und hörte Drohungen und Beschimpfungen, die sich gegen sie und ihre Familie richteten.
»Machen wir, dass wir hier rauskommen«, stieß Lionel gepresst hervor. Er konnte nicht fassen, wie schnell ihr aller Leben sich in einen Albtraum verwandelt hatte.
»Aber wir müssen doch etwas tun!«, stammelte Margaret.
Sie liebte ihr Zuhause über alles, aber kaum hatte sie die Worte ausgesprochen, als sie es auch schon bereute. Sie mussten sich und ihre Kinder in Sicherheit bringen. Alles andere war im Grunde unwichtig.
»Dafür haben wir keine Zeit. Los, beeilt euch!« Lionel drängte seine Frau und seine Kinder zur Hintertür.
Sie liefen zur Garage. Als Margaret und die Kinder eingestiegen waren, warf Lionel einen prüfenden Blick in die schmale Straße hinter dem Grundstück. Sie wirkte verlassen. Er eilte zum Auto und sprang hinein.
Sekunden später rollte der Wagen auf die schneebedeckte Nebenstraße. Lionel ließ die Scheinwerfer ausgeschaltet, als er nach links auf die Hauptstraße einbog, die früher an diesem Tag geräumt worden war. Er fuhr langsam, um nicht auf sich aufmerksam zu machen, er hoffte inständig, dass ihre Flucht unbemerkt blieb.
Einige Augenblicke lang glaubte er schon, sie hätten es geschafft und seien in Sicherheit, doch dann hörte er plötzlich jemanden brüllen: »Da sind sie! Los, hinterher! Die schnappen wir uns!«
Lionel schlug das Herz bis zum Hals. Er schaltete die Scheinwerfer ein, gab Gas und fuhr so schnell, wie die schlüpfrige Straße es zuließ. Im Rückspiegel sah er, wie sie von ein paar Männern zu Fuß verfolgt wurden. Aber es gelang ihm, sie abzuhängen. Er atmete auf, als sie endlich auf die Schnellstraße gelangten. Eine Weile schien es, als hätten sie ihre Verfolger abgehängt, doch auf einmal tauchten Scheinwerfer im Rückspiegel auf. Das Fahrzeug, zu dem sie gehörten, kam rasch näher.
»Gott, steh uns bei«, murmelte Lionel.
Margaret blickte ihn angstvoll an. »Was ist?«
Er antwortete nicht. Er umklammerte das Lenkrad mit beiden Händen und trat das Gaspedal durch, aber in seiner Panik verlor er auf der vereisten Straße die Kontrolle über den Wagen. Das Auto schlidderte seitwärts in den am Straßenrand aufgetürmten Schnee. Margaret und die Kinder schrien auf. Lionel nahm den Fuß vom Gaspedal, und die von einer Vakuumpumpe betriebenen Scheibenwischer schoben die Schneeflocken schneller von der Windschutzscheibe. Irgendwie gelang es Lionel, das Fahrzeug wieder unter Kontrolle zu bekommen.
Er streifte seine Frau mit einem Seitenblick. Selbst in dem schummrigen Licht im Fahrzeuginneren konnte er erkennen, dass sie kalkweiß geworden war. Die beiden Kinder klammerten sich auf der Rückbank aneinander. Mitchell blickte ängstlich über die Schulter aus dem Heckfenster. Schließlich drehte er sich um, kniete sich hin und wischte mit der Hand über die angelaufene Scheibe.
»Da ist ein Wagen hinter uns, Daddy. Er ist ganz schön schnell.« Lionel antwortete nicht. Der Junge wandte sich seiner Schwester zu. »Verfolgt er uns?«
»Nein, nein«, beruhigte Jacqueline ihn. »Setz dich wieder richtig hin.«
»Hast du nicht gehört?«, fuhr Margaret ihn an. »Tu, was deine Schwester sagt.«
Lionel trat das Gaspedal von neuem durch.
»Nicht so schnell!«, kreischte Margaret. Sie spürte, wie der Wagen auf der glatten Straße ins Rutschen kam, und klammerte sich an ihren Sitz. Das Schneetreiben war so dicht, dass sie kaum ein paar Meter weit sehen konnten.
Lionel blickte nervös in den Rückspiegel. Die Scheinwerfer hinter ihnen kamen rasch näher, und sie waren praktisch völlig allein auf dieser Schnellstraße. Nackte Angst schnürte Lionel die Brust zusammen. Er malte sich aus, wie seine Frau und seine Kinder von Valmae Browns Angehörigen aus Rache ermordet wurden. Das durfte er nicht zulassen. Seine Familie bedeutete ihm mehr als alles auf der Welt, und sie verließen sich darauf, dass er sie beschützte. Er flehte im Stillen, dass ein Wunder geschah.
Die Straße beschrieb einen lang gezogenen Rechtsbogen. Lionel schlug das Lenkrad ein, aber der Wagen reagierte nicht, die Räder blockierten. Sie fuhren geradewegs auf die Gegenfahrbahn. In diesem Moment näherte sich ein Fahrzeug. Lionel kniff die Augen gegen das grelle Scheinwerferlicht zusammen. Er hörte noch, wie Margaret einen gellenden Schrei ausstieß, dann prallten sie mit dem Kühler in eine Schneeverwehung am Straßenrand, fast gleichzeitig wurden sie von dem entgegenkommenden Fahrzeug gerammt. Der Wagen schoss über die Leitplanke hinweg und eine Böschung hinunter, überschlug sich mehrfach und blieb neben einer Bahnlinie auf dem Dach liegen.
Plötzlich war es totenstill. Nur das Surren und Zischen der sich drehenden Räder war zu hören.
Als Jacqueline die Augen aufschlug, herrschte Dunkelheit rings um sie her. Sie wusste nicht, wie viel Zeit vergangen war. Sie wusste nur, dass ihr Genick und ihre Schulter furchtbar wehtaten und sie entsetzlich fror. Erst nach einer ganzen Weile wurde ihr klar, dass sie auf der Innenseite des Wagendachs lag und nicht auf der Rückbank.
»Mom?«, krächzte sie schwach. »Dad?« Niemand antwortete.
Sie tastete mit beiden Händen ihre Umgebung ab. Jacqueline fand Mitchell im selben Moment, als der Strahl einer Taschenlampe sein lebloses, blutüberströmtes Gesicht erfasste. Seine Spielzeuglok lag neben ihm.
»Wach auf, Mitchell«, wisperte Jacqueline, die eine düstere Vorahnung überkam. »Mitchell? Wach doch auf!«
Ihre Augen füllten sich mit Tränen. Sie hörte Stimmen, einige waren weiter weg, andere ganz nah. Sie lauschte. Ob ihre Eltern sich schon aus dem Wagen befreit und Hilfe geholt hatten?
»Alles in Ordnung?«, fragte eine freundliche männliche Stimme. Jacqueline drehte den Kopf ein klein wenig und erblickte einen Mann, der im Schnee kniete und durch das zersplitterte Fenster zu ihr hereinsah. »Hab keine Angst, wir holen dich gleich da raus.«
»Wo ist meine Mom?«, wimmerte das Mädchen. »Ich will zu meiner Mom.«
Obwohl sie benommen und völlig verwirrt war, hörte sie genau, wie jemand leise sagte: »Der Junge und die Frau haben es nicht geschafft.«
Diese Worte sollten ihr Leben für immer verändern.
1
Oktober 1964 Küste von South Australia
»Da bist du ja, Henry!«, rief Jacqueline, als sie ihren Mann an der Schiffsreling erblickte.
Henry, der sich angeregt mit einer blonden Frau unterhalten hatte, fuhr erschrocken herum. »Jacqueline!« Die Umstehenden blickten verblüfft auf, so entgeistert hatte er den Namen seiner Frau ausgesprochen. »Ich habe gar nicht damit gerechnet … ich meine, schön, dass du an Deck gekommen bist, Liebes.« Er lächelte gezwungen.
Jacqueline hatte seit Wochen kaum etwas zu sich genommen, deshalb war sie entkräftet und ganz außer Atem, nachdem sie von ihrer Kabine auf dem C-Deck die drei Treppen zum Promenadendeck hinaufgestiegen war. Sie war so sehr mit sich selbst beschäftigt, dass sie die merkwürdige Reaktion ihres Mannes nicht bemerkte. Auf wackligen Beinen stakste sie auf dem schlingernden Schiff an die Reling und umklammerte sie mit beiden Händen.
»Als ich durch das Bullauge Land gesehen habe, hielt ich es unten nicht mehr aus.« Jacqueline zog die salzige Seeluft tief in die Lungen. »Herrlich! Endlich wieder frische Luft!« Sie schloss die Augen und streckte ihr blasses Gesicht der Morgensonne entgegen, die sie mit ihren warmen Strahlen liebkoste.
Zum ersten Mal seit Wochen war ihr nicht sterbenselend. Seit sie in Amerika an Bord der Liberty Star gegangen war, war sie seekrank gewesen. Der Schiffsarzt hatte ihr verschiedene Mittel gegen die heftige Übelkeit verabreicht, aber nichts hatte wirklich geholfen. Viele Menschen würden seekrank, sogar Seeleute seien nicht dagegen gefeit, hatte er ihr erklärt, den einen oder anderen habe man schon auf seinem Bett festbinden müssen, damit er nicht über Bord sprang, weil ihm so fürchterlich übel war. Jacqueline hatte fast zwei Wochen in ihrer Kabine verbracht, Henrys verblüffte Reaktion über ihr unverhofftes Auftauchen verwunderte sie daher nicht.
»Falls du jemals wieder die Absicht haben solltest, eine Schiffsreise mit mir zu machen, bringe ich dich um, Henry«, drohte sie ihm.
Abermals atmete sie tief durch. Da sie die Augen immer noch geschlossen hatte, sah sie nicht, wie ein Ausdruck nervösen Unbehagens über das Gesicht ihres Mannes huschte.
Nach einiger Zeit öffnete Jacqueline die Augen wieder, blinzelte und seufzte. »Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal so froh sein könnte, Land zu sehen«, flüsterte sie ergriffen. Sie ließ ihren Blick über den langen weißen Strand und die Kiefern dahinter schweifen und rief ihrem Mann zu: »Sag mir bitte, dass wir uns dem Hafen von Melbourne nähern.«
»Nein, das da vorne ist Outer Harbour in South Australia. Wir legen hier einen Zwischenstopp ein, bevor es nach Melbourne weitergeht.«
Jacqueline machte ein enttäuschtes Gesicht. »Aber wir werden doch von Bord gehen und uns ein bisschen die Beine vertreten können, oder?«
Henry schüttelte den Kopf. »Meines Wissens nicht. Hier dürfen nur die Passagiere, die nach Adelaide wollen, das Schiff verlassen.«
Jacqueline stöhnte. Doch dann sagte sie sich, dass es nach knapp vier Wochen auf See auf einen Tag mehr oder weniger auch nicht ankam. »Wer war eigentlich die blonde Frau, mit der du dich unterhalten hast?«, fragte sie unvermittelt.
»Welche Frau?«, entgegnete Henry mit ausdrucksloser Miene.
Jacqueline schaute über seine Schulter auf die Frau, die ein Stück entfernt mit dem Rücken zu ihnen stand und sich jetzt mit einem anderen Passagier unterhielt, dessen Frau nicht besonders glücklich darüber schien.
»Na, die in dem kurzen lila Minirock, der weißen Bluse und den Schuhen mit den zerschrammten Absätzen.« Jacqueline hielt es für überflüssig, die schönen Beine zu erwähnen. Henry war kein Frauenheld, aber blind war er auch nicht.
Henry drehte sich nicht um. Es überraschte ihn nicht im Mindesten, dass seiner Frau ein unwichtiges Detail wie zerschrammte Absätze auffiel. Jacqueline hatte die Angewohnheit, die merkwürdigsten Dinge an anderen Menschen zur Kenntnis zu nehmen. Hatte ihn das anfangs noch fasziniert, fand er diese Marotte mittlerweile einfach nur nervtötend. »Ach so, die! Oh, das ist nur eine Mitreisende …«
»Das dachte ich mir beinahe, Henry«, versetzte Jacqueline trocken. »Ein Mitglied der Crew oder ein blinder Passagier würde wohl kaum mit Minirock und Pfennigabsätzen hier herumlaufen.«
Henry lief rot an. Er räusperte sich und wechselte das Thema. »Morgen um diese Zeit legen wir in Melbourne an, wenn alles gut geht, Jacqueline. Dann hast du wieder festen Boden unter den Füßen.«
»Ich kann’s kaum erwarten«, erwiderte sie.
Etwas am Gesichtsausdruck ihres Mannes irritierte sie. Aber sie führte die ängstliche Angespanntheit, die sich auf seiner Miene spiegelte, auf den bevorstehenden Neuanfang in einem fremden Land zurück und fand seine Gefühle verständlich. Henry würde in das Möbelgeschäft seines Bruders einsteigen, das sie zu vergrößern beabsichtigten. Nachdem er fünfzehn Jahre lang in New York City einen auf Küchengeräte spezialisierten Elektrohandel geführt hatte, war es ganz normal, dass ihm ein wenig mulmig bei dem Gedanken war, sich die Leitung einer Firma, die er nicht selbst aufgebaut hatte, mit seinem Bruder zu teilen, den er jahrelang nicht gesehen hatte. Dennoch waren sie beide der Meinung gewesen, dass ein neuer Anfang in einem fremden Land genau das Richtige für sie war. Henrys Bruder hatte Australien als Land der vielen Möglichkeiten beschrieben, ihnen von seiner endlosen Weite, dem warmen Klima und der leuchtenden Sonne vorgeschwärmt.
Henry warf einen flüchtigen Blick über seine Schulter. Die hübsche Blondine war fort. Er wandte sich wieder seiner Frau zu. Der Wind spielte mit ihren langen, seidigen braunen Haaren. Ihre blasse Haut ließ sie kränklich aussehen, ihr weißes Kleid unterstrich das noch. Da sie während der Überfahrt fast nichts bei sich behalten hatte, hatte sie ein paar Pfund abgenommen. Von den weiblichen Rundungen, die er einmal so geliebt hatte, war kaum noch etwas zu sehen.
Die angegriffene Gesundheit seiner Frau verstärkte Henrys Schuldgefühle. Aber jetzt gab es kein Zurück mehr, er würde tun, was getan werden musste. Er holte tief Luft und sagte ernst: »Jacqueline.«
»Hm?«, machte sie abwesend, den Blick aufs Festland gerichtet, in Gedanken bei ihrem neuen Zuhause. Jetzt, wo Australien und ihr Ziel in diesem fremden Land in greifbare Nähe gerückt waren, war sie zum ersten Mal seit ihrer Abreise aus New York richtig aufgeregt.
»Ich muss etwas mit dir besprechen. Etwas sehr Wichtiges.«
Henrys Herz raste, der Schweiß brach ihm aus allen Poren, und es gelang ihm nicht, das Zittern in seiner Stimme zu unterdrücken. Er hatte eigentlich warten wollen, bis sich seine Frau vollständig erholt hatte, aber er merkte, wie ihm die Zeit davonlief.
»Jacqueline, hörst du mir überhaupt zu?«
»Was sagst du?« Sie wandte den Kopf und sah den Mann, mit dem sie seit zehn Jahren verheiratet war, prüfend an. Er sah besser aus denn je. »Hast du Sport getrieben, Henry?«
»Sport?« Er nestelte nervös an seinem Hemdkragen. »Unsinn! Wie kommst du denn auf so was?«
»Du siehst blendend aus, richtig gesund, irgendwie jünger.«
Er war vor einem knappen Jahr vierzig geworden, aber er wirkte nicht viel älter als sie selbst, und sie war einunddreißig. Obwohl er immer auf eine gepflegte Erscheinung geachtet hatte, war er noch sorgfältiger gekleidet als sonst. Außerdem konnte sie riechen, dass er sein bestes Rasierwasser benutzt hatte.
Jacqueline konnte sich sehr gut an den vierzigsten Geburtstag ihres Mannes erinnern, weil er Henry in eine Art Krise gestürzt hatte, die sich unter anderem in einem starken Wunsch nach Veränderung geäußert hatte. Das könne doch nicht alles gewesen sein, hatte er gesagt, es müsse doch noch mehr im Leben geben, es sei höchste Zeit, etwas Neues anzufangen. Nicht lange danach hatten sie den Entschluss gefasst, nach Australien auszuwandern.
»Im Gegensatz zu mir bist du auf See offenbar richtiggehend aufgeblüht«, bemerkte Jacqueline und versuchte, sich ihren Neid nicht anmerken zu lassen. Sie hatte das Gefühl, in den letzten Wochen um zehn Jahre gealtert zu sein. Befangen kramte sie ihre Sonnenbrille hervor und setzte sie auf, damit man ihre müden Augen nicht sah.
Henry, der von heftigen Schuldgefühlen geplagt wurde, machte den Mund auf, um zu protestieren, klappte ihn dann aber wieder zu und schwieg.
»Kein Wunder, dass sich Frauen, die halb so alt sind wie du, für dich interessieren«, neckte sie ihn. »Du bist der attraktivste Mann auf diesem Schiff, und du bist praktisch wochenlang allein gewesen.« Genau wie sie selbst. Sie hatte sich manches Mal sehr einsam gefühlt, aber sie machte Henry keinen Vorwurf deswegen. Sie konnte ja nicht erwarten, dass er die ganze Zeit bei ihr in der Kabine saß und ihr Gesellschaft leistete. Das wäre egoistisch. »Ein Glück, dass ich dir vertrauen kann und dich nicht ständig im Auge behalten muss.«
Sie scherzte nur, aber Henry fühlte sich höchst unbehaglich. »Lass uns nach unten gehen, Jacqueline, ich muss unbedingt mit dir reden.« Er hasste sich für das, was er ihr antun würde, aber er konnte nicht länger mit dieser Lüge leben.
»Nach unten? Ich denke gar nicht daran! Es wäre mir völlig egal, wenn ich diese Kabine nie wieder von innen zu sehen brauchte. Weißt du, was? Ich glaube, ich werde heute Nacht an Deck schlafen. Warm genug ist es.«
Obwohl es erst Morgen war, war es tatsächlich schon recht warm. Seit sie den Äquator überquert hatten, herrschte in den Kabinen bereits um die Mittagszeit eine unerträgliche Hitze, nachts war es nicht viel besser. Jacquelines Beschwerden wegen der unzureichenden Klimaanlage waren auf taube Ohren gestoßen, und das Lüftchen, das durch das Bullauge hereinwehte, reichte bei weitem nicht zur Kühlung aus. Sie konnte es Henry nicht übel nehmen, dass er die meiste Zeit oben an Deck verbracht und nachts manchmal sogar in einem Liegestuhl geschlafen hatte.
»Jacqueline, bitte!«, sagte Henry beschwörend. Er konnte diese Unterhaltung nicht noch länger hinausschieben, er hatte ohnehin bis zur letzten Minute damit gewartet.
Jacqueline musterte ihn irritiert. Er hörte sich so furchtbar ernst an. Andererseits neigte er dazu, die Dinge zu dramatisieren. »Wir können uns doch hier unterhalten, Henry. Die frische Luft und der Sonnenschein tun mir so unendlich gut!«
»Nein, Liebes, wir müssen unter vier Augen miteinander reden.« Henry fasste seine Frau bei der Hand und steuerte auf einen Niedergang zu. Er fürchtete, Jacqueline werde ihm eine Szene machen, und er wollte nicht, dass andere Passagiere etwas davon mitbekamen.
Jacqueline machte sich los. »Ich will aber nicht nach unten, Henry! Warum setzen wir uns nicht in einen Salon, damit ich wenigstens das Festland sehen kann?«
Normalerweise war er Wachs in ihren Händen, aber dieses Mal ließ er sich nicht erweichen. »Was ich dir zu sagen habe, ist nicht für fremde Ohren bestimmt. Ich muss darauf bestehen, dass wir unsere Kabine aufsuchen.«
»Na schön, wie du willst.« Jacqueline, die sich keinen Reim auf sein merkwürdiges Verhalten machen konnte, gingen die verrücktesten Gedanken durch den Kopf, als sie ihrem Mann durch einen Korridor zu einem der Niedergänge folgte, die zu den unteren Kabinendecks führten. Hätte er nicht so offensichtlich vor Gesundheit gestrotzt, hätte sie geglaubt, er werde ihr mitteilen, dass er schwer erkrankt sei. Wahrscheinlich, so vermutete sie, ging es um die Teilhaberschaft mit seinem Bruder. Sie hatte von Anfang an den Eindruck gehabt, dass er nicht wirklich begeistert war von der Vorstellung, Möbel zu verkaufen. Aber musste er deshalb gleich so theatralisch werden?
Henry schloss die Kabinentür und begann, nervös auf und ab zu gehen. Jacqueline setzte sich auf das Bett und strich mechanisch die Falten in der Tagesdecke glatt. Henry bemerkte es. Ihr Perfektionismus ging ihm auf die Nerven.
»Lass das doch, Jacqueline«, fauchte er.
Erschrocken blickte sie auf.
Er fuhr sich übers Haar. Jetzt, wo es so weit war, wusste er nicht, wie er vorgehen sollte. Einfach mit der Wahrheit herausplatzen oder es ihr schonend beibringen? Aber wie er es auch anfangen würde, das Ergebnis wäre das gleiche – Jacqueline wäre tief verletzt.
»Was ist denn los mit dir, Henry? Warum bist du so gereizt? Man könnte ja meinen, du hättest etwas zu verbergen«, stichelte sie und fügte scherzend hinzu: »Hast du eine heimliche Affäre mit einer Reisebekanntschaft?«
Henry blieb wie angewurzelt stehen. »Wie … wie kommst du denn darauf?«, stammelte er schuldbewusst.
Jacqueline musterte seinen entgeisterten Gesichtsausdruck. »Das war nur ein Witz, Henry. Du meine Güte, sei doch ein bisschen lockerer!« Sie hatte sich immer glücklich geschätzt, weil sie sich keinen treueren Mann wünschen konnte. Wenn er doch nur ein bisschen mehr Humor hätte!
Henry bekam plötzlich weiche Knie. Er ließ sich neben Jacqueline aufs Bett fallen und stützte seinen Kopf in beide Hände. Selten war ihm etwas so schwer gefallen, aber jetzt gab es kein Zurück mehr.
»Ist es wegen des Geschäfts?«, fragte Jacqueline und sah ihren Mann forschend an. »Hast du es dir anders überlegt? Willst du dich doch nicht mit deinem Bruder zusammentun? Ich könnte es verstehen, weißt du, und Philip sicher auch.«
Henry schüttelte den Kopf. »Nein, darum geht es nicht.« Er sah in die vertrauensvollen braunen Augen seiner Frau und versuchte, sich nicht wie ein erbärmlicher Schuft vorzukommen. »Ich weiß nicht, wie ich es dir sagen soll, und deshalb sage ich es einfach geradeheraus. Ich habe … jemanden kennen gelernt …«
Er wandte sich ab und knetete nervös seine Hände. Henry kannte Jacquelines Wutausbrüche. In ihrer Ehe hatte er den einen oder anderen erlebt, ihr Jähzorn konnte ziemlich Furcht einflößend sein.
»Du hast … jemanden kennen gelernt«, wiederholte sie verwirrt. Sie glaubte, sich verhört zu haben. »Das ist nicht komisch, Henry.«
Er dachte an die Zukunft, die er sich so sehr wünschte, und nahm all seinen Mut zusammen. »Ich meine es ernst, Jacqueline. Ich habe eine andere Frau kennen gelernt, und ich möchte ein neues Leben mit ihr beginnen.«
Es war eine Wohltat gewesen, mit jemandem zusammen zu sein, der nicht nach Perfektion strebte, der keinen Gedanken an etwas so Unwichtiges wie zerschrammte Absätze verschwendete. Doch das behielt er für sich.
»Henry, ich verstehe kein Wort! Wovon redest du da?« Jacqueline starrte ihn bestürzt an. Falls das ein Witz sein sollte, konnte sie überhaupt nicht darüber lachen. Aber es schien ihm vollkommen ernst zu sein. »Du hast mich um die halbe Welt geschleppt, damit wir beide hier ein neues Leben beginnen können, du und ich!«
»Ich will dir nicht wehtun, Jacqueline, aber du weißt, dass ich mir immer eine Familie gewünscht habe.« Es war schäbig, ihr ein schlechtes Gewissen machen zu wollen, aber sie ließ ihm keine andere Wahl.
Jacqueline war wie vor den Kopf geschlagen. Kinder waren seit Jahren kein Thema mehr gewesen. Ihre Ehe war kinderlos geblieben, und irgendwann hatten sie sich damit abgefunden. Einmal hatten sie sogar eine Adoption in Erwägung gezogen, den Gedanken aber wieder verworfen.
Eine heftige Übelkeit erfasste sie, aber dieses Mal lag es nicht an den Schlingerbewegungen des Schiffs. »Ich weiß nicht, was du mir eigentlich sagen willst, Henry, aber was es auch sein mag, ich kann im Moment nicht damit umgehen.«
Panik stieg in ihr auf. Ihr Herz hämmerte. Das konnte nur ein schlechter Traum sein! In ihrer gegenwärtigen Verfassung war sie nicht in der Lage, eine seelische Krise zu meistern, und sie konnte nicht glauben, dass Henry sie ausgerechnet jetzt damit konfrontierte. Genauso wenig konnte sie glauben, dass er sie betrogen hatte. Sie hätte ihre Hand für ihn ins Feuer gelegt.
»Es tut mir leid, Jacqueline, aber wir können diese Unterhaltung nicht aufschieben. Ich habe mich auf dieser Reise in eine andere Frau verliebt – ich möchte sie heiraten und eine Familie mit ihr gründen.«
Plötzlich ertrug Henry die Nähe zu seiner Frau nicht mehr. Er stand auf und stellte sich mit dem Rücken zur Tür vor sie.
Jacqueline sah ihren Mann fassungslos an. Seine Worte schienen keinen Sinn zu ergeben. Es war, als hätte er in einer fremden Sprache zu ihr gesprochen. »Wie kannst du dich in dieser kurzen Zeit so sehr in eine andere verlieben, dass du sie heiraten und Kinder mit ihr haben willst? Das ist doch nicht möglich! Zumal du bereits eine Frau hast!«
»Ich weiß, dass das alles sehr schnell gegangen ist, aber unsere Gefühle füreinander sind nun einmal da, wir können sie nicht ignorieren.«
Jacqueline schüttelte nur den Kopf. Henry hatte offensichtlich den Verstand verloren, eine andere Erklärung konnte es nicht geben.
»Du kannst ja nichts dafür, dass du keine Kinder bekommen kannst«, fuhr er fort. »Du sollst wissen, dass ich dir deswegen nicht böse bin.«
Jacqueline starrte ihn offenen Mundes an. Sie hatte keine Ahnung gehabt, dass das Thema Kinder so wichtig für ihn war. Er hatte ihr nie diesen Eindruck vermittelt. »Wie großzügig von dir«, bemerkte sie bissig. »Ich dachte, wir seien uns einig gewesen, dass in unserem Leben kein Platz für Kinder ist.«
Henry senkte seinen Blick. »Du warst dir einig, Jacqueline.« Vielleicht hätte er darauf gedrängt, ein Kind zu adoptieren, wenn er nicht das Gefühl gehabt hätte, dass sie es im Grunde nicht wollte, weil es ihren Lebensstil zu sehr beeinträchtigen würde. »Ich habe mir immer Kinder gewünscht, und allmählich läuft mir die Zeit davon. Ich bin kein junger Mann mehr.«
Jacqueline musterte Henry wortlos. Das war nicht ihr Ehemann, der da vor ihr stand, sondern ein grausamer, herzloser Fremder. Jetzt kam es ihr auf groteske Weise absurd vor, dass sie ihm gerade eben noch gesagt hatte, wie jung und attraktiv er aussah. Zumindest war ihr jetzt der Grund dafür klar.
»Ist das nicht nur eine Ausrede, weil du scharf auf so ein junges Ding bist?« Es wollte ihr nicht in den Kopf, dass er sie nicht mehr liebte und sie betrogen hatte, während es ihr so schlecht gegangen war. »Seien wir doch mal ehrlich: Du bist viel zu egoistisch, um ein guter Vater zu sein.« Sie hatte ihn in all den Jahren verwöhnt, ihm jeden Wunsch von den Augen abgelesen und so dafür gesorgt, dass er bequem geworden war.
Henry zuckte zusammen. Er hatte natürlich damit gerechnet, dass sie ihn beschimpfen würde, aber für einen Egoisten hielt er sich nicht. Er wich unwillkürlich einen Schritt zurück und prallte gegen die Kabinentür.
»Wenn wir wirklich ehrlich sein wollen, Jacqueline, dann müssen wir zugeben, dass wir schon eine ganze Weile nicht mehr glücklich miteinander sind«, konterte er.
»Ich war glücklich, Henry, aber anscheinend hast du vergessen, mir zu sagen, dass du es nicht warst.«
»Jacqueline, ich … ich möchte die Scheidung«, sagte er ruhig.
Eine beklemmende Stille trat ein. Henry beobachtete seine Frau. Sie war sichtlich schockiert. Das kam schließlich völlig unerwartet, für ihn genauso wie für sie. Dennoch war er erleichtert, dass der gefürchtete Wutausbruch ausblieb.
»Die Scheidung«, murmelte sie nach einer Weile ganz benommen. Sie hätte nie gedacht, dass sich dieses Wort einmal auf sie und Henry beziehen könnte. »Du willst einfach so die Scheidung.« In diesem Moment war ihr die Tragweite dessen, was das Wort bedeutete, gar nicht bewusst. Sie wusste nur, dass das neue Leben, das sie gemeinsam geplant hatten, im Begriff war, sich in Luft aufzulösen.
Er nickte. »Ja. Es tut mir wirklich leid, Jacqueline. Ich weiß, dass der Zeitpunkt alles andere als günstig ist, aber solche Dinge passieren einfach, dagegen ist man machtlos.« Auch für ihn war das Ganze völlig überraschend gekommen.
Jacqueline blickte zu Boden. Dann stand sie langsam auf und versuchte, einen klaren Gedanken zu fassen. »Soso, es tut dir leid«, sagte sie mühsam beherrscht. »Das ist wirklich reizend. Mal sehen, ob ich das richtig verstehe, Henry. Nur um weiteren Missverständnissen vorzubeugen. Während ich wochenlang krank hier unten liege, fängst du eine Affäre mit einer anderen Frau an, und jetzt willst du sie heiraten und eine Familie mit ihr gründen. Trifft das in etwa den Kern der Sache?« Sie hoffte immer noch, er werde gleich in Gelächter ausbrechen und sagen, er habe sie nur auf den Arm nehmen wollen.
Henry bekam einen roten Kopf. Der gefürchtete Wutausbruch schien unmittelbar bevorzustehen, das spürte er. »So, wie du es sagst, klingt es sehr billig, aber es stimmt, ich habe mich in eine andere verliebt«, sagte er leise. Er hoffte, sie besänftigen zu können, wenn er sich zerknirscht zeigte.
»Diese Frau, mit der du es hinter meinem Rücken getrieben hast, hat sie gewusst, dass du verheiratet bist, dass deine Frau schwer seekrank und ans Bett gefesselt ist und sich heftig übergeben muss, während ihr zwei … euch amüsiert habt?« Jacqueline wollte sich nicht im Einzelnen vorstellen, was die beiden miteinander machten, es war zu schmerzhaft.
»Ja«, antwortete Henry nur.
Jacqueline traute ihren Ohren nicht. »Sie hat es gewusst?«, kreischte sie. »Was für eine Sorte Mensch ist sie denn?«
Henry dachte daran, wie betroffen seine neue Liebe gewesen war, als er ihr gebeichtet hatte, dass er verheiratet und seine Frau mit an Bord war. Aber ihre Gefühle füreinander waren zu stark gewesen. »Ich weiß, was ich dir damit antue …«, stotterte er und wollte weiter zurückweichen, aber er stand schon mit dem Rücken an der Tür.
Jacqueline machte eine unwillige Handbewegung. »Woher willst du überhaupt wissen, dass deine neue Flamme Kinder bekommen kann?«, zischte sie wütend.
Henry trat verlegen von einem Fuß auf den anderen.
Jacqueline starrte ihn fassungslos an. Das Flittchen konnte in dieser kurzen Zeit ja nicht von ihm schwanger geworden sein, und das bedeutete … »Sie hat schon Kinder?« Der Gedanke, dass diese Frau ebenfalls verheiratet sein könnte, war ihr noch gar nicht gekommen.
»Eines. Einen kleinen Jungen.«
Jacqueline war, als hätte ihr jemand in den Magen geboxt. Sie konnte sich einfach nicht vorstellen, dass Henry für das Kind einer anderen den Vater spielte. »Dann hat sie doch sicher auch einen Ehemann!«
Henry schüttelte den Kopf. »Nein. Hör zu, Jacqueline, ich möchte die Scheidung einreichen, sowie wir in Melbourne angekommen sind«, sagte er völlig emotionslos. »Wenn alles glattgeht, wirst du eine großzügige Abfindung bekommen, das verspreche ich dir.«
Sie funkelte ihn so hasserfüllt an, dass er sich vorkam, als wäre er mit einem blutrünstigen Raubtier in einem kleinen Käfig eingesperrt.
»Wenn alles glattgeht …«, äffte sie ihn nach. Es brachte sie zur Weißglut, dass er anscheinend glaubte, er könne sie mit Geld bewegen, den Weg für ihn und seine Geliebte freizumachen. »Wie heißt dieses Flittchen überhaupt, für das du mich so eiskalt abservierst?«
»Das tut nichts zur Sache.« Henry wollte nur noch weg. »Das ist völlig unwichtig.«
»Nicht für mich!«, schrie Jacqueline, außer sich vor Wut. Plötzlich durchzuckte sie ein Gedanke. »Ist es diese Blondine, mit der du dich vorhin so angeregt unterhalten hast, die mit den schäbigen Absätzen?« Sie sah die Frau im Geist vor sich – man konnte sie sich nur schwer als Mutter eines kleinen Jungen vorstellen.
Henry erschrak. »Bitte lass Verity aus dem Spiel!«
Er wollte auf keinen Fall, dass sie seiner neuen Liebe nachstellte. Verity hatte schon genug durchgemacht. Sie war verwitwet und reiste mit ihren Eltern, den Darcys, und ihrem zweijährigen Sohn. Ihr Mann war anderthalb Jahre zuvor bei einem Unfall auf einer Baustelle ums Leben gekommen. Henry war begeistert, dass er sofort die Rolle des Stiefvaters übernehmen konnte, aber das behielt er ebenso für sich wie den Hinweis darauf, dass Verity nicht nur sehr attraktiv und süß war, sondern auch mit beiden Beinen fest auf dem Boden stand und sie mindestens noch zwei Kinder miteinander haben wollten. Auch ihre Eltern mochten ihn. Anfangs waren sie zurückhaltend gewesen, aber als sie merkten, wie gut er und Verity zusammenpassten, und erfuhren, dass er ihrer Tochter und ihrem Enkel ein angenehmes Leben bieten konnte, schlossen sie ihn in ihr Herz und boten ihm jede nur denkbare Unterstützung bei der Beendigung seiner »unglücklichen« Ehe an.
»Verity?«, wiederholte Jacqueline ungläubig. Was für ein Name für eine langbeinige Blondine.
»Nicht so laut!«, zischte Henry verlegen.
Sie schlug ihm mit der flachen Hand auf die Brust. »Was fällt dir ein! Ich rede so laut, wie ich will! Hast du Angst, jemand könnte von deiner schmutzigen kleinen Affäre erfahren? Oder dass du mich einfach wegwirfst wie eine alte Zeitung, weil ich keine Kinder bekommen kann?«
»Lass uns nicht streiten, Jacqueline.« Henry wich zur Seite, weg von der Tür. »Das hat doch keinen Sinn. Ich liebe dich nicht mehr, das ist nun mal nicht zu ändern.«
»Oh, wie reizend von dir! Ich soll mich heimlich, still und leise davonschleichen, damit du mit deiner Verity glücklich werden kannst! Was erwartest du von mir? Dass ich irgendwo im australischen Busch verschwinde, nachdem ich in die Scheidung eingewilligt habe?«
Er zuckte mit den Schultern. Seine Gleichgültigkeit machte sie rasend. »Ist es dir so egal, was aus mir wird?«, kreischte sie. »Ich bin fremd hier, ich kenne niemanden, ich habe weder Freunde noch Familie hier!«
»Ich habe dir doch gesagt, du bekommst eine großzügige Abfindung«, erwiderte er ungerührt. »Damit kannst du erster Klasse nach New York zurückfahren, wenn du das willst.«
Sie starrte ihn an. Sie konnte nicht glauben, dass er so kaltschnäuzig sein konnte. Sollte sie nach Hause zurückkehren und ihrem Vater und all ihren Freunden erzählen, dass ihr Mann sie wegen einer anderen Frau verlassen hatte, noch bevor sie Melbourne erreicht hatten? Was für eine Demütigung!
»Ich habe dir zehn Jahre meines Lebens geschenkt, und als Dank dafür, dass du immer ein schönes Zuhause und ein gutes Essen hattest, wirfst du mich weg für diese … diese …«
»Es war ja nicht so, dass du hättest putzen und kochen müssen, Jacqueline. Dafür hatten wir eine Haushälterin.« Er wollte nicht so grausam sein, sie darauf hinzuweisen, dass man das Arrangieren von Blumensträußen wohl kaum als Hausarbeit betrachten konnte.
»Aber ich war diejenige, die alles organisiert hat, Henry.«
Wut und Enttäuschung trieben Jacqueline Tränen in die Augen. Sie würde ihm allerdings nicht den Gefallen tun, in seiner Gegenwart zu weinen. Hastig wandte sie sich ab, bückte sich, zog ihren Koffer unter dem Bett hervor und fing an, ihre Sachen aus Schubläden und Schrankfächern zu reißen. Erbost faltete sie die Kleidungsstücke zusammen und warf sie hinein.
Henry schaute ihr einen Augenblick zu. »Was tust du denn da?« Er dachte, sie wolle vielleicht in eine andere Kabine umziehen. »Du kannst ruhig hierbleiben, Jacqueline. Ich werde …«
»Ich will aber nicht hierbleiben«, stieß sie grimmig hervor. Jetzt konnte sie die Tränen nicht mehr zurückhalten.
»Ich glaube nicht, dass du für eine Nacht noch eine andere Kabine bekommen wirst«, gab Henry zu bedenken.
»Ich will keine andere Kabine. Ich will nur fort von diesem Schiff und von dir und von diesem Flittchen mit den schäbigen Absätzen.«
»Wir sind doch erst morgen da«, stammelte Henry.
»Ich will aber heute noch von Bord«, fauchte sie.
Sie würde keinen Tag länger auf diesem Schiff verbringen, zusammen mit Henry und seiner Geliebten. Jacqueline knallte den Kofferdeckel zu, obwohl sie erst einen kleinen Teil ihrer Sachen eingepackt hatte.
»Das … das kannst du doch nicht machen!«, stotterte Henry.
»Das werden wir ja sehen!« Wütend ließ sie die Schlösser einrasten.
»Jacqueline, ich bitte dich! Wir haben doch bis nach Melbourne gebucht und … und wir müssen doch den ganzen Papierkram wegen der Scheidung erledigen!«
»Ich muss gar nichts!«, geiferte sie wutschäumend. »Du bist derjenige, der die Scheidung will, also kümmere du dich gefälligst auch um den Papierkram!« Sie schnappte ihre Handtasche, nahm ihren Koffer und stürmte an Henry vorbei aus der Kabine.
Er folgte ihr in den Korridor. »Jacqueline! Jacqueline, warte doch!« Panik erfasste ihn. »Wo willst du denn hin? Du kannst jetzt nicht von Bord gehen!«
Jacqueline antwortete nicht. Ohne sich noch einmal umzudrehen, eilte sie nach oben, wo bereits alle Vorbereitungen für das Ausbringen des Fallreeps und das Ausbooten der Passagiere getroffen wurden. Sie wünschte sich nichts sehnlicher, als Henry durch ihr vorzeitiges Von-Bord-Gehen größtmögliche Unannehmlichkeiten zu bereiten und sein verlogenes Gesicht nie wiederzusehen.
2
Jacqueline ging gemeinsam mit einundfünfzig anderen Passagieren von Bord. Die Zollformalitäten waren in einer guten Stunde erledigt. Während sie warten und mehrere Formulare ausfüllen musste, hatte sie reichlich Zeit zum Nachdenken. Sie konnte einfach nicht glauben, dass Henry sich in eine andere Frau verliebt hatte und sich allen Ernstes von ihr trennen wollte. Das ist sicher wieder nur eine seiner Krisen, sagte sie sich. Sobald er merkte, dass sie tatsächlich von Bord gegangen war, würde er Vernunft annehmen und ihr nachlaufen.
Erst als sie die Schiffssirene hörte und ihr klar wurde, dass die Liberty Star ohne sie nach Melbourne weiterfahren würde, konnte sie sich nichts mehr vormachen: Es war Henry bitterernst, er wollte tatsächlich die Scheidung, damit er mit seiner Verity ein neues Leben beginnen konnte. Die Wahrheit traf sie wie ein Schlag ins Gesicht. Da stand sie nun, mutterseelenallein in einem fremden Land, praktisch ohne Geld und mit wenig mehr als dem, was sie auf dem Leib trug, und hatte keine Ahnung, was sie mit dem Rest ihres Lebens anfangen sollte.
Der grauhaarige Beamte am Einwanderungsschalter betrachtete prüfend den Pass, den sie ihm reichte, verglich das Foto mit der Frau, die vor ihm stand, und studierte ihre Reiseunterlagen.
»Hier steht, Ihr Reiseziel ist Melbourne, Mrs. Walters«, sagte er schließlich.
Er sah, dass sie geweint hatte, aber das war nicht ungewöhnlich. Einige Passagiere weinten, weil das Wiedersehen mit Angehörigen, die sie lange nicht gesehen hatten, bevorstand, und andere, weil sie ihren Entschluss auszuwandern schon wieder bereuten.
»Ja, das ist richtig«, erwiderte Jacqueline schniefend.
»Und weshalb sind Sie dann in Adelaide von Bord gegangen?«
Jacqueline blinzelte. Ihre Augen hatten sich mit Tränen gefüllt, und sie sah alles wie durch einen Schleier hindurch. »Darf man denn seine Meinung nicht ändern? Spielt es eine Rolle, wo in diesem Land ich leben möchte?« Ihre Nerven lagen blank, ihre Stimme klang fast hysterisch. Andere Passagiere wurden auf sie aufmerksam. Ihre Reaktion weckte auch das Misstrauen des Schalterbeamten.
»Es muss doch einen Grund für Ihre Meinungsänderung geben«, sagte er und sah sie aus seinen blauen Augen durchdringend an. Er übte diesen Beruf lange genug aus, er wusste, wenn jemand etwas zu verheimlichen hatte.
»Ja, den gibt es, aber das ist meine Privatsache«, gab sie patzig zurück. Sie kramte ein Taschentuch hervor und schnäuzte sich. »Das geht Sie überhaupt nichts an. Kümmern Sie sich lieber um Ihren Papierkram.«
Jetzt war es ganz still geworden rings um sie her. Sie spürte, wie die Leute sie anstarrten.
Der Schalterbeamte warf ihr einen argwöhnischen Blick zu und blätterte dann abermals in ihrem Reisepass. »Sind Sie allein gereist oder mit Ihrem Mann, Mrs. Walters?«
»Herrgott noch mal, was spielt das denn für eine Rolle? Ja, ich bin mit meinem Mann gereist, aber ich will nicht darüber reden«, fauchte sie.
»Ist er hier?« Der Beamte ließ seinen Blick über die Passagiere schweifen.
»Nein, er ist nicht hier. Sind Sie schwer von Begriff? Ich habe doch gerade gesagt, ich will nicht darüber reden.« Jacqueline hatte keine Lust, vor allen Leuten zu erklären, dass ihr Mann sie gerade verlassen hatte.
Der Beamte zählte zwei und zwei zusammen. Allem Anschein nach hatte sich die sichtlich aufgewühlte junge Frau mit ihrem Mann gestritten und das Schiff aus einer Anwandlung heraus verlassen. Wahrscheinlich bereute sie ihren spontanen Entschluss bereits.
»Wo ist Ihr Mann jetzt, Mrs. Walters?«
Jacqueline starrte ihn an. Ihre Unterlippe zitterte. Sie hätte diesen Menschen ohrfeigen können, weil er sie wie ein unmündiges Kind behandelte. Als müsste sie sich jede Entscheidung von ihrem Mann absegnen lassen.
»Würden Sie bitte meine Frage beantworten, Mrs. Walters?«
Auf einmal hatte sie genug von diesem Verwirrspiel und machte ihren Gefühlen Luft. »Mein Mann hat mir vor einer Stunde erklärt, dass er die Scheidung will, damit er die Frau, mit der er mich auf der Reise hierher betrogen hat, heiraten kann«, sagte sie laut und deutlich. Sollten die Leute doch von ihr denken, was sie wollten. »Können Sie mir sagen, warum ich an Bord bleiben und mit ihm und diesem Flittchen bis nach Melbourne weiterfahren sollte?«
Dem Beamten war sichtlich unbehaglich zumute. Er räusperte sich. In all den Jahren hatte er schon die verrücktesten Sachen in seinem Beruf erlebt, aber das war eine Premiere.
»Nun? Ich höre«, sagte Jacqueline bissig.
»Mrs. Walters, ich kann Ihnen die Einreise nur genehmigen, wenn ich sicher sein kann, dass Sie über die nötigen Mittel verfügen, um Ihren Lebensunterhalt zu bestreiten, und nicht auf der Straße landen werden.«
Was es ihn kümmerte, hätte sie am liebsten erwidert, ihrem Mann war es schließlich auch egal, was aus ihr wurde. »Ich … ich kann mir einen Job suchen«, antwortete sie. »Ich bin sehr wohl in der Lage, für mich zu sorgen.«
Die Leute ringsumher belauschten die Unterhaltung mit morbider Faszination. Einige jedoch, hauptsächlich Frauen, hatten unwillkürlich Mitleid mit Jacqueline.
Der Beamte sah sie ernst an. »Haben Sie Freunde oder Angehörige hier in South Australia, bei denen Sie wohnen können, Mrs. Walters?«
»Ich werde schon eine Unterkunft finden.« Jacqueline reckte ihr Kinn. »Ich gehe doch davon aus, dass es in diesem Land Hotels gibt.«
»Sicher gibt es hier Hotels, aber auf lange Sicht ist das eine kostspielige Lösung«, gab der Beamte zu bedenken. Er wollte nicht herzlos erscheinen, er dachte nur praktisch.
»Ich kann mir ein Zimmer in einer Pension nehmen oder beim Christlichen Verein Junger Frauen unterkommen.«
»Dort werden leider nur Frauen unter dreißig aufgenommen«, wandte der Beamte ein. »Und Sie sind …«
»Ich weiß, wie alt ich bin, danke«, fauchte sie. Die Wut trieb ihr Tränen in die Augen. Sie drehte sich Hilfe suchend zu den Frauen in der Schlange hinter ihr um. »Typisch Mann, nicht? Als ob es ein Verbrechen wäre, über dreißig zu sein!«
Die blonde Frau unmittelbar hinter ihr nickte zustimmend. Dann wandte sie sich an den Beamten. »Mrs. Walters kann bei uns im Britannia Hotel in Port Adelaide wohnen.« Jacqueline tat ihr leid, und sie fühlte sich genötigt, ihr zu helfen.
Jacqueline drehte sich um und betrachtete die Frau genauer. Sie war Mitte bis Ende dreißig, hatte kurze, lockige Haare und lebhafte blaue Augen. Sie lächelte Jacqueline mitfühlend an. Das »uns« bezog sich offenbar auf sie und die Frau neben ihr.
»Ich heiße Vera Westward«, stellte sie sich vor. An den Beamten gewandt, fügte sie hinzu: »Ich werde mich persönlich um Mrs. Walters kümmern. Ich kenne jemanden von einer Arbeitsvermittlung, der ihr sicherlich eine Stelle besorgen kann.«
Jacqueline kam sich wie eine Fürsorgeempfängerin vor, aber die Hauptsache war, dass sie das Abfertigungsgebäude so schnell wie möglich verlassen konnte. »Sehen Sie? Das ist also überhaupt kein Problem«, sagte sie mit gespielter Selbstsicherheit zu dem Beamten. Ihr Blick fiel auf ihren Trau- und ihren Verlobungsring, als sie auf ihre Einreisepapiere schaute. Die beiden Ringe hatten ein Vermögen gekostet. Sie streckte dem Beamten ihre Hand hin, damit er den Schmuck begutachten konnte. »Im Notfall kann ich immer noch meine Ringe verkaufen. Ich habe sowieso keine Verwendung mehr dafür«, fügte sie frostig hinzu.
»Na schön.«
Der Beamte griff zum Stempel. Da ihm eine solche Situation noch nie untergekommen war, gab es keinen Fall, an dem er sich hätte orientieren können. Er stempelte Jacquelines Pass und reichte ihn ihr. Sie nahm ihn wortlos entgegen, nickte der Frau hinter ihr, die ihr zu Hilfe gekommen war, kurz zu und eilte aus dem Gebäude.
Als Jacqueline aus dem Abfertigungsgebäude trat, konnte sie noch das Heck der Liberty Star sehen, die Kurs auf Melbourne nahm. Die Passagiere an Deck waren kleine, nicht voneinander zu unterscheidende Figuren. Sie fragte sich, ob Henry sich unter ihnen befand, ob er nach ihr Ausschau hielt und seinen Entschluss vielleicht schon bereute. Oder hielt er seine neue Liebe im Arm und war erleichtert, weil er seine Frau schneller losgeworden war, als er befürchtet hatte?
Inzwischen war es Mittag, die Sonne schien, und es war furchtbar heiß. Einige Reisende wurden von aufgeregten Freunden und Verwandten in Empfang genommen. Es tat weh, ihre Wiedersehensfreude mit anzusehen, und so wandte sich Jacqueline ab und schloss sich einer Gruppe von Passagieren an, die um das Gebäude herum und zur Straße gingen. Während die anderen in verschiedene Richtungen davoneilten, blieb Jacqueline stehen und schaute sich ratlos um. Wie zum Hohn ertönte in diesem Moment die Schiffssirene ein zweites Mal. Jacqueline war wie betäubt. Sie konnte es nicht fassen, dass Henry sie einfach hatte gehen lassen. Sie schwankte zwischen blinder Wut, Selbstmitleid und Verzweiflung.
»Hau doch ab!«, zischte sie, während ihr die Tränen übers Gesicht liefen. »Ich brauche dich nicht, du verlogener Gigolo.«
Nie zuvor hatte sie sich einsamer gefühlt als in diesem Augenblick. Und wenn sie ehrlich war, musste sie zugeben, dass sie überstürzt und kopflos gehandelt hatte. Wenn ihre Ehe schon nicht mehr zu retten war, hätte sie wenigstens warten sollen, bis finanziell alles zwischen ihnen geregelt war, bevor sie sich daranmachte, sich ein neues Leben ohne Henry aufzubauen.
Jacqueline blinzelte ihre Tränen fort und kramte in ihrer Handtasche. Fünf Pfund und ein bisschen Kleingeld, das war alles, was sie bei sich hatte. Damit würde sie nicht weit kommen. Und was jetzt?, dachte sie verzweifelt.
»Da sind Sie ja!«, rief eine Frauenstimme. »Wir haben Sie schon gesucht!«
Jacqueline drehte sich um. Vera Westward und die Frau, die in der Abfertigungshalle neben ihr gestanden hatte, kamen auf sie zu. Beide trugen schwer an ihren Koffern. Jacqueline wischte sich verstohlen die Tränen ab und setzte ihre Sonnenbrille auf.
»Vielen Dank, dass Sie mir da drin geholfen haben, aber ich komme schon zurecht. Wirklich«, versicherte sie, weil sie nicht wollte, dass Vera sich in irgendeiner Weise verpflichtet fühlte.
»Mir ist es ernst mit meinem Angebot. Sie können gern bei uns wohnen. Es sei denn, Sie haben andere Pläne.«
»Ich … äh … nein«, erwiderte Jacqueline kopfschüttelnd.
»Das ist übrigens meine Freundin, Tess Clarke.«
Jacqueline musterte die andere Frau flüchtig. Sie war jünger und wog mindestens zwanzig Pfund mehr als Vera. Sie hatte lange, rötlich braune Haare, grüne Augen und ein freundliches Lächeln.
»Guten Tag«, sagte sie herzlich.
»Hallo, ich bin Jacqueline Walters. Aber das haben Sie ja wahrscheinlich schon mitgekriegt. So wie alle anderen im Abfertigungsgebäude.« Sie wurde rot, als sie an ihren Ausbruch am Schalter dachte.
Vera machte eine wegwerfende Handbewegung. »Schwamm drüber. Der Bahnhof muss dort auf der anderen Straßenseite sein, und die Züge verkehren anscheinend pünktlich.« Sie schaute auf ihre Armbanduhr. »Das heißt, uns bleiben noch zwanzig Minuten.«
Die beiden Frauen machten sich unverzüglich auf den Weg. Jacqueline folgte ihnen nach kurzem Zögern. Vera und Tess mühten sich mit ihrem schweren Gepäck ab, ihr eigener Koffer wog so gut wie nichts.
Am Fahrkartenschalter kauften die drei Frauen Fahrkarten nach Port Adelaide. Zwei Bänke standen im Schatten des Bahnhofsgebäudes. Tess und Vera setzten sich, froh über die Verschnaufpause, Jacqueline wischte erst mit ihrem Taschentuch über den Sitz, bevor sie Platz nahm. Tess und Vera wechselten einen viel sagenden Blick.
Auf der anderen Seite der Gleise befand sich eine weitläufige, eingezäunte Grünfläche. Man konnte Golfspieler zwischen den vereinzelt auf dem Rasen stehenden Bäumen sehen. Abgesehen von einer Landstraße hinter dem Golfplatz war nicht viel von der Landschaft zu erkennen. Auf der Bank neben den drei Frauen saß ein junges Paar mit zwei kleinen Kindern. Die Familie war ganz mit sich selbst beschäftigt.
»Ich habe Sie gar nicht an Bord gesehen, Jackie«, sagte Tess, die rechts von Jacqueline saß.
»Ich möchte Jacqueline genannt werden, wenn es Ihnen nichts ausmacht.«
»Oh, entschuldigen Sie«, sagte Tess ein wenig verlegen. »Es ist nur so ein langer Name, finden Sie nicht?«
»Nein, eigentlich nicht«, erwiderte Jacqueline. »Sie haben mich auf dem Schiff wahrscheinlich deshalb nicht gesehen, weil ich fürchterlich seekrank war und meine Kabine so gut wie nie verlassen habe. Es ist ein wunderbares Gefühl, endlich wieder festen Boden unter den Füßen zu spüren«, fügte sie seufzend hinzu. Verstohlen wischte sie sich eine Träne aus dem Augenwinkel. »Sie müssen entschuldigen, dass ich mich so merkwürdig benehme. Das passt eigentlich gar nicht zu mir, aber im Moment bin ich vollkommen mit den Nerven fertig.«
»Sie haben allen Grund dazu, wie mir scheint«, meinte Vera mitfühlend.
»Eigentlich geht es ja niemanden etwas an, dass mein Mann mich auf dem Schiff betrogen hat, während ich so krank war. Aber dieser Mensch am Schalter hat mich derart bedrängt, dass ich keine andere Wahl hatte, als ihm die Wahrheit zu sagen. Mich vor allen Leuten so zu demütigen!«
Schluchzend hielt Jacqueline sich ihr Taschentuch vors Gesicht. Das junge Paar auf der Bank nebenan hatte mitgehört und bedachte sie jetzt mit einem befremdlichen Blick.
»Ihr Mann scheint ja ein schöner Mistkerl zu sein«, bemerkte Tess.
»Ob Sie’s glauben oder nicht, aber er war ein guter Ehemann«, räumte Jacqueline schniefend ein. »Ich hätte niemals gedacht, dass er mich betrügen würde.«
»Ich will ja nicht neugierig sein, aber haben Sie Kinder?«, fragte Vera.
»Nein.« Jacqueline schüttelte den Kopf. Wie war es möglich, dass sie nicht bemerkt hatte, wie sehr Henry sich eine Familie wünschte?
»Seien Sie froh«, tröstete Vera. »Wenn Kinder da sind, ist eine Scheidung immer schwierig.« Sie dachte an ihre eigene Kindheit zurück. »Ich war zehn, als meine Eltern sich scheiden ließen, und das hat mich geprägt.«
»Ich kann keine Kinder bekommen«, gestand Jacqueline leise. »Deshalb hat Henry mich wegen einer anderen verlassen. Das hat er zumindest gesagt.«