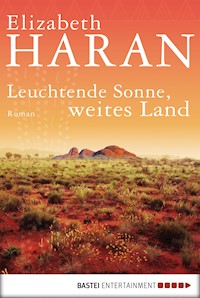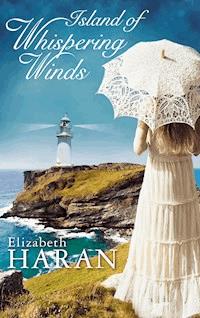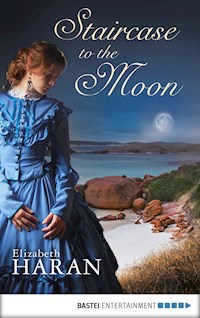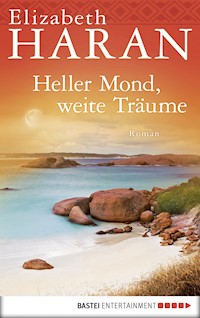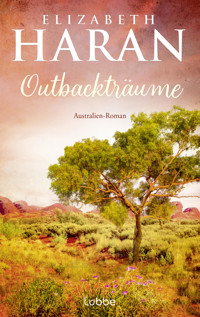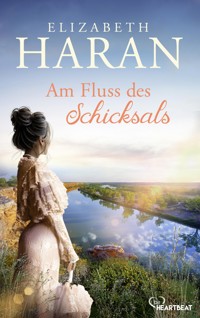7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Große Emotionen, weites Land - Die Australien-Romane von Elizabeth Haran
- Sprache: Deutsch
Ein fesselnder Australienroman über eine junge Frau und ihre Suche nach dem Glück.
Südaustralien, 1866: Die junge Abigail wird gegen ihren Willen mit einem reichen, alten Landbesitzer verheiratet. Doch noch in der Hochzeitsnacht wird Abbey Witwe ... Unter Schock flieht sie und findet Unterschlupf bei Jack Hawker, der für seine Mutter eine Gesellschaftsdame sucht, um ihr das Leben auf seiner abgelegenen Farm erträglicher zu machen. Aber schon bald wird Abbey vom Sohn ihres toten Gatten aufgespürt. Um an das Vermögen und den Landbesitz seines verhassten Vaters zu kommen, umwirbt er Abbey, die seinem Charme nicht widerstehen kann ... Wird Abbey das durchtriebene Spiel noch rechtzeitig durchschauen?
»Ein sehr unterhaltsames Buch, die Landschaftsbeschreibungen sind fantastisch und die Charaktere sind sehr gelungen!« Radio Euroherz, Hof
Lass dich von Elizabeth Haran in die Weiten Australiens entführen: zu riesigen Schaffarmen und mystischen Aborigines-Zeremonien!
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 734
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhalt
CoverGrußwort des VerlagsÜber dieses BuchTitelWidmungKapitel 1Kapitel 2Kapitel 3Kapitel 4Kapitel 5Kapitel 6Kapitel 7Kapitel 8Kapitel 9Kapitel 10Kapitel 11Kapitel 12Kapitel 13Kapitel 14Kapitel 15Kapitel 16Kapitel 17Kapitel 18Kapitel 19Kapitel 20Kapitel 21Kapitel 22Kapitel 23Kapitel 24Kapitel 25Kapitel 26Kapitel 27Kapitel 28Kapitel 29DanksagungÜber die AutorinWeitere Titel der AutorinImpressumLiebe Leserin, lieber Leser,
herzlichen Dank, dass du dich für ein Buch von beHEARTBEAT entschieden hast. Die Bücher in unserem Programm haben wir mit viel Liebe ausgewählt und mit Leidenschaft lektoriert. Denn wir möchten, dass du bei jedem beHEARTBEAT-Buch dieses unbeschreibliche Herzklopfen verspürst.
Wir freuen uns, wenn du Teil der beHEARTBEAT-Community werden möchtest und deine Liebe fürs Lesen mit uns und anderen Leserinnen und Lesern teilst. Du findest uns unter be-heartbeat.de oder auf Instagram und Facebook.
Du möchtest nie wieder neue Bücher aus unserem Programm, Gewinnspiele und Preis-Aktionen verpassen? Dann melde dich für unseren kostenlosen Newsletter an: be-heartbeat.de/newsletter
Viel Freude beim Lesen und Verlieben!
Dein beHEARTBEAT-Team
Melde dich hier für unseren Newsletter an:
Über dieses Buch
Südaustralien, 1866: Die junge Abigail wird gegen ihren Willen mit einem reichen, alten Landbesitzer verheiratet. Doch noch in der Hochzeitsnacht wird Abbey Witwe … Unter Schock flieht sie und findet Unterschlupf bei Jack Hawker, der für seine Mutter eine Gesellschaftsdame sucht, um ihr das Leben auf seiner abgelegenen Farm erträglicher zu machen. Aber schon bald wird Abbey vom Sohn ihres toten Gatten aufgespürt. Um an das Vermögen und den Landbesitz seines verhassten Vaters zu kommen, umwirbt er Abbey, die seinem Charme nicht widerstehen kann … Wird Abbey das durchtriebene Spiel noch rechtzeitig durchschauen?
eBooks von beHEARTBEAT – Herzklopfen garantiert.
E L I Z A B E T H
HARAN
Der Duft derEukalyptusblüte
Aus dem australischen Englisch von Sylvia Strasser
Im Gedenken an die verstorbene Edda Merz – ich fühle mich aufrichtig geehrt, dass sie mich ihre Lieblingsautorin genannt hat.
1
South Australia,Ende November 1866
Von der Blyth Street aus sah das ausgetrocknete Flussbett, das sich durch Burra schlängelte, wie jedes andere aus. Erst bei näherem Hinsehen konnte man den Rauch von Eukalyptusholzfeuern erkennen, der aus unzähligen Löchern entlang des Ufers aufstieg. Die Öffnungen dienten als Rauchabzug für die vielen hundert Erdwohnungen in den Uferböschungen des knapp hundert Meilen von Adelaide entfernten Bergwerksstädtchens Burra im Gilbert Valley, in denen um die zweitausend Menschen hausten.
Die Sonne ging unter an diesem außergewöhnlich heißen Novembertag. Kein Lüftchen regte sich, und über dem Flussbett, in dem sich seit Monaten kein Wasser mehr befand, sondern nur noch unverwüstliches Unkraut im Staub wucherte, hing ein stechender Gestank nach Fäkalien und Abfall.
Während die Frauen in den Erdwohnungen sich anschickten, ein einfaches Abendessen zuzubereiten, war ihnen bewusst, dass etwas Unheilvolles über der Creek Street, wie das Flussbett genannt wurde, lag. Plötzlich zerriss ein unheimlicher, herzerweichender Schrei, der einem das Blut in den Adern gefrieren ließ, die angespannte Stille. Alle erstarrten. Eine Sekunde später erhob sich lautes Wehklagen.
Tränen kullerten über Abbey Scottsdales sonnengebräunte Wangen. Sie trat aus der zwei Räume umfassenden Behausung, die sie mit ihrem Vater teilte, auf die Straße hinaus, wo sich bereits etliche Frauen versammelt hatten. Wie Bäume in einem engen Tal, stumme, statuenhafte Wächter, sahen sie in der hereinbrechenden Dämmerung aus.
Alle wussten, was die herzzerreißenden Schreie bedeuteten: Der kleine Ely Dugan hatte den Kampf gegen den Typhus verloren. Ihre Gebete waren umsonst gewesen. Der schmächtige Vierjährige hatte keine Chance gehabt. Das gramerfüllte Klagen und Schluchzen seiner Mutter brach den draußen Versammelten beinah das Herz.
Obwohl Abbey mit ihren achtzehn Jahren weder Ehefrau noch Mutter war, konnte sie Evelyn Dugans Schmerz nachempfinden. Die arme Frau hatte vor nicht einmal einem Jahr bereits einen Sohn verloren. Damals waren in der Creek Street fast dreißig Kinder an Typhus, Pocken und Fleckfieber gestorben. Jedes Kind, das ums Leben kam, erinnerte Abbey an ihre persönlichen Verluste. Sie selbst war 1848 in Irland geboren worden. Ein gutes Jahr später war ihr Bruder Liam auf die Welt gekommen, und eineinhalb Jahre später hatte sie noch eine Schwester, Eileen, bekommen. Als Abbey fünf Jahre alt war, wurde Liam von den Pocken dahingerafft. Ein Jahr später erkrankte Eileen so schwer an Keuchhusten, dass sie die Krankheit nicht überlebte. Und 1860 starb Mary, ihre Mutter, im Alter von nur neunundzwanzig Jahren an Diphtherie.
Die unhygienischen Verhältnisse in der Creek Street waren ein idealer Nährboden für allerlei Krankheiten. Doch die Bergleute, die mit ihren Familien hierhergekommen waren, um in der Monster Mine zu arbeiten, hatten keine andere Wahl, als in den mit Balken gestützten, höhlenähnlichen Erdwohnungen zu hausen. Im Sommer war es drinnen zwar angenehm kühl, im Winter jedoch feucht, schlammig und bitterkalt. Oft genug führte der Fluss dann so viel Wasser, dass die Bewohner ihre Behausungen verlassen mussten.
Abbey wischte sich die Tränen ab und ging in ihre Wohnung zurück. Sie steckte sich die langen schwarzen Haare hoch und rührte nachdenklich die Suppe um, die sie aus einem ausgekochten geräucherten Schinkenknochen zubereitet hatte. Die junge Frau fragte sich, warum sie vom Typhus oder einer anderen Krankheit verschont worden war und ein unschuldiges Kind wie Ely nicht. Sie verstand das einfach nicht.
Abbey wartete auf ihren Vater, der wie jeden Donnerstagabend im Miner’s Arms Hotel mit seinen irischen Freunden zechte. Donnerstag war nämlich Zahltag. Abbey hatte nichts gegen diese Wirtshausbesuche einzuwenden, weil sie dadurch eine Stunde mit Neal Tavis allein sein konnte. Dass ihr Vater aber auch samstagnachmittags nicht auf direktem Weg von der Arbeit nach Hause kam, sondern einen Abstecher in seine Kneipe machte, nahm sie ihm übel.
Neal, der junge Mann, in den sich Abbey verliebt hatte, war achtzehn Jahre alt wie sie selbst und arbeitete Seite an Seite mit ihrem Vater in einhundertsechzig Meter Tiefe in der Kupfermine. Samstags verdingte er sich zusätzlich auf einer Farm, um etwas dazuzuverdienen. Da er von Finlay Scottsdales Kneipenbesuchen wusste, eilte er jeden Donnerstag von der Zeche nach Hause, wusch sich und ging dann schnurstracks zu Abbey. Er wollte Finlay nicht unbedingt aus dem Weg gehen, aber dieser hatte keinen Zweifel daran gelassen, dass er sich für seine Tochter einen wohlhabenden Ehemann wünschte, dass sie in seinen Augen etwas Besseres verdient hatte als einen Minenarbeiter, der in einer Erdwohnung hauste.
Doch Abbey und Neal hatten einen Plan. Neal hoffte, Finlay werde seine Meinung ändern, wenn er sich ein Stück Land kaufen und beweisen könnte, wie zuverlässig und fleißig er war, deshalb sparte er jeden Penny, den er erübrigen konnte. Einfach war das allerdings nicht, weil er seine Mutter Meg und seine beiden Schwestern, die Zwillinge Emily und Amy, die noch zur Schule gingen, unterstützen musste. Sie alle wohnten eine knappe Meile von den Scottsdales entfernt auf der anderen Seite der Creek Street.
Eine Stunde war vergangen, als ein vertrautes Pfeifen die gedrückte Stille durchbrach, die sich nach dem Tod des kleinen Ely über die Siedlung gelegt hatte. Finlay, betrunken und nichts ahnend von dem Unglück, das sich ereignet hatte, schwankte nach Hause. Abbey lauschte angestrengt. Sie erkannte meist schon an dem Lied, das er pfiff, wie viel er getrunken hatte und in welcher Stimmung er folglich sein würde. Abbey nahm es ihrem Vater übel, dass er so viel Geld für Alkohol und Wetten ausgab und sein Ziel, ein besseres Leben für sie beide zu erreichen, dadurch in weite Ferne rückte. Nach zwei oder drei Bier war er zuversichtlich, dass sich bald alles zum Besseren wenden würde, doch es blieb nur selten bei zwei oder drei Bier. Nach vier oder fünf Gläsern wurde Finlay schwermütig oder patriotisch, und hatte er noch mehr getrunken, war er übelster Laune und sah alles schwarz. Abbey hasste es, wenn er so war, aber da sie ihn nicht ändern konnte, wie sie mittlerweile eingesehen hatte, tröstete sie sich mit der Vorfreude auf ihre gemeinsame Zukunft mit Neal.
An diesem Abend jedoch war Finlay guter Dinge. Abbey merkte es daran, dass er Brian Boru’s March pfiff. War er sinnlos betrunken, bevorzugte er The Lamentation of Deirdre. Das war ein Lieblingslied ihrer Mutter gewesen. Abbey graute es vor dieser Melodie, weil sie bedeutete, dass ihr Vater in Weltuntergangsstimmung war.
»Abigail, mein Engelchen!«, begrüßte Finlay seine Tochter fröhlich, als er durch die niedrige Tür eintrat. »Was hast du uns denn heute Abend Gutes zu essen gemacht?«
Abbey, die auf dem Boden aus gestampfter Erde saß, blickte nur flüchtig auf. »Nicht so laut, Vater! Der kleine Ely ist gestorben.«
Finlay machte ein bestürztes Gesicht. »Das ist eine schlimme Nachricht«, brummte er. »Er war ein feiner kleiner Kerl.«
»Ja, das war er«, murmelte Abbey traurig, als sie sich seinen roten Lockenkopf und sein spitzbübisches Lächeln ins Gedächtnis rief. Einen kleinen Kobold hatte sie ihn immer genannt. An ihre eigenen Geschwister konnte sie sich zu ihrem Bedauern kaum noch erinnern, aber sie würde niemals die Tränen vergessen, die ihre Mutter so oft vergossen hatte.
Abbey schniefte und kämpfte gegen die tiefe Rührung an, die sie verspürte. »Hast du Evelyn denn nicht weinen hören, als du bei den Dugans vorbeigegangen bist?«
Finlay schüttelte den Kopf. »Nein.« Er wollte sich hinsetzen, verlor aber das Gleichgewicht und fiel wie ein nasser Sack zu Boden. Ächzend drehte er sich um und stieß dabei mit dem Fuß in die Feuerstelle. Asche wirbelte auf. Finlay lachte leise in sich hinein.
Abbey, die ihn viele Male in diesem Zustand gesehen hatte, war nicht beunruhigt. Sie schnalzte nur missbilligend mit der Zunge, so wie ihre Mutter es immer getan hatte, wenn sie sich über Finlay geärgert hatte. Ihr Vater nahm ihr das nicht übel, im Gegenteil: Er fand es auf seltsame Weise tröstlich, dass sie ihn oft zurechtwies wie eine Ehefrau.
»Wir haben etwas zu feiern, Abbey«, sagte er und lächelte.
»So? Was denn?« Abbey schöpfte ihm Suppe in einen tiefen Teller und brach ein Stück von dem Fladenbrot ab, das sie gebacken hatte. Eine gute Nachricht wäre eine willkommene Abwechslung.
»Wir beide sind kommenden Samstagabend zum Essen nach Martindale Hall eingeladen«, antwortete Finlay aufgeregt.
Abbey starrte ihren Vater über das Feuer hinweg an. Verblüffung zeigte sich auf ihrem hübschen Gesicht. »Nach Martindale Hall? Wieso hat man uns dorthin eingeladen?« Sie wusste, dass Ebenezer Mason, der Eigentümer der Mine, nichts als Verachtung für seine Arbeiter übrighatte, deshalb wunderte sie sich über diese Einladung in sein Herrenhaus in Mintaro. Die wenigen, die es gesehen hatten, beschrieben es als protzig und palastähnlich. Noch mehr aber erstaunte sie, dass ihr Vater die Einladung angenommen hatte, stand Mr. Mason doch in dem Ruf, auf die Arbeiterklasse herabzusehen und seine Untergebenen skrupellos auszubeuten.
Finlay wählte seine nächsten Worte mit Bedacht. »Nun, zum Abendessen, wie ich schon sagte. Und ich wette, dass ein Festschmaus auf uns warten wird, vielleicht eine gebratene Lammkeule mit allem, was dazugehört. Das wär doch mal was, Abbey, hm?« Er leckte sich in gieriger Vorfreude die Lippen. »Ich hoffe nur, Ebenezer Mason hat genug Bier im Haus. Diese stinkvornehmen Weine sind nichts für mich.«
»Dad, ich verstehe das nicht! Ich dachte, du hältst nicht viel von Mr. Mason.« Abbey sah ihren Vater misstrauisch an. Wie oft hatte er über den Minenbesitzer geschimpft, weil dieser als Geizkragen bekannt war und seine Knickerigkeit das Leben der Bergleute gefährdete.
»Ja, das war auch so«, antwortete Finlay nachdenklich.
»Und jetzt hast du deine Meinung geändert?« Abbey war verwirrt, weil sie nicht verstand, was auf einmal anders geworden war.
»Ich habe diesen Mann in den letzten Wochen näher kennen gelernt, Abbey, und heute schäme ich mich dafür, dass ich so hart über ihn geurteilt habe.«
»Ich dachte, du hättest allen Grund, ihn zu hassen.«
Finlay nickte. »Ja, das dachte ich auch.« Abbeys Vater klang müde. Er brach ein Stück Brot ab und begann, geräuschvoll seine Suppe zu schlürfen.
Abbey verzog schmerzlich das Gesicht bei dem Gedanken daran, dass er im vornehmen Speisezimmer von Martindale Hall genauso schlürfen und schmatzen würde.
»Wir müssen an deine Zukunft denken, Abbey«, fuhr Finlay unvermittelt fort.
»Meine Zukunft?«, wiederholte die junge Frau verdutzt. »Was hat das mit der Einladung nach Martindale Hall zu tun?« Ein Gedanke durchzuckte sie, und sie wurde unwillkürlich rot, als sie begriff, was ihr Vater möglicherweise im Schilde führte. Sie kannte seine Anspielungen auf potenzielle Ehemänner, auf Männer, die seiner Ansicht nach die richtigen für sie waren, wie der Sohn des Bürgermeisters oder der Direktor des Royal Exchange Hotel. Einmal hatte Finlay sogar versucht, sie mit dem Polizeichef, einem Mann Ende dreißig, zu verkuppeln. Abbey war das furchtbar peinlich, weil all diese Männer ihrer Meinung nach entweder zu alt oder höherrangig waren. Ihr Vater glaubte doch wohl nicht, Ebenezer Masons Sohn könnte an ihr interessiert sein?
Doch dann fiel ihr ein, dass sie gehört hatte, der Sohn wohne nicht im Herrenhaus, sondern in einem kleinen Cottage irgendwo auf dem riesengroßen Gutsbesitz. Nach einer Auseinandersetzung wegen Ebenezers kurzer Ehe mit einer viel jüngeren Frau, so erzählten die Leute, war der Kontakt zwischen Vater und Sohn mehr oder weniger abgerissen. Aber niemand wusste etwas Genaues. Freunde hatten Abbey seine Kutsche gezeigt, wenn er, was selten vorkam, einmal durch Burra fuhr, aber gesehen hatte sie ihn nie.
»Ebenezer Mason möchte dich gern kennen lernen, Abbey«, sagte Finlay. Der Ausdruck von Missfallen und Verwunderung auf ihrem Gesicht entging ihm nicht, und er unterdrückte einen gereizten Seufzer. Der mangelnde Ehrgeiz seiner Tochter, einen Ehemann zu finden, der ihr ein angenehmes Leben bieten konnte, hatte ihn immer schon verdrossen.
Natürlich war Finlay voreingenommen, aber seiner Meinung nach konnte sich jeder Mann glücklich schätzen, eine Schönheit wie Abbey zur Frau zu bekommen. Allerdings war ihm nicht jeder gut genug für sie. Abbey war zwar ein bisschen dünn, genau wie ihre Mutter vor der Geburt ihrer Kinder, aber ihre langen, welligen Haare schimmerten wie Kohle in der Sonne, und ihre Augen waren so blau wie das Meer.
»Ich glaube, er hat ein Auge auf dich geworfen«, fügte er hinzu. In Wirklichkeit glaubte er es nicht nur, er wusste es, aber das wollte er seiner naiven Tochter möglichst schonend beibringen.
»Was?« Jetzt bekam es Abbey mit der Angst zu tun. »Aber … aber Mr. Mason ist ein alter Mann! Er muss doch in deinem Alter sein, Dad!« Ihr schauderte bei dem Gedanken an irgendetwas Romantisches zwischen ihnen. Sie konnte es nicht fassen, dass ihr Vater allen Ernstes glaubte, sie könnte einen Mann seines Alters als geeigneten Verehrer betrachten.
»Alt« war für eine blutjunge Achtzehnjährige wie Abbey jeder über dreißig. Ebenezer Mason war dreiundfünfzig, nur fünf Jahre jünger als ihr Vater, der relativ spät geheiratet hatte: Er war vierzig gewesen, Mary, seine Braut, knapp siebzehn. In County Sligo, wo Finlays Familie herstammte, war eine Eheschließung zwischen einer Halbwüchsigen und einem Mann jenseits der Vierzig nicht ungewöhnlich, in Australien dagegen schon.
»Das ist doch gar nicht wahr!«, brauste Finlay auf. »Er ist doch nicht so alt wie ich! Jedenfalls nicht ganz«, fügte er friedlicher hinzu. Das Bild, das er in diesem Moment vor seinem inneren Auge sah, schob er ebenso hastig beiseite wie seine Gewissensbisse. Er musste an Abbeys Zukunft denken, nur darauf kam es an. »Mr. Mason ist ein reifer Mann und obendrein ein sehr wohlhabender. Das heißt, du könntest eines Tages eine reiche Witwe sein.«
»Wie kannst du nur so etwas Furchtbares sagen, Dad!«, entgegnete Abbey ärgerlich. »Außerdem glaube ich, dass du dir etwas vormachst. Wieso sollte sich Mr. Mason für ein Mädchen aus der Bergarbeitersiedlung interessieren?«
»Ich werde dir jetzt etwas verraten, was nicht viele wissen: Mr. Mason war früher selbst Bergmann.«
Abbey riss erstaunt die Augen auf. Wie alle hier hatte sie immer gedacht, Ebenezer Mason sei in einer adligen Familie in England mit einem goldenen Löffel im Mund geboren worden.
»Da staunst du, was?« Finlay nickte bekräftigend. »Ja, auch er ist mal ein armer Schlucker gewesen. Bis er sich in Victoria als Goldgräber versuchte. Anfang der 1850er-Jahre stieß er in Peg Leg Gully auf ein reiches Vorkommen. So machte er sein Vermögen. Alles in allem wurden dort dreihundertvierundzwanzig Pfund Gold geschürft, ein großer Teil davon von Ebenezer und seinen Kumpels. Kannst du dir das vorstellen? Dreihundertvierundzwanzig Pfund!«, wiederholte Finlay verträumt. Seine irischen Zechkumpane hatten nicht schlecht gestaunt, als er ihnen davon erzählt hatte. Dann hörte er, wie der Wirt raunte, Ebenezer Mason hätte seine beiden Partner um ihren Anteil betrogen. Doch Finlay gab nichts darauf, er vermutete, dass Neid hinter diesen Gerüchten steckte. »Ein Mann, der so hart arbeiten kann, hat Respekt verdient. Und wenn er das Glück hatte, eine große Goldmenge zu finden – nun, dann sei es ihm gegönnt, meine ich.«
»Woher weißt du, dass diese Geschichte wahr ist, Dad?«, fragte Abbey zweifelnd. Ihrer Ansicht nach klang das alles ein bisschen weit hergeholt.
»Er hat sie mir selbst erzählt! Wir haben uns in letzter Zeit einige Male lange unterhalten.« Finlay starrte ins Feuer. In den vergangenen zwei Wochen hatte er eine Menge über Ebenezer Mason erfahren. Anfangs war er schon misstrauisch gewesen, als der Bergwerkseigner ihn auf einen Drink einlud, um ihn näher kennen zu lernen. Doch Ebenezer Mason hatte keinen Hehl aus seinen Beweggründen gemacht, und Finlay fand das sehr anständig. Er war genauso offen gewesen und hatte Ebenezer erklärt, seine Abbey sei ein tugendhaftes Mädchen, und er werde sich auf nichts einlassen, wenn er, Ebenezer, keine ehrlichen Absichten hätte. Nachdem der Minenbesitzer ihm jedoch glaubhaft versichert hatte, dass das der Fall sei, waren Finlays Zweifel ausgeräumt, und die beiden Männer hatten sich des Öfteren auf ein Glas getroffen.
»Ach ja?«, meinte Abbey, die der Sache nicht so recht traute. Sie konnte sich nur schwer vorstellen, dass Mr. Mason mit seinen blütenweißen Hemden und den polierten Lacklederschuhen einmal Bergmann gewesen war und sich die Hände schmutzig gemacht hatte. Ihr Vater hingegen schien nicht an dieser Geschichte zu zweifeln.
»Wenn ich es dir sage«, bekräftigte Finlay. »Eine Mine zu besitzen bedeutet eine Menge Verantwortung und Sorgen. Ich habe nie viel darüber nachgedacht, aber Mr. Mason hat mir die Augen geöffnet, und jetzt sehe ich ihn in einem ganz anderen Licht.«
Abbey schnaubte verächtlich. »Er tut nichts anderes, als sein Geld zu zählen! Die Sorge hätte ich auch gerne.«
»Er muss nicht selten zählen, wie viel er verloren hat«, erwiderte Finlay ernsthaft. »Weißt du noch, als letztes Jahr vierhundert Männer entlassen worden sind?«
Abbey nickte. Wie hätte sie das vergessen können! Das war ein schwerer Schlag für die Stadt gewesen, und die Stimmung in der Bergarbeitersiedlung hatte sich auf einem absoluten Tiefstand befunden.
»Mr. Mason war gar nichts anderes übrig geblieben, weil die Mine vertieft werden musste und die Kosten für die Kupfergewinnung dadurch gestiegen sind. Und kaum hatte er in die Mine investiert, sind die Kupferpreise gefallen. Das sind schwere Entscheidungen, die er da Tag für Tag treffen muss.«
»Hast du nicht immer gesagt, ihn interessiert nur der Profit und nicht das Wohl seiner Arbeiter?«
»Das habe ich bis vor kurzem auch geglaubt. Das leugne ich gar nicht. Aber ich habe mich geirrt. Er hat mir selbst gesagt, dass er nachts aus Sorge um seine Arbeiter und ihre Familien oft nicht schlafen kann, und ich habe das Gefühl, er meint es ehrlich. Du hast Recht, ich habe ihn für einen Blutsauger gehalten, aber ich muss zugeben, dass er jedes Mal, wenn die Kupferpreise wieder gestiegen sind, auch wieder Leute eingestellt hat.«
In seinen Unterhaltungen mit dem Minenbesitzer hatte Finlay die Befürchtung geäußert, er werde jetzt, wo die Kupferpreise auf acht Pfund pro Tonne gesunken waren, vielleicht seine Arbeit verlieren, doch Ebenezer hatte ihn beruhigt: Das werde auf keinen Fall geschehen.
»Ich freue mich für dich, dass du in Mr. Mason einen Freund gefunden hast, Dad«, sagte Abbey und fuhr dann entschlossen fort: »Aber ich liebe Neal Tavis, und eines Tages werden wir heiraten.«
Das hörte Finlay gar nicht gern. Er hatte seiner Tochter bereits unmissverständlich erklärt, dass er nichts von der Liebelei zwischen den beiden hielt, und geglaubt, die Angelegenheit sei damit erledigt. Aber Abbey fand, es war höchste Zeit, dass er sich an den Gedanken gewöhnte, dass sie sich ihren Ehemann selbst aussuchen und aus Liebe heiraten würde und nicht um finanzieller Sicherheit willen.
»Ich weiß, das passt dir nicht«, fügte sie hinzu, als sie seinen Gesichtsausdruck sah, »aber ich werde auf keinen Fall einen alten Mann nur des Geldes wegen heiraten.«
»Und ich werde nicht zulassen, dass meine Tochter einen Mann heiratet, der sein Leben lang ein armer Schlucker bleiben wird«, brauste Finlay auf. »Du sollst es einmal besser haben und dein Leben nicht in einer Erdwohnung verbringen müssen!«
»Neal spart, um eines Tages eine Farm kaufen zu können, Dad. Wir werden ein schönes Zuhause haben, du wirst sehen.«
Finlay schüttelte den Kopf. Schmerzliche Erinnerungen stiegen in ihm empor. »Weißt du nicht mehr, wie hart das Leben auf einer Farm sein kann, Abbey? Und dann sind da noch die Mutter und die Schwestern, für die Neal sorgen muss. Das ist kein guter Anfang für eine Ehe.«
Abbey erwiderte nichts darauf, aber auch sie erinnerte sich an etwas. Nach dem Tod ihrer Mutter war ihr Vater schwermütig und lebensüberdrüssig geworden. Er hatte erst zwei Kinder, dann seine Frau verloren, wozu also noch weiterleben? Morgens konnte er sich kaum noch aus dem Bett aufraffen, und wenn doch, dann nur, um sich zu betrinken. Es dauerte nicht lange, bis sie die Farm, die sie gepachtet hatten, verloren. Finlays Schwester Brigit, die mit Mann und fünf Kindern auf einer Farm in Galway lebte, nahm die beiden bei sich auf. Dort lebten sie knapp drei Jahre lang auf engstem Raum, unter unerträglichen Bedingungen. Als Brigit hörte, dass in Australien Bergleute gesucht wurden, drängte sie Finlay, sein Glück dort zu versuchen, und so brach er mit Abbey auf, um in den Kolonien ein neues Leben zu beginnen.
Bei ihrer Ankunft war Finlay zuversichtlich gewesen, mit dem Geld, das er in den Minen verdienen würde, bald ein hübsches Häuschen in der Stadt für sich und seine Tochter kaufen, vielleicht sogar einen kleinen Laden eröffnen zu können. Doch es war nicht so gelaufen, wie er sich das vorgestellt hatte. Die Arbeit in den Minen war äußerst kraftraubend, gefährlich und obendrein schlecht bezahlt. Und die wenigen Häuser in der Stadt reichten nicht aus für die zahlreichen Arbeitssuchenden, die hierher geströmt waren. Finlay begann schon nach kurzer Zeit zu resignieren und Trost im Alkohol und im Glücksspiel zu suchen, sodass auch das wenige Geld, das er auf die Seite hätte legen können, im Nu aufgebraucht war.
»Ich will nicht, dass meine Tochter Schweine- und Hühnerställe ausmisten und in einem Land, wo jahrelange Dürren keine Seltenheit sind, verzweifelt auf Regen warten muss«, fuhr Finlay bitter fort. »Das Leben auf einer Farm ist verdammt beschwerlich, wenn man kein Geld hat, um harte Zeiten überstehen zu können. Ich will, dass du einen Mann heiratest, der besser für dich sorgt, als ich für deine Mutter gesorgt habe.«
»Du hast dein Möglichstes getan, Dad. Die schlechte Kartoffelernte und die Hungersnot waren schließlich nicht deine Schuld«, sagte Abbey besänftigend.
»Das vielleicht nicht, aber wenn du die Wahl zwischen einem harten und einem angenehmen Leben hast, wärst du schön dumm, dich für das falsche zu entscheiden. Wer das Glück hat, ein so hübsches Gesicht zu haben, sollte das Beste daraus machen, Abbey.«
Wollte er ihr damit zu verstehen geben, sie sollte ihr Aussehen benutzen, um sich einen reichen Mann zu angeln? Sie war regelrecht entsetzt über seine Worte, und Finlay sah es ihr an.
»Ist es denn so falsch, wenn ich mir für meine Tochter ein leichteres Leben wünsche?«, fuhr er ärgerlich auf.
»Nein, Dad, aber du musst mich schon selbst über mein Leben entscheiden lassen«, erwiderte Abbey ruhig.
»Das kann ich aber nicht, weil ich deinen Entscheidungen nicht vertrauen kann. Nicht, wenn du dich in den Erstbesten verliebst, der dich ansieht. Und der obendrein ein Habenichts ist.«
Empört über diese Bemerkung entgegnete Abbey hitzig: »Neal ist ein wundervoller junger Mann, und er macht mich glücklich.«
»Glücklich kann man auf die unterschiedlichsten Arten sein, Abbey. Sollte Mr. Mason dich heiraten wollen, dann wirst du ihn nicht zurückweisen. Eines Tages, wenn du schöne Kleider tragen und Gäste in einem vornehmen Salon auf Martindale Hall empfangen wirst, wirst du mir dankbar sein.«
»O nein, ganz bestimmt nicht! Ich werde mich auf gar keinen Fall mit einem Scheusal wie Ebenezer Mason ins Ehebett legen, und wenn er noch so reich ist! Wie kann mein eigener Vater so etwas von mir verlangen?« Abbey war außer sich.
»Es ist besser, eine Dienerin zu haben, als Dienerin zu sein, Abbey. Du wirst mich nach Martindale Hall begleiten, und jetzt will ich kein Wort mehr davon hören!«, knurrte Finlay.
»Lieber bin ich arm und kratze Seite an Seite mit dem Mann, den ich liebe, im Dreck, als dass ich ein Leben lang unglücklich bin, nur damit ich mich bedienen lassen kann«, gab Abbey wütend zurück.
»Du redest Unsinn, Mädchen«, erwiderte Finlay gähnend. Es war ein langer Tag gewesen, und das Bier, das er in der Kneipe getrunken hatte, machte ihn zusätzlich müde. Ihm fielen fast die Augen zu.
Abbey sprang auf und lief nach draußen. Sie solle sich gefälligst etwas Hübsches zum Anziehen kaufen für die Einladung ins Herrenhaus, rief Finlay ihr nach. Abbey antwortete nicht. Mit Tränen in den Augen eilte sie die Creek Street hinunter zu der Erdwohnung, in der Neal mit seiner Mutter und seinen Schwestern lebte.
Sein Vater war zwei Wochen nach ihrer Ankunft in Burra ganz plötzlich gestorben, vermutlich an einem Herzanfall, und hatte die Familie mittellos zurückgelassen. Das war ein schwerer Schlag gewesen, zumal Neals Mutter Meg von schwacher Konstitution und oft krank war. Neal war noch keine fünfzehn Jahre alt gewesen, als er sich Arbeit in der Kupfermine suchen musste. Fühlte sie sich kräftig genug, verdiente Meg in einer Wäscherei in Burra zwar ein paar Shilling dazu, aber ohne Neals Lohn wäre die Familie nicht in der Lage gewesen zu überleben.
Als er Abbey rufen hörte, kam Neal heraus. Er war stämmig und nicht sehr groß, sein rotblondes, leicht gelocktes Haar rahmte ein jungenhaftes Gesicht ein. Neal strahlte Ruhe und Sanftmut aus.
»Abbey! Was hast du denn?«
Sie warf sich in seine Arme und klammerte sich an ihn. Die junge Frau brachte es nicht übers Herz, Neal von den Plänen ihres Vaters zu erzählen, so sehr schämte sie sich bei dem Gedanken daran, was er von ihr verlangte.
Neal spürte, wie sie schauderte, ohne zu ahnen, dass Abscheu der Grund dafür war. »Was ist denn passiert, Abbey?«, drängte er sanft. Er löste sich von ihr und hielt sie auf Armeslänge von sich, um ihr ins Gesicht sehen zu können. Im Mondlicht schimmerte es feucht von Tränen.
Abbey blickte in seine warmen braunen Augen und fühlte sich getröstet. Sie würde ihm nicht sagen, dass ihr Vater niemals mit einer Hochzeit zwischen ihnen einverstanden wäre, damit würde sie ihm nur wehtun. »Der kleine Ely Dugan ist gestorben«, sagte sie stattdessen. Wieder kamen ihr die Tränen.
»O Gott, Abbey, das tut mir so leid! Ich weiß doch, wie sehr er dir ans Herz gewachsen war.«
Abbey nickte. »Lass uns von hier fortgehen, Neal!«, brach es unvermittelt aus ihr hervor. »Warum laufen wir nicht heimlich weg und heiraten?« Sie sah ihn flehentlich an.
Neal machte ein erschrockenes Gesicht und schaute sich verstohlen um. Sie standen direkt vor dem Eingang zu der Wohnung, in der sich seine Mutter und seine Schwestern aufhielten. Er nahm Abbey bei der Hand, und sie gingen ein Stück das Flussbett hinunter. »Du weißt, dass ich dich liebe und dich heiraten will, Abbey, aber ich kann nicht einfach abhauen und meine Mom und meine Schwestern sich selbst überlassen. Sie brauchen mich doch!«
Abbey wusste, er hatte Recht, sie respektierte sein Verantwortungsbewusstsein und seine Zuverlässigkeit. Es gab so viel an Neal, das sie liebte, und ein ausgesprochen gut aussehender Mann war er in ihren Augen obendrein. Natürlich hatte sie nicht vergessen, dass ihm die Hände gebunden waren und er seit dem Tod seines Vaters drei Jahre zuvor für seine Mutter und seine Schwestern sorgen musste. »Dann lass uns doch heiraten und hierbleiben, bis wir es uns leisten können wegzuziehen.« Das wäre sicherlich nicht die beste Lösung, aber alles war besser, als mit Ebenezer Mason verheiratet zu werden.
»Abbey, ist irgendetwas passiert?« Neal sah sie eindringlich an. »Ich würde ja gern glauben, dass du es kaum erwarten kannst, die Freuden der Ehe mit mir zu teilen, aber ich habe das Gefühl, da steckt etwas anderes dahinter.« Er lächelte, und Abbey wurde ganz warm ums Herz. Sie griff zärtlich in seine Haare und erwiderte sein Lächeln, aber sie brachte es nicht über sich, ihm die Wahrheit zu sagen. Sie schmiegte sich an ihn, legte den Kopf an seine Schulter und flüsterte: »Ich wünsche mir einfach nur, deine Frau zu sein.«
»Und ich wünsche mir, dein Mann zu sein«, entgegnete Neal und gab ihr einen Kuss auf die Wange. »Hab noch ein bisschen Geduld, Abbey. Wir werden bald heiraten. Ich lege jede Woche ein kleines Sümmchen für unsere Hochzeit zurück, damit wir uns einen Geistlichen und ein schönes Hochzeitsessen leisten können.« Für einen Trauring brauchte er kein Geld auszugeben: Seine Mutter hatte ihm für seine Zukünftige den Ehering seiner Großmutter geschenkt.
Abbeys Miene hellte sich auf. »Wirklich?«
»Wenn ich es dir sage.« Er war gerührt über ihre kindliche Freude. »Kopf hoch, Abbey! Spätestens Mitte nächsten Jahres sind wir Mann und Frau, ich verspreche es.« Er freute sich nicht minder auf die Hochzeit und seine Zukunft mit Abbey als sie. In ein paar Jahren, wenn seine Schwestern alt genug wären, um sich eine Arbeit zu suchen, würde ein Teil der finanziellen Last, die er zu tragen hatte, von ihm genommen werden, und dann würde vieles leichter werden.
»O Neal!« Abbey drückte sich an ihn. »Ich liebe dich wirklich, weißt du das?« Jetzt hatte sie etwas, auf das sie sich freuen konnte, etwas, das ihr die Kraft geben würde, die nächsten Wochen und Monate durchzustehen, egal, was kommen mochte.
Als Abbey nach Hause zurückkehrte, war sie nicht mehr ganz so niedergeschlagen. Finlay war eingeschlafen und schnarchte laut. Abbey betrachtete ihn seufzend. Sie wusste, ihr würde nichts anderes übrig bleiben, als ihn nach Martindale Hall zu begleiten, falls er darauf bestand, aber sie nahm sich vor, so abweisend und unausstehlich wie möglich zu sein, damit Ebenezer Mason die Lust, sie zu heiraten, gründlich verging.
2
Als Abbey am anderen Morgen aufwachte, war ihr Vater schon zur Arbeit gegangen. Sie hatte ein schlechtes Gewissen, weil sie verschlafen und ihm kein Frühstück gemacht hatte. Er hatte offenbar ein Stück von dem Fladenbrot gegessen, das sie am Abend zuvor gebacken hatte, doch das würde ihn kaum satt machen, und er hatte einen langen, harten Arbeitstag vor sich. Als sie das Geld sah, das er ihr dagelassen hatte, zwickte ihr Gewissen sie noch heftiger. Es war mehr als gewöhnlich, und sie wusste, warum: Sie sollte nicht nur etwas zu essen, sondern sich auch ein neues Kleid für den Abend auf Martindale Hall kaufen. Anscheinend erwartete er tatsächlich von ihr, dass sie Ebenezer Mason bezirzte. Der Gedanke bedrückte Abbey, aber sie versuchte, ihn beiseitezuschieben und sich stattdessen auf ihre gemeinsame Zukunft mit Neal zu konzentrieren.
Der Morgen nahm seinen gewohnten Gang. Während Abbey die Hausarbeit erledigte, die Wäsche wusch und Feuerholz sammelte, beschlich sie ein merkwürdiges Gefühl, eine düstere Vorahnung. Sie redete sich ein, dass ihr der Streit mit ihrem Vater auf der Seele lag. Abbey beschloss, die Sache aus der Welt zu schaffen und sich bei ihm zu entschuldigen. Schließlich wollte er nur ihr Bestes. Wenn er doch endlich begreifen würde, dass Neal das Beste war, was ihr passieren konnte!
Ich werde Dad ein Steak und Nierenpastete zum Abendessen machen, dachte sie. Und eine Flasche Bier werde ich auch besorgen. Darüber freut er sich bestimmt. Eigentlich konnten sie sich solche Leckerbissen gar nicht leisten, aber sie wollte wiedergutmachen, dass sie sich ihrem Vater gegenüber so respektlos benommen hatte. Vielleicht würde sie ihn ja doch noch überreden können, in die Hochzeit mit Neal einzuwilligen.
Eine sengende Hitze lag über der Stadt. Der heiße Nordwind wirbelte Staubwolken über die ausgedorrte Landschaft. Abbey war in der Bäckerei, als plötzlich die Sirene an der Kupfermine zu heulen begann. Sie erstarrte. Irgendetwas musste passiert sein. Vielleicht war ein Stollen eingestürzt.
Alle schrien durcheinander und rannten los. Abbey stand wie versteinert da, dann lief auch sie zur Mine. Das schrille Heulen der Sirene jagte ihr eine Gänsehaut über den Rücken, ihr Herz raste. Die seltsame, beklemmende Vorahnung, die sie den ganzen Morgen gequält hatte, machte auf einmal Sinn. Zeitweilig arbeiteten bis zu vierhundert Bergleute unter Tage, deshalb musste man bei einem Einsturz oder einem ähnlichen Unglück mit einer furchtbaren Katastrophe rechnen.
Atemlos und schweißgebadet kam Abbey bei der Mine an. Schon hatte sich eine riesige Menschenmenge vor dem Eingang zur Grube eingefunden: Ehefrauen und Kinder von Bergleuten, Minenarbeiter aus einer anderen Schicht, Ladenbesitzer, die von der Mine und ihren Angestellten lebten.
»Was ist passiert?«, keuchte Abbey, während sie versuchte, sich einen Weg durch die Menge zu bahnen. »Ist ein Schacht eingestürzt?«
»Wasser ist in einen der Stollen eingedrungen, und die Morphett-Pumpe ist ausgefallen. Es wird nicht lange dauern, bis das Wasser auch in die anderen Stollen laufen wird.« Der Mann, der ihr geantwortet hatte, ein Grubenarbeiter, war ungefähr so alt wie ihr Vater. Sein Gesicht war aschfahl, eine Wange aufgeschürft und seine Arbeitskleidung nass und verschmutzt. »Ich hab Glück gehabt, ich kam gerade noch heraus«, fügte er stockend hinzu. Bevor Abbey ihm weitere Fragen stellen konnte, war er davongeeilt.
Abbey, die sich ausmalte, wie ihr Vater und Neal in einem der Stollen gefangen waren und ertranken, war besinnungslos vor Angst. Sie spürte, dass sie keinen Tropfen Blut mehr im Gesicht hatte und ihre Knie ganz weich geworden waren. Sie wusste von ihrem Vater, wie wichtig die Pumpe war, mit der das Grubenwasser abgepumpt wurde. Fiel sie aus irgendeinem Grund aus, konnten sich die Stollen im Nu mit Wasser füllen.
Abbey packte einen der anderen Arbeiter am Ärmel. »Wie viele Männer sind rausgekommen? Hat irgendjemand meinen Vater gesehen, Finlay Scottsdale?« Panisch ließ sie ihre Blicke über die Gesichter der Umstehenden schweifen. Sie hätte gern nach ihrem Vater gerufen, doch sie hatte Angst, er könnte ihr nicht antworten.
»Wie durch ein Wunder hat es eine ganze Reihe von Männern geschafft rauszukommen, weil sie gerade auf dem Weg nach oben waren, um eine Pause zu machen, als die Pumpe ausfiel«, antwortete ein Bergmann. »Kopf hoch, Mädchen«, fügte er hinzu, fasste sie an den Armen und sah ihr fest in die Augen. »Alles wird gut werden, hörst du?« Er wandte sich ab und tauchte in der Menge unter.
Abbey hätte ihm gern geglaubt. Die Angst wühlte in ihren Eingeweiden. Im Stillen betete sie inbrünstig, dass ihr Vater und Neal unter jenen waren, die sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen konnten.
Sie dachte an die Auseinandersetzung mit ihrem Vater, und ihr kamen die Tränen. Sie bereute ihre harschen Worte und wünschte sich verzweifelt, dass sie die Möglichkeit bekam, sich mit ihm zu versöhnen. Hoffentlich war es nicht zu spät! »Wenn du heil zurückkommst, Dad, werde ich dir eine bessere Tochter sein, ich verspreche es«, wisperte sie. Und sie meinte es aufrichtig.
Langsam schob Abbey sich durch die Menge, ließ ihre Blicke suchend über die Gesichter der Männer gleiten. Aber weder ihr Vater noch Neal waren darunter.
Plötzlich fasste sie jemand von hinten am Arm, und sie schrak zusammen.
»Dad!« Überglücklich fuhr sie herum. Doch anstatt in das Gesicht ihres Vaters blickte sie in das von Neals Mutter.
»Wo ist mein Junge?« Megs sorgenvolles, verängstigtes Gesicht war kalkweiß. Tränen liefen ihr über die Wangen.
»Ich weiß es nicht, Meg.« Abbey schüttelte hilflos den Kopf. »Meinen Dad kann ich auch nirgends sehen.«
Die beiden Frauen klammerten sich aneinander und warteten. Mehr konnten sie nicht tun.
Ein Bergmann nach dem anderen wurde aus dem Schacht geborgen. Alle waren völlig durchnässt, husteten, prusteten und schnappten gierig nach Luft. Abbey musste an ihren Vater denken, an die Todesangst, die er ausstehen würde. Er hatte das Wasser immer schon gehasst, selbst eine Bootsfahrt war ihm ein Gräuel, deshalb war auch die Überfahrt nach Australien unerträglich für ihn gewesen.
Die Helfer zogen immer mehr Männer aus der Grube herauf, manche mehr tot als lebendig. Weinend vor Freude nahmen ihre Angehörigen sie in Empfang, sanken neben ihnen auf den staubigen Boden und hielten sie fest umschlungen. Abbey und Meg wussten, dass die Zeit gegen sie arbeitete, und ihre Angst wuchs. Bei jedem Bergarbeiter, der geborgen wurde, hielten sie unwillkürlich den Atem an und fassten sich noch fester an den Händen, immer hoffend, dass es Finlay oder Neal wäre.
Hektisch wurde daran gearbeitet, die Pumpe wieder in Gang zu setzen. Einige Männer drängten die bangenden Angehörigen, die nur hilflos zuschauen konnten, zurück, damit sie den Arbeitern nicht im Weg standen und sie behinderten. Abbey hörte laute Gebete und das Schluchzen der Frauen und Kinder.
Dann endlich ertönte das Geräusch, auf das alle gewartet hatten: Die Morphett-Pumpe sprang stotternd wieder an. Einen Augenblick herrschte Stille, aber dann brandete Beifall auf.
»Jetzt wird alles gut, Meg«, sagte Abbey. Sie lachte und weinte zugleich und schob den Gedanken, die Rettung könnte vielleicht zu spät kommen, weit von sich.
Megs kummervolle Miene hellte sich ein klein wenig auf. »Das glaube ich erst, wenn ich meinen Neal sehe«, flüsterte sie. »Bitte, lieber Gott, verschone das Leben meines Jungen und das von Finlay!«
Abbey legte ihren Arm um Megs Schultern und drückte sie tröstend. Auch sie hatte nur einen Wunsch: ihren Vater und Neal lebend wiederzusehen. Sie betete inbrünstiger als je zuvor in ihrem Leben.
Die Bergleute, die aus der Grube geborgen wurden, waren über und über mit Schlamm bedeckt, sodass es schwierig war, sie zu identifizieren. Frauen stürzten herbei und riefen in grenzenloser Erleichterung den Namen ihrer Männer und Söhne, als sie sie erkannten. Für Meg und Abbey wurde das Warten zur Tortur. Sosehr sie sich für die Geretteten und ihre Familien freuten, die Enttäuschung, dass es nicht Finlay oder Neal war, der geborgen worden war, war kaum auszuhalten, und mit jeder Minute, die verstrich, schwand ein kleines Stück Hoffnung.
Plötzlich begann die Pumpe wieder zu stottern. Sie setzte ein paarmal aus, dann blieb sie endgültig stehen.
»O Gott, nein!«, jammerte Abbey entsetzt. Männer liefen hektisch hin und her, schrien einander Anweisungen zu. Jede Minute war kostbar, das war allen klar. Freiwillige meldeten sich und stiegen gegen den Willen des Geschäftsführers in die Grube hinunter, um nach Verunglückten zu suchen. Meg und Abbey wagten kaum zu atmen, während sie darauf warteten, dass die Helfer wieder heraufkamen. Zweimal brachten sie einen Bewusstlosen aus dem Schacht, der, als er wieder zu sich kam, schmutziges Wasser aushustete und röchelnd nach Luft schnappte. Aber bei keinem der beiden handelte es sich um Finlay oder Neal.
Die Minuten verrannen. Megs und Abbeys Nerven waren zum Zerreißen gespannt, sie fühlten sich vor lauter Angst einer Ohnmacht nahe. Einer der Männer, die unten gewesen waren, berichtete, durch das einströmende Wasser sei der Stollen teilweise eingestürzt. Abbey schlug sich erschrocken die Hand vor den Mund, als sie das hörte. Ihre schlimmsten Befürchtungen waren eingetroffen.
»Wie viele sind denn noch unten?«, fragte sie einen Mann neben ihr.
Er schüttelte den Kopf. »Das können wir noch nicht genau sagen. Wir müssen erst die Zahlen vergleichen.«
Eine Frau drängte sich durch die Menschen zum Eingang des Schachts und rief laut nach ihrem Mann. Zwei Bergleute konnten sie nur mit Mühe zurückhalten, so ungestüm gebärdete sie sich in ihrem Kummer. Achtundfünfzig Männer hatten im Stollen gearbeitet. Die meisten waren offenbar gerettet worden, aber Jock McManus, der Mann der verzweifelten Frau, sowie Finlay und Neal und zwei, drei andere wurden immer noch vermisst. Anscheinend waren sie zum ungünstigsten Zeitpunkt – nämlich als die Pumpe ausfiel – auf eine größere Menge Grubenwasser gestoßen.
Plötzlich riss sich Meg von Abbey los. »Wo ist mein Sohn?«, kreischte sie hysterisch und hämmerte mit den Fäusten gegen die Brust des Mannes, der sie festhielt. »Wo ist mein Junge? Warum helft ihr ihm denn nicht? So helft ihm doch!«, schrie sie voller Panik, dann brach sie bewusstlos zusammen.
Abbey eilte zu Meg und kniete sich neben sie. Im gleichen Moment sprang die Pumpe wieder an.
»Danke, lieber Gott«, flüsterte Abbey. Tränen liefen ihr übers Gesicht. Sie glaubte fest daran, dass ihr Vater und Neal noch am Leben waren und in einem Lufteinschluss im Stollen auf Rettung warteten. Sie ergriff Megs schlaffe Hand.
»Alles wird gut, Meg, du wirst sehen, jetzt wird es nicht mehr lange dauern, bis Dad und Neal in Sicherheit sind.« Abbey war überzeugt, dass sie gerettet würden. Es konnte nicht anders sein. Es durfte nicht anders sein. Sie hatte ihre Mutter, ihren Bruder, ihre Schwester verloren. Sie konnte nicht auch noch ihren Vater verlieren.
Es schien eine Ewigkeit zu dauern, bis das Wasser endlich aus dem Stollen gepumpt war und die Helfer hinabsteigen konnten, um nach den Vermissten zu suchen. Abbey, die immer noch neben der bewusstlosen Meg kniete, stand auf und trat dicht an den Eingang des Schachts heran. Sie wollte da sein, wenn ihr Vater herauskam. Sie wollte der erste Mensch sein, den er zu Gesicht bekam. Fiebernd vor Angst und Aufregung nahm sie sich vor, ihm gehörig den Kopf zu waschen, weil er ihr einen solchen Schrecken eingejagt hatte, und ihn zu drängen, die Arbeit in der Mine aufzugeben.
Die Minuten verstrichen, und noch immer gab es keine Spur von den Vermissten oder ihren Rettern.
Abbey wandte sich an einen Minenarbeiter neben ihr. »Wo bleiben sie denn? Wieso dauert das so lange?«
»Sie müssen vorsichtig sein, die Stollen dürften durch das Wasser instabil geworden sein.«
Sein besorgter Ton entging Abbey nicht. Ihre Anspannung wuchs erneut, aber sie weigerte sich, die Hoffnung aufzugeben. Ihrem Vater und Neal war nichts geschehen. Sie wusste es in ihrem tiefsten Inneren. Gott konnte nicht so grausam sein und ihr die beiden letzten Menschen nehmen, die sie auf der Welt noch hatte. Nein, das würde er bestimmt nicht tun.
Die Zeit schien endlos, das Warten wurde unerträglich. Dann endlich kamen die Männer zurück, vollständig durchnässt und erschöpft. Abbeys Herz machte einen freudigen Hüpfer. Erwartungsvoll ließ sie ihre Blicke über die schlammbespritzten Gesichter gleiten.
»Wo ist mein Dad?«, rief sie einem der Retter zu. »Finlay Scottsdale. Habt ihr ihn oder Neal Tavis gefunden?«
Der Mann stapfte zu ihr, legte ihr eine Hand auf die Schulter und sagte mit ernster Stimme: »Ja, wir haben sie gefunden.«
Grenzenlose Erleichterung durchflutete Abbey. »Wo sind sie? Sie sind doch nicht verletzt, oder?«
Der Minenarbeiter schwieg. Abbey bemerkte jetzt erst den Ausdruck von Niedergeschlagenheit und Trauer in seinen Augen, und der kleine Funken Hoffnung in ihr erlosch schlagartig. Als der Arbeiter zur Seite trat, sah Abbey, dass seine Kameraden drei leblose Männer aus dem Schacht heraustrugen und nebeneinander auf die Erde legten. Sie erkannte Jock McManus, ihren Vater und Neal.
Wie versteinert stand sie da und starrte die drei Männer an, aus denen alles Leben gewichen war. Judy McManus war herbeigestürzt und hatte sich schluchzend über ihren Mann geworfen. Das bestürzte Schweigen ringsum wurde von geraunten Anschuldigungen durchbrochen, von Vorwürfen gegen Ebenezer Mason, weil er es in seinem Geiz versäumt hatte, für die Funktionstüchtigkeit der Morphett-Pumpe zu sorgen. Abbey musste an ihre Auseinandersetzung mit ihrem Vater am Abend zuvor denken. Er hatte ihr nahegelegt, den Mann zu verführen, der jetzt für seinen Tod verantwortlich war.
Als sich die Menge langsam zerstreute, wankte Abbey wie in Trance zu den drei Leichen hinüber und blickte auf das Gesicht ihres Vaters hinunter, der reglos neben Neal und Jock McManus lag, dessen Witwe von einigen Frauen getröstet wurde. Das kann nicht sein, dachte Abbey. Das ist bestimmt nur ein böser Traum. Sie hatte sich ausgemalt, wie sie ihren Vater und Neal umarmen und an sich drücken und Freudentränen weinen würde, und jetzt stand sie vor ihren Leichen.
Im Tod sah Neal zwischen den beiden älteren Männern wie ein Schuljunge aus. Der Gedanke, dass er nie eine eigene Familie, nie die Kinder haben würde, die sie ihm gern geschenkt hätte, brach Abbey schier das Herz. Ihr fiel die seltsame Gesichtsfarbe der drei Männer auf, aber sie konnte noch immer nicht fassen, dass sie wirklich tot sein sollten. Das kann nicht sein, dachte sie verwirrt, das kann einfach nicht sein.
»Dad«, wimmerte sie, während ihr die Tränen über die Wangen liefen. Sie fiel neben ihm auf die Knie und berührte sein Gesicht, das eiskalt war. Hinter ihr hörte sie Meg hysterisch schluchzen. »Lass mich nicht allein, Dad«, wisperte sie verzweifelt. »Ich brauche dich doch. Bitte, lass mich nicht allein!«
Die Stunden nach dem Unglück erlebte Abbey in einem Zustand dumpfer Benommenheit. Sie nahm kaum wahr, wie sie von einem Minenarbeiter zu ihrer Erdwohnung zurückbegleitet wurde und dass er ihr erklärte, der Leichnam ihres Vaters würde zu Herman Schultz, einem der Leichenbestatter der Stadt, gebracht. Später kamen einige Frauen aus der Nachbarschaft vorbei, um ihr ihr Beileid auszusprechen, aber Abbey nahm keine Notiz von ihnen. Erst als am Abend einer von den irischen Freunden ihres Vaters ihr zuredete, einen kräftigen Schluck Whiskey aus seiner Taschenflasche zu nehmen, gelang es ihr endlich, sich zusammenzureißen. Sie wischte sich die Tränen ab und dachte zum ersten Mal seit dem Nachmittag an Neals Mutter und seine Schwestern.
Schweren Herzens machte sie sich auf den Weg zu der Erdwohnung, in der ihr geliebter Neal zu Hause gewesen war. Sie sorgte sich um die zarte, kränkelnde Meg. Wie würde sie mit ihren beiden Mädchen ohne Neal zurechtkommen, wovon wollten sie leben?
Als sie an die Tür der Familie Tavis klopfte, öffnete niemand. Abbey schaute in die Wohnung – sie war leer, vollständig ausgeräumt. Verdutzt stand die junge Frau da. Was hatte das zu bedeuten?
»Du willst sicher zu Meg, Abbey.« Vera Nichols, eine Nachbarin, kam aus ihrer Behausung und lief auf sie zu.
»Ja. Können Sie mir sagen, wo sie ist, Mrs. Nichols?«
»Sie wurde nach Clare ins Krankenhaus gebracht. Ich dachte, du wüsstest, dass man den Doktor zur Mine gerufen hat.«
Abbey schüttelte fassungslos den Kopf. »Nein, das hab ich nicht gewusst.«
»Das mit deinem Vater tut mir sehr leid, Kindchen«, sagte Vera sanft.
Abbey, der von neuem die Tränen kamen, brachte kein Wort hervor. Sie nickte stumm.
»Ich bin gleich mit meinem Dennis nach Haus gegangen, nachdem sie ihn aus dem Schacht heraufgeholt hatten«, fuhr Vera fort, »deshalb habe ich nicht mehr mit Meg gesprochen, aber ich habe gehört, dass der Tod ihres Sohnes sie ganz schön mitgenommen hat. Anscheinend geht es ihr gar nicht gut.«
Abbey machte sich schreckliche Vorwürfe, dass sie so mit ihrem eigenen Kummer beschäftigt gewesen war, dass sie Meg darüber ganz vergessen hatte. Sie schniefte und schnäuzte sich. »Wie geht’s Mr. Nichols?«
»So weit ganz gut. Wie durch ein Wunder ist ihm nicht viel passiert. Abbey, Beatrice Smythe hat mir gesagt, dass es sehr schlecht um Meg steht«, fügte Vera behutsam hinzu. Sie hielt es für besser, ehrlich zu dem Mädchen sein. »Der Arzt meint, ihr schwaches Herz verkraftet den Schock möglicherweise nicht. Wen wundert’s.« Sie stieß einen abgehackten Seufzer aus.
Abbey schlug erschrocken die Hand vor den Mund. Dann fragte sie: »Was ist mit den Sachen von Meg und den Mädchen passiert?« Die Familie Tavis hatte nicht viel besessen, aber all ihre Habseligkeiten waren verschwunden, sogar Neals Kleidung. Abbey brachte es nicht über sich, seinen Namen zu erwähnen, weil sie wusste, sie würde unweigerlich einen neuerlichen Weinkrampf bekommen.
»Beatrice und ich haben alles zusammengepackt und zu Beatrice gebracht. Wenn die Lumpensammler herausfinden, dass die Wohnung leer steht, wäre alles weg gewesen.«
»Daran habe ich gar nicht gedacht«, murmelte Abbey. Meg ging ihr nicht mehr aus dem Sinn. Sie hatte das Gefühl, Neal im Stich gelassen zu haben, weil sie nicht für seine Mutter da gewesen war. »Ich hätte mich um Meg kümmern müssen. Ich hätte sie nicht alleinlassen dürfen …«
»Mach dir deswegen keine Vorwürfe, Abbey. Meg weiß, dass du mit deinem eigenen Verlust fertig werden musstest. Bei ihrer angegriffenen Gesundheit ist es ja auch kein Wunder, dass sie einen so schweren Schlag nicht verkraften kann.«
»Wer kümmert sich denn jetzt um Amy und Emily?«, fragte Abbey und wischte sich die Tränen ab. Die Zwillinge waren erst elf Jahre alt. »Wo sind die beiden überhaupt?«
»Sie sind mit Meg gegangen«, antwortete Vera. »Wenn sie sterben sollte, was Gott verhüten möge, werden die Mädchen vermutlich in ein Waisenhaus in Clare oder Adelaide gebracht werden. Sie haben in Australien keine Angehörigen, und von uns hier ist niemand in der Lage, sie bei sich aufzunehmen. Was für eine schreckliche Tragödie! Wollen wir hoffen, dass die beiden wenigstens zusammenbleiben können. Es wäre furchtbar, wenn sie auseinandergerissen würden.«
Der Gedanke an die Zwillingsschwestern, die erst ihren Bruder verloren hatten und jetzt um ihre Mutter bangen mussten, war zu viel für Abbey. Von Kummer und Schmerz überwältigt brach sie schluchzend zusammen.
Vera, die dem Elend rings um sie her mit stoischer Gelassenheit zu begegnen versuchte, da sie die Dinge ohnehin nicht ändern konnte, brach es schier das Herz. Abbey war noch zu jung, um mit den Schicksalsschlägen, die sie heute ereilt hatten, fertig zu werden.
Sie kniete sich neben sie und legte ihr tröstend den Arm um die Schultern. »Aber, aber, Kindchen! Beruhige dich doch. Das war ein furchtbarer Tag für dich, nicht wahr?«, murmelte sie tief bewegt. »Ich weiß, wie gern du Neal gehabt hast, und dann auch noch den Vater zu verlieren …« Sie schürzte ihre schmalen Lippen. »Und das alles ist nur Ebenezer Masons Schuld. Er allein hat die Männer, die heute ihr Leben verloren, auf dem Gewissen. Aber du musst dich zusammenreißen, Kindchen. Es gibt nichts, was du tun könntest. Das Leben geht weiter.«
Als Vera den Namen des Minenbesitzers aussprach, ging ein Ruck durch Abbey. Sie hob den Kopf und straffte die Schultern. Ebenezer Mason! Er sollte ihren ohnmächtigen Zorn und ihren Schmerz zu spüren bekommen. Aber zuerst würde sie dafür sorgen, dass ihr Vater ein anständiges Begräbnis erhielt.
Als das Miner’s Arms schloss, machte sich Paddy Walsh, einer von Finlays besten Freunden, auf den Weg in die Creek Street.
»Ich möchte dir stellvertretend für alle Stammgäste im Miner’s Arms mein tiefstes Beileid aussprechen, Abbey«, sagte er ernst, seine Mütze in seinen Händen haltend. »Dein Vater war ein feiner Kerl, ein Gentleman und ein prima Kumpel. Ich habe den Hut herumgehen lassen. Es ist nicht viel, aber ich hoffe, es hilft dir.« Verlegen kramte er ein paar Pfundnoten und einige Münzen aus seiner Mütze und reichte ihr das Geld. »Vielleicht reicht es für die Beerdigung. Sag uns Bescheid, wenn du weißt, wann sie sein wird, wir werden da sein. Anschließend treffen wir uns in der Kneipe zum Leichenschmaus. Du bist herzlich dazu eingeladen, Abbey.« Seine Stimme war brüchig vor Ergriffenheit, und er musste sich räuspern.
»Ich danke Ihnen, Mr. Walsh«, murmelte Abbey gerührt. Sie wusste, wie eng ihr Vater mit seinen Stammtischkumpels befreundet gewesen war, aber sie bemerkte auch, dass sich Paddy offenbar Mut angetrunken hatte, bevor er zu ihr gekommen war. Es war ihr unangenehm, Geld von ihm und den anderen Freunden ihres Vaters anzunehmen, aber sie konnte es sich nicht leisten abzulehnen.
Herman Schultz, der Leichenbestatter, zu dem man ihren Vater gebracht hatte, war bereits bei ihr gewesen. Ein würdevolles Begräbnis war nicht billig, und das Geld, das Paddy gesammelt hatte, reichte bei weitem nicht aus. Doch Abbey war zu stolz, etwas zu sagen. Sie war fest entschlossen, die Kosten für die Beerdigung von Ebenezer Mason einzufordern, schließlich hatte er ihren Vater auf dem Gewissen.
»Mir war nie wohl bei dem Gedanken, dass dein Vater in der Mine arbeitet«, fuhr Paddy fort. »Ich hab immer gesagt, es ist verdammt gefährlich im Untertagebau. Deinem Vater war das schon klar, aber er hatte Angst, dass er keine andere Arbeit finden würde, deshalb ist er geblieben.«
Paddys Worte verstärkten Abbeys Schuldgefühle noch. Offenbar hatte ihr Vater seine gefährliche Arbeit nur deshalb nicht aufgegeben, weil er für seine Tochter sorgen musste. Zum ersten Mal kam ihr der Gedanke, sie könnte eine Last für ihn gewesen sein. Ihre Verzweiflung wuchs.
»Weißt du schon, was du jetzt anfangen wirst, Abbey?«, fragte Paddy leise.
»Nein«, entgegnete sie kopfschüttelnd. »Ich denke, ich werde mir eine Arbeit suchen müssen. Dad hat mir das nie erlaubt.« Sie schluckte schwer und fuhr mit spröder Stimme fort: »Er hat immer gesagt, ich soll zu Hause bleiben und für ihn sorgen, bis ich einmal heiraten würde.« Als sie an Neal dachte, konnte sie die Tränen nicht mehr zurückhalten.
»Kopf hoch, Mädel«, tröstete Paddy sie unbeholfen. »Es ist hart, ich weiß. Da fällt mir ein, Mrs. Slocomb, meine Vermieterin, sucht jemanden, der ihr beim Putzen hilft. Wenn du nichts Besseres findest, kannst du sie ja mal fragen, ob sie dich nimmt.«
Abbey dankte ihm für seine Hilfe.
Nachdem Paddy gegangen war, legte sie sich auf den strohgefüllten Sack auf dem nackten Erdboden, der ihr als Bett diente, und versuchte zu schlafen. Nie zuvor in ihrem Leben hatte sie sich so allein und verloren gefühlt. Nach dem Tod ihrer Mutter hatte sie wenigstens noch ihren Vater gehabt. Jetzt hatte sie niemanden mehr, keine Menschenseele auf der ganzen weiten Welt. Oder zumindest nicht in Australien. Und für eine Rückkehr nach Irland zu ihrer Tante und ihrem Onkel fehlte ihr das Geld. Tiefer Kummer überwältigte Abbey. Und schuld an ihrem grenzenlosen Leid war nur Ebenezer Mason. Wie konnte jemand zulassen, dass die Maschinen und Geräte in der Mine veraltet oder kaputt waren, obwohl er die nötigen Mittel zu ihrer Instandhaltung besaß? Wie konnte jemand das Leben seiner Arbeiter vorsätzlich gefährden? Für Abbey war ein solcher Mann schlichtweg ein Verbrecher. Ginge es nach ihr, würde er ins Gefängnis von Redruth geworfen werden. Doch sie wusste, dass das nie passieren würde. Ebenezer Mason hatte in Burra zu viel Macht und Einfluss – es wurde gemunkelt, dass jeder Constable in der Stadt auf seiner Gehaltsliste stand.
In ihrer Verzweiflung konnte Abbey nicht aufhören zu weinen. Irgendwann endlich fiel sie in einen unruhigen Schlaf.
Als Abbey am anderen Morgen aufwachte, fühlte sie sich wie gerädert. Doch dann fiel ihr wieder ein, was sie zu tun hatte, und das gab ihr die Kraft aufzustehen. Sie wollte sich gerade auf den Weg zur Mine machen, um Ebenezer Mason zur Rede zu stellen, als Herman Schultz kam.
Nachdem er ihr sein Beileid ausgesprochen hatte, fuhr er bedauernd fort: »Ich fürchte, bei diesen Temperaturen werden wir Ihren Vater heute schon beerdigen müssen, Miss Scottsdale, und nicht bis morgen warten können.«
Abbey riss die Augen auf. »Heute schon!«
»Ja, spätestens heute Nachmittag.«
»Aber … aber ich habe kein Geld für einen anständigen Sarg und einen Grabstein.«
Herman hatte Mitleid mit der jungen Frau. »Dann schlage ich vor, dass wir einen schlichten Kiefernholzsarg nehmen werden und Sie das Grabkreuz selbst fertigen.«
»Was ist mit Neal Tavis?«, fragte Abbey mit zitternder Stimme. »Seine Mutter ist nach Clare ins Krankenhaus gebracht worden, wer wird seine Beerdigung veranlassen?«
Herman machte ein betretenes Gesicht. »Mr. Tavis wird ein Armenbegräbnis bekommen«, erwiderte er bedrückt. In Fällen wie diesem wurde der Leichenbestatter von der Gemeinde bezahlt.
Abbey guckte ihn groß an, als sie das hörte. Ohnmächtige Wut packte sie. »Das ist nicht gerecht«, sagte sie zornig. »Es wäre Sache des Minenbesitzers, ein anständiges Begräbnis für meinen Vater, für Neal und für Jock McManus zu bezahlen! Das ist das Mindeste, was er tun könnte!«
»Es steht mir nicht zu, Geld vom Eigentümer der Mine zu fordern, Miss Scottsdale. Das kann ich nicht machen.«
»Sie vielleicht nicht, aber ich«, fauchte Abbey. »Und genau das werde ich auch tun! Das Beste ist für meinen Vater und für Neal gerade gut genug. Ich werde das Geld schon bekommen, das verspreche ich Ihnen.«
»Was die Bezahlung angeht, kann ich Ihnen leider keinen Aufschub gewähren, Miss Scottsdale«, sagte Herman sichtlich verlegen. »Ich habe eine große Familie zu ernähren …«
»Sie kriegen Ihr Geld«, versprach Abbey.
Herman Schultz kannte Ebenezer Mason zwar nicht persönlich, aber seit er sein Bestattungsunternehmen fünf Jahre zuvor gegründet hatte, waren zwölf Minenarbeiter tödlich verunglückt, und der Eigentümer der Mine hatte kein einziges Begräbnis bezahlt. Er hielt es daher für ziemlich unwahrscheinlich, dass die junge Frau Geld von Mason bekommen würde. »Es tut mir leid, Miss Scottsdale, aber ich muss darauf bestehen, dass Sie mich vor der Beerdigung bezahlen.«
»Ich verstehe«, erwiderte Abbey ärgerlich. »Ich werde sehen, was ich tun kann.«
Herman nickte und verabschiedete sich.
Als er fort war, machte sich Abbey unverzüglich auf den Weg zur Mine, um Ebenezer Mason aufzusuchen. Er sei nicht da, erklärte ihr Mrs. Sneebickler, seine Sekretärin.
»Wann kommt er zurück? Ich werde nicht von hier weggehen, bis ich mit ihm gesprochen habe«, sagte Abbey mit Nachdruck und verschränkte die Arme vor der Brust.
Mrs. Sneebickler war eine resolute Person, die wie geschaffen war für die Arbeit in der Männerwelt. Sie konnte sehr energisch sein und sich normalerweise selbst bei den härtesten Burschen Respekt verschaffen. Aber sie brachte es nicht fertig, eine trauernde junge Frau, die gerade ihren Vater verloren hatte und nichts als ein paar Antworten und ein wenig Hilfe wollte, abzuweisen.
»Kommen Sie morgen noch einmal vorbei, Abbey«, sagte sie. »Ich denke, dann wird Mr. Mason da sein. Mehr kann ich nicht für Sie tun.«
So leicht ließ sich Abbey nicht abwimmeln. »Wenn Mr. Mason nicht da ist, möchte ich seinen Stellvertreter sprechen. Ich werde nicht eher von hier fortgehen, bis ich mit jemandem geredet habe, der mir helfen kann«, beharrte sie mit Tränen in den Augen.
Mrs. Sneebickler seufzte. Sie hatte Abbeys Vater gemocht, weil er sie immer höflich und mit Respekt behandelt hatte, selbst dann, wenn sie ziemlich kurz angebunden gewesen war.
»Frank Bond, der Geschäftsführer, ist da, Abbey. Er hat zwar viel um die Ohren, aber ich werde sehen, ob er einen Moment Zeit für Sie hat.«
»Vielen Dank.« Abbey kämpfte gegen die Tränen an. Es ging fast über ihre Kräfte, so kurz nach dem Grubenunglück wieder auf dem Bergwerksgelände zu sein.
Mrs. Sneebickler bot ihr einen Platz an und schickte nach Frank Bond.
Der Geschäftsführer beaufsichtigte die Reparatur der Pumpe. Er wusste, dass sein Boss den Bergwerksbetrieb so schnell wie möglich wieder aufnehmen wollte. Aber bei den Reparaturarbeiten waren unerwartete Probleme aufgetreten, und es ging einfach nicht voran. Frank Bond war daher alles andere als begeistert, als er hörte, dass er ins Büro kommen sollte. Übellaunig stapfte er über das Gelände.
Als er das Büro betrat und sich der aufgewühlten jungen Frau gegenübersah, die ihm erklärte, dass es Ebenezer Masons Pflicht und Schuldigkeit sei, für das Begräbnis seiner Arbeiter aufzukommen, beruhigte er sich jedoch sogleich. Er sei nicht befugt, ihr eine finanzielle Entschädigung anzubieten, er müsse erst mit seinem Arbeitgeber sprechen, sagte er bedauernd.
»Und wo ist Ihr Arbeitgeber?«, fragte Abbey bitter.
»Soviel ich weiß, hält er sich in seinem Haus in Mintaro auf, Miss Scottsdale«, antwortete Frank, dem das Ganze sehr unangenehm war.
Mintaro lag ungefähr fünfzehn Meilen entfernt. Abbey konnte es vor der Beerdigung ihres Vaters unmöglich dorthin und wieder zurück schaffen, zumal sie weder ein Pferd noch einen Buggy besaß und es sich nicht leisten konnte, einen zu mieten.
»Weiß er denn nicht, dass drei seiner Arbeiter ums Leben gekommen sind?«, fragte Abbey fassungslos.
»Doch, wir haben ihn unmittelbar nach dem Unglück benachrichtigt«, erwiderte Frank peinlich berührt. »Aber bisher hat er sich nicht gemeldet.« Der Geschäftsführer nahm es seinem Boss sehr übel, dass er nicht sofort nach Burra gekommen war, aber was hätte er tun sollen? Ebenezer Mason hatte nie den Kontakt zu seinen Untergebenen gesucht, und sofern es nicht einen triftigen Grund gab, sprach er nicht mit ihnen. Das Einzige, was ihn interessierte, war der Gewinn, den die Mine abwarf, damit er seine aufwändige Lebensweise finanzieren konnte.
»Warum unternehmen Sie denn nichts?«, fragte Abbey, die völlig außer sich war. »Mein Vater und Neal Tavis müssen wegen der Hitze heute schon beerdigt werden. Ich kann nicht länger warten!«
»Es tut mir sehr leid, Miss Scottsdale.« Frank schüttelte bedauernd den Kopf. »Aber ich kann leider nichts für Sie tun.«