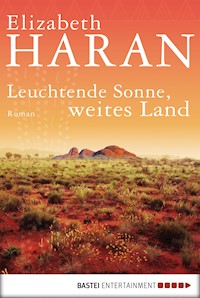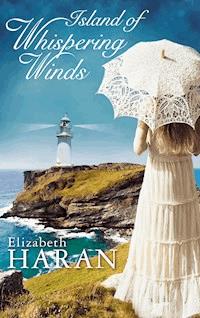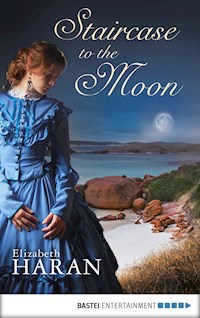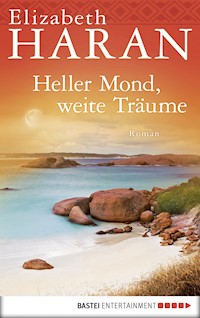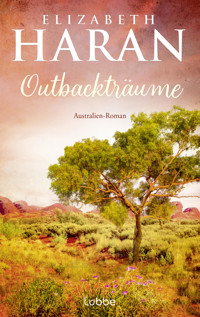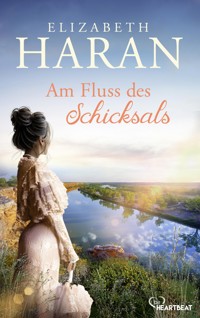7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Große Emotionen, weites Land - Die Australien-Romane von Elizabeth Haran
- Sprache: Deutsch
Sie jagt einer Story hinterher - und entdeckt ihre eigene Geschichte ...
Australien, 1900. Ein mysteriöser Tiger treibt im abgelegenen Tantanoola sein Unwesen! Die junge Reporterin Eliza wittert hinter dieser Meldung eine spannende Story. Noch ahnt sie nicht, dass zwei schicksalhafte Begegnungen im kleinen Ort ihr Leben gehörig durcheinanderwirbeln werden: Zum einen ist da der attraktive Jäger Brodie, der den Tiger erlegen soll. Zum anderen erlebt Eliza eine große Überraschung, als sie auf ihre lange verschollene Tante Matilda trifft - und auf ein Geheimnis aus der Vergangenheit stößt, das alles verändert ...
Ein mitreißender Familienroman vor der beeindrucken Kulisse des australischen Outbacks.
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 753
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhalt
CoverWeitere Titel der AutorinÜber dieses BuchÜber die AutorinTitelImpressumWidmungPrologKapitel 1Kapitel 2Kapitel 3Kapitel 4Kapitel 5Kapitel 6Kapitel 7Kapitel 8Kapitel 9Kapitel 10Kapitel 11Kapitel 12Kapitel 13Kapitel 14Kapitel 15Kapitel 16Kapitel 17Kapitel 18Kapitel 19Kapitel 20Kapitel 21Kapitel 22Kapitel 23Kapitel 24Kapitel 25Kapitel 26Kapitel 27Kapitel 28Kapitel 29Kapitel 30Kapitel 31Weitere Titel der Autorin
Am Fluss des Schicksals
Der Duft der Eukalyptusblüte
Der Glanz des Südsterns
Der Himmel über dem Outback
Der Rur der Ferne
Der Ruf des Abendvogels
Die Insel der roten Erde
Ein Hoffnungsstern am Himmel
Ein Traum in Australien
Eine Liebe in Australien
Heller Mond, weite Träume
Im Glanz der roten Sonne
Im Hauch des Abendwindes
Im Land des Eukalyptusbaums
Im Tal der Eukalyptuswälder
Im Tal der flammenden Sonne
Jenseits der südlichen Sterne
Jenseits des leuchtenden Horizonts
Leuchtende Sonne, weites Land
Träume unter roter Sonne
Weitere Titel in Planung.
Über dieses Buch
Sie jagt einer Story hinterher – und entdeckt ihre eigene Geschichte …
Australien, 1900. Ein mysteriöser Tiger treibt im abgelegenen Tantanoola sein Unwesen! Die junge Reporterin Eliza wittert hinter dieser Meldung eine spannende Story. Noch ahnt sie nicht, dass zwei schicksalhafte Begegnungen im kleinen Ort ihr Leben gehörig durcheinanderwirbeln werden: Zum einen ist da der attraktive Jäger Brodie, der den Tiger erlegen soll. Zum anderen erlebt Eliza eine große Überraschung, als sie auf ihre lange verschollene Tante Matilda trifft – und auf ein Geheimnis aus der Vergangenheit stößt, das alles verändert …
Ein mitreißender Familienroman vor der beeindrucken Kulisse des australischen Outbacks.
eBooks von beHEARTBEAT – Herzklopfen garantiert.
Über die Autorin
Elizabeth Haran wurde in Simbabwe geboren. Schließlich zog ihre Familie nach England und wanderte von dort nach Australien aus. Heute lebt sie mit ihrem Mann und ihren zwei Söhnen in einem Küstenvorort von Adelaide in Südaustralien. Ihre Leidenschaft für das Schreiben entdeckte sie mit Anfang dreißig, zuvor arbeitete sie als Model, besaß eine Gärtnerei und betreute lernbehinderte Kinder.
E L I Z A B E T H
HARAN
Im Schatten desTeebaums
Aus dem australischen Englisch von Sylvia Strasser und Veronika Dünninger
Digitale Neuausgabe
»be« – Das eBook-Imprint der Bastei Lübbe AG
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2007 by Elizabeth Haran
Titel der australischen Originalausgabe: »The Tantanoola Tiger«
The author has asserted her Moral Rights.
Published by Arrangement with Elizabeth Haran-Kowalski
Für diese Ausgabe:
Copyright © 2008/2021 by Bastei Lübbe AG, Köln
Lektorat: Jutta Schneider
Textredaktion: Wolfgang Neuhaus
Covermotive: © Ironika/shutterstock; © TJteamwork/shutterstock
eBook-Erstellung: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7517-1565-2
be-ebooks.de
lesejury.de
Dieser Roman ist meinen Freundinnen gewidmet, die mir helfen, nicht zu verzweifeln, wenn ich bisweilen das Gefühl habe, die Welt sei verrückt geworden.
Gute Freunde können zuhören und mitfühlen. Sie lachen und weinen mit dir, sie teilen deinen Kummer, deine Freude und deine Erfolge.
Ich darf mich glücklich schätzen, solch wunderbare Freundinnen zu haben.
Prolog
Mannie Boyd trat aus seiner Hütte hinaus in den grauen Morgennebel. Er schlurfte zu einem niedrigen Busch und erleichterte sich, wobei er ausgiebig gähnte und dann träge beobachtete, wie der Dunst seines Atems vom Nebel geschluckt wurde. Der Morgen brach an über Tantanoola, einem kleinen, verschlafenen Städtchen im Südosten von South Australia, doch die Sonne schaffte es nicht, die Nebeldecke zu durchbrechen, die über den Schaf- und Getreidefarmen lag, von denen Tantanoola umschlossen wurde.
Mannies Körper war verspannt, er fühlte sich älter als die vierundfünfzig Jahre, die er auf dem Buckel hatte. Er war Junggeselle und trank gerne einen über den Durst, und wenn er genug hatte, fing er meistens Streit an. Diese Lebensweise rächte sich nun: Sein Körper protestierte mit jedem Tag heftiger, und Mannie wurde immer griesgrämiger. Er lebte seit fast sechs Jahren in der Gegend und verdiente sich seinen Lebensunterhalt mit dem Verkauf von Kaninchenfellen – nicht gerade die angesehenste Arbeit der Welt. Mannie, der von der Hand in den Mund lebte, war überzeugt, dass das Leben ihn schlecht behandelte und ihm etwas schuldig sei.
Wie jeden Morgen schickte er sich auch an diesem Tag an, seine Fallen auf den umliegenden Farmen zu überprüfen. Er hatte die Farmer nie um Erlaubnis gefragt, ob er seine Kaninchenfallen auf ihrem Land aufstellen durfte, denn er war der Ansicht, dass er ihnen einen Gefallen tat, wenn er ihnen die Schädlinge vom Hals schaffte, die ihren Schafen das Gras wegfraßen. Tatsächlich hatte noch kein Farmer Einwände gegen Mannies Fallen erhoben.
»Komm schon, Rastus, beweg dich, du nichtsnutziger Sack voll Flöhe«, rief Mannie seinen Hund.
Der Vierbeiner kam aus einer Kiste gekrochen, die auf der rückseitigen Veranda stand und ihm als Unterschlupf diente, und trottete widerstrebend zu seinem Herrchen. Auch der Colliemischling war nicht mehr der Jüngste – wie Mannie schien der Hund unter steifen Gelenken zu leiden, vor allem an einem feuchten Morgen wie diesem. Rastus folgte Mannie in einigem Abstand. Er war vorsichtig geworden, weil er wusste, dass sein übellauniger Besitzer gern einmal nach ihm trat.
Mannie machte sich auf den Weg zu Jock Milligans Farm. Fröstelnd und missmutig vor sich hin schimpfend, stülpte er sich seinen Wollhut auf und zog ihn bis über die Ohren. In der tiefen Stille waren nur Mannies mürrisches Gebrummel und das Knirschen seiner Schritte auf dem gefrorenen Boden zu hören.
Es war August, Winter auf der Südhalbkugel. Zwei Wochen zuvor waren die ersten Lämmer geboren worden. Eigentlich hätte bereits ein Hauch von Frühling in der Luft liegen sollen, doch morgens war es immer noch winterlich kalt und ungemütlich. Mannie hoffte, dass ein paar Kaninchen in seine Fallen gegangen waren, damit er die Felle verkaufen konnte. In letzter Zeit hatte er im Hinterzimmer der Bar öfter Karten gespielt und ziemlich viel Geld verloren.
Griesgrämig, den Blick auf den Weg gerichtet, stapfte Mannie über den harten Boden. Nach einer Weile lief Rastus in weitem Bogen an ihm vorbei und verschwand im Nebel. Mannie achtete nicht weiter auf den Hund. Er schlug bibbernd den Kragen seiner Jacke hoch. Ein kalter Schauer rieselte ihm über den Rücken, und plötzlich überkam ihn ein merkwürdiges, beängstigendes Gefühl, ähnlich einer schrecklichen Vorahnung. Abrupt blieb er stehen, starrte mit zusammengekniffenen Augen in die wogenden Nebelschwaden und lauschte. Es war still – viel zu still, wie ihm jetzt erst auffiel. Nicht einmal das Blöken von Milligans Schafen war zu hören. Beklemmendes Schweigen lag über dem Land. Hatte Jock Milligan seine Herde auf eine andere, weiter entfernte Weide getrieben?
In diesem Moment hörte er Rastus erschrocken aufjaulen. Sekunden später hetzte der Hund mit angelegten Ohren an ihm vorbei nach Hause zurück, so schnell seine Beine ihn trugen. Mannie blickte ihm verdutzt nach. Er pfiff, doch Rastus kam nicht zurück. Sein sonderbares Verhalten beunruhigte Mannie noch mehr.
Irgendetwas stimmte nicht.
Langsam ging er weiter. Furcht stieg in ihm auf. Hätte er doch seine Winchester-Büchse mitgenommen! Angestrengt starrte Mannie in den Nebel, ob er irgendwo Schafe ausmachen konnte. Aber da war nichts. Er lauschte, doch kein Laut war zu hören. Die unheimliche Stille lastete so schwer auf dem Land, dass sie beinahe mit Händen zu greifen war.
Plötzlich blieb Mannie wie angewurzelt stehen und riss die Augen auf. Eine klebrige, verklumpte Masse hob sich rot glänzend von dem mit Raureif überzogenen Erdboden ab. Gleich daneben lag ein zerfetztes, blutiges Schaffell.
Mannie stand da wie versteinert, den Blick unverwandt auf die Überreste des Tieres geheftet. Im ersten Moment dachte er, ein streunender Hund hätte ein Lamm gerissen. Da Jock Milligan jeden Penny mindestens zweimal umdrehte, ehe er ihn ausgab, würde er schrecklich wütend sein über den Verlust des Tieres. Schaudernd betrachtete Mannie den Kadaver. Erst jetzt bemerkte er, dass Kopf und Schwanz fehlten. Das war seltsam. Abermals schaute er sich suchend nach der Schafherde um und lauschte, ob irgendwo ein Blöken zu hören war. Doch da war nichts. Die Stille war noch immer so undurchdringlich wie der Nebel. Eine unbestimmte Furcht erfasste Mannie und wühlte wie mit eisigen Fingern in seinen Eingeweiden.
Unschlüssig stand er da und überlegte, was er tun sollte. Da vernahm er unvermittelt ein tiefes, drohendes Knurren. Nie zuvor hatte er ein ähnliches Geräusch gehört. Das Herz schlug ihm bis zum Hals. Das war kein Hund! Wieder verwünschte sich Mannie, dass er seine Winchester zu Hause gelassen hatte, und fragte sich, ob dieser Fehler ihn möglicherweise das Leben kosten würde.
Irgendwo ganz in der Nähe lauerte eine unbekannte Gefahr. Mannie konnte es spüren. Seine Nackenhaare stellten sich auf, so fühlbar knisterte die Luft vor Anspannung. Er drehte sich im Kreis, suchte die Umgebung nach dem wilden Tier ab, das Jocks Schaf gerissen hatte. Er fand einen Stock und hob ihn auf, damit er wenigstens eine behelfsmäßige Waffe hatte, mit der er sich im Notfall verteidigen konnte. Vorsichtig, den Stock in der erhobenen Hand, ging Mannie weiter. Plötzlich sah er vor sich im Nebel die Umrisse eines ausgewachsenen Schafes. Irgendetwas daran kam ihm merkwürdig vor …
Im nächsten Augenblick wusste Mannie, was es war. Nacktes Entsetzen erfasste ihn. Das Schaf schwebte ein Stück über dem Boden scheinbar in der Luft. Eine Blutlache hatte sich unter dem Tier gebildet. Das Blut dampfte, folglich war es noch warm.
Mannie starrte angestrengt in die Nebelschwaden, und mit einem Mal wurde ihm klar, dass das Schaf im Maul eines Raubtiers hing, das ihm seine Zähne in den Rücken gegraben hatte. Auch wenn Mannie nur die mächtigen, blutverschmierten Kiefer und die starren Augen der Bestie erkennen konnte, wusste er, dass er nie zuvor ein solches Tier gesehen hatte.
Abermals stieß es ein drohendes, Furcht einflößendes Knurren aus. Mannie war sicher, dass sein letztes Stündlein geschlagen hatte. Vor seinem geistigen Auge lief in rasender Geschwindigkeit sein ganzes Leben ab – ein Leben, auf das er alles andere als stolz sein konnte. Zwar wurde Mannie respektiert, weil er ein harter Bursche war, aber er hatte keine Familie, die ihn liebte und achtete, und das war allein seine Schuld. Keine Frau war bereit, mit einem Trinker und Raufbold eine Familie zu gründen. Und da Mannie sich nie hatte ändern wollen, war ihm klar, dass er einsam und allein sterben würde.
Vielleicht jetzt und hier …
All seine Instinkte schrien Mannie zu, die Flucht zu ergreifen, wenn ihm sein Leben lieb war, doch die namenlose Angst, die ihn gepackt hatte, lähmte ihn. Er wollte den Stock in seiner Hand schwingen, wollte brüllen, um die Bestie zu verjagen, aber er stand nur da, unfähig, sich zu rühren oder einen Laut von sich zu geben. Er starrte in die kalten Raubtieraugen. Ein Geruch, wie er ihn nie zuvor wahrgenommen hatte, umfing ihn. Es war der Geruch des Todes.
Plötzlich hörte er eiliges Hufgetrappel. Ehe er wusste, wie ihm geschah, wurde er von ein paar Schafen, die in blinder Panik flohen, umgerissen und zu Boden geworfen. Hart stürzte er auf die gefrorene Erde und blieb sekundenlang benommen liegen. Als er sich mühsam aufrappelte, war das Raubtier verschwunden.
Mannie schaute sich ängstlich nach allen Seiten um; dann rannte er los, so schnell seine Beine ihn trugen. Er lief zu seiner Hütte zurück, schnappte sich sein Gewehr, lud es durch und machte sich gleich wieder auf die Suche. Am ganzen Körper zitternd, den Finger nervös am Abzug, kehrte er zu der Stelle zurück, wo er das fremdartige Raubtier gesehen hatte. Doch alles, was er fand, waren weitere gerissene Schafe. Die Bestie blieb spurlos verschwunden.
Schließlich gab Mannie auf. Er brauchte jetzt dringend einen Drink und beschloss, in die Bar zu gehen. Die hatte um diese Zeit zwar noch nicht geöffnet, doch Ryan Corcoran, der Wirt, würde ihm bestimmt schon etwas ausschenken.
Ryan wischte gerade die Theke ab, als Mannie die Tür aufstieß. Der Wirt sah sofort, dass etwas nicht stimmte. Mannie war totenbleich, und seine Hände zitterten.
»Was ist los, Mannie? Hast du ein Gespenst gesehen?« Ryan warf einen Blick aus dem Fenster. Draußen wirbelten noch immer graue Nebelschwaden über das Land.
»Viel schlimmer!«, stieß Mannie atemlos hervor. »Mir ist der Teufel persönlich begegnet!« Er ließ sich schwer auf einen Barhocker fallen.
»Was redest du denn da?« Ryan musterte ihn besorgt. Hatte Mannie jetzt endgültig den Verstand verloren? Er bemerkte die Schmutzspuren auf Mannies Jacke und an einem Ärmel.
»Da draußen treibt sich eine … wilde Bestie herum«, stammelte Mannie und gab dem Wirt mit einer Handbewegung zu verstehen, dass er einen Doppelten brauchte.
»Eine wilde Bestie?« Ryan runzelte die Stirn. Er stellte ein Glas vor Mannie hin, griff nach der Whiskeyflasche und schenkte ein. Er konnte sich nicht erinnern, Mannie jemals so durcheinander erlebt zu haben. Der Fallensteller war als hart gesottener Bursche bekannt, den so schnell nichts umhauen konnte, aber jetzt schien er völlig am Ende.
Mannie nickte. »So was hab ich noch nie gesehen! Der Kopf war mindestens doppelt so groß wie der von ’nem Hund, sag ich dir, und dann dieses grauenhafte Knurren …« Er schauderte. »Meine Haare sind vor Schreck bestimmt schlohweiß geworden.« Er zog seinen Wollhut vom Kopf und warf ihn auf die Theke.
Ryan streifte Mannies Haare mit einem flüchtigen Blick. Sie waren karottenrot wie eh und je, doch ihm fiel auf, dass Mannie trotz der Kälte der Schweiß auf der Stirn stand. Ob er krank war und Fieberfantasien hatte? »Sag mal, Mannie, geht’s dir auch gut? Du bist doch nicht krank?«
»Unsinn!«, brauste Mannie ärgerlich auf. »Ich bin weder krank noch verrückt. Da draußen streift ein gefährliches Untier herum, sag ich dir … ein Raubtier, wie ich noch nie im Leben eins gesehen habe!« Er leerte sein Glas auf einen Zug. »Ich wollte meine Fallen auf Jock Milligans Land kontrollieren. Auf dem Weg dahin hab ich ein blutiges, zerrissenes Schaffell entdeckt. Und dann sah ich die Kreatur …«
»Was du nicht sagst«, bemerkte Ryan beiläufig. Er kannte Mannies Temperament. Es passte zu seinen roten Haaren. »Kann es nicht ein streunender Hund gewesen sein?«
»Niemals!« Mannie schüttelte entschieden den Kopf, griff nach der Whiskeyflasche und schenkte sich erneut ein. »Mit einem anderen Hund würde mein Rastus es mühelos aufnehmen, aber dieses Scheusal, was immer es gewesen ist, hat ihm einen solchen Schreck eingejagt, dass er wie ein Wilder davonrannte. Ich kann von Glück sagen, dass ich noch am Leben bin. Hätte das Ungeheuer nicht ein ausgewachsenes Schaf im Maul gehabt, hätte es mich vermutlich zum Frühstück verspeist.«
»Ein ausgewachsenes Schaf?«, wiederholte Ryan ungläubig. Jetzt übertrieb Mannie aber doch ein wenig. »Mary!«, rief er. Er war gespannt, was seine Frau von dieser Räubergeschichte hielt.
Mary Corcoran kam aus der Küche. Sie hatte sich ein Tuch um den Kopf geschlungen und hielt einen Mopp in der Hand. Als sie Mannie an der Theke sitzen sah, machte sie ein ärgerliches Gesicht. »Du weißt doch, dass du noch nichts ausschenken darfst, Ryan Corcoran!«, schalt sie ihren Mann. »Das könnte uns die Schankkonzession kosten!«
»Reg dich nicht auf, Frau. Mannie braucht den Drink aus gesundheitlichen Gründen. Er hat nämlich einen furchtbaren Schock erlitten.« Ryan erzählte ihr, was geschehen war.
Mary musterte Mannie aufmerksam. Er schien wirklich völlig außer sich zu sein. Mary dachte über Mannies Beschreibung des wilden Tieres nach. »Ob der Tiger zurückgekehrt ist?«, sagte sie dann bedächtig. »Er ist seit Jahren nicht mehr gesehen worden, aber wer weiß?«
»Meinst du wirklich?« Ryan blickte sie zweifelnd an. »Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.«
»Dann stimmt es also, dass sich mal ein Tiger hier in der Gegend rumgetrieben hat?« Mannie hatte in der Bar immer wieder Geschichten darüber gehört, sie aber nie ernst genommen, sondern für Hirngespinste der Einheimischen gehalten.
»Natürlich stimmt das!«, erwiderte Mary entrüstet. Dann fiel ihr ein, dass Mannie ja erst vor ein paar Jahren in die Gegend gezogen war, während ihre Familie schon lange Zeit in Tantanoola lebte, seit Gründung der Stadt. Marys Großvater hatte eines der ersten Häuser, die damals gebaut worden waren, für zwei Pfund und zehn Shilling erstanden. »Vor Jahren ist eine Tigerin mit ihrem Jungen aus dem Käfigwagen eines Zirkus ausgebrochen, der zwischen Mount Graham und dem Overland Inn Station gemacht hatte, in einer Gegend namens Gran-Gran.«
»Wann genau war das?«, fragte Mannie, dem das Raubtier, das er gesehen hatte, nicht mehr aus dem Kopf ging.
»Das war 1883. Obwohl sofort die ganze Gegend abgesucht wurde, blieben die Raubkatzen wie vom Erdboden verschluckt. Damals war alles noch mit undurchdringlichem Gestrüpp überwuchert, was die Suche natürlich erschwerte. Der Zirkus musste weiter, weil er am nächsten Abend eine Vorstellung in Mount Gambier geben sollte, also wurde die Suche nach ein paar Stunden ergebnislos abgebrochen und der Inhaber des Overland Inn über den Vorfall informiert. Zwei Jahre später berichtete ein angesehener und glaubwürdiger Einwohner von Tantanoola, er habe eines Morgens bei einem Spaziergang über sein Grundstück einen Tiger gesehen. Danach hörte man zehn Jahre nichts mehr, niemand bekam die Raubkatzen noch einmal zu Gesicht. In den letzten Jahren aber will der eine oder andere wieder einen Tiger gesehen haben, auch die Zeitungen haben darüber berichtet – nicht nur hier in South Australia, auch in anderen Staaten.«
»Die Tigerin von damals kann es nicht gewesen sein, die ist bestimmt längst tot«, warf Ryan ein. »Es ist siebzehn Jahre her, dass sie mit ihrem Jungen aus dem Käfigwagen ausgebrochen ist.«
Ryan hatte die Geschichten von den Begegnungen mit einem Tiger nie so richtig geglaubt, das wusste Mary nur zu gut. »Ja, da magst du recht haben, aber ihr Junges könnte schon noch am Leben sein. Schließlich können Tiger zwanzig Jahre alt werden, hab ich mal gelesen. Wer weiß – vielleicht ist auch schon wieder eine andere Raubkatze aus einem Zirkus entwischt. Wenn es einmal passiert, kann es auch ein zweites Mal passieren.«
Mannies Augen wurden schmal. War das Tier, das er gesehen hatte, ein Tiger gewesen? Er wusste es nicht, aber möglich wäre es. »Wir müssen eine Suchmannschaft zusammenstellen, die Bestie aufstöbern und sie töten, bevor sie jemanden angreift«, sagte er mit zittriger Stimme.
»Das ist zwecklos, falls es tatsächlich ein Tiger oder eine andere große Raubkatze war«, sagte Mary. »Im Laufe der Jahre hat man die Gegend unzählige Male nach dem ursprünglichen Tiger von Tantanoola abgesucht, aber nie eine Spur von ihm gefunden.«
»Könnte das Tier, das du gesehen hast, nicht doch ein streunender Hund gewesen sein?«, fragte Ryan noch einmal. Er konnte nicht glauben, dass sich ein Tiger in dieser Gegend aufhalten sollte.
»Ich sag dir doch, das war kein Hund!«, fuhr Mannie auf. Es machte ihn wütend, dass man ihm nicht glaubte. »Ein Hund kann kein ausgewachsenes Schaf im Maul herumschleppen! Es war ein riesiges, blutrünstiges Biest! Eine Bestie, wie ich in meinem ganzen Leben noch keine gesehen hab und hoffentlich auch nie wieder sehen werde!«
»Aber es war doch dichter Nebel, man konnte kaum die Hand vor Augen sehen«, gab Ryan zu bedenken.
»Ich weiß, was ich gesehen habe!«, beharrte Mannie. »Hättest du die Überreste des Schafes gesehen, würdest du anders darüber denken.« Er schauderte bei der Erinnerung an das blutverschmierte, zerfetzte Fell und bei dem Gedanken daran, dass er selbst womöglich nur um Haaresbreite dem Tod entronnen war. »Ich werde meine Fallen jedenfalls erst wieder kontrollieren, wenn der Nebel sich verzogen hat.«
»Jemand sollte Jock Milligan warnen und ihm sagen, was mit seinen Schafen passiert ist«, meinte Ryan.
»Also, ich ganz bestimmt nicht«, versetzte Mannie. »Ich hab keine Lust auf eine zweite Begegnung mit der Bestie. Eins steht jedenfalls fest: Ohne mein Gewehr werde ich mein Haus nicht mehr verlassen!« Er schlug mit der flachen Hand auf die Theke, um seinen Worten Nachdruck zu verleihen, rutschte vom Hocker, nickte Ryan und Mary zu und verließ das Lokal.
»Ob er tatsächlich einen Tiger gesehen hat?«, wandte Ryan sich an seine Frau, als die Tür hinter Mannie zugefallen war. »Ich kann das nicht glauben.«
Mary zuckte die Achseln. »Das Tigerjunge von damals wäre inzwischen ziemlich alt, falls es überhaupt noch am Leben ist, aber dass sich ein zweiter Tiger hier in der Gegend herumtreibt, ist doch sehr unwahrscheinlich. Ich glaube eher, dass Mannie einen großen Hund gesehen hat, oder einen Dingo. Er hatte gestern Abend ganz schön gebechert, und in dem dichten Nebel heute Morgen hat er es vermutlich mit der Angst bekommen und Gespenster gesehen.«
Ryan nickte. »Wahrscheinlich hast du recht.«
Noch am selben Nachmittag änderten die Corcorans jedoch ihre Meinung, als Jock Milligan in die Bar kam und eine ähnliche Geschichte wie Mannie erzählte. Er war kurz vor der Mittagszeit draußen auf der Weide gewesen, um nach seinen Schafen zu sehen, als er ein großes Tier zwischen den Bäumen verschwinden sah. Er fand das seltsam, dachte sich aber nichts weiter dabei. Dann jedoch machte er eine beunruhigende Entdeckung: Mehrere Schafe waren gerissen worden, wie er zu seinem Entsetzen feststellen musste. Eins davon hatte er zum Beweis mitgebracht. Als die Corcorans das fürchterlich zugerichtete Tier mit eigenen Augen sahen, berichteten sie Jock von Mannies Besuch und seiner Geschichte über die wilde Bestie.
»Wie sah das Biest denn aus?«, fragte Jock aufgeregt. »War es der Tiger?«
»Mannie konnte nur mit Sicherheit sagen, dass es kein Wildhund war«, antwortete Ryan. »Mary und ich dachten, er hätte vielleicht Fieberfantasien und sich das alles nur eingebildet. Außerdem war er gestern Abend sternhagelvoll, und in so einem dicken Nebel wie heute Morgen verzerren sich die Dinge, oder man sieht etwas, das gar nicht da ist. Wir dachten, Mannie wäre einem streunenden Hund oder einem Dingo begegnet.«
»Ein Dingo bringt so etwas nicht fertig.« Jock deutete mit dem Kinn auf die grausigen Überreste des Schafes. »Ich habe diese Bestie nur ganz kurz gesehen, aber ich wusste sofort, dass es kein Dingo oder irgendein Haustier ist.«
Ryan und Mary sahen sich verdutzt an.
»Sieht ganz so aus, als wäre der Tiger wieder da«, sagte Mary.
1
»Kommen Sie bitte mit, Eliza.«
Eliza Dickens, die an ihrem Schreibtisch in der Zeitungsredaktion der Border Watch in Mount Gambier saß, sprang auf und folgte ihrem Chef in dessen Büro. »Ja, Mr. Kennedy?«
Er drehte sich zu ihr um und schwenkte ihren Artikel in der erhobenen Hand. »So geht das nicht! Ich habe Ihnen schon hundert Mal gesagt, dass wir kein Klatschblatt sind!«
»Das ist kein Klatsch, Sir, das ist die Wahrheit«, behauptete Eliza im Brustton der Überzeugung.
»Unsere Leser brauchen nicht zu erfahren, dass Ihrer Meinung nach eine gewisse Person, die in unserer Stadt großes Ansehen genießt«, er blickte sich rasch nach allen Seiten um, weil er sichergehen wollte, dass die Unterhaltung mit seiner jungen Reporterin nicht belauscht wurde, »eine andere gewisse Person eingestellt hat, weil diese von der Natur so großzügig bedacht wurde.«
»Ich finde schon, dass unsere Leser das erfahren sollten, wenn diese gewisse Person qualifiziertere Bewerberinnen für die Stelle einer Bürokraft abgelehnt hat, weil sie von der Natur nicht so großzügig bedacht wurden«, widersprach Eliza.
George Kennedy seufzte tief. Wie sehr er Fred Morris vermisste! Auch nach Monaten hatte er es noch nicht verschmerzt, dass sein langjähriger bester Reporter sich zur Ruhe gesetzt hatte. Als Ersatz hatte er Eliza und einen jungen Mann namens Jimmy Connelly eingestellt, doch keiner von beiden konnte Fred das Wasser reichen. »Ich kann das nicht drucken, Eliza«, sagte er entschieden. »Was ich brauche, sind Fakten. Nachrichten. Richtige Nachrichten.«
»Mira Hawkins hätte die Stelle bei Mitchell’s nie bekommen, würde sie keine tief ausgeschnittenen Kleider tragen«, versetzte Eliza trotzig. »Jeder weiß doch, dass sie bestenfalls bis zehn zählen kann und keine Ahnung hat, welches Ende des Bleistifts zum Schreiben taugt. Und ausgerechnet so jemand wird als Bürokraft eingestellt? Können Sie mir das vielleicht erklären?« Schmollend fügte sie hinzu: »Margaret Fawster hätte die Stelle bekommen müssen.«
George Kennedy war mittlerweile so genervt, dass es ihm egal war, ob jemand in der Druckerei nebenan ihn hören konnte. »Das sind Spekulationen, Eliza, keine Tatsachen. Wenn ich das drucke, kriege ich eine Klage an den Hals. Außerdem fehlt es Ihnen in diesem Fall an der nötigen Objektivität.« Eine ergrauende Augenbraue hochgezogen, fuhr er fort: »Ich weiß, dass Sie mit Miss Fawster befreundet sind.«
»Das tut nichts zur Sache«, gab Eliza störrisch zurück. »Margaret ist eine sehr intelligente Frau.«
»Dann wäre mein Job vielleicht genau das Richtige für sie«, meinte George trocken. »Vielleicht gelingt es ihr ja, einen richtigen Reporter aufzutreiben, der ein Gespür für echte Neuigkeiten hat.«
»Das bezweifle ich. In dieser Stadt passiert doch nie etwas wirklich Interessantes.«
»Ein guter Reporter hat eine Nase für lohnenswerte Geschichten, Eliza, das habe ich Ihnen schon hundertmal gesagt. Und wenn Ihre Nase Sie im Stich lässt, sollten Sie sich vielleicht eine Stelle in einem Bekleidungsgeschäft suchen, so wie Ihre Schwester.«
Eliza presste zornig ihre vollen Lippen zusammen. Sie hasste es, mit ihrer Schwester Katie verglichen zu werden. Schlimm genug, dass ihre Mutter ihr Katie immer als Vorbild hinstellte. Eliza liebte ihre Schwester, doch es störte sie, dass Katie keinerlei Ehrgeiz hatte. Ihr einziges Ziel war, den gut aussehenden Thomas Clarke zu heiraten und einen ganzen Stall voll Kinder zu bekommen. Eliza hingegen wollte etwas erleben, bevor sie sich einen Ehemann suchte und eine Familie gründete. Sie hoffte, in ihrem Beruf würde sich ausreichend Gelegenheit bieten, ihre Abenteuerlust zu stillen. »Ich verspreche Ihnen, dass ich mich künftig mehr anstrengen werde, Sir, aber …«
George Kennedy schnitt ihr mit einer Handbewegung das Wort ab. »Ich habe jetzt keine Zeit, weiter mit Ihnen darüber zu diskutieren, Eliza. Haben Sie zufällig Jimmy gesehen? Ich habe da etwas für ihn, um das er sich kümmern sollte.«
Eliza wurde hellhörig. Das klang nach einem wichtigen Auftrag. »Worum handelt es sich denn, Sir?«, fragte sie neugierig.
»Er soll nach Tantanoola und überprüfen, was es mit dieser Tigergeschichte auf sich hat.« George eilte auf der Suche nach seinem jungen Reporter über den Flur. Er merkte gar nicht, dass Eliza ihm folgte.
»Tigergeschichte?«, wiederholte sie verblüfft. »Ist der Tiger von Tantanoola etwa zurückgekehrt?«
Ohne stehen zu bleiben, während er im Vorbeigehen einen Blick in die Büros entlang des Flurs warf, antwortete George: »Die Einheimischen glauben es jedenfalls. Einige von ihnen wollen den Tiger gesehen haben. Außerdem wurden ein paar Schafe gerissen.«
»Das klingt ja schrecklich aufregend! Kann ich das nicht übernehmen, Mr. Kennedy?«
George hielt inne und blickte sie stirnrunzelnd an. »Nein, ich schicke lieber Jimmy. Sie würden ja doch nur einen Haufen Klatsch zusammenschreiben.«
Eliza wollte auffahren, beherrschte sich aber, weil sie den Auftrag unbedingt haben wollte. »Ich verspreche Ihnen, ich werde Ihnen eine großartige Story liefern, die ausschließlich auf Tatsachen beruht. Bitte, Mr. Kennedy!«, bettelte sie. »Wie soll ich Ihnen denn beweisen, was ich kann, wenn Sie mir keine Chance geben?«
»Falls der Tiger sich tatsächlich wieder in der Gegend von Tantanoola aufhält, ist das die beste Story seit Wochen. Ein Knüller! Ich kann es mir nicht leisten, eine blutige Anfängerin darauf anzusetzen, die womöglich alles vermasselt.«
»Aber Jimmy ist doch auch Anfänger! Er hat nicht mehr Erfahrung als ich. Ich werde es ganz bestimmt nicht vermasseln, Mr. Kennedy! Ich werde Ihnen eine fantastische Geschichte liefern, das verspreche ich. Wenn nicht, können Sie mich rausschmeißen, ohne dass Sie auch nur ein Wort des Widerspruchs von mir hören werden.«
»Klingt verlockend«, bemerkte George trocken. Doch er spürte, dass er schwach wurde. Er mochte Eliza Dickens, und das wusste sie genau. Sie war gerade einmal neunzehn Jahre alt und überaus begeisterungsfähig. Doch George hätte nie gedacht, dass es so schwer wäre, ihren unbändigen Tatendrang in die richtige Richtung zu lenken. Sie erinnerte ihn an den jungen Mann, der er vor fast dreißig Jahren gewesen war – was er ihr gegenüber allerdings niemals zugeben würde. Der Punkt war der, dass er den wirtschaftlichen Aspekt nicht aus den Augen verlieren durfte: Die Auflage seiner Zeitung war rückläufig. Er würde Eliza tatsächlich entlassen müssen, wenn sie sich nicht mehr Mühe gab. Das war auch der Grund, warum er ihr gegenüber immer wieder andeutete, dass sie sich vielleicht ein anderes Betätigungsfeld für ihre Begabungen suchen sollte. Im Grunde wollte er sie nicht feuern; deshalb versuchte er stets, sie bei ihrem Ehrgeiz und ihrem Stolz zu packen.
»Ich glaube nicht, dass Ihre Eltern einverstanden wären, wenn Sie ganz allein nach Tantanoola fahren würden, Eliza. Zumal Sie im dortigen Hotel übernachten müssten.«
Sein Widerstand erlahmte zusehends. Nicht mehr lange, und sie hatte ihn herumgekriegt, das spürte Eliza genau. Sie fand den Gedanken, fern von zu Hause ganz allein für einen Artikel zu recherchieren, herrlich aufregend. »Wenn meine Eltern nichts dagegen haben, lassen Sie mich dann gehen?«
George seufzte, dachte kurz nach und erwiderte: »Also gut, meinetwegen. Aber nur, wenn sie wirklich einverstanden sind.« Wie er Henrietta Dickens kannte, würde sie ihrer Ältesten die Fahrt nach Tantanoola sowieso nicht erlauben, deshalb ging ihm seine Zusage leicht über die Lippen. »Sie müssen mir aber heute noch Bescheid geben, Eliza. Die South Eastern Times in Millicent wird garantiert auch jemanden schicken, und ich will nicht, dass sie uns die Story vor der Nase wegschnappen.«
»Keine Sorge, Sir«, entgegnete Eliza aufgeregt. »Ich werde gleich mit meinen Eltern reden und Ihnen sofort Bescheid sagen.«
Henrietta Dickens reagierte panisch, als ihre Tochter ihr erklärte, dass sie nach Tantanoola fahren wolle und weshalb das so wichtig für sie sei.
»Tantanoola? Das kommt überhaupt nicht in Frage, Eliza!«
Eliza hatte zwar mit Einwänden gerechnet, aber nicht mit einem kategorischen Nein. »Das ist die beste Story seit Wochen, Mom! Eine einmalige Chance für mich! Dann kann ich Mr. Kennedy endlich zeigen, was in mir steckt. Ich muss einfach dahin!«
»Das ist viel zu gefährlich, Eliza. Ein Tiger! Ich werde nicht zulassen, dass meine Älteste bei dem Versuch, eine Story zu bekommen, von einem Raubtier gefressen wird.«
Eliza verdrehte die Augen angesichts dieser dramatischen Übertreibung. »Um Himmels willen! Ich hab doch nicht vor, auf Tigerjagd zu gehen. Mr. Kennedy interessiert sich für den menschlichen Aspekt der Geschichte … wie die Farmer mit der Situation umgehen und solche Dinge.« Dass sie im Hotel würde übernachten müssen, hatte sie vorsichtshalber noch nicht erwähnt. Eins nach dem andern, sagte sie sich.
»Ich habe Nein gesagt, Eliza. Und jetzt will ich nichts mehr davon hören«, erwiderte Henrietta energisch.
Eliza wunderte sich über diese unnachsichtige Strenge. Plötzlich durchzuckte sie ein Gedanke. »Du willst nicht, dass ich nach Tantanoola fahre, weil Tante Matilda dort lebt. Das ist der wahre Grund, stimmt’s?«
Henrietta sprach nur selten von ihrer einzigen Schwester, und wenn, bezeichnete sie Matilda stets als das schwarze Schaf der Familie. Die beiden Schwestern hatten das letzte Mal Kontakt gehabt, als Eliza noch gar nicht auf der Welt gewesen war. Henriettas Miene verriet Eliza, dass sie mit ihrer Vermutung richtig lag.
»Lass Matilda aus dem Spiel«, erwiderte Henrietta mit versteinerter Miene. »Wieso nimmst du dir nicht ein Beispiel an Katie? Die käme nie auf eine so verrückte Idee!«
»Weil sie so langweilig ist wie eine Wasserpfütze.«
»Sei nicht so grausam, Eliza«, tadelte ihre Mutter. »Katie hat eine gute Anstellung in Miss Beatrice’ Bekleidungsgeschäft und ist mit einem netten jungen Mann befreundet, den eine glänzende Zukunft erwartet. Eines Tages wird Thomas das Möbelgeschäft seines Vaters erben, und Clarkes Möbelhaus läuft ausgezeichnet.«
Eliza machte ein zerknirschtes Gesicht. Sie hatte ihre Schwester nicht beleidigen wollen. Sie liebte Katie. Die gemeine Bemerkung war ihr nur herausgerutscht, weil sie sauer auf ihre Mutter war. »Ich bin aber nicht Katie, und ich wünschte, du würdest sie mir nicht ständig als Vorbild hinstellen. Ich liebe meinen Beruf, ich will eine gute Reporterin werden, und jetzt habe ich die Chance auf einen sensationellen Artikel.«
»Ich will dich ja nicht davon abhalten, Artikel zu schreiben, Eliza. Ich will nur nicht, dass du das ausgerechnet in Tantanoola tust.«
»Warum denn nicht?«, beharrte Eliza. »Sag jetzt bloß nicht, weil du Angst hast, ich könnte vom Gegenstand meiner Geschichte gefressen werden! Ich bin neunzehn und kein Baby mehr.«
»Eben. Anstatt in der Weltgeschichte herumzureisen, solltest du dir lieber einen netten jungen Mann suchen und eine Familie gründen«, sagte Henrietta. Es war ihr unbegreiflich, wie ihre Tochter all die jungen Männer, die sichtlich Interesse an ihr zeigten, einfach ignorieren konnte. »Katie ist zwei Jahre jünger als du und wird wahrscheinlich noch vor dir zum Traualtar schreiten.«
»Soll sie doch«, gab Eliza achselzuckend zurück. »Ich will nicht wie Katie sein, Mom, oder wie du. Ich will mehr vom Leben, als Ehefrau und Mutter einer Horde von Kindern zu sein, denen ich ständig die Nase putzen muss. Dafür habe ich noch Zeit genug, wenn ich älter bin.«
Henrietta presste die Lippen aufeinander und atmete geräuschvoll ein. »Nach Tantanoola wirst du jedenfalls nicht fahren. Das ist mein letztes Wort. Mount Gambier ist viel größer als Tantanoola. Wenn es dir nicht gelingt, hier etwas zu finden, über das zu schreiben sich lohnt, bist du vielleicht nicht gut genug in deinem Beruf.« Sie konnte sehen, dass sie ihre Tochter mit diesen Worten verletzt hatte, aber das kümmerte sie nicht. Für Henrietta stand zu viel auf dem Spiel.
Eliza hätte weinen können vor hilfloser Enttäuschung und ballte zornig die Fäuste. In diesem Moment sah sie ihren Vater in den Hof reiten. Er war mit King Solomon, seinem preisgekrönten Hengst, in der Gegend von Dartmoor gewesen und hätte eigentlich erst am Abend zurückkommen sollen. Elizas Miene hellte sich auf. Ihr Vater kam ihr wie gerufen. Sie eilte nach draußen und lief zu den Ställen, wo er den Hengst abzäumte.
»Hallo, Dad«, begrüßte sie ihn mit zuckersüßer Stimme. »Wie war’s? Hattest du einen schönen Tag mit King?«
Richard Dickens lachte. »Hallo, mein Schatz. Ja, es war wunderbar. Er liebt diese langen Ausritte, das weißt du ja. Außerdem ist er mit ein paar Stuten zusammengekommen, die in einigen Wochen hierher gebracht werden sollen, damit er sie decken kann. Das gibt bestimmt ein paar prächtige Fohlen. Aber sag mal, wieso bist du eigentlich schon zu Hause?« Er sah seine Tochter fragend an. »Gibt es in der Redaktion nichts für dich zu tun? Musst du keine Artikel schreiben?«
Elizas Miene verdüsterte sich, als sie wieder an den Tiger von Tantanoola dachte. Sie wünschte sich nichts sehnlicher, als über ihn berichten zu dürfen. »Es gibt da etwas, über das ich sehr gern schreiben würde, eine packende Geschichte, aber Mom verbietet es mir.« Die angestaute Enttäuschung brach sich Bahn, und ihr kamen die Tränen. Ihrem Vater gegenüber schämte sie sich ihrer Gefühle nicht, weil es Richard nie in den Sinn käme, sie zu verurteilen.
»Na, na, Liebes, wer wird denn gleich weinen.« Begütigend legte er seinen Arm um sie. »Was ist denn passiert?«
Eliza vertraute sich ihm an und fügte hinzu: »Ich glaube, Mom will mich nicht nach Tantanoola gehen lassen, weil Tante Matilda dort wohnt. Aber das ist nicht fair!«
Schon bei Elizas ersten Worten war Richard zusammengezuckt. Er hatte lange Zeit nicht mehr an die Schwester seiner Frau und an die Vergangenheit gedacht, doch ihm war sofort klar, weshalb Henrietta nicht wollte, dass ihre Tochter nach Tantanoola ging. Ein trauriger Ausdruck erschien in Richards Augen, doch Eliza bemerkte es nicht. »Komm, wir reden noch einmal mit ihr«, sagte er. »Ich bin sicher, wir werden eine Lösung finden.«
Als Henrietta ihren Mann und ihre Tochter Arm in Arm in Richtung Haus schlendern sah, konnte sie sich schon denken, was die beiden beredet hatten. Sie straffte sich und bereitete sich auf die bevorstehende Konfrontation vor. Richard ergriff bei jeder Auseinandersetzung Partei für Eliza, und das machte Henrietta wütend. Sie wusste genau, warum er immer zu ihrer Tochter hielt: Sie erinnerte ihn an Matilda.
Richard gab seiner Frau zur Begrüßung einen Kuss auf die Wange und setzte sich dann in einen der bequemen Sessel ihres behaglich eingerichteten Wohnzimmers.
»Wie war die Reise?«, erkundigte Henrietta sich förmlich, als sie ihrem Mann Tee einschenkte. Weder sie noch Richard fand diese Reserviertheit seltsam; ihre Beziehung war von Anfang an nicht allzu herzlich gewesen.
»Gut. King Solomon wird nächstes Jahr prachtvollen Nachwuchs bekommen, denke ich.« Richard nippte am Tee und ließ den Blick zwischen Frau und Tochter hin und her schweifen. Die Spannungen zwischen beiden entgingen ihm nicht. »Eliza hat mir erzählt, dass ihr ein interessanter Auftrag angeboten wurde. Sie soll über den Tiger von Tantanoola berichten«, fuhr er fort. Sein Tonfall verriet, dass er von dieser Idee sehr angetan war.
»Stimmt, aber ich habe ihr gesagt, dass sie sich das aus dem Kopf schlagen kann«, erwiderte Henrietta mit finsterer Miene.
»Warum? Sie ist doch jetzt alt genug, dass sie ein paar Tage allein auswärts verbringen kann.« Obwohl der Name Matilda nicht fiel, wussten beide genau, dass sie der wahre Grund für Henriettas Widerstand war.
»Das ist viel zu gefährlich.« Henrietta knetete nervös die Hände. Sie konnte ihre Gefühle nur mühsam unterdrücken.
»Der Tiger ist seit Jahren angeblich immer wieder in der Gegend gesehen worden, aber es kam nie zu einem ernsthaften Zwischenfall«, sagte Richard. »Und Eliza wird vorsichtig sein – nicht wahr, mein Schatz?« Er lächelte seiner Tochter über den Rand seiner Tasse hinweg zu.
Henrietta brannten Tränen in den Augen. »Ich will aber nicht, dass sie nach Tantanoola geht!«, stieß sie hervor. »Das habe ich ihr auch klipp und klar gesagt, und damit ist das Thema für mich erledigt.« Sie stand auf und wollte aus dem Zimmer eilen, um jeder weiteren Diskussion aus dem Weg zu gehen.
Richard war es gewohnt, dass seine Frau eine Konfrontation scheute. Sie war nicht imstande, ihre Gefühle zu zeigen, sei es Zorn oder Zuneigung. Stattdessen zog sie sich zurück, wenn sie ihren Willen nicht durchsetzen konnte. Matilda war da ganz anders gewesen.
»Und ich sage, sie kann gehen«, versetzte Richard in einem Tonfall, den er seiner Frau gegenüber höchst selten anschlug. »Wir sollten uns geschmeichelt fühlen, dass George Kennedy so viel Vertrauen in Eliza setzt. Wenn sie ihre Sache gut macht – und daran zweifle ich nicht –, wird es ihrer Karriere förderlich sein.«
Henrietta war abrupt stehen geblieben und hatte sich langsam umgedreht. Ihre Miene verriet, wie wütend sie war. Obwohl es sie nicht überraschte, dass ihr Mann auch dieses Mal zu Eliza hielt, machte es sie rasend. »Na schön. Ich wollte zwar nichts sagen, aber du zwingst mich dazu. Matilda hat uns vor Jahren deutlich zu verstehen gegeben, dass sie uns nie mehr sehen will. Ich kann das zwar nicht verstehen und finde es auch nicht richtig, aber wir sollten es respektieren. Deshalb möchte ich nicht, dass unsere Töchter Kontakt zu ihr aufnehmen. Es war Matildas Entscheidung, sich von uns und von der Welt zurückzuziehen, also soll sie auch damit leben.«
Betretenes Schweigen entstand nach diesen harten Worten. Henrietta hatte ihren Töchtern nie erklärt, warum ihre Schwester Matilda nichts mehr mit ihrer Familie zu tun haben wollte, sondern lediglich angedeutet, dass Matilda einen schrecklichen Unfall gehabt hatte, der tiefe körperliche und seelische Narben hinterlassen und sie zum weitgehenden Rückzug aus der Öffentlichkeit bewogen hatte.
Eliza brach das Schweigen als Erste. Sie wählte ihre Worte mit Bedacht. »Ich verspreche, dass ich Tante Matilda aus dem Weg gehe, Mom.«
»In einer kleinen Stadt wie Tantanoola kann man sich nicht aus dem Weg gehen, Eliza.«
»Das finde ich nicht«, widersprach Eliza. »Mr. Kennedy möchte, dass ich mich darauf konzentriere, wie die Farmer mit der Situation umgehen und wie sie den Verlust ihrer Schafe verkraften. Das heißt, ich werde mich hauptsächlich auf den Farmen aufhalten. Und selbst wenn ich Tante Matilda auf der Straße begegne – ich würde sie ja gar nicht erkennen, genauso wenig wie sie mich.«
Wieder breitete sich Schweigen aus. Schließlich seufzte Henrietta tief. Sie stand auf verlorenem Posten, das wusste sie. Sie kannte ihre Tochter. Falls Eliza auch nur den leisesten Verdacht schöpfte, dass mehr hinter Matildas Rückzug in die Abgeschiedenheit steckte, würde sie nicht ruhen, bis sie die Hintergründe herausgefunden hätte. »Mir wäre es wirklich lieber, du würdest nicht nach Tantanoola fahren, Eliza. Aber ich sehe schon, du wirst keine Rücksicht auf meine Wünsche nehmen, zumal du ja deinen Vater hinter dir weißt.« Sie bedachte ihren Mann mit einem vernichtenden Blick.
»Die Story zu schreiben bedeutet mir unendlich viel, Mom«, sagte Eliza eindringlich.
»Dann versprich mir wenigstens, dich von Matilda fernzuhalten.« Henrietta sah ihren Mann beschwörend an, damit er sie wenigstens in diesem Punkt unterstützte.
»Du sollest tun, was deine Mutter verlangt, Eliza«, sagte Richard angespannt. Als sie Matilda das letzte Mal gesehen hatten, waren er und Henrietta noch nicht einmal verheiratet gewesen. Sie hatten ihre Töchter nie bewusst von Tantanoola ferngehalten. Selbst heute, nach so vielen Jahren, verstand Richard nicht, weshalb Matilda den Kontakt vollständig abgebrochen hatte, doch er respektierte ihre Entscheidung.
»Ja, Vater«, sagte Eliza gehorsam. »Ich verspreche, dass ich Tante Matilda nicht belästige.«
Henrietta gab es einen Stich. »Wie lange wirst du wegbleiben?«
»Ich weiß noch nicht genau. Mr. Kennedy meinte, ein paar Tage, vielleicht auch ein bisschen länger …«, antwortete Eliza ausweichend. War sie erst einmal in Tantanoola und außerhalb des elterlichen Einflussbereichs, würde sie bleiben können, so lange sie wollte.
»Und wo wirst du wohnen?«, fragte Henrietta.
Abermals hielt Eliza es für klüger, sich nicht festzulegen. »Mr. Kennedy wird sich um eine Unterkunft kümmern. Sobald ich Genaueres weiß, sage ich euch Bescheid. Ich werde euch keine Schande machen«, fügte sie hinzu. »Ich möchte, dass ihr stolz auf mich sein könnt.«
»Das sind wir auch, mein Schatz.« Richard drückte ihr einen Kuss aufs Haar. Eliza blickte lächelnd zu ihm auf. Sie war ihm dankbar für seine Unterstützung.
Henrietta beobachtete die beiden mit säuerlicher Miene. Eliza erinnerte sie fatal an Matilda. Ihre Schwester hatte Richard mit der gleichen Mühelosigkeit um den Finger gewickelt.
»Ich werde Mr. Kennedy Bescheid sagen, dass ich gleich morgen früh fahren kann!«, sagte Eliza erfreut. Sunningdale, die Farm der Familie Dickens, die nach Henriettas Eltern, den Dales, benannt worden war, lag drei Meilen außerhalb der Stadt. Sie würde es also gerade noch rechtzeitig vor Büroschluss schaffen.
Eliza verabschiedete sich von ihren Eltern, lief aufgeregt nach draußen und stieg auf ihren Einspänner. Als der Wagen vom Hof rollte, drehte Henrietta sich zu ihrem Mann um. Ihre Augen funkelten vor Zorn.
»Warum fällst du mir jedes Mal in den Rücken? Ich habe Eliza verboten, nach Tantanoola zu fahren, und dann kommst du und erlaubst es ihr!«
»Das hätte ich sicher nicht getan, wenn du einen triftigen Grund für dein Verbot gehabt hättest, Henrietta.«
»Einen triftigen Grund? Dieser Auftrag ist gefährlich! Wir reden hier von einem Tiger!«
Richard machte eine wegwerfende Handbewegung. »Dir geht es doch gar nicht um den Tiger, den es wahrscheinlich nicht einmal gibt. Wenn du ehrlich bist, hast du nur Angst, Eliza und Matilda könnten sich begegnen.« Henrietta wollte bloß nicht, dass Eliza die alte Geschichte herausfand, da war Richard sicher: Er und Matilda waren einst ein Liebespaar gewesen, und er hatte eigentlich sie und nicht Henrietta heiraten wollen.
»Und du hoffst, Eliza würde Matilda begegnen, weil es dir selbst nicht vergönnt ist!«, entgegnete Henrietta hitzig, auf deren Wangen sich hektische rote Flecken gebildet hatten.
Richard blickte sie fassungslos an. »Was redest du denn da? Wenn ich Matilda sehen wollte, bräuchte ich doch nur nach Tantanoola zu fahren.«
»Dann fahr doch!«
Ihre Aggressivität verwunderte Richard. Außerdem hatte er Henrietta versprochen, Matilda nie mehr wiederzusehen. »Es ist Jahre her, seit wir erfahren haben, dass sie in Tantanoola lebt«, antwortete er ausweichend. »Vielleicht ist sie längst weggezogen.«
Daran hatte Henrietta überhaupt noch nicht gedacht. Ihre maßlose Eifersucht trübte offenbar ihren Verstand. »Du lässt dich von Eliza um den Finger wickeln, weil sie dich an Matilda erinnert«, warf sie ihrem Mann vor.
Richard nickte. »Sie ist ihr sehr ähnlich, das stimmt.« Er wusste, seine Frau hatte damit gerechnet, dass er es abstreiten würde. »Sie sprüht vor Temperament und brennt darauf, etwas aus ihrem Leben zu machen. Matilda war genauso … bis zu ihrem Unfall«, fügte er leise hinzu. Einen Augenblick schien er einen inneren Kampf auszufechten; dann räusperte er sich und fuhr fort: »Ich hoffe aufrichtig, Eliza wird so bleiben, wie sie ist.«
»Du wünschst, alles wäre anders gekommen, nicht wahr?«, sagte Henrietta voller Bitterkeit. Der Gedanke begleitete sie seit vielen Jahren, aber jetzt erst fand sie den Mut, ihn auszusprechen. Sie war es leid, ihre Gefühle zu verbergen.
Richard seufzte. »Es ist nun mal so, wie es ist, Henrietta. Außerdem sind wir doch glücklich miteinander, oder nicht? Und wir haben zwei prachtvolle, hübsche Töchter.«
Henrietta nickte, doch in ihren Augen schimmerten Tränen. Ihr Mann hatte ihr nicht widersprochen, und das war ihr nicht entgangen.
»Ich habe die Vergangenheit schon vor langer Zeit losgelassen, Liebes«, sagte Richard und streichelte ihr zärtlich die Wange. Er wollte hinzufügen, dass er seine Entscheidung nicht bereue, besann sich dann aber anders, weil es eine Lüge gewesen wäre: Er hätte Matilda nicht einfach gehen lassen dürfen; das bereute er noch heute. Sie hatte sich nach ihrem Unfall geweigert, ihn zu sehen, was aber nichts an Richards Gefühlen für sie änderte. Sein Herz gehörte zum größten Teil Matilda. Den Rest konnte er Henrietta nur borgen.
Sie schwieg. Die Traurigkeit in Richards Stimme schmerzte sie in der Seele. In ihrem Innern wusste sie, dass ihr Mann ihre Schwester immer noch liebte. Wäre dieser schreckliche Unfall nicht gewesen, wären Richard und Matilda auch heute noch ein Paar.
2
George Kennedy verschlug es die Sprache, als Eliza in sein Büro stürmte und ihm freudestrahlend verkündete, dass ihre Eltern ihr erlaubt hätten, nach Tantanoola zu fahren.
»Mein Vater ist sehr stolz, dass Sie so viel Vertrauen in mich setzen!«, fügte sie aufgeregt hinzu.
George räusperte sich. »Tatsächlich? Und was sagt Ihre Mutter dazu?«
»Anfangs war sie nicht sehr angetan von der Idee. Aber zu guter Letzt hat sie eingesehen, dass dieser Auftrag mir sehr viel bedeutet, und war einverstanden.« Ohne das Eingreifen ihres Vaters hätte Henrietta niemals ihre Einwilligung gegeben, das wusste Eliza. Sie konnte froh sein, ihn auf ihrer Seite zu haben.
»Was Sie nicht sagen!« George war sicher gewesen, dass Henrietta ihrer Tochter verbieten würde, nach Tantanoola zu fahren; deshalb hatte er Jimmy bereits gesagt, er solle ein paar Sachen packen. Zum Glück hatte er keine weiteren Einzelheiten preisgegeben, sonst käme es unweigerlich zu einem Zusammenstoß zwischen seinen beiden Jungreportern, die auf der Jagd nach guten Storys erbitterte Rivalen waren.
»Mir scheint, Sie haben nicht damit gerechnet, dass ich die Erlaubnis von meinen Eltern bekomme«, stellte Eliza fest, die ihrem Chef ansehen konnte, wie überrascht er war.
»Nun, ich … ja, ich dachte, Ihre Eltern hätten gewisse Vorbehalte.«
»Zum Glück haben sie genauso viel Vertrauen in mich wie Sie, Sir«, erwiderte Eliza ein wenig spöttisch.
»Ja, zum Glück«, murmelte George seufzend.
»Machen Sie sich keine Sorgen, Mr. Kennedy, ich werde Sie nicht enttäuschen.«
»Das hoffe ich, Eliza. Unsere Auflage ist gesunken …«
»Das wird sich ändern, Sir, Sie werden schon sehen! Ich werde einen fantastischen Artikel schreiben«, versprach sie. »Ich fahre gleich nach Hause und packe meinen Koffer. Morgen früh bin ich pünktlich wieder hier.«
George blickte sie verdutzt an. »Einen Koffer werden Sie nicht brauchen, Eliza. Packen Sie nur das Nötigste. Sie fahren nicht nach Tantanoola, um Ihre schönen Kleider vorzuführen, vergessen Sie das nicht. Sie sollen Stoff für eine gute Story sammeln, und das könnte bedeuten, dass Sie mit einem Farmer durch einen schlammigen Pferch stapfen und sich die schaurigen Überreste seiner Schafe ansehen müssen.«
Jetzt war es Eliza, die ein verdutztes Gesicht machte. »Das weiß ich, Mr. Kennedy«, sagte sie kleinlaut. In Wahrheit war ihr der Gedanke, im Schlamm herumwaten und einen blutigen Kadaver begutachten zu müssen, noch gar nicht gekommen. »Aber als Reporterin der Border Watch möchte ich einen guten Eindruck hinterlassen.«
»Das werden Sie ganz bestimmt. Dennoch möchte ich Sie bitten, nur das Nötigste mitzunehmen. Vielleicht werden Sie nur kurze Zeit in Tantanoola bleiben. Soviel ich weiß, haben die Einheimischen einen Jäger angeheuert, weil mehrere Farmer viele Schafe verloren haben.« Je länger Eliza am Ort des Geschehens blieb, desto größer war die Wahrscheinlichkeit, dass sie alles verpatzte; deshalb hoffte George, ihr Aufenthalt in Tantanoola wäre nur von kurzer Dauer. »Sehen Sie zu, dass Sie schnellstmöglich Material für Ihre Geschichte zusammenkriegen. Dann kommen Sie hierher zurück, damit ich den Artikel drucken kann. Und denken Sie immer daran, Eliza: Nachrichten sind Tatsachen ohne die Wiedergabe Ihrer persönlichen Meinung.«
»Ich werde daran denken, Sir«, versicherte sie.
»Gut. Und jetzt gehen Sie hinunter ins Archiv und lesen nach, was im Lauf der Jahre über den Tiger geschrieben worden ist.«
Eliza machte große Augen. »Jetzt gleich, Sir?«
»Ja, jetzt gleich. Worauf warten Sie? Sie müssen informiert sein, damit Sie die richtigen Fragen stellen können. Nur so bekommt man eine gute Story.«
Eliza ließ sich ihr Unbehagen nicht anmerken. Das Archiv befand sich im Keller, wo es immer kalt und düster war. Sie ging nicht gern dort hinunter und drückte sich davor, wann immer sie konnte. »In Ordnung, Sir«, murmelte sie schicksalsergeben.
»Und vergessen Sie nicht abzuschließen, wenn Sie gehen. Ich mache Schluss für heute.«
Elizas Entsetzen wuchs, als sie das hörte. Die anderen hatten längst Feierabend gemacht; das bedeutete, dass sie ganz allein im Gebäude sein würde. »Ist gut, Sir«, sagte sie dennoch tapfer. »Dann bis morgen. Ich werde noch einmal ins Büro kommen, bevor ich zum Bahnhof gehe.«
»Gut. Dann kann ich Ihnen das Geld für Ihre Auslagen gleich mitgeben.« George war aufgestanden und hatte sich sein Jackett übergestreift. »Gute Nacht, Eliza.« Damit verließ er das Büro.
Eliza stieg in den Keller hinunter und suchte sämtliche Artikel heraus, die vom Tiger von Tantanoola handelten. Es war ihr nicht geheuer im Archiv, wo dunkle Schatten zwischen den langen Regalreihen lauerten, Spinnen die Wände hinaufkrochen und man das Gebäude in der hereinbrechenden kühlen Nacht ächzen und knarren hörte. Aber sie bekämpfte ihre Furcht, indem sie sich auf ihre Lektüre konzentrierte.
Die Beschreibungen des Raubtiers wichen voneinander ab, einige Geschichten von angeblichen Begegnungen mit dem Tiger waren schlichtweg unglaubwürdig. Elizas lebhafte Fantasie fand reichlich Nahrung, und sie vergaß alles rings um sie her.
Die Zeit verging wie im Flug. Erstaunt stellte sie fest, wie spät es schon war, als sie nach einer ganzen Weile auf die Uhr schaute. Ihre Eltern würden sich bestimmt schon Sorgen machen. Sie sprang auf, um die dicken Zeitungsbündel an ihren Platz zurückzulegen, und stieß gegen eine Schachtel auf einem Bord unmittelbar über ihr. Die Schachtel fiel auf den Fußboden, der Deckel rutschte herunter, und ein Stapel loser Blätter flatterte auf den Boden.
»Verflixt«, murmelte Eliza verärgert, als sie sich bückte, um die Blätter einzusammeln. Das hatte ihr gerade noch gefehlt. Sie wollte doch schnell nach Hause! Plötzlich fiel ihr Blick auf eine einzelne, zusammengefaltete Zeitungsseite. Neugierig faltete sie das Papier auseinander. Es war ein Artikel über einen Unfall. Ein Schauder rieselte ihr über den Rücken, als sie die tragischen Einzelheiten las. Merkwürdig nur, dass die Namen der Beteiligten nicht genannt waren. Der Artikel stammte von 1880 und war von ihrem Chef verfasst worden, als dieser noch ein junger Reporter gewesen war. Eliza runzelte die Stirn. Wieso steckte die Seite zwischen all den Blättern, die inhaltlich nichts damit zu tun hatten, wie sie mit einem raschen Blick feststellte?
Noch einmal überflog sie die Zeilen, die George Kennedy damals geschrieben hatte.
In Millicent wurde am Freitag, dem 10. August, auf der Hauptstraße eine Frau von einer Postkutsche erfasst. Der Unfall ereignete sich vormittags vor den Augen zahlreicher Fußgänger. Die Frau trug schwerste Verletzungen davon, darunter zahlreiche Knochenbrüche und tiefe Fleischwunden, überlebte aber wie durch ein Wunder, da ihr Passanten direkt zu Hilfe geeilt waren. Der Kutscher musste mit einem Schock ins Krankenhaus gebracht werden. Seltsamerweise konnte keiner der Zeugen genaue Angaben zum Unfallhergang machen. Bei der Verunglückten handelt es sich um eine Einwohnerin von Mount Gambier.
Eliza fragte sich, warum der Name der Frau nicht genannt wurde. Sie kannte ihren Chef und wusste, was für ein penibler Mensch er war. Eine solche Unterlassung sah ihm gar nicht ähnlich. Ob die Frau sich jemals von ihren schweren Verletzungen erholt hatte? Oder war sie doch noch daran gestorben?
Tief in Gedanken verließ Eliza das Gebäude. Auf dem Nachhauseweg schwirrte ihr der Kopf von Geschichten über Tiger und wilde Tiere, doch immer wieder kehrten ihre Gedanken zu dem Artikel über den Unfall zurück, der so viele Fragen aufwarf.
Am Mittwochmorgen ging Eliza nach einem kurzen Abstecher in die Redaktion zum Bahnhof und stieg in den Zug nach Adelaide, der an der Küste entlangfuhr und in Tantanoola, Millicent, Beachport und Kingston hielt. Da Tantanoola nur zwölf Meilen von »The Mount« entfernt lag, wie Mount Gambier bei den Einheimischen hieß, würde sie schon früh dort ankommen. Eliza war ganz zappelig vor Aufregung und Vorfreude. Sie war noch nie in Tantanoola gewesen und konnte es kaum erwarten, den Ort kennen zu lernen.
Als der Zug seine Fahrt an einem Haus verlangsamte, hinter dem sich eine überwiegend von Tee- und Kängurubäumen bestandene Hügelkette erstreckte, schaute Eliza neugierig aus dem Fenster und fragte dann den Schaffner, ob das schon Tantanoola sei.
»Nein, Miss, bis Tantanoola sind es noch zwei Meilen.« Als er bemerkte, dass sie das Gebäude an der Bahnstrecke aufmerksam betrachtete, fügte er hinzu: »Das ist das Hanging Rocks Inn, Miss. Hier verlief früher die alte Postkutschenroute. Das Gasthaus hier war das erste Haus, das in der Gegend gebaut wurde. Seinen Namen hat es von den Felsen, die sich dahinter erheben, den Up and Down Rocks.«
Eliza runzelte verwundert die Stirn. »Was für ein seltsamer Name. Wird das Gasthaus denn noch betrieben?«
»Meines Wissens ist es heute ein Wohnhaus. Manchmal sehe ich im Vorüberfahren jemanden im Garten arbeiten.«
Eliza fand, dass das Haus ein wenig verloren und bedrückend wirkte.
Kurze Zeit später hielt der Zug in Tantanoola. Eliza war der einzige Fahrgast, der ausstieg. Obwohl sie eine ruhige Stadt erwartet hatte, war sie dennoch überrascht von der Stille, die über dem Ort lag. Der Zug war längst weitergefahren, als sie immer noch auf dem Bahnsteig stand und sich umschaute.
Die Gleise führten von Norden nach Süden mitten durch die Stadt. Verglichen mit Mount Gambier drückte Tantanoola sich förmlich an den Boden, so eben war die Stadt. Direkt gegenüber dem Bahnhof befand sich das Railway Hotel, ein einstöckiges Gebäude. Hinter dem Bahnhof lagen Stallungen – »Gurney’s Stables« stand über dem Tor – und die Kolonial- und Haushaltswarenhandlung der Brüder Wiltshire. Daneben gab es eine Apotheke sowie einen Obst- und Süßwarenladen, der mit einem Schild im Schaufenster für erfrischende Getränke warb, obwohl die Luft schneidend kalt und der Sommer noch nicht in Sicht war. Hinter den Geschäften konnte man Häuserzeilen sehen, ein Schulgebäude und eine Kirche. Auf der Seite des Hotels standen ebenfalls Häuser an einigen wenigen Straßen, und ein Postamt gab es auch. Eliza fiel auf, dass die meisten Grundstücke nicht eingezäunt waren.
Noch hundert Jahre zuvor hatte es reichlich Wasser in der Gegend gegeben, und auf dem sumpfigen Land waren hauptsächlich Teebäume und Tussock-Gras gewachsen. Obwohl das Gebiet heute weitgehend entwässert war, wie Eliza erfahren hatte, gab es immer noch zahlreiche Moore, die von Acker- und Weideland umgeben waren. Zwei Meilen weiter westlich lag der Lake Bonney, doch man konnte den See von der Stadt aus nicht sehen, weil ein Gürtel dichter Vegetation dazwischenlag, der unter anderem aus Manna-Eschen, Schwarzen Mangroven, Buchsbäumen und Geißblatt bestand. Tausend Verstecke für einen wilden Tiger, dachte Eliza schaudernd. Ob dieser Tiger der Grund dafür war, dass die Straßen menschenleer waren? Hätte sich nicht Rauch aus den meisten Schornsteinen gekräuselt, hätte man Tantanoola für eine Geisterstadt halten können.
Eliza nahm ihren Koffer und ging zum Hotel hinüber. So früh am Morgen bin ich sicherlich der einzige Gast, überlegte sie, als sie ihren Koffer durch die Tür wuchtete. In der leeren Bar fiel ihr Blick auf eine Tafel an der Wand, auf der verzeichnet war, dass man den Tiger zweimal gesichtet hatte; außerdem war die Zahl der Tiere vermerkt, die er gerissen hatte. Die Liste mit den Verlusten wurde offenbar von Tag zu Tag länger. Während Eliza gedankenverloren die Tafel betrachtete, kam eine Frau aus dem hinteren Teil des Gebäudes. Es war Mary Corcoran. Sie hatte einen Staubwedel in der Hand.
»Oh, guten Morgen«, sagte sie überrascht, als sie den Gast erblickte.
Eliza trug einen dunklen Rock zu einer weißen Bluse und hatte einen schweren Mantel über die Schultern geworfen. Ihr lockiges, schulterlanges braunes Haar betonte ihren hellen Teint. Mary fielen ihre warmen braunen Augen und die rosigen Lippen auf. Sie ahnte nicht, dass sich hinter dem unschuldigen, lieblichen Äußeren eine willensstarke junge Frau verbarg.
»Guten Morgen«, erwiderte Eliza die Begrüßung. »Mein Name ist Eliza Dickens.«
»Ich bin Mary Corcoran. Meinem Mann und mir gehört das Hotel. Aber die Bar ist noch nicht geöffnet.«
»Oh, das macht nichts. Sie dürften mir sowieso keinen Alkohol ausschenken, weil ich noch nicht alt genug bin. Ich würde gern ein Zimmer mieten.«
»Ach herrje«, entfuhr es Mary. »Wir haben nur zwei, und beide sind bereits vergeben.«
»Und für wie lange?«
»Das kann ich nicht genau sagen.« Mary machte ein ratloses Gesicht. Vor knapp einer Woche hatte Mannie den Tiger zum ersten Mal gesehen; seitdem herrschte in der Stadt eine Nervosität, die manchmal an Hysterie grenzte.
»Ich arbeite für die Border Watch, die Zeitung in Mount Gambier«, sagte Eliza in der Hoffnung, Mary würde sich dann hilfsbereiter zeigen. »Ich bin Reporterin und möchte über den Tiger schreiben, der hier in der Gegend gesehen wurde.«
Mary nickte. »Das überrascht mich nicht. Diese Geschichte wirbelt ganz schön Staub auf. Dabei sind wir nicht einmal sicher, ob es sich wirklich um einen Tiger handelt.«
»Sagen Sie jetzt bloß nicht, dass es ein streunender Hund oder etwas Ähnliches ist!«, stieß Eliza enttäuscht hervor. Das würde keine besonders spannende Story abgeben.
»Nein, das sicher nicht. Die beiden Einheimischen, die das Raubtier gesehen haben, konnten es zwar nicht genau erkennen, aber sie sind überzeugt, dass es sich um eine gefährliche wilde Bestie handelt. Möglicherweise ist es der Tiger, der vor Jahren als Jungtier mit seiner Mutter aus einem Zirkus entwischt ist.« Die Zeitungsleute würden das Geschäft ankurbeln, das wusste Mary, deshalb nahm sie sich gern die Zeit, über die Geschichte zu sprechen.
»Meinen Sie? Na ja, wie auch immer, jedenfalls soll ich über die Sache berichten, und deshalb brauche ich eine Unterkunft. Ob einer Ihrer Gäste heute zufällig abreisen wird?«, fragte Eliza hoffnungsvoll.
»Das kann ich mir nicht vorstellen«, erwiderte Mary kopfschüttelnd. »Der eine ist ein gewisser Alistair McBride. Er ist …«
»… Reporter bei der South Eastern Times in Millicent«, beendete Eliza den Satz. Ihr Chef hatte seinen Namen erwähnt. McBride ging angeblich über Leichen, um an eine gute Story zu kommen. Es wurmte Eliza, dass er vor ihr in Tantanoola eingetroffen war.
»Stimmt. Er will genau wie Sie über den Tiger schreiben. Also wird er nicht abreisen, ehe er seine Geschichte hat. Der andere heißt Brodie Chandler und ist Berufsjäger. Alle hier im Ort haben zusammengelegt, damit er angeheuert werden konnte. Er soll die Bestie, die das Vieh reißt, zur Strecke bringen. Mr. Chandler wird erst abreisen, wenn er seine Arbeit erledigt hat.«
»Was mache ich denn jetzt?«, sagte Eliza hilflos. »Das ist wirklich eine dumme Situation.«
»Tut mir leid, dass ich Ihnen nicht behilflich sein kann, Miss Dickens«, sagte Mary bedauernd.
Eliza blieb unschlüssig stehen und überlegte. Sie konnte unmöglich nach Hause zurückfahren und ihrem Chef erzählen, dass aus der Geschichte leider nichts geworden war, weil sie keine Unterkunft gefunden hatte. Eher würde sie in einem Stall übernachten! »Gibt es hier im Ort jemanden, bei dem ich unterkommen könnte? Gegen gute Bezahlung natürlich. Mein Chef hat mir genug Geld mitgegeben.«
Mary legte nachdenklich den Zeigefinger auf die Lippen. »Hm. Normalerweise kommen nicht viele Fremde hierher, aber als letztes Jahr ein junges Paar auf der Durchreise eine Unterkunft suchte und ich die beiden nicht aufnehmen konnte, weil meine Schwester mit ihrer Familie aus Adelaide zu Besuch war, kamen die beiden bei Tilly Sheehan unter. Sie lebt zurückgezogen und hat nicht gerne Menschen um sich, aber vielleicht macht sie ja auch diesmal eine Ausnahme.«
»Das wäre wunderbar!«, rief Eliza erleichtert. »Ich werde sie gleich fragen. Wo finde ich sie?«
»Sie wohnt im Hanging Rocks Inn. Sie sind auf der Fahrt hierher daran vorbeigekommen, vielleicht ist es Ihnen aufgefallen.«
Elizas Hoffnungen bekamen einen Dämpfer. »Ja, ich erinnere mich.« Sie erinnerte sich auch daran, dass das Haus keinen sehr einladenden Eindruck gemacht hatte. »Und sonst gibt es hier niemanden, bei dem ich unterkommen könnte?«
Mary schüttelte den Kopf. »Ich fürchte, nein. Sagen Sie Tilly, ich hätte Sie geschickt, Miss Dickens. Ich wünsche Ihnen viel Glück.« Sie bezweifelte, dass Tilly das Mädchen bei sich aufnehmen würde, aber fragen kostete ja nichts.
»Danke.« Elizas Blick fiel auf den schweren Koffer, den sie neben sich abgestellt hatte. »Bis zum Hanging Rocks Inn sind es zwei Meilen. Ich kann meinen Koffer unmöglich so weit tragen.«