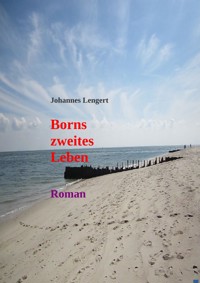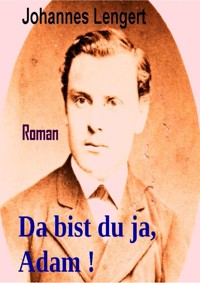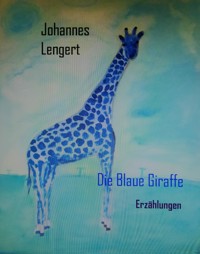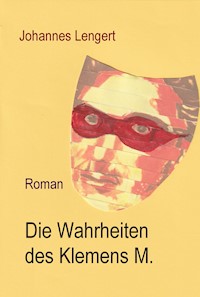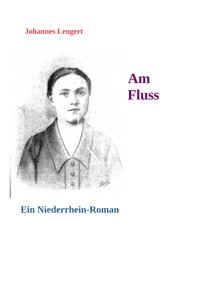
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das Fischerdorf Alsum am Niederrhein existierte seit Jahrhunderten. Seine Bewohner lebten vom Fischfang und waren zum Teil auch Schiffer, die Waren stromaufwärts und -abwärts transportierten. Mit Seglern und später mit Dampfschiffen. Als aber die Schwerindustrie sich am Rhein niederließ und der Kohleabbau das Leben der Bevölkerung zu bestimmen begann, war das Ende des Fischer- und Schifferdorfes besiegelt. Der Roman erzählt die Geschichte Wilhelmines und ihrer Vorfahren aus Alsum bis in die Gegenwart. Schon Wilhelmines Vater kehrt dem Fluss den Rücken und will von der Industrie profitieren. Alsum ist nur noch ein Ausflugsort fürs Wochenende, wenn man mit der Fähre auf die andre, die grüne Rheinseite übersetzen möchte. Wilhelmines Enkel kennt einige der Geschichten vom Niederrhein durch die Erzählungen seiner Großmutter. Sie haben ihn neugierig gemacht auf den Fluss, den er selbst besser kennenlernen will. Auf seinen Fahrten den Strom entlang erlebt er Liebesfreud und Liebesleid und erfährt einiges über seine Vorfahren, deren Leben und deren Schicksal ungleich härter war als sein Liebeskummer. Seine letzte Fahrt macht er in die Niederlande auf einem Segler, und er hofft, dass sich am Ziel alles zum Guten wendet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
Impressum
Johannes Lengert
Nußaumer Str. 3-5
51469 Bergisch Gladbach
Johannes Lengert
Am Fluss
Ein Niederrhein-Roman
Das Fließen des Wassers und die Wege
der Liebe haben sich seit den Zeiten
der Götter nicht verändert.
Inhalt:
Teil I
Teil II
Teil III
Teil IV
Teil V
Teil I
1. Kapitel
Sie hauchte auf den Spiegel. Mit dem rechten Unterarmteil ihres Sonntagskleides wischte sie über die Glasfläche. Viel schärfer wurde das Bild nicht. Der Spiegel war alt, fleckig, narbig, und dunkle Stellen sowie der Riss, der diagonal durchs Glas ging, zeigten ein unscharfes und verzogenes Konterfei. Ein Mädchengesicht. Die dunklen Haare aufgesteckt. Es ragte aus dem hohen Spitzenkragen des hellgrauen Kleides heraus. Wenn Wilhelmine etwas vom Spiegel zurücktrat, sah sie die an den Schultern gebauschten Ärmel und auch die silberne Kette mit dem Kreuz, die ihr von der Patentante zur Firmung geschenkt wurde. Sie musste sich noch nicht einmal auf die Zehenspitzen stellen, um ihre Frisur zu begutachten. Denn für ihr Alter war sie schon recht groß. Und das hatte wohl den Ausschlag gegeben, dass sie bei Merian angenommen wurde, natürlich auch das gute Schulzeugnis mit Rechnen und Schreiben und Betragen gut. Das Empfehlungsschreiben des Rektors wäre da gar nicht mehr nötig gewesen. Der alte Merian verließ sich auf seine Menschenkenntnis. Das hatte er zu ihrem Vater gesagt, der sie in die Villa begleitet hatte. Mit dem Lohn konnte sie ebenfalls zufrieden sein. Gut war ebenso, dass Vater nicht versucht hatte, ihn hochzuhandeln. So was machte den Alten fuchsig, und es hätte alles zunichte machen können. Wilhelmine konnte froh sein, bei den Merians in Stellung gekommen zu sein, obwohl sie nicht katholisch waren. Da hatte der Vater lange gezögert. Denn liberal und evangelisch, davor hatte der Pfarrer gewarnt. Aber sie als die Älteste brauchte eine gut bezahlte Anstellung. Noch sechs Kinder waren zu versorgen.
Morgen früh um sieben würde sie ihre Stellung antreten. Nicht in diesem Kleid. Denn für die Arbeit stellten ihr die Herrschaften ein einfach geschnittenes schwarzes Kleid mit weißem Kragen. Das Spitzenkleid war nur für feierliche Anlässe und für den sonntäglichen Kirchgang. Jetzt musste sie schnell herausschlüpfen. Sie wollte nicht von ihren jüngeren Brüdern erwischt werden, wenn sie sich vor dem Spiegel drehte. Die würden sie garantiert verpetzen und sich lustig über sie machen. Und das würde ihre gute Stimmung verderben.
2. Kapitel
Die Wellen des Rheins schlagen fast an meine Füße. Ich weiche noch ein Stück zurück. Der Fluss führt Hochwasser. Die starke Strömung transportiert Treibgut in Richtung Niederlande. Äste, Teile von Baumstämmen, Tuchfetzen haben sich in der Uferböschung verfangen. Immer wenn ein Schubschiff mit mehreren Leichtern dem schwimmenden Treibgut in Richtung Grenze folgt, steigt der Pegel am alten Anleger ein paar Zentimeter höher. Dann begebe ich mich noch ein Stückchen zurück, bis ich am oberen Ende der Rampe stehe, die man von der Fähre aus hochging, um den Fußweg nach Baerl zu erreichen.
Die Fähre von Alsum zum Baerler Ufer war eine reine Personenfähre. An Sonn- und Feiertagen konnte sie den Ansturm der Passagiere aus Beeck, Bruckhausen und Hamborn kaum bewältigen. Dann füllten sich die umliegenden Gaststätten und entleerten sich erst wieder bei Sonnenuntergang. Den Alsumer Steig, das Gegenstück zum Baerler Anleger, gibt es nicht mehr. Er ist verschwunden wie der ganze Stadtteil. Alsum gibt es nicht mehr.
Mein Blick vom Baerler Ufer auf die gegenüberliegende Flussseite fällt auf gigantische Kokerei-Türme, die ununterbrochen Wasserdampfwolken steil in den Himmel blasen. Irgendwann vermischen sie sich mit den Wolkenwänden, die vom Meer her landwärts wehen. Eine Batterie von Schornsteinen, Koksbunkeranlagen und Strommasten besetzt das Ufer wie eine Verteidigungsfront. Undurchdringlich. Eine Fähre könnte nicht mehr landen. Der Alsumer Steig ist ja verschwunden.
Thyssen-Krupp-Steel herrscht hier, wo früher Fischer, Bauern und auch schon ein paar Stahlarbeiter wohnten. Deren Häuser, Läden und Kirchen mussten weichen. Sie mussten weichen, weil der Stadtteil zu versinken drohte. Der Kohleabbau, der sich sich von Ost nach West unter dem Rhein lang zog, ließ das ehemalige Fischer- und Schifferdorf allmählich absinken. Eine Rettung war nicht mehr möglich. Der Ort verschwand. Auf aktuellen Landkarten ist er nicht mehr zu finden. Nur alte Karten zeugen noch von seiner früheren Existenz. Das Gelände wurde aufbereitet für eine moderne Koksproduktion. Für den Koks, den man für die Hochöfen braucht. Etwas entfernt, aber noch nah genug in Bruckhausen, Beekerwerth und Schwelgern.
Wenn ich mich leicht nach rechts drehe, sehe ich die Umrisse der Hochofen-Anlagen. Durch das Rheinknie ist mir der Blick flussabwärts nicht gestattet. Da müsste Schwelgern liegen, mit seinen Hafenanlagen, um Steinkohle und Erze zu entladen. Der Alsumer Hafen dagegen war klein. Schon in den letzten Jahren nicht mehr tauglich für größere Güter. Aber immerhin war er ein Hafen, den der große Fluss mit dem Meer verband. Die Mündung war gar nicht mehr so weit entfernt. Anders als der Ursprung des Stroms, der viele hundert Kilometer weit im Süden lag. Uns Kinder interessierte er aber nicht. Wenn wir Papierschiffe ins Wasser setzten, stellten wir uns vor, sie segelten ins Meer. Und schon hatten wir den Geruch von See in der Nase. Der kam aber eher von den angeschwemmten toten Fischen, die hier und da in den Ufersteinen lagen.
Wir fanden uns fast regelmäßig am Alsumer Steig ein. Nach der Schule, mit den Rädern. Bei einigermaßen schönem Wetter. Also, wenn es gerade nicht feste regnete. Wir stiegen nicht mal von den Rädern. Hockten auf den Querstangen und sahen den Schiffen zu, die entweder bergauf oder talwärts fuhren. Man konnte aufs Wasser sehen, ohne an etwas Besonderes zu denken. Wir sahen die Zeit verfließen. Vermutlich war das unsere Art von Entspannung. Vielleicht heißt das heute Meditation. Einfach an nichts denken. Dann, irgendwann, drehten wir die Räder um 180°, bogen in die Uferstraße ab, kreuzten die Alsumer Straße, fuhren an der Nikolaus-Kirche vorbei und tauchten im Matena-Tunnel unter. Über uns lag der wuchtige Block der August-Thysen-Hütte, der die Stadtteile Bruckhausen und Alsum von einander trennte. Wenn wir ein paar Minuten später wieder ins Freie fuhren, drangen die ätzenden Gerüche der Koks,- Eisen- und Stahlproduktion in unsere Nasen ein. Die kurzen Momente der imaginierten freien Seeluft lagen schon wieder weit zurück.
Schon als kleines Kind war ich oft am Rhein. Mit meinen Eltern. Wie viele andere Familien aus Bruckhausen und Hamborn drängte es uns bei schönem Wetter auf die andere Rheinseite, auf die grüne Seite, die von der Industrie unberührt war. In Alsum selbst hielten wir uns nicht auf, obwohl meine Großmutter von dort stammte. Ich glaube, aus der Seemannstraße. Manchmal nach dem Abendessen kamen ihre Erinnerungen hoch, dann erzählte sie von ihrer Kindheit und frühen Jugend und ihren Vorfahren. Langsam strich sie dabei mit ihrer linken Hand über die Tischdecke und ließ die untergegangene Welt ihrer Vorfahren, die Welt der Rheinschiffer, Fischer und Bauern lebendig werden. Die Welt der Rheinschiffer, die weit vor dem ersten Weltkrieg mit ihren Seglern zwischen Ruhrort und Rotterdam pendelten. Die Welt der Fischer, die von ihren Booten aus am Steig den Fisch an die Hamborner, z. B. an den Probst der ehemaligen Abtei verkauften. Sie erzählte von den Fischer- und Landwirtssöhnen, die dem Rhein den Rücken kehrten, um sich als Handwerker einen neue Existenz aufzubauen, weil das Leben am Fluss zu beschwerlich war, Hochwasser und Eisgang fast regelmäßig enorme Schäden im Dorf anrichteten.
Schon lange war meine Großmutter nicht mehr am Rhein gewesen. Sie hatte wohl innerlich damit abgeschlossen. Der Fluss lebte nur in ihrer Erinnerung fort. Ein Wiedersehen schloss sie kategorisch aus. Gerade, wenn wir sie drängten, mit uns die Fähre nach Baerl zu nehmen. Denn wir hätten ja die Straßenbahn Linie 10 nehmen können, die sich als Schmalspurbahn durch den Matena-Tunnel wand und bis zur Uferstraße fuhr. Aber da war nichts zu machen. Und wir mussten dann manchmal Wochen warten, bis die Großmutter den Erzählfaden wieder aufnahm und Geschichten von ihrer Kindheit, ihren sechs Geschwistern, Cousins und Cousinen, Eltern und Großeltern zum Besten gab.
Wenn ich in der Geschichte des untergegangenen Rheindorfes blättere, erfahre ich, dass es Alsum als Siedlung schon zur fränkischen Zeit gegeben hat, in der Rheinaue gelegen, nahe an der Emschermündung. Erst aus dem 14. Jahrhundert gibt es Überlieferungen von Landschenkungen an die Alsumer, angeblich vom Grafen Engelbert von der Mark. So weit in die Geschichte brauchen wir nicht einzutauchen. Es reicht, weniger als 200 Jahre zurückzugehen, in die Welt meiner Großmutter und ihrer Vorfahren, um zu sehen, wie aus einem Fischerdorf ein Industrieort wurde, wie Lebensläufe entstanden und endeten - sowie Träume und Erwartungen bis in die Gegenwart.
3. Kapitel
Schang, eigentlich Johann, flickte die Segel, die der starke böige Wind von der Fahrt von Ruhrort nach Alsum, also nach Hause, an den Rändern zerfetzt hatte. Er hätte längst neue Segel gebraucht. Die jedoch konnte er sich im Moment nicht leisten. Der Fischfang brachte wenig ein, weil er seine Netze nur in der Nähe des rechten Rheinufers auswerfen konnte. Die Franzosen, die das linke Rheinufer besetzt hielten, holten alles aus dem Fluss raus, was sie in ihre Netze kriegten, und er konnte froh sein, wenn sie seinen Kahn nicht aufbrachten und ihm seinen Fisch nahmen. Der Fisch reichte gerade für die Familie aus, verkaufen konnte er ihn nicht mehr, eine Einkommensquelle fiel also aus, aber noch nagten sie nicht am Hungertuch. Lachs und Maifisch, eigentlich die Brotfische der Fischer, hatte es im Frühjahr noch gegeben, jetzt waren sie verschwunden, der Maifisch sowieso, aber auch die Lachse, die sonst um diese Jahreszeit noch Geld eingebracht hätten, befanden sich jetzt wohl auf den Porzellantellern der französischen Bürgermeister auf der anderen Rheinseite.
Griets Schwester hatte davon vertellt, als sie neulich in „Frankreich“, wie sie sagte, war, um ihre Cousine zu besuchen, die noch einmal ein Mädchen bekommen hatte. Ein süßes petit enfant. Also von Griets Schwester wusste er, wie die Franzosen essen. Drei bis vier Sachen hintereinander. Alle auf neuen frisch gespülten Tellern mit Goldrand. Pastete. So etwas wie Leberwurst, hatte man ihm erklärt. Lachs mit Kartoffeln in Sahnesauce. Natürlich sein Lachs! Ochsenbäckchen mit Schmorgemüse. Dann zum Schluss: Crème brûlée. So eine Art Vanillepudding. Das brauchte er nicht mal zu Weihnachten. Lieber eine ordentliche Fischsuppe mit einem Kanten vom frischen Ofenbrot. Dazu eine Kanne Bier. Nachher noch einen Schnaps. Seitdem Griets Schwester öfter bei den Franzosen war, tat sie so etepetete. Ja, noch nagten sie nicht am Hungertuch, wie Griet jeden Morgen voller Überzeugung sagte, wenn sie ihm die warme Biersuppe hinstellte. Seine Schwägerin trank inzwischen Kaffee und aß dazu Weißbrot. Weiß der Himmel, woher sie das bekam. Ja, sie hatten noch Fisch, allerdings keine Wanderfische mehr wie Lachs und Maifisch, aber Barben, Döbel und Brassen. Die holte er aus den Seitenarmen des Rheins, bei Emmerich. Da kamen die Franzosen nicht hin. Das waren jetzt ihre Brotfische. Davon hatten sie genug. Unter der Hand ging noch einiges davon weg. Und dann brachte der Handel noch einiges ein.
Schang betrachtete das geflickte Segel. Etwas schief die Nähte. Aber sie würden halten. Er faltete das geflickte Segel zusammen und legte es über das noch unbeschädigte, schon gefaltete Focksegel, verstaute das Werkzeug in der Kiste im Achterschiff. Er überprüfte noch einmal, ob der Kahn gut an der Hafenmole festgezurrt war, warf einen fast wehmütigen Blick auf das jetzt ruhig liegende Schiff mit seinem hohen Mast, sah die daneben liegenden Zweimaster, die Frachtschiffe, und schlug den Heimweg ein. Der Zweimaster hatte den Vorteil, dass man mehr Waren transportieren, längere Strecken zurücklegen konnte. Aber dann hätte er die Fischerei aufgeben müssen und wäre oft tagelang, wenn nicht wochenlang nicht zu Hause gewesen, bei Griet und den Kindern. Das wollte er nicht. Und Griet auch nicht. Für den Einmaster brauchte er nur einen zweiten Bootsmann, manchmal bei den längeren Fahrten, wenn er Transporte übernahm. Bald würde sein Erstgeborener mit an Bord sein, und wenn alles gut ging, in naher Zukunft den Anton als Bootsmann ersetzen.
Wenn er an all dies dachte, fühlte er sich verbunden mit der Erde und dem Strom. Mit der Erde, auf der das von den Vorfahren ererbte Haus mit dem Garten drumherum stand, der ihnen Kartoffeln, Gemüse und Obst gab, Lebensmittel, die sie über die kalte Jahreszeit lagern und einkochen konnten. Mit dem Strom, der sie mit frischem Fisch versorgte - noch, dachte Schang und bekreuzigte sich - , mit dem Strom, der manchmal wild über die Ufer trat, Land verwüstete und mitnahm, der in heißen Sommern zum Rinnsal wurde, den Fischen kein Leben mehr gab und sie tot am Ufer liegen ließ, schließlich mit dem Strom, der unsichtbar unter dicken aufgestauten Eispanzern dahinfloss, so dass trotz bitterster Kälte die Alsumer aufs Eis gingen und zur Musik einer eiligst zusammengetrommelten Kapelle tanzten. Wir Fischer blasen keine Trübsal, wenn das Wetter wendisch ist und der Herrgott uns zeigt, wie klein wir Menschenkinder sind. Pah, die Pfarrer mit ihren Predigten vom Himmelreich. Er musste seine Familie jetzt durchbringen und trotzdem die kleinen Freuden des Alltags genießen.
Es war inzwischen dunkel, doch er kannte den Weg. Schwacher Lichtschein aus den umliegenden Häusern gab ihm Orientierung. Auch die zunehmende Entfernung zum Fluss, das nachlassende Glucksen des fließenden Wassers ließen ihn wissen, dass sein Haus nicht mehr weit war. Zudem war heute der Himmel ziemlich wolkenfrei, der Abendstern schon gut sichtbar. Griet glaubte an die Bedeutung der Gestirne. Sie bestimmen unser Leben! Doch Genaueres wusste sie dazu nicht zu sagen. Eine Tante, die bei ihr im Elternhaus wohnte, hatte ihr wohl früher diesen Floh ins Ohr gesetzt. Humbug, nichts als Humbug, schnaubte er, wenn Griet wieder damit anfing. Das Wort hatte er neulich aufgeschnappt, in Ruhrort, als er mit ein paar Holländern über Frachttarife verhandelte. Und die hatten es aus England mitgebracht. Jedenfalls gaben sie damit mächtig an. Mit ihrer Weltkenntnis. Mit ihrer Erfahrung. Waren aber über Amsterdam nicht hinausgekommen. Letztlich handelten sie nur mit Stockfisch, der eher für die ärmeren Leute war. Doch sein frischer Lachs und, wenn er Glück hatte, manchmal sein Kaviarfisch, die „Herrenfische“, landeten auf dem Tisch der Reichen. Fischers Fritze fängt frische Fische. Frische Fische fängt Fischers Fritze.
Die Barben und Brassen im wasservollen Holzeimer zappelten und schlugen mit den Schwänzen. Um die Haustür zu öffnen, musste er Eimer und Reuse abstellen. Er schnupperte den holzigen Geruch des Herdfeuers. Bald würden sie am Tisch sitzen, die Pfanne in der Mitte, daneben die große Schale mit Kartoffeln. Jan-Pieter, der Älteste neben dem Jüngsten, dem Jakob auf der Holzbank an der einen Längsseite des Tisches. Ihnen gegenüber die Mädchen, Agnes und Anna auf der andren Bank. Griet und er an den Stirnseiten des Tisches. Ihm, dem Hausherrn, gebührte der Lehnstuhl, in dem er auch nach dem Essen sitzen blieb, um seine Pfeife zu rauchen. Griet brauchte nur einen niedrigen Hocker, weil sie ja sowieso mehr stand als saß, im Grunde immer ging, um auf- und abzuräumen, in den Töpfen zu rühren, Brot nachzureichen und Wasser einzuschenken und dem Schang sein Bier nachzugießen. Griet tat das gern. Und jetzt ging es ihr auch wieder besser, nachdem sie den plötzlichen Tod der Zwillinge etwas verwunden hatte. So einfach am Fieber gestorben. Mir nichts. Dir nichts. Von den Franzosen kommt das! Tuschelten manche, und auch der Pfarrer machte so seine Andeutungen. Alles Quatsch hatte Schang gemeint, der den Pfarrer nicht leiden konnte. Auf der anderen Rheinseite sterben sie doch auch. Die konnten sich selbst auch nicht helfen mit ihren neuen Gesetzen und dem Fortschritt.
Die Sterne hatten es ihr vorhergesagt. Griet war sich da sicher, und Tante Luise, mit der sie regelmäßig Kontakt hielt, hatte es auch so gesehen. Ein Unglück wird deine Familie heimsuchen. Du wirst abgeben und leiden müssen. Sie hatte gelitten und gegeben, hatte Gott, dem Herrn gezürnt und ihre schwere Sünde gebeichtet. Die Zwillinge waren im Himmel. Das war ganz sicher. Das glaubte auch Schang, der manchmal eine lose Zunge hatte, wenn es um den Glauben ging. Vielleicht hatte er zu viel von den Linksrheinischen aufgeschnappt, den Gottlosen.
Es gab da aber nicht nur die Sterne da oben, die den Menschen da unten Zeichen gaben. Hier unten, ganz in der Nähe, das spürte Griet, bewegten sich die Nixen, an den Ufern, in den kleineren Gewässern, und Tante Luise hielt sich immer etwas darauf zugute, nahe der Emschermündung Nixen gesehen zu haben, wenn auch im Nebel. Doch ganz deutlich hat sie ihre Stimmen gehört. Andere Frauen im Schifferdorf meinten auch, wenn die Novembernebel so dicht über der Erde lagen, dass man nicht mehr Freund und Feind unterscheiden konnte, dann trauten sich die Wassergeister hervor, um nach Jünglingen zu suchen, die sie zu sich in die Tiefe ziehen konnten. Gisbert Koch, der von Wesel zugezogen war, um hier in Alsum das Schifferhandwerk zu lernen, der bei den Tanzfesten und auf dem zugefrorenen Rhein mit jeder getanzt hatte, die noch unverheiratet war, und der auch den Verheirateten schöne Augen machte, und Griet musste sich eingestehen, dass auch sie selbst gern in seinen Armen gelegen und sich sich im Takt der Musik gedreht hätte, bis ihr schwindelig geworden wäre, der schöne blonde Gisbert war eines Tages verschwunden. Weg für immer. Nie mehr gesehen. Es waren die Nixen, sagten sogleich die alten Weiber. Warum sollten sie sich diese Beute entgehen lassen? Unsinn, meinte Schang, das waren die Ehemänner. Die wollten nicht gehörnt werden! Im Nebel kann viel passieren. Gott hat den Schuldigen bestraft, sagten die ganz Frommen, hinter denen der Pfarrer steckte. Du sollst nicht ehebrechen. Es gibt eben viele Mächte, die auf uns Menschen einwirken, dachte Griet, ohne dass sie dabei etwa Gott nicht achten würde. Gott stand ja sowieso über allem. Doch es gab auch die Zwerge und Drachen, weiter oben, den Rhein hoch, wo ein Goldschatz versteckt sein sollte. Weit hinter den sieben Bergen. So weit waren Schang und die Schiffer, die sie kannte, noch nicht gekommen. Von Köln hatte er öfter erzählt. Ob er wirklich selbst da war? Oder nur weiter erzählt hatte, was er gehört hatte? Sie brauchte nicht da gewesen zu sein. Ruhrort reichte ihr. Einmal im Jahr, wenn Schang oder ein anderer Schiffer sie mitnahm, damit sie Sachen kaufen konnte, die in Alsum nicht ausgeladen wurden, Sachen aus Holland, aus dem Land ihrer Vorfahren, Spitzen, Porzellan, Seide, die übers Meer kamen. Einmal im Jahr kaufte sie sich etwas. Einmal war es eine Tasse aus Delft. Wenn dann der Nebel dicht über dem Land lag und das Heimweh sie befiel, trank sie aus dieser Tasse und träumte sich in die Welt des Helden aus dem Nebelland hinein, in die Welt des Drachenbezwingers, der aus einer Stadt kam, in der sie auch noch nicht gewesen war, obwohl nicht weit entfernt, nur einen halben Tag weiter bergab, doch schon etwas mehr der großen See zu. Und noch weiter dem Meer zu, da lag die Burg, von der aus der edle Ritter, der seinen Namen nicht nennen durfte, den Rhein hinauf fuhr, in einem Nachen, von einem weißen Schwan gezogen.
Schang stand mit dem Rücken zur Haustür. Die grüne Farbe war abgeblättert. Kein Immergrün. Auch die Fenster brauchen einen neuen Anstrich, meinte Griet. Oder hatte das ihre Etepetete-Schwester mal wieder gesagt? Wenn überhaupt, darum würde er sich später kümmern. Er wartete auf Jan-Pieter, der ihn begleiten sollte. Gerade jetzt musste Griet Maß nehmen für eine neue Überjacke, die sie ihm nähen wollte, aus Stoffresten, die sie über längere Zeit gesammelt hatte, von alten Hosen, Westen und Jacken. Der Junge wuchs zu schnell aus seinen Sachen heraus. Schon jetzt war er fast so groß wie seine Mutter. Schang wurde ungeduldig. Mit Geduld und Spucke fängt man eine Mucke. Was für ein Quatsch! Er hasste das Warten. Allzu leicht riss ihm in letzter Zeit der Geduldsfaden. Sie wollten nach Beeck. Dort an der Emscher lag die Werkstatt, wo sie seinen Nachen reparierten, der beim letzten Hochwasser Schaden genommen hatte. Im März war nochmal das Wasser gestiegen. Der Winter war lang gewesen, die Schneeschmelze schnell und gewaltig, später als sonst. Die Wege im Schifferdorf bis runter nach Hamborn waren überflutet. Und als der Lehrer Martin Ricken plötzlich gestorben war, da konnten sie ihn zum Beecker Friedhof nur mit dem Nachen überführen. Die Alsumer Trauergemeinde folgte ihm in zwölf weiteren. Seiner war der letzte. Und weil er den vorausfahrenden im Blick behielt und nicht mehr auf die Wassertiefe achtete, lief der Nachen auf Grund. Ein Stein riss ihm den Boden auf.
In der Werkstatt müssten sie ihn jetzt fertig haben. Lange genug hatten sie ja gebraucht. Der März war längst vorbei, die Bauern konnten ihre Rösslein erst Ende April anspannen, dann kam wieder so ein heißer Sommer, und schon bald musste die Ernte eingebracht werden. Doch Heinrich Müller aus der Werkstatt hatte ihn immer vertröstet. Was brauchst du jetzt deinen Nachen? Vielleicht haben wir wieder kaum Wasser in Rhein und Emscher. Was willst dann mit dem Nachen? Blödes Gerede, sagte sich Schang. Bei dem heutigen Wasserstand kann der Jan-Piter zeigen, wie er mit dem Boot umgehen kann. Kräftige Arme zum Rudern hat er schon. Außerdem fahren wir mit der Strömung. Da gehts ums Steuern. Steuermann will er ja werden, auf einem Lastensegler. Aber zuerst lernt er bei mir das Fischen und Segeln. Griet hat Angst, dass er sich später nach Holland verdingt, als Schiffer, wie manch einer aus Alsum, der abgewandert ist. Da zahlen sie gut, und de meisje zijn mooi en lekker, wie seine Griet aus der Nähe von Arnheim. Das wusste er ja selbst am besten. Besonders wenn er an die letzte Nacht dachte. Er hatte diesmal besonders aufgepasst. Auch die Frau wollte nicht noch einmal von vorn anfangen. Den Tod der Zwillinge hatte sie noch nicht verwunden. Und es war viel zu tun im Haus und Garten. Neulich bei der Predigt, Pflichten der Eheleute Gott gegenüber, als die Augen des Geistlichen die Frauenseite absuchten, wurde Griet ganz rot, er aber ballte Fäuste, dass seine Knöchel weiß wurden. Der Kapaun hatte gut reden! Oder der wusste sogar gut Bescheid, der Gockel! Die Evi von der Witwe Niewerth sah dem Pfarrer sehr ähnlich, meinten sogar die ganz Frommen. Die Ältere der Niewerth-Töchter war ja nach Amsterdam verheiratet. Das wird schon seine Gründe gehabt haben.
Der kleine Kahn glitt ruhig mit der Strömung des Nebenflusses dahin. Ab und zu ließ Schang seinen Sohn anhalten und mit den Rudern die Stellung halten. Man konnte im klaren Wasser die Fischschwärme deutlich ausmachen. Die meisten Namen der Fische wusste Jan-Pieter schon. Der Vater brachte ihm noch neue bei: Äsche, Nase, Gründling, Schneider, Döbel. Die wollten jetzt in den großen Fluss. Eine gute Stelle zum Fischen. Doch nicht heute. Keine Sorge, die Fische werden nicht ausbleiben. Demnächst würde Jan seinem Vater beweisen, wie gut er schon mit Angel und Netz umgehen konnte. Und wegen der Fische machte er sich keine Gedanken. Gedanken machte er sich höchstens wegen Evi.
Jan konnte sich auch vorstellen, Zimmermann zu werden. Mit Werkzeug konnte er umgehen. Die Reparaturen im Haus übernahm er schon ganz oft. Zimmerleute brauchte man hier im Schifferdorf für das Flottmachen von Kähnen und Nachen und großen Seglern. Da gab’s genug Arbeit. Außerdem besaß jeder Hof hier im Umland einen Nachen. Die mussten immer mal wieder in Schuss gehalten werden, so wie ihrer. Die Zimmerer waren gesucht und genossen Ansehen. Eine eigene Werkstatt! Träum weiter, Jan-Pieter! Aber dann wäre er immer zu Hause. Wenn die Evi ihn denn nähme, wäre er immer bei ihr. Wenn die Schiffer auf Hollandfahrt waren, dann waren sie lange Zeit fern von zu Hause. Da konnte viel passieren. In Holland, aber auch hier. Da hatte er oft die Gesprächen gehört, wenn der Ohme Jupp zu Besuch war mit der Tante Luise. Und der Ohme Jupp konnte erzählen!
Seit er firmiert war, ging Jan nicht mehr zur Schule. Schule, na ja. Die Schule war die Wohnung des Organisten. Und der Organist war ihr Lehrer, der sich mit dem Unterrichten noch ein paar Groschen dazu verdiente, damit er seine große Familie über Wasser halten konnte. Acht Blagen hatten überlebt. Der Organist und seine Frau, die gehorchten dem Pfarrer aufs Wort. Deshalb kamen sie auch auf keinen grünen Zweig. Das hatte er seinen Eltern abgelauscht, wenn sie glaubten, dass er schon schläft. Sie wussten ja nicht, dass er heimlich die Tür zur Küche einen Spalt geöffnet hatte. Manchmal stritten sich die Eltern. Seine Mutter hätte es lieber gesehen, wenn er dem Bauern Schultes geholfen hätte, so wie die meisten anderen Kinder in seinem Alter auf den Höfen halfen. Auch die arbeiteten schon als kleine Helfer, brachten Kartoffeln, Gemüse, Äpfel, Birnen nach Hause und zu Weihnachten ein Suppenhuhn oder in guten Zeiten eine Gans. Geld gab es so gut wie nie. Der Vater jedoch hatte darauf gedrängt, dass er lesen und schreiben und rechnen lernte. Ohne das kommt ein Schiffer heute nicht mehr aus. Er muss rechnen, schreiben und lesen können, damit er nicht später bei der Abrechnung der Frachtkosten übers Ohr gehauen wird. Da hatte auch Jan sich gefügt, obwohl er lieber wie die anderen Jungen selbst etwas verdient hätte. Aber jetzt, wenn er an die Evi dachte, wenn er sich vorstellte, vielleicht Kapitän auf einem Zweimaster zu sein oder sogar Zimmermann mit eigener Werkstatt, dann gab er zu, der Vater hatte wohl Recht gehabt.
Der Ohme Jupp, der so viel und gut erzählen konnte, der war auch schon weit in der Welt herumgekommen. Der kannte sich aus. Der hatte ihm auch bei der Evi geholfen. Bald werden sie heiraten. Auch mit den Papieren kennt er sich aus. Seitdem Napoleon geschlagen ist, gehören sie alle zu Preußen, auch die von der linken Rheinseite, die „Franzosen“. Der Staat wird die Heirat beglaubigen. Die nötigen Papiere hat der Ohme Jupp besorgt, die von seiner und Evis Geburt. Die lagen noch in der Hamborner Pfarrei. Der Bürgermeister in Hamborn übernahm die Trauung. In die Messe gingen sie später auch noch. Darauf hat die Mutter bestanden. Er hatte nichts dagegen und die Evi auch nicht. Der Vater hat gemeint, das wär nicht nötig, nur um dem Pfarrer eins auszuwischen, und über die „Franzosen“ drüben, auf der anderen Seite, hat er gelacht. Ob die noch weiter französisch palavern, wenn die Preußen das Sagen hätten? Jedenfalls der Ohme Jupp hat das Gerücht aus der Welt geschafft, dass die Evi das Kind vom Pfarrer ist. Er und Evis Vater, der Mattes Niewerth, waren Hollandfahrer, immer von Alsum nach Arnheim oder von Alsum nach Amsterdam. Jahrelang. Und eines Tages haben sie in Amsterdam als Hochseeschiffer angeheuert. Da waren sie auf langer Fahrt, von Amsterdam nach Holländisch Indien, jahrelang. Und der Ohme Jupp und der Mattes waren selten zu Hause, aber danach kam irgendwie die Evi zur Welt und auch deren Schwester vorher. Nur irgendwann kam der Mattes nicht mehr nach Alsum zurück. Er ist in Amsterdam geblieben. Er mochte wohl die Holländerinnen. Der Ohme Jupp konnte das verstehen. Sein Vater wohl auch, denk doch nur an deine Mutter, Jan! Als der Mattes nicht mehr kam, sah man immer öfter den Pfarrer, um die junge Witwe zu trösten, wie er meinte, obwohl sie gar keine richtige Witwe war.