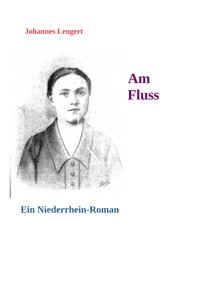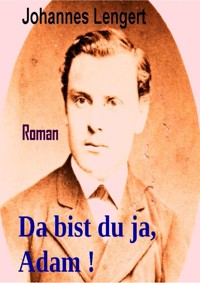8,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sieben Erzählungen, die zu verschiedenen Zeiten, in verschiedenen Ländern und Kontinenten spielen. Sie handeln von Erinnerungen an die Kindheit, der ersten Liebe, von Verlust, Enttäuschung, Eifersucht und Rache. Von Betrügereien in der Welt der Kunst und von der Kraft der Literatur.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Impressum
Cover: Johannes Lengert
Johannes Lengert
Nußbaumer Str. 3-5
51469 Bergisch Gladbach
Webseite
JL-Galerie.de
Johannes Lengert
Die blaue Giraffe
Erzählungen
Die Erinnerung ist das einzige Paradies, aus dem wir nicht vertrieben werden können.
Jean Paul
Inhalt:
Die blaue Giraffe
Longstreet
Emma K.
Die weiße Dame
Roswitha
Bluter
Letzte Tage im Land des Januarflusses
Die blaue Giraffe
Namibia war bisher nie für mich als Urlaubs- oder Reiseland in Frage gekommen. Nicht einmal aus beruflichen Gründen hatte ich es dorthin geschafft. Natürlich war mir die grundsätzliche politische und historische Situation bekannt. Deutsch-Südwest-Afrika als Kolonie des deutschen Kaiserreiches, die damit verbundene Herero-Problematik, der Befreiungskampf der SWAPO, die jahrzehntelange Abhängigkeit von der Südafrikanischen Republik. Und schließlich hatte ich vor Jahren Uwe Timms engagierten Roman „Morenga“ gelesen. Ferner war mir bekannt, dass es in diesem Land noch einige deutsche Farmer gab, von denen einige die alten Verhältnisse für besser als die gegenwärtigen hielten. Selbst die von Freunden und Bekannten in den höchsten Tönen gelobten geografischen Schönheiten, die Flora und Fauna hatten mich unbeeindruckt gelassen.
Wie es dazu kam, dass ich doch nach Namibia reiste, hatte mit der „Blauen Giraffe“ zu tun.
Die Sonne ging unter, und man konnte am Düsseldorfer Rheinufer, wochentags, wenn die Tagesausflügler die Rheinpromenade noch nicht überschwemmt hatten, ihr bei einem Glas Altbier oder einem Glas Rosé gut dabei zusehen und seinen Gedanken nachhängen. Zumal wenn man vorher in der Kunsthalle die aktuelle Ausstellung zum bildnerischen Surrealismus gesehen hatte.
Max Ernst hatte mich beeindruckt. Ich hatte noch das Bild der das Jesuskind züchtigenden Jungfrau (vor drei Zeugen: André Breton, Paul Éluard und dem Maler selbst) im Kopf. Vieles verflüchtigte sich nach einem Museumsbesuch, der letztendlich immer anstrengend war, weil man Neues aufnahm, es mit Bekanntem verknüpfte, nach Erklärungen, Verbindungslinien, nach Anregungen suchte. Die Erschöpfung hatte auch zu tun mit dem Farbenrausch, den ich suchte und dem ich mit hingeben wollte.
Vielleicht war gerade dieser letzte Punkt nicht das Ziel surrealistischer Malerei, doch hatte mich gerade ein Bild in seinen Bann gezogen, das eigentlich nur eine Variation einer einzigen Farbe war und das noch nicht einmal ein einzigartiges Sujet darstellte.
Es zeigte nur ein Tier. Ein mir bislang unbekannter Maler hatte im Format vierzig mal fünfzig Zentimeter, also eher kleinflächig, eine Giraffe in blauen Farben ins Bild gesetzt und auch Vorder- Mittel- und Hintergrund, mit der derselben Grundfarbe spielend, gestaltet.
Zuerst war mir an der Körperform nichts aufgefallen. Das schlanke Tier sah mich unbeteiligt mit, ja, blauen Augen an, hatte die Ohren hochgestellt und schien in einer abstrakten Savannenlandschaft wie ein Solitär. Es gab keine Herde, keine anderen Tiere, keine Feinde. Der Hintergrund wirkte ätherisch, wenig plastisch, sehr flächig, kaum perspektivisch. Das Außergewöhnliche erschloss sich mir bei näherem Herantreten.
Da das Bild relativ klein war, musste ich mich über das Absperrungsseil zum Bild hin beugen. Ich mache das sehr ungern. Das Aufsichtspersonal will immer gleich Verdacht schöpfen und einen Kunsträuber in einem vermuten, das übrige Publikum sieht her und glotzt, anstatt sich mit den ausgestellten Objekten zu beschäftigen.
Und da sah ich es oder besser sah sie, die sieben Beine. Die Giraffe besaß vier Hinter- und drei Vorderbeine.
Nun erklärte sich mir die Hängung bei den Surrealisten noch besser. Ein zweites Mal musste ich mich vorbeugen, um auf dem kleinen in drei Sprachen gedruckten Schildchen rechts neben dem Giraffenbild den Namen des Malers zu lesen. Er sagte mir nichts. Er gab sich mir nicht bekannt. Es gab auch keinen weiteren Hinweis auf weitere Bilder von ihm oder eine Malerschule. Also ließ ich mich weiter treiben, sah mir die restlichen Bilder an, war aber unkonzentriert, verließ schließlich die Ausstellung und begab mich ans Rheinufer.
Ich brauchte Zeit, um nachzudenken. Die Rheinterrassen waren trotz der kalten Jahreszeit geöffnet. Heizpilze und Decken schützten gegen die Kälte. Ich bestellte einen Rosé südfranzösischer Herkunft. Den leicht moussierenden Rosado Alquézar, den ich aus den spanischen Pyrenäen kannte, gab es hier leider nicht.
Die leichte Abendbrise reinigte ein wenig die stickige Luft, die den ganzen Nachmittag auf der Stadt gelastet hatte. Die Sonne versank hinter dem linken Rheinufer, genauso kitschig, wie ein Postkartenfotograf ihren Untergang gemalt hätte.
Der Museumsbesuch sollte mich ablenken. Nicht, dass mir das Ausstellungsthema egal gewesen wäre. Mitnichten. Ich war gerade wegen der Surrealisten-Exponate in diese Stadt gekommen. Das Ausstellungsarrangement und der Katalog hatten gute Kritiken in der überregionalen Presse bekommen.
Eine Zeitlang war ich abgelenkt, doch die Sache mit Lisa ließ sich nicht einfach wegwischen, so wie man eine Schultafel sauber wischt. Die Aussprache hatte nichts genutzt. Wahrscheinlich war es auch keine ehrliche Aussprache gewesen, eher das Aufwärmen bekannter gegenseitiger Vorwürfe. Etwa, warum ich nicht endlich konsequent handle, die Beziehung richtig leben wolle, statt auszuweichen, scheinbar aus beruflichen Gründen, Arbeit vorschiebend, um abreisen zu können, angeblich als Location Scout, wer weiß, was da denn dahinter stecke, oder sie dann doch tatsächlich beenden sollte, die Beziehung, endgültig, für immer. So, in der doppelten Verneinung endete ihr Part.
Der meinige war nicht weniger eingeübt. Sie sei ja kaum noch zu Hause, immer nur auf der Karriereleiter unterwegs und abends sei sie zu müde, um ins Kino oder in Galerien zu gehen.
Ich übertriebe denn auch mit meinem Kunsttick, das ständige Aufsuchen von Museen, das ich mit meinen Beruf rechtfertigen wolle, was Filmsettings denn mit hängenden Bildern zu tun hätten.
Der gut gekühlte Rosé hatte eine erfrischende Wirkung, und ich fühlte eine leichte Entspannung. Auf der Restaurant-Terrasse saßen nur wenige Leute, trotz des schönen Wetters und der Aussicht auf den Rhein. Ein älteres Ehepaar hatte sich einen kleinen Imbiss bestellt, ein turtelndes junges Paar nahm sich ein Drei-Gänge-Menü vor. Offensichtlich hatten die beiden mit der Weinauswahl Probleme. Der Kellner hatte sie wohl nicht gut beraten.
Immerhin war ich mit meinem Rosé zufrieden, dachte schon daran, mir auch die Speisekarte kommen zu lassen, als ich wieder an das blaue Bild denken musste. Warum war nichts über den Maler herauszufinden gewesen? Selbst der Katalog zeigte eine Leerstelle, mehr noch, das Bild tauchte im Katalog gar nicht auf. Ein Versehen? Ein Fauxpas der Druckerei? Absicht der Herausgeber? Wenn ja, aus welchen Gründen? Ich nahm mir vor, am nächsten Tag im Internet zu recherchieren, wenn es denn im Hotel einen entsprechenden Zugang gab.
Meine Buchung bezog sich auf drei Tage. Ich wollte noch in das Museum der Kunstakademie und in die Ausstellungsräume des Landesmuseums.
Jetzt brauchte ich doch etwas zu essen. Ich rief den Kellner, orderte die Speisekarte und bat um die restliche Flasche des Weines aus Südfrankreich.
Die Internet-Recherche nach dem Abendessen auf den Rheinterrassen hatte noch kein zufrieden stellendes Ergebnis gebracht. Der Name des Malers auf dem Schildchen lautete Otto Frivol. Sollte man beim Nachnamen die erste oder zweite Silbe betonen? Die direkte Suche nach Vor- und Zuname erbrachte nichts. Ersetzte man allerdings das I in frivol durch ein O, ergab sich Frovol und dann weiter entwickelt Frohwohl, eine Spielerei, die mich auf eine Spur brachte. Aber das Internet schwieg zu Otto Frohwohl und zeigte mir seine Grenzen.
Ich kenne nicht viele Kunstexperten oder Galeristen persönlich, immerhin war ich flüchtig mit dem Kurator des Landesmuseums bekannt. Wir waren uns auf einer Vernissage in Hamburg, in einer kleinen Galerie, begegnet, als Lisa noch daran Interesse zeigte und nicht mehr wie heute nur ihre Schule im Kopf hatte. Dieser Kurator hatte zwar für ein persönliches Gespräch keine Zeit, versprach aber, eine E-Mail mit Informationen zu schicken, spätestens am Abend.
Im Grunde ist die Farbe blau heutzutage nichts Besonderes mehr. Früher, in der Antike und im Mittelalter, als man die Farbe aus Indigo oder Lapislazuli, also aus einer Pflanze oder einem Halbedelstein herstellen musste, war sie kostbar und wenig verwendet. Infolge chemischer Herstellungs- verfahren seit dem 19. Jahrhundert gibt es nun alle möglichen Varianten des Blau, zum Beispiel bei Stoffen von den früheren Uniformen bis zu Jeans heute. Und für die Maler gibt es ein Sortiment blauer Acrylfarben. Aber Franz Marc malte doch schon Große Blaue Pferde jenseits von banalem Realismus! Dann dachte ich an Henri Roussau, an sein Bild mit dem Tiger im Dschungel, scheinbar natürlich gemalt, aber auf seinem Rücken sitzt der Maler selbst, die Ukulele spielend. Von Dalí gibt’s die Elefanten mit langen Spinnenbeinen vor wüstenartigem Hintergrund.
Wo lag nur der Schlüssel zur „Blauen Giraffe“? Die eher klassischen Surrealisten mussten nicht die Lösung sein. Und Yves Klein hatte sicherlich nichts damit zu tun. Ich versuchte es mit den Romantikern, mit Novalis' Blauer Blume und dem Blues, den ich bald wohl selbst bekam. Es stellte sich kein Sinn her.
Du musst zielstrebiger sein. Du lässt dich manchmal so hängen. Lisas Worte gingen mir durch den Kopf, als sie ihre Bewerbung auf eine Schulleiterstelle rechtfertigte. Meine Arbeitsweise reichte mir doch zum Leben. Ich brauchte ihre nicht zu kopieren. Ich konnte reisen, bei Bedarf organisieren, mir die Welt ansehen, unter der Bedingung, geeignete Drehorte für Filmproduktionen zu finden.
Ich war größtenteils für Lateinamerika zuständig. Da jedoch wurde nicht so viel gedreht, und schon wieder schwebte Lisas Vorwurf über mir. Aber ich hatte auch Zeit für meine Interessen, oder war es schon ein Tick, dass ich dauernd in Museen war, wie jetzt, in Düsseldorf?
Tatsächlich war vom Kurator eine Nachricht gekommen.
Ich hätte Otto Frivols Giraffe fotografieren sollen! Auch wenn dies offiziell nicht gestattet war ( mit dem Smartphone in einem unbeobachteten Augenblick). Jetzt verfügte ich lediglich über Erinnerungen, die mit dem zeitlichen Abstand immer vager wurden. Wie war das denn mit der Vegetation, gab es die überhaupt nicht oder doch? Und die Farbnuancen. Kam auch türkis vor oder nur hellblau? Obwohl in meinem Gedächtnis viele Bilder recht gut abgespeichert sind, stieß ich auf Erinnerungslücken, gerade jetzt. Ich war unkonzentriert. Sie wollte Schulleiterin werden. Kein Beruf ist derartig Kräfte zehrend, anstrengend, mit wenig Prestige ausgestattet und dann zu schlecht bezahlt. Das Unterrichten von Erdkunde und Biologie war ihr wohl nicht genug. Da musste erst noch die Oberstufenleitung dazu. Dann die stellvertretende Schulleitung.
Mir hatte es nach der Referendarzeit gereicht. Ich bin danach ausgestiegen. Für mich war damit meine Schulzeit endgültig beendet. Alexander von Humboldts Südamerikanische Reise, die Lektüre dieses Buches hatte den Ausschlag für meine Fächerwahl an der Universität gegeben. Dann wollte ich nur noch nach Südamerika.
Es gibt, so hieß es in der Kurator-Mail, einen Maler Frohwohl. Möglicherweise mit dem Vornamen Otto. Dabei kann es sich um ein Pseudonym handeln. Im Archiv gibt es ein paar alte Ausstellungskataloge. Da wir dauernd Wechselausstellungen machen, ist die Fluktuation hoch. Es fehlt ein bisschen die Übersicht. Der Katalog ist aus den siebziger Jahren. Ich hinterlasse für Sie eine Kopie des letzten Exemplars an der Pforte.
P.s. Bitte halten Sie mich über Afrika auf dem Laufenden. Ihr Forschergeist hat auch mein Interesse geweckt.
Offensichtlich hatte ich die Blaue Blume gefunden, oder sie war in erreichbarer Nähe. Aber das hieß, ich musste auf Wanderschaft gehen, wieder hinaus in die Welt. Das kam mir nicht ungelegen, obwohl ich, bekanntermaßen zu wenig ehrgeizig, eine Zeitlang in heimischen Gefilden verbringen wollte.
Die Kopie des alten Katalogs zeigte eine Präsentation verschiedener Künstler aus den siebziger Jahren des vorigen Jahrhunderts, die hier als Repräsentanten der Postmoderne galten. Beim Durchblättern fanden sich zwar einige dem Surrealismus anverwandte Bilder, aber nicht die Blaue Giraffe, sondern stattdessen andere Werke von Frivol und im Anhang eine Kurzbiographie.
Frivols Bilder hatten kein wiederkehrendes Sujet, sondern offenbarten Phasen eines Künstlers, der auf der Suche war, aber niemals sich auf eine Mode würde festlegen können, der eigentlich für Galerien, die ja Moden und Stilumbrüche brauchten, uninteressant war. Die Bilder im Katalog waren kleinformatig, auf der Kopie farblich noch gut erkennbar, mit Angaben über die wirklichen Größenverhältnisse.
Auffallend war eine Serie von Bildern, die den aktuellen Gemälden von Gerhard Richter ähnelten, verschlierte Farben, offenbar mit einem Rakel aufgetragen und dann von oben nach unten verteilt, so dass sich die ursprünglichen Grundfarben leicht vermischten.
Überhaupt, das fand ich schnell heraus, ging es Frivol offensichtlich immer wieder um die Grundfarben rot, blau, gelb, dann gemischt als orange oder violett und manchmal grün. Es gab auch Selbst- oder Familienporträts, die expressionistisch wirkten und mit der Plakatkunst verwandt waren. Und schließlich, am Schluss, drei Bilder unterschiedlichen Formats, die so etwas wie eine blaue Periode bildeten: ein großformatiges Gemälde in Blautönen, streng geometrisch aufgebaut, dessen Flächen wie Glas- oder Spiegelwände wirkten, mit dem bezeichnenden Namen „Liebe zur Geometrie“, ein kleineres Format, dunkel- blau, senkrecht schmutzig-weiß aufgehellt, aus dem Augen und Mund einer Frau herausblickten, alles mit blauen Waagerechten, wie mit Gitterstäben gequert, das die Bezeichnung „Frau in Blau“ trug. Und es gab ein ein drittes Bild, in der Größe des zweiten, ein Frauenporträt, das mich melancholisch anblickte, mit dem leichten Lächeln der La Gioconda, allerdings mit nach links geneigtem Kopf. Durch die ausschließliche Verwendung von Blau- bis Weißtönen entsteht der Eindruck einer Skulptur, einer Marmorbüste im Mondlicht. Dieses Bild hatte Frivol „Mona als Lisa“ genannt. Hierher musste auch die Blaue Giraffe gehören!
Das Frauenporträt gab mir die Idee ein, nach Italien zu ziehen, so wie Eichendorffs Taugenichts. Ich verwarf den Gedanken schnell wieder, da dort wohl keine Giraffen-Maler zu finden wären. Aber wo steckte Frivol oder hielt er sich versteckt? Und warum wollte ich ihn überhaupt finden. Die Vorstellung, die Person ausfindig zu machen, ergriff allmählich von mir Besitz. Die Kurzbiografie konnte erst einmal etwas helfen.
Kurz erwog ich, nach Hamburg zu reisen, um Lisa von meinen Entdeckungen zu berichten, zumal mich das blaue Porträt sofort an sie erinnerte. Es hatte aber nicht die harten Züge, die sich schon in Lisas Gesicht einzuschleichen begannen.
Schön waren unsere gemeinsamen Abende gewesen, wenn wir uns in der kleinen Dach-Wohnung gegenseitig vorlasen, was wir in Zeitungen und Büchern, mit denen wir beschäftigt waren, gefunden hatten. Noch gab es einen gemeinsamen Nenner, der vom Studium herstammte, denn wir hatten uns beim Geografiestudium kennengelernt. Sie hatte immer schon Afrika allen anderen Themen vorgezogen. Mein Hauptinteresse galt ja Lateinamerika, deshalb auch das zweite Studienfach Spanisch. Lisa war nur einmal in Afrika, damals auf einer Großen Exkursion mit ihrem verehrten Professor Horst Mensching. Ich glaube, es war in den Ländern des Maghrebs. Sie schlug eine Dissertation zum Thema Trockenheit in Marokko aus, lieber ging sie in die Schule, um hier ihre Meriten zu verdienen.
Nach Hamburg fuhr ich dann doch nicht.
Ich war nur ein einziges Mal in Afrika, nicht lange, in Togo und Ghana. Eine Produktionsfirma hatte mich hingeschickt, um Eindrücke zu sammeln. Ein Film wurde nicht gedreht.
Afrika! Die blaue Giraffe hatte damit zu tun und möglicherweise ihr Schöpfer!
Düsseldorf zeigte sich auch an diesem Abend von seiner schönen Seite. Ich machte einen Spaziergang am Rheinufer entlang. Die Luft war kühl, und es dunkelte, ruhig floss der Rhein, ich suchte einen Platz im Abendsonnenschein.
Auf einer Bank, abseits von bereits einsetzenden Trubel, wollte ich die Kurzbiografie über Frivol lesen.
Das Rheinwasser schlug plätschernd gegen die Ufersteine. Langsam breitete sich Stille aus. Möwen überflogen die Uferpromenade, flogen mir fast ins Haar und stoben davon. Eine leichte Brise kam auf, und ich begann zu frösteln. Was mir vorhin noch leicht möglich erschien, einfach nach Hamburg zu reisen, war mit einem Mal unmöglich. Zu groß waren inzwischen die Differenzen zwischen Lisa und mir. Gerade deshalb saß ich ja hier. Wir waren Fremde geworden. Ich hatte eine lange Zeit geglaubt, dass sich die Gegensätze überbrücken ließen, wenn nur ein tiefes Begehren da war. Aber die Auseinandersetzungen in letzter Zeit ließen davon kaum etwas übrig. Es ergriff mich plötzlich mit wildem Weh. Egal, ich musste jedenfalls fort.
Die Lektüre der Biografie ergab, dass ein gewisser Hans Günther Frohwohl ursprünglich Restaurator war, in verschiedenen Kirchen gearbeitet hatte und sich dann der Leinwand zuwandte, um nur noch nach eigenem Gusto zu malen. Man könnte sagen, dass er einige „Lehrjahre“ in Italien verbrachte, um die alten Meister zu studieren. Immerhin bildete sich eine Gruppe Gleichgesinnter, die zwar technisch versiert, aber inhaltlich und farblich neue Wege beschreiten wollte.
Seine ersten eigenständigen Bilder waren Akte, die zwar schockieren sollten, es auch taten, was wohl dazu führte, dass er sich nun das Pseudonym „Frivol“ gab. Danach verbrachte er wiederum längere Zeit im Ausland. Der Katalog spricht von der südlichen Hemisphäre. Die Angaben bleiben ungenau. Es wird eine Quelle zitiert, nach der sich Otto (wie er sich jetzt nannte) Frivol eine Farm in Südwestafrika gekauft hat. Aha. Er hatte eine Farm in Afrika. Die gezeigten Bilder sollen aus seinem Nachlass sein. Damit enden die Informationen.
Noch bin ich jenseits von Afrika. Ich gehe in ein Reisebüro, um mir Broschüren über das südliche Afrika zu besorgen. Obwohl ich das Internet regelmäßig nutzte, möchte ich manchmal Seiten durchblättern, nicht nur digital, sondern haptisch, mit meinen Händen. Deshalb lese ich täglich die Zeitung als Printmedium, auch wenn ich mir dabei die Finger schmutzig mache.
Beim Durchblättern der Reisejournale stoße ich auf die Big Five. Zunächst weiß ich nicht, was gemeint ist, aber dann erkenne ich es an den Bildern. Es ist das Großwild, das man auf Safaris sehen, aber nicht jagen darf: der Elefant, das Nashorn, der Büffel, der Löwe und der Leopard. Die Giraffe gehört nicht dazu.
Die fünf sind abgebildet vor leuchtenden Landschaften. Rötlich-braun, hell- bis dunkelgrüne Büsche und Bäume, hohes Gras. Klar. Savanne. Feuchtsavanne. Trockensavanne. Dornstrauchsavanne. Hier wohl Feuchtsavanne kurz nach der Regenzeit. Der Fotograf hat kein Klischee vermieden. Lisa ist ja Savannenspezialistin. Damit hat sie die Schüler im Unterricht gequält. Aber eine geführte Safari will ich mir nicht antun. Und die ist außerdem extrem teuer. Es muss anders, billiger gehen.
Mir fällt Afrika-Kurt ein. Nicht verwunderlich, da mir Afrika nicht mehr aus dem Kopf geht. Afrika-Kurt lernte ich während meiner Lehrerausbildung kennen. Der Spitzname rührt daher, dass er alle seine Ferien in Afrika verbrachte, Unmengen von Fotos schoss und diese einem auserwähltem Publikum an Dia-Abenden zeigte. Er gilt als Afrika-Experte und liebt die Afrikanerinnen.
Kurt hielt es länger im Schuldienst aus als ich, hat aber inzwischen den Dienst quittiert, war eine Zeitlang Entwicklungshelfer, ist Händler afrikanischen Kunsthandwerks und organisiert Gruppenreisen in Afrika. Er half mir auch damals in Westafrika. Warum nicht auch jetzt? Ein Anruf bei ihm ergab, dass er nicht zu Hause war, einer seiner Söhne setzte mich davon in Kenntnis, dass es da ein paar Leute gebe, die nach Namibia reisen wollen, er selbst könne aber nicht teilnehmen. Da gibt es einen gewissen Josef. Ich gebe dir seine Telefonnummer. Kannst einfach anrufen. Tschüss. Ja, Danke.
Wie sind Otto Frivols Bilder nach Deutschland gekommen? Der Kunstmarkt ist nicht leicht überschaubar. Und nach welchen Kriterien werden überhaupt Ausstellungen organisiert? Ich erinnere mich daran, dass ich vor einigen Jahren mit Lisa ein weiteres Mal in Madrid war. Groß angekündigt war eine Goya-Sonderausstellung. Natürlich mussten wir sie sehen, zumal der Eindruck vermittelt wurde, dass Gemälde gezeigt würden, die bisher unzugänglich gewesen seien. Wir standen mehr als eine Stunde in der Schlange vor der Kasse. Mit Erstauen und einer großen Portion Wut stellten wir fest, das wir vor Jahren im selben Prado alle Bilder schon einmal gesehen hatten, denn sie waren Bestandteil der ständigen Goya-Präsentation, jetzt nur anders arrangiert. Ähnlich ging man wohl mit der modernen Kunst zu Werke: Nur Aufmerksamkeit erregen!
Na, zunächst musste ich mal Otto aufspüren.
Ich rief Josef an. Er war interessiert, da die derzeitige Gruppe nur aus drei Leuten bestand. Vier seien besser, dann könne man einen Geländewagen mieten und auch gruppendynamisch liefe es dann glatter. Sie drei hätten sich schon auf den Monat Februar geeinigt, aus klimatischen Gründen und weil die Touristenströme geringer seien, also es keine Probleme mit der Unterkunft gebe. Wir vereinbarten ein gemeinsames Treffen zu viert, waren uns sympathisch, et causa finita est, so Josefs Kommentar.
An einem Montag Abend landeten wir in Windhoek. Außer mir und Josef, Beate und Frieda, Josefs jüngere Kusine. Bis auf Frieda, die Tierärztin war, waren alle Lehrer oder waren es gewesen. Josef unterrichtete Latein und Geschichte, Beate war für Deutsch und Mathematik zuständig. Sie war die Älteste, Pensionärin und Weltenbummlerin, mit allem wohlvertraut. Frieda schleppte eine professionelle Fotoausrüstung mit. Kein Tier soll ihr entkommen. Meine wahren Reisemotive hatte ich bisher verschwiegen. Ich gab Interesse an der Landschaft, der Geologie, den Sozialstrukturen vor, hatte auch meine Tätigkeit als Location Scout nicht verheimlicht, denn unter diesem Vorwand würde ich mich leichter bei Bedarf absetzen können.
Eagle's Rock hieß unsere erste Unterkunft, eine Lodge auf den Hügeln des Khoma-Hochlandes, einige Kilometer von der Hauptstadt Windhoek entfernt. Hier blieben wir zwei Nächte, also hatte ich einen Tag lang Zeit, mich auf Spurensuche zu begeben, wenn die andern einen Stadtbummel machen. Vorerst verbrachten wir den Abend auf dem Gelände der Lodge, von dem aus ein beeindruckender Blick auf die namibische Savanne gelang. Die untergehende Sonne ließ die hoch aufragenden Kakteen wie Geisterhände erscheinen. Ich notierte mir im Geiste diese filmische Dekoration und machte zur Sicherheit ein Foto mit dem Smartphone, das ich Lisa schicken konnte.
Also in Bolivien habe ich das schon großartiger erlebt, hörte ich Beates Stimme im Hintergrund. Da werden die Kandelaber-Kakteen bis zu sechzehn Meter hoch.
Frieda hatte bestimmt schon die ersten Eidechsen fotografiert, denn von den Big Five war hier noch nichts zu sehen. Höchstwahrscheinlich waren die Eidechsen in Bolivien auch viel größer als hier. Ich genieße im hic et nunc, ist Josefs Kommentar. Ich find‘s großartig, außerdem schmeckte mir die Antilope, und der Wein war auch gut. Josef war leicht zufrieden zu stellen. In schwierigen Situationen griff er zu Seneca, dessen philosophische Schriften er als Reclamheft mit sich führte.
Anderntags in Windhoek begab ich mich zur Stadt- verwaltung, um etwas über die Farmen deutsch- stämmiger Siedler herauszubekommen. Mein Anliegen wurde nicht verstanden, oder man tat zumindest so, denn die junge etwas füllige Beamtin verwies mich immer wieder ans Nationalmuseum.
Gut. Dann eben ins National Museum. Dort war ich am falschen Ort: hier wurde rein Historisches ausgestellt. Aber ich sollte mal in die National Galerie von Namibia gehen, die hätten moderne Kunst. Schon bald war ich im richtigen Haus, einem modernen Gebäude aus den Neunzigern, in de Joe Madisia (* 1954) gezeigt wurde, ein zeitgenössischer Künstler aus Namibia.
Es gab kaum Besucher, und ich fand einen leitenden Angestellten, der mir weiterhalf. Ich erfuhr, dass es intensive Beziehungen zu einigen deutschen Museen gab, die auch schon Werke von Madisia ausgestellte hatten,. Als ich den Namen des Kurators aus Düsseldorf erwähnte, blüht mein Gesprächspartner auf und geriet ins Schwärmen. Ja, sie würden manchmal deutsche Künstler präsentieren und Otto Frivol sei ihm nicht unbekannt. Ach ja: hier hing mal ein Frivol! Wer dahinter stecke, wisse er nicht. Allerdings hätten sich im Norden des Landes einige deutschstämmige Farmer niedergelassen, und an der Küste in Swakopmund würde ich mit Sicherheit fündig werden, auf der Suche nach Frohwohl.
Das traf sich gut. Unsere Reise führte zunächst nach Norden, schlug einen Bogen nach Westen und Süden, unter anderem nach Swakopmund. Ohne große Probleme konnte ich meine Interessen weiterverfolgen. Die Rundfahrt durch das Land war von Uniquue Tours & Safaris organisiert worden, so dass unsere Logdges schon gebucht waren und somit auch ein Zeitrahmen abgesteckt war, aus dem nicht auszubrechen war.
Frieda hatte schon in Deutschland die Planung in die Hand genommen und mit Beate zusammen die Route festgelegt. Josef hatte sich herausgehalten, er ließ seine Kusine gewähren, in die er, wir mir schien, verliebt war. Ich war als Späteinsteiger vor vollendete Tatsachen gestellt, beklagte das jedoch nicht. Zwar war mir als Geografen an Landschaft, Vegetation, Gebirgsformationen und Wüste gelegen, zwar wollte ich Farbeindrücke, durch Sonneneinstrahlung und Schattenbildung hervorgerufen, sammeln, aber mit der Tierwelt, den Big Five im Besonderen, hatte ich wenig zu tun. Das jedoch war für die anderen drei das Wichtigste.
Wir waren in Doppelzimmern untergebracht, die Männer und Frauen jeweils zusammen. Josef und ich kamen gut miteinander klar, die beiden Frauen hatten sich angefreundet, eine gruppendynamisch interessante Konstellation, unter der Josef offenbar litt, aber die er mit stoischer Grundhaltung durchzustehen schien: Si vis amari, ama!
Gar wunderlich sind doch die Menschen. Ich halte mich lieber an Heine oder Dr. Kästners Lyrische Hausapotheke. Wie es schien, ging meine Romanze mit Lisa sachlich zu Ende, aber es war ein Ende, das ich mit allen Mitteln hinauszuzögern versuchte. Ich hätte dich nicht gehen lassen sollen! (Nicht meinetwegen. Ich bin gern allein.) Und doch: Wenn Frauen Fehler machen wollen, dann soll man ihnen nicht im Wege sein.
Windhoek war stadt- und sozialgeografisch an mir vorübergegangen. Aber dafür blieben mir vielleicht noch die Tage vor dem Weiterflug nach Kapstadt. Unsere Route führte jetzt circa dreihundertfünfzig Kilometer nach Norden, in Richtung Waterberg. Genau in diesem Umfeld war auch die Farm, auf die mich der freundliche Museumsangestellte hingewiesen hatte.
Beate setzte sich ans Steuer, Frieda vorn, wir Männer hinten. So ganz einfach war die Sache nicht, schließlich mussten wir uns auf Linksverkehr und auf die Steuerung rechts umstellen. Josef fuhr übrigens nie. Wenn Beate fuhr, nahm ich freiwillig hinten im Auto Platz, spielte dann den Gentleman.
Josef war hager, sein graues Haar wurde etwas licht, zum Ausgleich ließ er sich die Barthaare stehen. Er ging leicht nach vorn gebeugt, sprach leise und hielt sich eher im Hintergrund auf.