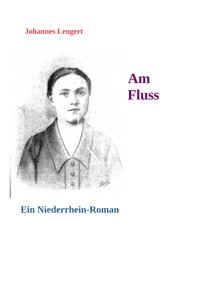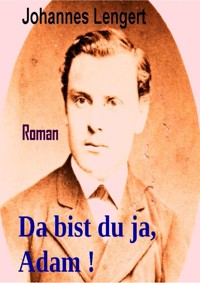
9,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Familiengeschichte voller Umbrüche und gewaltiger Veränderungen. Adam, der Stammvater, muss seine große Familie durch ruhige und unruhige Zeiten bringen. Im Kaiserreich herrscht noch Frieden. Doch dann kommen der Krieg, die Revolution und die Republik. Die neue Friedenszeit währt nicht lange, und die Nazi-Diktatur verändert das Leben aller erneut. Kurz vor Beginn des Zweiten Weltkrieges sitzt Adam am Totenbett seiner Frau. Drei Tage lang blickt er auf sein Leben zurück. Auf seine Kindheit und Jugend in der Eifel, seine Ausbildung als Volksschullehrer, die Freude an der Musik, seine erste Liebe - und seinen Verrat und seine Schuld. Auf die Abwanderung ins Ruhrgebiet und das neue Leben, das er für sich und seine Familie aufbauen musste. Auf seine elf Kinder, deren Zukunft er patriarchalisch bestimmte. Doch lernt er durch sie die Errungenschaften moderner Technik kennen: er schätzt das Radio und das Grammophon, die jetzt ins Haus kommen, die aber schon politische Propaganda verbreiten und damit den Weg in den neuen Krieg. Die Kraft zum geistigen Widerstand findet er im Glauben. Das Wort des Papstes zählt mehr als das des Diktators. Und so hofft er, dass er und seine Kinder die Nazi-Zeit überstehen werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Johannes Lengert
Da bist du ja,
Adam
Roman
Inhalt:
Erste Nacht
Zweite Nacht
Dritte Nacht
Erste Nacht
Gerade haben die beiden Angestellten des Beerdigungsinstituts Brüggelmann, die die Leiche aufgebahrt hatten, die Wohnung verlassen. Es ist gerade ein paar Stunden her, dass Doktor Michels den Totenschein ausgestellt hat. Dass Katharinas Tod dann so plötzlich kam, hatte keiner erwartet. Sie war seit drei Monaten bettlägerig, und das Ende war absehbar, das spürten alle, insbesondere die Kranke selbst, trotzdem ist ihr Weggang ein Schock. Wie soll er jetzt mit der Leere fertig werden, um ihn herum, auch wenn noch ein Teil der Kinder im Haus wohnt? Eine Leere nach über 45 Jahren Ehe!
Vom Wohnzimmer aus geht eine Tür ins eheliche Schlafzimmer. Er bleibt im Türrahmen stehen, stützt sich mit dem Rücken ab. Das Zimmer ist verdunkelt. Auf der rechten Hälfte des Ehebettes liegt jetzt die Tote, aufgebahrt im Sarg. Vor dem Bett stehen zwei Silberleuchter, auf denen zwei Altarkerzen blakend ein schwaches Licht erzeugen, so dass er nur das eingefallene Gesicht und die gefalteten, mit einem Rosenkranz umwundenen Hände seiner Frau sehen kann. Der Kopf ist auf ein großes weiß besticktes Kissen gebettet, von dem sich die noch dunklen, hochgesteckten Haare deutlich abheben. Ihre Haare sind kaum ergraut, aber die elf Geburten, die schwere Haus- und Gartenarbeit, die Sorgen um die Kinder, die in der Kriegs- und Nachkriegszeit durchgebracht werden mussten, haben die Frau körperlich früh altern lassen. Neben ihm, der auch nicht gerade groß ist, nahm sie sich mit ihrem gekrümmtem Rücken noch kleiner aus, viel kleiner, als er sie als junge Frau, dann als seine Verlobte in Erinnerung hat.
Bei ihrer Verlobung war sie bereits schon über das übliche Heiratsalter hinaus. Aber sie hatten warten wollen, bis er eine feste Stelle als Lehrer bekam, und sie hatte ihm das Versprechen gegeben zu warten, sie, die Tochter des Küsters, die auch den jungen Bäcker oder den verwitweten Schmied hätte haben können, um versorgt zu sein.
Doch seit sie sich auf der Kirchweih drei Jahre zuvor besser kennengelernt hatten, er noch ohne feste Anstellung im preußischen Schuldienst war, nur als Hilfslehrer, der mal hier, mal da eingesetzt wurde, wenn im Regierungsbezirk Trier ein Volksschullehrer benötigt wurde, stand trotzdem für sie beide schnell fest, dass sie zusammenbleiben wollten, auch wenn noch auf Jahre hinaus das Warten anstand, manchmal etliche Meilen zwischen ihnen lagen und in Katharinas Wohnort sich die Leute in ihrem Eifeler Singsang die Mäuler zerrissen über dieses ältliche Verlobungspaar, das scheinbar doch nicht zusammenkam, und er selbst dachte in einsamen Stunden an die Königskinder, die nicht zueinander fanden.
Zur Kirchweih in Münstermaifeld war er nur deshalb gegangen, weil er nicht noch einen Abend allein in seinem Zimmer hocken wollte, das der Küster Nikolaus Kirchem ihm billig vermietet hatte und außerdem der Schule schräg gegenüber lag. Denn der Küster selbst hatte noch vor der Schulreform, die ausschließlich Leute mit ordentlicher Ausbildung zum Lehrerberuf zuließ, Unterricht in der Elementarschule gegeben.
Vor einigen Wochen war er hier eingezogen, die Lehrerstelle war befristet, warum sollte er sich hier eingewöhnen? Er brauchte keine Menschen um sich herum, da war er lieber allein und las auf Französisch Romane von Léon Bloy, um sein Französisch aufzubessern und sich gleichzeitig religiös erbauen zu lassen. Er mochte auch nicht den Lärm des Wirtshauses, und wenn er einen Krug Bier wollte, ließ er sich ihn vom jüngsten Küsterssohn Niklas aus dem Wirtshaus holen.
Doch heute war es anders, da wollte er sich die Beine vertreten, er brauchte Luft, ein unbestimmtes Gefühl beherrschte ihn, ein Rauschen war in seinem Kopf, ein Rauschen, das ihn in letzter Zeit immer mal wieder heimsuchte, das nicht gerade angenehm war, aber auch nicht schmerzte, eher ihn zur Bewegung zwang. Also fand er sich jetzt auf dem Kirchplatz wieder, die Musik brandete ihn an, die Fiedeln, schlecht gestimmt oder schon wieder verstimmt, quietschten in seinen Ohren, die große Trommel hatte den Rhythmus immer noch nicht gefunden, so dass er sich zum Bierstand flüchtete, durch ein Rudel wild tanzender Kleinstädter und Dörfler aus der Umgebung, und nach einem großen Krug Bier verlangte, der ihm ziemlich schnell gereicht wurde und den er, ohne abzusetzen, zur Hälfte leer trank.
Trotz dieser Geste blieb er ein Fremdkörper unter den Männern am Bierstand, die über ihren kragenlosen weißen Hemden allenfalls eine aufgeknüpfte Weste trugen und vielleicht auf dem Kopf einen in den Nacken geschobenen Hut und daher leicht etwas verwegen, gewollt verwegen, aussahen, während er wie immer im Dreiteiler nun dastand, Distanz und Autorität auszustrahlen schien, wenn auch der Hemdkragen und die Manschetten durchgescheuert, die Ärmel der Jacke an den Ellbogen fadenscheinig waren und an der Weste zwei Knöpfe fehlten. Noch am Morgen, vor dem Aufbruch ins Schulgebäude hatte Katharina, des Küsters älteste Tochter, sich erboten, ihm die Knöpfe, zwar in anderer Form und Farbe, schnell anzunähen, doch er hatte sie abgewimmelt, warum auch immer, oder weil er sich nicht eingestehen wollte, dass ihre Nähe ihm wohltat.
Den halb geleerten Krug in der Hand, ließ er seine Augen schweifen, stellte sich auch auf die Zehenspitzen und versuchte, in Richtung Tanzboden zu schielen, konnte aber niemanden mit aufgesteckten braunen Haaren ausmachen, in der Hoffnung, es sei Katharina, die ja hier sein musste. Das wusste er, weil sie ihn am Tage vorher um seine Begleitung gebeten hatte, zum Tanz heute Abend vor der Kirche, eine Begleitung, die er aus Angst vor Peinlichkeit ausgeschlagen hatte. Was sollten die Leute denken, sie beide unter einem Dach wohnend, und dann drehen sie sich wild brünstig auf der Tanzfläche, sein Ruf als Lehrer wäre dahin gewesen.
Nach dem gänzlich geleerten Krug bedauerte er sein Verhalten. Jetzt hatte er das Nachsehen. Andere würden sie über den Tanzboden schleifen, sie im Arm halten, ihr Worte ins Ohr flüstern. Das konnte er sowieso nicht. Da fehlten ihm die richtigen Worte. Und französische Lyrik hätte sie nicht verstanden, und das wäre ihm noch peinlicher gewesen. Sollte er noch ein zweites Bier bestellen und dann nach einiger Zeit nach Hause zurückgehen?
Eine Berührung am linken Ärmel weckt ihn aus den erinnernden Träumereien. Seine älteste Tochter, die Barbara, ist wohl herangeschlichen, wie es ihre Art ist, um ihm irgendetwas mitzuteilen. Nie kann sie etwas geradeheraus sagen, nur umständlich, nicht immer ganz zu verstehen, manchmal erschien sie ihm unzurechnungsfähig, und es war gut, dass sie nach der Schule direkt weiter im Haushalt mithalf, beim Einkaufen, Einmachen, Kochen, Stopfen und Nähen, was sie noch einigermaßen hinbekommt. Seine Entscheidung hat sich als richtig erwiesen: sie ist zum Dienen geboren, nicht zum Denken.
Was sie denn jetzt wieder wolle, entfährt es ihm harsch.
Die Trauer macht ihn nicht gütiger. Sie ist nun über vierzig, das schwarze Kleid und die dunkle Schürze lassen sie noch älter erscheinen, und auch die zum Knoten aufgesteckten schon leicht grau werdenden dünnen Haare verstärken diesen Eindruck. Er solle jetzt zum Essen in Küche kommen, wiederholt Barbara, die anderen würden nur noch auf ihn warten. „Ich habe keinen Hunger, esst ohne mich, bring mir ein Wasser und lasst mich in Ruhe! Ich will mit meiner Frau allein sei.“ Und damit tritt er nun ganz ins Schlaf- oder Totenzimmer, zieht einen Stuhl ans Bett heran und beginnt mit der Totenwache.
„Da bist du ja, Adam!,“ hörte er neben sich eine Stimme. Das Bier hatte ihn benommen gemacht. Die Hitze, die laute Musik, das ungewohnt schnelle Herunterstürzen des Starkbieres verlangsamten seine Reaktionen, und da die Stimme von hinten kam, musste er sich umdrehen, um Katharina zu erkennen, die in ihrer Festtagskleidung, etwas atemlos, vom Tanzen wohl, dann vor ihm stand. „Dann gefällt dir die Kermes doch?“, hörte er die Stimme der Küstersstochter. „Du wolltest doch gar nicht herkommen!“ Bevor er eine plausibel klingende Erklärung stammeln konnte - die Zunge war ihm vom überhasteten Biergenuss schwer geworden - , hatte sich Katharina bei ihm untergehakt und zog ihn nun in Richtung Dorfteich, dahin, wo die Menschenmenge nicht mehr so dicht stand.
Die Sonne war nur noch als schmaler gelber Streifen über dem Dach des Pfarrhauses zu sehen, Einige dunkle schwere Wolken schoben von Westen heran und sorgten dafür, dass die Sicht unscharf wurde. Um so besser, dachte Adam, dann kann man meine klägliche Verfassung nicht erkennen, denn nichts erschien ihm schrecklicher, als sich in der Öffentlichkeit bloßgestellt zu sehen oder eine Schwäche zeigen zu müssen, die ihn als Staatsdiener blamieren könnte.
Katharina war von derlei Gedanken weit entfernt. Das Getuschel anderer kümmerte sie wenig, obwohl sie im strengen Regiment einer tiefgläubigen Küstersfamilie aufwuchs und sicherlich jeder ihrer Schritte in der Öffentlichkeit genau beobachtet und kommentiert wurde. Auch die Tatsache, dass da ein lediger Volksschullehrer in ihrem Vaterhaus, also gleichsam mit ihr unter einem Dach wohnte, führte bei ihr nicht zu Gewissensbissen. Sie hatte sich ja nichts vorzuwerfen. War es eine Sünde, wenn sie diesen Lehrer mochte, diesen überkorrekten, höflichen jungen Mann mit den blaugrauen Augen und dem streng gescheitelten blonden Haaren im abgewetzten Sommeranzug, der vor einiger Zeit aus Steinborn hergekommen war, um eine Vertretungsstelle anzunehmen, der wochentags auch als Organist in der Frühmesse einsprang und manchmal laut, in seinem Zimmer auf- und abgehend, französische Verse deklamierte, von denen sie annahm, dass sie ihr galten? War es denn Sünde, wenn sie davon träumte, aus ihrem engen Elternhaus hinaus zukommen und die Frau eines Lehrers zu sein? War es sündhaft, sich im reifen Alter von gut 25 Jahren eine Ehe zu wünschen, wenn ihre Schulfreundinnen Anna Getultich und Margarethe Welmen schon längst verheiratet waren und mehrere Kinder hatten?
Anna und Margarethe waren versorgt, hatten „gute“ Männer bekommen - sagten sie jedenfalls. Aber was konnte sie selbst Großes erwarten, sie, die immer nur auf ihre kleineren Geschwister aufpassen und der Mutter beim Haushalt zur Hand gehen musste, sie, die lieber ihrem Vater bei dessen Arbeit in der Kirche, in der Sakristei, beim Vorbereiten der Messe geholfen hätte, was ihr jedoch als Mädchen oder Frau verboten war, sie, die die Schule noch nicht einmal ganz bis zur achten Klasse abgeschlossen hatte, weil damals ihr jüngster Bruder zur Welt gekommen war und sie den Haushalt übernehmen musste, weil ihre Mutter nach der schweren Geburt monatelang das Bett hüten musste.
Vor drei, vier Jahren, da hätte sie den Martin, den Sohn des Bäckers, haben können. Doch sie wollte nicht, er war ihr zu unscheinbar, zu schmächtig, nicht stattlich genug, und der alte Kirchem hätte es damals sowieso nicht erlaubt. Wenn sie auch keine gute Partie war, finanziell gesehen - was hat ein ein Küster schon an Mitgift zu bieten? - so war sie doch eine Frau, nach der sich die Männer umdrehten, nach einer Frau mit heller Haut, die ihr volles braunes Haar hochgesteckt trug, so dass ihr schlanker Hals, wenn auch von einem weißen Kragen züchtig verschlossen, noch gut zu sehen war, einer Frau, deren eng tailliertes Sonntagskleid nicht neu, aber mit immer verschiedenen, kaum merklichen, dunklen Schleifen versehen, ihre schlanke Figur beim Kirchgang zur Geltung brachte, so dass die anderen, meist älteren Frauen - das spürte sie - die Köpfe zusammensteckten und tratschten. Auch das machte ihr gar nichts aus, und so nahm sie sogar Adam an die linke Hand, um ihn unter die Baumgruppe am Teich zu führen, wo der Stamm einer gefällten Platane eine Art Bank bildete.
Adam atmet tief auf. Er sitzt kerzengerade auf dem Schlafzimmerstuhl und betrachtet das Antlitz seiner toten Frau. Die Monate im Küsterhaus hatten sein Glück bedeutet. Nachdem ihm Katharina ihre Zuneigung bekannt hatte, hatte es nicht mehr lange bis zur Verlobung gedauert. Er konnte demnächst auf eine feste Anstellung hoffen, das hatte ihm das Trierer Regierungsdezernat in Aussicht gestellt, aber vor Erscheinen der Verlobungsanzeige musste er aus Schicklichkeitsgründen die Küsterei verlassen und sich für die Übergangszeit eine andere Unterkunft suchen. Katharina hätte sein Verbleiben nicht gestört, aber er selbst und sein künftiger Schwiegervater, der nur ungern seine Tochter abgab, waren sich unausgesprochen einig darüber, kein Gerede im Ort entstehen zu lassen.
Den Verlobungstermin hat er noch genau in Erinnerung: es war im Oktober 1892. Ein Jahr später sollte die Hochzeit stattfinden. Im Jahr der Verlobung war es, als der Preußische Ministerpräsident - an den Namen kann er sich nicht mehr erinnern - wegen des neuen Volksschulgesetzes zurücktrat. Die Kirche durfte sich vom Preußischen Staat nicht unterkriegen lassen! Davon war er damals fest überzeugt.
Ohne die Katholische Kirche, ohne den Pfarrer in Neunkirchen wäre er nicht Lehrer geworden, ohne dessen ständige Hilfe und Förderung und Bittgänge zu seinem Vater, er solle den aufgeweckten und begabten Adam doch aufs Lehrerseminar schicken, wäre er kein Staatsbeamter geworden, sondern Tabakspinner, der die kleine Werkstatt seines Vaters einmal übernehmen sollte und jahrein, jahraus Blättertabak, besonders den schwarzen Brasilientabak zu Stangen dreht, daraus Rollentabak herstellt, den Tabak vorher mit verschiedenen Beizen behandelt, um verschiedene Geschmackssorten, aber auch Schnupftabak herzustellen.
Gut, das war ein angesehener und sogar Lehrberuf, aber nichts für ihn, der schon früh Interesse am Lesen gefunden hatte und den der Pfarrer für würdig hielt, selbst Pfarrer oder auch nur Lehrer zu werden. Da der kleine Adam als einziger unter den Messdienern keine Probleme mit den lateinischen Gebeten hatte und das Stufengebet und das „Suscipiat“ fehlerfrei hersagen konnte, hatte der Pfarrer ihm zunächst nur einmal wöchentlich Lateinstunden gegeben, und als sich der Junge als geeignet erwies, regelrechten Latein- und anschließend auch Französischunterricht, um ihn auf die Prärparandie in Daun, die Vorstufe zum Volksschullehrerseminar vorzubereiten.
Es hatte viel Arbeit gekostet, den Vater zu überzeugen, aber erst der Mutter war es zu verdanken, dass die Pläne des Pfarrers auf- und die Wünsche des kleinen Adam in Erfüllung gingen: Er, Johann solle nicht so stur sein, die Werkstatt könne auch der jüngere Bruder Peter übernehmen und man könne doch nicht alle Kinder im Dorf behalten, jetzt, da es mit der Wirtschaft allgemein bergauf gehe und sie jetzt das Deutsche Reich hätten. Da sollen die Kinder, oder wenigstens eines, mal besser dastehen als sie selber: „Wir müssen mit der Zeit gehen!“
An diese Worte erinnert sich Adam noch, als wären sie eben gesprochen. Worte von einer Frau, die selbst kaum lesen und schreiben konnte, aber Weitsicht bewies. Aber als die Entscheidung einmal gefallen war, tat sein Vater so, als hätte er von vornherein die Richtung und das Schicksal seines Sohnes bestimmt. Obwohl diese letzte Entscheidung seines Alten für ihn von Vorteil war, nahm er sich für die Zukunft vor, als Familienvorstand niemals die Zügel aus der Hand zu lassen.
Auch das Orgelspielen in der Kirche hatte ihm der Vater zunächst verboten. Als Messdiener war er einmal auf die Orgelbühne geklettert, noch in Rock und Rochett, direkt nach der Messe, um dem Organisten über die Schulter zu sehen, der nach dem sonntäglichen Hochamt noch einmal das Instrument brausen lies, mit den den letzten Klängen von „Großer Gott, wir loben dich“. Und als ihm dann Heinrich Bast, der Organist, erlaubte, ein paar Töne zu klimpern, und ihm dann auch den gesamten Mechanismus erklärte, mit Tastatur, Registern, Pedalen, Holz-und Metallpfeifen und der Luftmaschine, dem Blasebalg, da stand für ihn fest, dass er dieses gewaltige Musikorgan selbst einmal beherrschen wollte.
Seine Bitte an den Vater, beim Organisten Bast Orgelstunden zu nehmen, stießen wie immer zunächst auf Widerstand, und erst als sich die Mutter einschaltete und die wiederum den Pfarrer und der dann beim Tabakspinner vorstellig wurde und die Ehre und das Lob Gottes ins Spiel brachte, erhielt Adam die Möglichkeit, das Orgelspiel zu erlernen, wenn der denn zum wirtschaftlichen Ausgleich dem Heinrich Bast im Sommer und Herbst bei Erntearbeiten auf seinen Äckern half, ohne die dieser seine Familie nicht hätte ernähren können.
Einen Teil seiner Ernte konnte der Bast auf den umliegenden Wochenmärkten umsetzten. Die Straßen waren jetzt viel besser als früher, die Leute hatten auch mehr Geld, denn Handel und Handwerk florierten, und selbst der Herr Pfarrer, der von der französischen Politik oder gar den Revolutionen überhaupt nichts hielt, sagte immer, wenn auch schon lange die Preußen hier herrschten, das hätten sie eigentlich alles dem Napoleon zu verdanken. Irgendwie hatte der Pfarrer eine Schwäche fürs Französische. Wie hätte er es sonst so gut sprechen können? Nachfragen konnte man da nicht so direkt. Aber die Preußen hasste er, auch sie empfand er als Besatzungsmacht, und außerdem waren sie - und das war das Schlimmste - protestantisch.
Sein Kopf ist auf die Brust gesunken. Er ist kurz davor einzuschlafen. Und als die Schlafzimmertür leise und langsam geöffnet wird, weiß er schon gar nicht mehr, woran er gerade noch gedacht oder wovon er geträumt hat. Seine zweitälteste Tochter Käthe steckt vorsichtig ihren Kopf durch den geöffneten Türspalt. Sie ist gekommen, um nach dem Vater zu sehen und bei Bedarf zu fragen, ob er noch etwas brauche. Barbara traut sich nicht mehr nach der Abfuhr, die sie bekommen hat, und die energische Käthe wird also vorgeschickt, um nach dem Rechten zu sehen.
Ihm war ziemlich schnell klar, dass ihm in der zweitgeborenen Tochter, die den Namen seiner Frau bekam, ein aufgewecktes, intelligentes Mädchen heranwuchs, das einmal später den Lehrerberuf ergreifen sollte. Schon als Kind zeigte sie herrische und besserwisserische Züge und ließ sich von ihrem drei Jahre älteren Bruder nicht die Butter vom Brot nehmen.
Ihr kindliches Aussehen, das rundliche Gesicht täuschte über ihre eigentliche Art hinweg, und in ihren ersten Berufsjahren wurde sie anfangs häufig unterschätzt, bis ihre Kollegen und Schüler merkten, dass mit ihr nicht gut Kirschen essen war. Wenn er sie jetzt im halb geöffneten Türspalt wahrnimmt, haben sich ihre Züge verändert und zeigen eine gewisse Strenge, die sie in ihrer Berufsausübung auch stets an den Tag legt. Das weiß er von ehemaligen Kollegen, die ihn ab und zu noch besuchen, und von der Schule erzählen, von derselben Schule, in der schon seit längeren Jahren die Käthe arbeitet, und wenn man so will, seinen Platz eingenommen hat. Natürlich nicht die Stelle des Konrektors, die er in den letzten Jahren seiner Dienstzeit bekleidet hatte, denn dazu sollte man keine Frau berufen, sie wären damit überfordert, aber für den normalen Unterricht, der heutzutage schon eine gestandene Persönlichkeit erforderte, ist seine Tochter bestens geeignet.
Leider aber nicht fürs Orgel- oder Klavierspiel, wie er es sich gewünscht hätte. Seine Musikalität geht ihr ab. Mit Mühe und Not hat sie das Geigenspiel erlernt. Ein Instrument muss man ja als Lehrer beherrschen. Gott sei Dank spielt sie nicht zu Hause auf der Geige herum, das hätte seinen Ohren weh getan.
Zusammengenommen ist er froh, dass sie auch bei ihm im Haus wohnt, als Lehrerin darf sie ja keine eigene Familie haben. Den Gedanken daran hat er ihr schon frühzeitig ausgetrieben. Ihre Familie ist hier bei ihm. Er braucht sie auch immer mehr für die alltägliche Organisation, jetzt zum Beispiel für die Beerdigung, sie übernimmt auch die Besorgungen, die mit dem Haus zu tun haben, Steuern, Reparaturen usw., Dinge, die ihm allmählich immer schwerer fallen.
Er tut jetzt so, als ob er schliefe, um nicht mit seiner Tochter reden zu müssen, dabei ist er wieder wach und versucht sich an seine letzten Gedanken zu erinnern. Ja, die Beerdigung! Da muss er doch persönlich mit Pfarrer Sutholdt sprechen. Er wird ohnehin bald herkommen. Sutholdt ist auch nicht gut auf die Protestanten zu sprechen. Die haben jetzt ihre eigene kleine Schule neben die allerdings viel größere katholische gesetzt, und es blieb nicht aus, dass er und seine katholischen Kollegen mit den protestantischen redeten. Notgedrungen. Er hasst sie aber nicht. Sie sind ihm lediglich fremd. Sutholt aber macht aus seinem Abscheu keinen Hehl und bezeichnet sie im kleinen Kreis als preußische Spione.
So weit ging ja noch nicht einmal der Pfarrer damals in Neunkirchen, aber die Preußen waren dem ein ständiger Dorn im Auge. Ihnen lastete er auch an, dass ein guter Teil der Hunsrücker und Eifeler Bevölkerung auswandern musste, in einer Zeit, als er selbst noch nicht geboren war, als Hunger und Armut herrschten, in den vierziger Jahren des vorigen Jahrhunderts, als die preußischen Landbesitzer den verarmten Bauern, die Abgaben abpressten, die Handwerker wegen der schlechten Lage keine Aufträge mehr bekamen und immer mehr Leute aus dem Hunsrück nach Brasilien gingen, um ein besseres Leben zu beginnen, da wo der König Pedro herrschte.
Sein Vater selbst war vom Hunsrück, aus Morbach, in den Dauner Raum, nach Neunkirchen gezogen, weil da unten, auf der anderen Moselseite, kein Auskommen mehr zu finden war, ein Auskommen als Ackerer, wie sein Großvater, schon gar nicht mehr. Und wer sollte in Zeiten der Not Tabak kaufen, wenn er nicht genug Geld zum Leben hatte oder sogar auf die Überfahrt sparte? „Aber Deutschland und der Heimat sind wir treu geblieben!“, hatte sein Vater oft gesagt. „Ins Ausland sind wir nicht gegangen! Wir haben‘s auch so geschafft.“ Und das klang so, als wären die Auswanderer Verräter gewesen. Aber für ihn selbst hatte das alles auch sein Gutes. Wie hätte er sonst Lehrer werden und seine Katharina kennenlernen können? Da ganz unten in Brasilien bestimmt nicht! Ein Leben in Südbrasilien konnte er ich nicht vorstellen. Und der Witz der Geschichte ist, dass sein Sohn Ludwig genau dahin ausgewandert ist und eine Familie gründen will. Aber 100 Jahre später!
Er hat längere Zeit nichts mehr von ihm gehört. So gut soll‘s ihm da nicht gehen. Käthe meinte, dass die Deutschen in Brasilien jetzt Probleme bekämen, aus politischen Gründen, wegen Hitler. Dabei war er doch dessentwegen aus Deutschland weggegangen. Weiterer Witz der Weltgeschichte. Auf jeden Fall, zur Beerdigung der Mutter wird er nicht kommen können.
Wegen der Beerdigung wird er noch mit Käthe sprechen müssen. Die Todesanzeigen müssen raus, verschickt werden, es werden viele Leute kommen, schon allein seinetwegen, er ist bekannt und geachtet in der Kirchengemeinde. Die Totenmesse in der Liebfrauenkirche, sie wird voll sein, und dann der Leichenzug von der Kirche zum Ostacker-Friedhof. Brüggelmann hat ihm einen Motorwagen als Leichenwagen vorgeschlagen, das komme billiger. Er, der Konrektor i. R. Hat aber auf der von schwarzen Pferden gezogenen Kutsche betanden. Die Kosten spielen jetzt keine Rolle.
Auch zum Beerdigungskaffee wird das Gemeindehaus voll sein. Da muss Käthe die Einladung bei manchen Todesanzeigen mitschicken. Hoffentlich wird das Wetter einigermaßen gut, und die Aprilstürme bleiben aus. Bei der Beerdigung seiner Mutter war es im Dezember 1894 schon ungewöhnlich kalt, und ein Schneesturm fegte über den Neunkirchener Friedhof hinweg, eine Kälte, die noch einige Trauergäste kurz darauf ins Grab gerissen hat. Wie der Apotheker später erzählte.
Nur ein Jahr nach seiner Trauung mit Katharina starb die Mutter. Kränkelnd war sie schon viele Jahre lang. Die Tabakspinnerei warf nicht so viel Geld ab, wie anfangs erhofft. Und so musste sich die Mutter beim Bürgermeister und Apotheker als Plätterin verdingen und in machen Erntemonaten half sie noch den reichen Bauern auf dem Feld, für ein Stück Speck, einen Sack Kartoffeln und ein paar Scheffel Korn, das sie selbst malen lassen konnten. Die harte Feldarbeit, bei jedem Wetter draußen, in der heißen Sonne, und wenn das Gewitter kam, so lange im Regen, bis die Ernte eingebracht war, hat ihr Rücken und Bronchien kaputt gemacht.
Die Arbeit machte sie auch für ihn, damit er sein Studium zu Ende brächte: „Du musst hier raus, aus dem Dorf. Du siehst, wie schlecht es dem Vater gegangen ist, die ganze Sach mit dem Tabak hat doch nichts gebracht.“ Der Bruder Peter konnte mit seinen kräftigen Händen beim Hufschmied unterkommen. Hatte längst schon eine Familie, Kinder, die aber als Enkelkinder ihren Großvater nicht mehr kennenlernten. Der hatte sich bis zum letzten Atemzug am Tabak abgearbeitet, zwölf Stunden am Tag, dauernd den trockenen Staub in der Lunge, und trotzdem wurden die Einkünfte immer geringer. 15 Jahre vor seiner Frau nahm ihn der Herr zu sich. „Gott war gnädig und hat ihn erlöst“, tröstete sich die Mutter. Da war er, Adam, schon auf dem Lehrerseminar und hatte die drei Präparandie-Jahre in Daun hinter sich.
In der Präparandenanstalt war es streng zugegangen. Es waren wohl die schlimmsten Jahre seines Lebens. Schlimmer als auf dem Kasernenhof, später, als er in Trier seinen Einjährig-Freiwilligen-Dienst ableistete. Nicht dass sie geprügelt wurden, aber gedemütigt von zwei noch recht jungen, fertigen Volksschullehrern, die ihre Macht ausspielten. Er weiß sogar noch ihre Namen: Heinrich Bach und Erwin Lucken. Ständig mussten sie auswendig lernen, und dann wurden sie abgefragt und bei scheinbar ungenauen Antworten mit Zusatzaufgaben „belohnt“, so dass sie an den freien Sonntagen keine Zeit mehr hatten, zu den Maaren hinaus zu wandern. Ernst Fuhrmann hielt es dann nicht mehr aus, gab auf, ging zurück nach Mayen, wo sein Vater eine Metzgerei besaß, der er eigentlich entflohen war. Mit Ernst war er befreundet. Mit ihm machte er weite Wanderungen, über die Maare hinaus nach Süden, manchmal bis an die Mosel. „Adam, du musst mir helfen. Das Klavierspielen fällt mir schwer. Bei mir zu Hause sind alle unmusikalisch. Und du bist ja sogar ein wunderbarer Orgelspieler. Das sagen sogar Bach und Lucken.“
So hatte ihre Freundschaft angefangen, und als sich zeigte, dass Ernst gut zeichnen konnte, eine Fähigkeit, die ihm, Adam, abging, halfen sie sich gegenseitig und waren so häufig zusammen, dass sie schon die Zwillinge genannt wurden, da sie sich auch äußerlich ähnelten, in ihrer kräftigen gedrungenen Statur.
Ernsts Weggang war ein herber Verlust. Sie waren ja fast alle noch nicht mal 17, lebten in der Präparandenanstalt, einem Gebäude, das in der Franzosenzeit als Verwaltungsgebäude gedient und dann notdürftig, nach langem Leerstand, für ihre Unterbringung hergerichtet worden war. Bach/Lucken wohnten zur Untermiete, privat, und wurden dort auch gut beköstigt, sie allerdings, die sechs Präparanden, wurden vom Pfarrhaus aus mitverpflegt. Sicherlich nicht mit dem Essen, das der Pfarrer bekam. Adam lernte, seinen Groll herunterzuschlucken. Die Eltern legten sich krumm, aber die Kirche zahlte doch das meiste für seine Ausbildung, da durfte er nicht undankbar sein.
Mit Ernst hatte er manchen Sonn- und Feiertag die Maare und ihre Umgebung erkundet. Von Daun aus bekam man zuerst das Schalkenmehrener Maar zu Gesicht und war auch schnell im gleichnamigen Ort, wo aus manchen Häusern heraus die Webstühle klapperten. Ernst hätte hier schon am liebsten Halt gemacht, seinen Durst im „Ochsen“ gelöscht, aber ihn drängte es weiter, zum Weinfelder Maar, auch Totenmaar genannt. Hier saß er am liebsten, oben auf der Steilkante, und sah auf den steilen Trichterrand mit den Ginsterbüschen und Haselsträuchern, und direkt gegenüber, am anderen, entgegengesetzten Ufer, lag die kleine gedrungen wirkende, weiß gekalkte Kirche mit dem niedrigen Turm. „Das war früher die Pfarrkirche von Weinfeld.“
Ernst wusste da gut Bescheid in Heimatkunde. Neben dem Zeichnen sein Lieblingsfach. Und im Zeichnen war er gut. Das mussten Bach und Lucken eingestehen. „Im 16. Jahrhundert hat die Pest die ganze Dorfbevölkerung dahingerafft.“ Und schon hatte er seinen Skizzenblock ausgepackt und mit ihm, Adam, im Vordergrund eine Zeichnung von Maar und Kapelle angefertigt. „Hier, schenk‘ ich dir“, überreichte ihm das fertige Blatt und legte seinen Arm um seine Schulter. Irgendwann musste er mal nach dem Blatt suchen. Er wusste, dass es sämtliche Umzüge überdauert hatte.
Wieso hatte er gerade an Ernst gedacht? Katharina hatte er einiges aus seiner Ausbildungszeit erzählt. Für sie eine Welt, die ihr verschlossen geblieben wäre, und er war stolz darauf, ihr ein bisschen davon abgeben zu können, nicht zu viel, da musste schließlich der gebührende Abstand gewahrt bleiben. Doch von Ernst hatte er nie jemandem erzählt.
Aber mit Ernst hatte er über manches gesprochen. Wenn sie das Strafen von Bach oder Lucken für ungerecht, nicht gerechtfertigt hielten, nachdem sie, wie sie glaubten, ihre Aufgaben gut gemacht hatten und los zum Wandern wollten. Aber dann, gerade hatten die Lehrer einen Vorwand gesucht, sie zurückzuhalten, um sie zu quälen, ihre Macht auszukosten.
„Natürlich schulden wir unseren Lehrern Gehorsam. Die Strenge gehört dazu!“, hatte er noch deren Verhalten vor Ernst verteidigt. „Aber nicht ohne Grund, ohne Sinn und nur einfach so, weil es ihnen gefällt“, hatte ihm Ernst geantwortet. „Das ist fast wie bei meinem Vater. Der hat oft grundlos geschrien, mich beschuldigt, wenn etwas schief gelaufen war und nicht selten einfach auf mich losgeprügelt. Und das noch nicht einmal im Suff. Wenn sich meine Mutter einmische, machte er sie auch fertig“. So etwas kannte Adam nicht. Es ging bei ihnen zu Hause nicht immer friedlich zu, vieles lag am fehlenden Geld. Aber Streit wurde nicht körperlich ausgetragen.
Was Adam früh gelernt hatte, war gehorsam zu sein. Das vierte Gebot. Gehorsam in der Familie, gegenüber den Eltern. Gehorsam in der Schule, dem Lehrer gegenüber. Gehorsam forderte auch der Kaiser, sonst würde das Reich zusammenbrechen. Und vor allem Gehorsam in der Kirche, dem Pfarrer gegenüber, dem Bischof und vor allen dem Stellvertreter Christi auf Erden gegenüber. Dies war das Wichtigste. Zumal die Worte des Papstes nicht angezweifelt werden durften. Das hatten sie später im Seminar gelernt, dass es früher oft Streit gegeben hatte, zwischen Papst und Bischöfen, zwischen Papst und Kaiser. Seit dem letzten Konzil galt das Dogma der Unfehlbarkeit in der Glaubenslehre. Seit Pius IX. hatte die Streiterei ein Ende. Dem Papst war Gehorsam zu schulden! Ach wenn jetzt die Lehrerausbildung in den Händen des Staates lag, so wurde es ebenfalls im Seminar gesagt: wenn es darauf ankommt, hören wir nur auf den Papst.
Welche Folgen das haben sollte, hatte Adam erst sehr viel später verstanden. Im Grunde war ja der Papst wie ein Vater. Schließlich heißt er ja auch Heiliger Vater. Und Strenge gehörte zum Vatersein dazu. Zu viel Strenge, die hat ihm Katharina manchmal vorgeworfen, wenn er mit Barbara kein Nachsehen hatte, wenn er die Kinder zu sehr kontrollierte. „Ja ,Kat“, sagte er jetzt zu der Toten, „ohne dich wäre manches schlimm ausgegangen. Wenn du nicht vermittelt hättest…. Ich hätte dir von Ernst erzählen sollen. Einmal von einem guten Freund und von einem Menschen, der sehr gradlinig war und eine Ausbildung, die ihm falsch erschien, abgebrochen hat. Jetzt ist es zu spät dazu.“
Katharina war eine gute Frau. Ja, sie hatte ihren eigenen Kopf, aber sie war folgsam, wie es sich für eine Frau dem Ehemann gegenüber gehörte. Das Weib sei dem Manne untertan als dem Herrn. Denn der Mann ist des Weibes Haupt, gleichwie auch Christus das Haupt ist der Gemeinde, und er ist seines Leibes Heiland. So der heilige Paulus. Nur manchmal, wenn sie etwas unbedingt wollte, von dem ihr Seelenheil abhing, dann ließ sie nicht nach. Dann bearbeitete sie ihn so lange, bis er nachgab. Das tat er denn auch. Nachgeben. Er spürte dann seine Güte. Und irgendwie kam es ja auch ihm zugute. Zum Beispiel die Wallfahrt zum Heiligen Rock nach Trier.
„Da sie ihn aber gekreuzigt hatten, teilten sie seine Kleider und warfen das Los darum, auf dass erfüllet würde, was gesagt ist durch den Propheten: Sie haben meine Kleider unter sich geteilt, und über mein Gewand haben sie das Los geworfen." Denn der Leibrock aber war ohne Naht, von oben an durchweg gewebt. „Da sprachen sie zueinander: Lasst uns ihn nicht zerreißen, sondern um ihn losen, wessen er sein soll.“
1891 sollte es wieder so weit sein. Der Heilige Rock, die Tunika Jesu, sollte wieder im Dom zu Trier ausgestellte werden, auf dass die Gläubigen aus aller Welt kämen, um ihn, den ungeteilten Leibrock, zu sehen, als Zeichen der Einheit der Christenheit. Die letzte große Wallfahrt lag Jahrzehnte zurück. Seit 1844 war die Reliquie nicht mehr gezeigt worden. Jetzt nach dem langen Kulturkampf zwischen Rom, dem Heiligen Stuhl, und Bismarcks Preußen war es an der Zeit, die Glorie der Kirche wieder einmal zu zeigen. Beim letzten Mal, 1844, soll über eine Million Pilger gekommen sein. Auf dass es diesmal noch viel mehr würden! Schließlich war es die Heilige Helena, die Mutter des Kaisers Konstantin, die höchstpersönlich den Rock Jesu nach Trier gebracht hat. Damals, als die Stadt die Hauptstadt des Weströmischen Reiches war.
Zwar war Trier heute nur noch Bezirkshauptstadt in der preußischen Rheinprovinz, aber es musste ein Zeichen gesetzt werden, den Liberalen, den Sozialdemokraten, ja auch dem Preußischen Ministerpräsidenten, ein Zeichen, dass die Katholischen im Reich sich nicht unterkriegen ließen. Hatte er nicht oft genug davon zu Hause so gesprochen, nicht nur im Religionsunterricht vor seinen Schülern, auch vor seiner zukünftigen Frau, deren Glauben er nicht stärken musste, aber die er in die großen politischen Zusammenhänge einweihen wollte?
War es da verwunderlich, wenn Katharina immer öfter darauf drang, mit ihm nach Trier zu reisen, zum Heiligen Rock, natürlich, aber auch um die Stadt einmal selbst kennenzulernen, wo er zwei Jahre im Seminar und ein Jahr als Soldat verbracht hat, aber auch die Stadt, die einmal so groß gewesen war und so viele Kirchen hatte?
Sie kannte ja nur Neunkirchen, Daun und Münstermaifeld, und jetzt wollte sie gleich in die große Welt hinaus. Er müsste sich dafür einen Tage beurlauben lassen. Das tat er nicht ohne schlechtes Gewissen, und die Vorgesetzten sahen es auch nicht besonders gern. Und sie waren auch noch nicht verheiratet, noch nicht einmal verlobt. Jedoch in dieser Sache ließ Katharina nicht locker. Für sie war es auch nicht unschicklich. Schließlich würden sie demnächst Mann und Frau sein. Gott würde sie als Pilger empfangen. Also fuhren sie hin.
Die Stadt war in ein Meer von Fahnen getaucht. Es überwogen die Farben gelb und weiß, senkrecht gehängt. Die Farben des Vatikans, des Papstes. Eigentlich Gold und Silber. Manche Fahnen wehten von kleinen Stangen, die in Halterungen direkt an den Häuserwänden steckten und damit zeigten, dass die Hausbewohner dazugehören wollen, zum großen Fest, das jetzt ein paar Wochen lang in der ehemaligen Kaiserstadt gefeiert wurde. Aber auch ganze Straßenzüge waren gesäumt von Fahnen, deren Stangen in den Boden gerammt sind, teilweise mit Birkenreisern geschmückt, wie zu Fronleichnam. Auf dem Hauptmarkt waren Buden aufgebaut. Es gab Limonade - Wein und Bier aber erst nach Sonnenuntergang. Gebäck, Kuchen, Würstchen wurden den ganzen Tag über angeboten. Ein süßer Duft und Bratgerüche lagerten wie eine leichte Wolke über dem Marktgelände, auf dem die Pilger aneinander vorbeizogen, manche in Richtung Bahnhof, also nach Hause, andere kamen gerade daher und drängten auf den Marktplatz, um sich von hier aus auf den Weg zum Dom zu machen. Es herrschte so etwas wie Kirmesstimmung, aber ohne die sonst dazugehörige laute Musik und ohne das Geschrei der Schauleute, die ihre Sensationen anpriesen, die Große Schiffschaukel, den Hau-den-Lukas, die Schießbude. Dafür wimmelte es von ambulanten Händlern, Männern oder Frauen, manchmal auch Kindern, die in ihrem Bauchladen Heiligenbilder anboten, die Heilige Helena mit dem Kreuz Christi, Helena mit dem Heiligen Rock, der Leidende Jesus neben dem Heiligen Leibrock, eine Kreuzigungsszene: im Vordergrund die römischen Soldaten, die die Kleider des Herrn verlosen, und natürlich Marienbilder über Marienbilder.
Denn seit dem Dogma der Unbefleckten Empfängnis und erst recht seit den Marienerscheinungen von Lourdes erfuhr der Marienkult erneut einen Aufschwung, und was passte nicht besser zu dieser Wallfahrt als die Gottesmutter in strahlender Keuschheit oder auch als Schmerzensmadonna, die ihren toten Sohn in den Armen hielt? Natürlich gab es auch Kreuze aller Art zu kaufen, aus Holz oder Bronze, mit und ohne Corpus, oder Nachbildung des Heiligen Rockes in Porzellan oder - billiger - in lasiertem Ton. Und Madonnenfigürchen, ebenfalls dem jeweiligen Geldbeutel angepasst, und vornehmlich Kerzen in allen möglichen Größen und Durchmessern, weiße Kerzen mit aufgeprägten roten Inschriften, und Kreuzen, von Jesus und seinem Erlösertod kündend.
Für Adam stand es schon fest: es wird für sie beide nur jeweils ein Bildchen geben. Katharina durfte sie allerdings aussuchen. Alles andere wie Kerzen, Figürchen, Kreuze, brauchten sie nicht, und außerdem könnten sie zerbrechen auf der Rückreise. Denn es war voll gewesen im Zug von Daun nach Wittlich an der Mosel und erst recht im Anschlusszug, der, von Koblenz kommend, nach Trier fuhr und schon so gut wie voll war mit Pilgern aus dem unteren Moseltal. Da wollte er nichts riskieren.
Die Reise war ja schon nicht ganz billig. Weil sie als Neunkirchner eine kleine Gruppe bildeten - der Pfarrer hatte alles organisiert - war die Reise etwas günstiger, und sie wollten auch während der ganzen Zeit zusammenbleiben, der Pfarrer selbstverständlich, der Apotheker, der Bäcker und der Hufschmied, der Krämer und der Glaser, der erst kürzlich seinen Laden aufgemacht hatte, alle mit Ehefrau, Verlobter oder Beinaheverlobter wie er, außer dem Pfarrer selbstverständlich. Der ließ sogar seine Haushälterin zu Hause. Dabei wussten doch alle Bescheid.
Jedenfalls hatten sie noch ein leeres Abteil gefunden, bei der Abfahrt in Daun, ganz früh um sechs, nach dem Umsteigen in Wittlich mussten sie sich als Gruppe aufteilen, und nun, am frühen Mittag machen sie sich endlich auf den kurzen Weg vom Hauptmarkt zur Kathedrale. Die beiden Bildchen, die er von einem kleinen Mädchen erstanden hatte, bewahrte Adam in der Innentasche seines Sommeranzugs auf.
Eine frische Brise wehte über den Domplatz. Die Sommersonne hatte den Platz schon mächtig aufgewärmt, und die Menschenmasse sorgte noch für mehr Hitze, auch innerer Hitze wohl, die aus der religiösen Inbrunst herrühren mochte, die offensichtlich einige Nonnen ergriffen hatte, die nach vorn, zur rechten Eingangstür stürmten, um endlich vor dem Unterkleid ihres Herrn stehen zu können.
Bei all dem fühlte sich Adam nicht ganz wohl. Einmal schätzte er nicht die Menschenansammlung und zum Zweiten als eher nüchterner Mensch nicht die übersteigerten Glaubensäußerungen. Er ruhte in seinem Glauben, Zweifel gabs da nicht, aber der Rummel störte ihn doch immer mehr. Gut, er tat es hauptsächlich Katharina zuliebe. Er sah sie von der Seite an und merkte, dass heute für sie ein besonderer Festtag war. Und wenn er sie dann noch mit all den anderen Frauen aus ihrer Heimatgruppe verglich, dann freute er sich auf die Hochzeit mit dieser schönen Frau.
Die Brise sorgte auch dafür, dass Orgelklänge und der Chorgesang, der stoßweise aus den geöffneten Domportalen drang, auf dem Vorplatz über ihren Köpfen verteilt wurden und eine Vorahnung vom Geschehen und Erleben im Innern der Kirche entstand. Aber gleichzeitig wusste er, er hatte es in der Trierer Kirchenzeitung gelesen, dass das Gewand Jesu vor einem Jahr erst restauriert worden war, weil es im Laufe der Jahrhunderte stark beschädigt worden war und jetzt im Ostchor des Domes auseinandergefaltet und ausgebreitet in einem Schrein liegen würde.
Manche, auch kirchliche Stimmen, zweifelten die Echtheit des Stoffes an. Und der Erzbischof war vorsichtig, wenn er schon einige Zeit vor der großen Wallfahrt in einer Rede darauf hinwies, dass die Echtheit der Tunika Domini nicht zum Dogma gehöre, aber hier gehe es vielmehr um eine der großen christlichen Traditionen, und die Verehrung gelte nicht dem Kleidungsstück, sondern seinem Träger Jesus Christus.
Mit der Menge wurden sie zum rechten, dem Eingangsportal geschoben. Jetzt ging es nur in kleinen Schritten voran, und er spürte an seiner rechten Seite Katharinas dunkelblaues Sommerkleid und sah, wie sie mit beiden Händen ihr Gebetbuch umklammernd, den Blick nach vorn gerichtet, wie zur Heiligen Kommunion der Reliquie entgegen schritt. Hier im Innenraum der gewaltigen Kirche mit den hohen spätromanischen Bögen war die Luft kaum kühler. Nicht nur die vielen Pilger erwärmten den Kirchenraum, sondern es waren auch die unendlich vielen Kerzen, die für ein warmes Licht sorgten und gleichzeitig die Luft zusätzlich aufheizten.
Ein leichter Schweißfilm bildete sich unter seinem Hemdkragen. Schweißperlen traten auf seine Stirn. Die Gläubigen schoben sich in einer schmalen Schlange zwischen den Kirchenbänken zum Hochaltar, wo die Heilige Tunika gleichsam aufgebahrt lag. Damals, im Jahre 44, da hatte man sie noch berühren können, allerdings nur flüchtig, mit den Fingerspitzen. Das ging heute nicht mehr, der Rock war konserviert worden, und als sie dann endlich vor ihm standen, in staunender Andacht, dann war es ein gelbbraunes Stück Stoff, das gar nichts mehr von dem Leibgewand eines göttlichen Wesens an sich hatte. Adam merkte, dass Katharina erschrocken innehilt beim Anblick des bräunlichen Dings und die heilige Aura zu vermissen schien, da sie wohl das Heilige ausschließlich mit leuchtendem Weiß in Verbindung bringen konnte. Zusammen mit ihm brachte sie noch eine tiefe Kniebeuge zustande. Zum Glück brauste in diesem Moment die Orgel wieder auf, die eine Zeitlang während ihrer Prozession durch das Kirchenschiff geschwiegen hatte, und mit deren beruhigenden Klängen im Ohr und mittels seiner Hand, die er ihr, leicht unterstützend, unter den linken Unterarm schob, gewann sie ihre Fassung zurück.
Als nach den mächtigen Orgeltönen der Kirchenchor auf der Orgelempore, gleichsam wie aus himmlischen Sphären herab, ein voll tönendes Halleluja anstimmte, nahm Adam zu seiner Freude wahr, dass Kathrine ihre Fassung zurückgewonnen hatte und nun mit strahlenden Augen ins Freie strebte, so schnell, wie die sich langsam bewegende Menschengruppe es zuließ. Sie hatten keine Zeit mehr, sich die Stadt genauer anzusehen, etwa die Matthiaskirche, die Römerbrücke, die Porta Nigra und zu guter Letzt, das Seminar, wo Adam zum Lehrer ausgebildet worden war. Dem war das ganz recht, denn dann wäre wieder die ganze Geschichte mit Mathilde hochgekommen, von der Katharina auf keinen Fall etwas erfahren durfte. Adam wischte sich den Schweiß von der Stirn. Wie gut, dass die Trier-Fahrt sich auf die reine Wallfahrt beschränken musste!
Draußen stand schon der Pfarrer, mit dem Birret winkend, damit auch alle seine Schäfchen rechtzeitig am Bahnhof sind. Mit wehender Soutane bahnte er sich den Weg, sie hatten‘s eilig, der Nachmittagszug würde nicht warten, die Rückfahrt brauchte ihre Zeit. In Daun warteten Pferdefuhrwerke, die sie nach Hause bringen würden. Alles war bis zur Perfektion arrangiert.
Sie hielten zwei Abteile besetzt. Adam und Katharina saßen in Fahrtrichtung, gegenüber der Pfarrer, der das Birett auf die Gepäckablage gelegt hatte und sich jetzt die Soutane oben etwas aufknöpfte. Neben ihm der Apotheker mit seiner etwas fülligen Frau, die noch von der Anstrengung des Marsches zum Hauptbahnhof gezeichnet war und laut schnaufend nach Luft rang Nach dem Pfeifsignal des Stationsvorstehers, schnaufte jetzt die schwarze Dampflok auf und übertönte damit die Apothekerin, die Pleuelstangen setzten die Räder in Bewegung, ein Ruck ging durch das Abteil, Katharina rutschte auf der harten Holzbank nach hinten und klammerte sich an Adam Anzugärmel fest. Zur Bestätigung, dass es wirklich losging, ertönte die kreischende Dampfpfeife. „Wie zu Hause beim Wasserkessel auf dem Herd“, dachte Katharina, die sich auf die Rückfahrt genauso freute wie sie sich auf die Hinfahrt gefreut hatte. Nur war es heute morgen die Vorfreude auf die Reliquie, jetzt nahm sie, die sonst nie weiter als bis zu den umliegenden Kreisstätten gekommen war, in freudiger Erregung die Landschaft wahr, die an der Moselstrecke lag.
Bis Wittlich ging es leicht bergab. Sie folgten ja schließlich der Mosel, die in den Rhein fließen wollte. Katharina saß am Fenster, das halb geöffnet war, weil die Sommerhitze im Abteil lastete. Ab und zu drang der rußige Rauch der Dampflok in Schwaden zu ihnen ins Abteil. Aber das störte sie nicht, wenn auch der Rußnebel manchmal die Sicht behinderte, auf die still liegenden Fischerbote oder die flussabwärts gleitenden Lastensegler. Zwischendurch fuhren sie so dich am Ufer vorbei, dass sie glaubte, sie müssten demnächst ins Wasser stürzen, aber dann fing sie eine eiserne Brücke auf. Die Brückenstreben versperrten die Sicht und schienen an ihr vorbeizufliegen, bis der Zug wieder festen Boden unter den Rädern hatte und das metallene Geräusch wieder vom rhythmischen Klackern der Schienen auf festem Boden abgelöst wurde. Auf der anderen Flussseite lagen Dörfer und Städtchen, die sich mit ihren spitzen Kirchtürmen unter den Weinbergen wegduckten, grüne Weinberge, die den Fluss auf seinem Mündungsweg begleiteten und nur ab und zu von gelben Ackerflächen unterbrochen wurden, wenn die Hänge nicht allzu steil waren.
Auf den Eifelhöhen, bei ihnen zu Hause, wuchs der Wein nicht mehr. Deshalb gab es ihn nur zu Festtagen oder für den Pfarrer in der Messe, täglich. Von ihrem Vater wusste sie, dass die Pfarrer einen verschieden Weingeschmack hatten und der ihrige, der ihr gegenüber gerade eingeschlafen war, den Riesling bevorzugte. Manche mochten lieber süßen als herben, das wusste sie, weil der Vater die Bestellungen aufgeben musste, einmal im Jahr beim Weinhändler Kurzum in Daun. Da durfte sie früher dabei sein, aber nicht in der Sakristei, wenn der Messwein von der Flasche in das Kännchen gegossen wurde, damit nachher bei der Messfeier die Ministranten dem Priester Wasser und Wein in den Kelch gossen und der Priester mit dem Daumen anzeigte, wie viel Wein und wie viel Wasser es sein sollten. Und weil ihr Pfarrer länger den Daumen beim Einfüllen des Weines hochhielt als beim Wasser, mussten sie in den letzten Jahren öfter zur Weinhandlung nach Daun.
Auch Katharina fielen vom monotonen Fahrtrhythmus schon die Augen zu. Sie hatte versucht, bei jeder Station aufzupassen, ob sie nicht schon in Wittlich waren, bei ihrem Umsteigebahnhof. Doch dann ging es plötzlich recht schnell, der Pfarrer war wieder hellwach, mahnte zur Vorbereitung des Ausstiegs, und nur eine Viertelstunde später saßen sie alle wieder im nächsten Zug, der sich geräuschvoll und langsam vom Moseltal unten nach oben auf die Höhen der Vulkaneifel hinaufschob.
Adam nahm Katharinas Hand, wie zur Beruhigung, dass es nicht mehr lange dauern würde und die Strapazen bald zu Ende wären. Sie jedoch genoss auch diesen Streckenabschnitt, weil sie sich lebendig fühlte unterwegs und wusste, dass der Alltagstrott sie bald wieder eingeholt haben würde.
Die Tageswallfahrt nach Trier war für Katharina ein bleibendes Erlebnis geblieben. Später waren sie verschiedene Male nach Kevelaer gepilgert, nicht zu Fuß, wie es manche aus der Gemeinde taten, sondern mit dem Bus, aber auch von der Pfarrgemeinde organisiert. Das war nach dem Weltkrieg, da wären sie körperlich nicht mehr dazu in der Lage gewesen, die vielen Kilometer zu Fuß zu gehen, schon gar nicht seine Frau, die nach dem Tod des ältesten Sohnes seelisch und körperlich angeschlagen war. Aber die Kinder, besonders die Käthe und der Jüngste, der Alois, die waren eine Zeitlang fast regelmäßig gepilgert, eher gewandert. Die wanderten auch in der Eifel, so wie er früher, meistens mit dem Ernst, gewandert war.
Jetzt verspürt er doch etwas Hunger. Selbst das Erinnern verbraucht Kräfte. Nachdem er sich aufs Bett gelegt hat, der Stuhl war auf die Dauer unbequem und hart, muss er wohl für eine kurze Zeit eingeschlafen sein. Als er sich jetzt aufrichtet, bemerkte er auf dem Nachttisch ein Tablett mit einem Wurstbrot und einem Glas Milch. Die Käthe, fährt es ihm zunächst durch den Sinn. Aber die ist sich fürs Essenmachen zu fein. Es muss Barbara gewesen sein, die heimlich ins Zimmer gekommen ist. Die anderen Töchter werden wohl bald alle im Hause sein.
Ob Magdalena zur Beerdigung ihrer Mutter kommen kann? Käthe hat den Steyler Missionsorden über das Ableben seiner Frau informiert und dringend gebeten, Schwester Theofredis, wie Magda nun heißt , freizustellen, um an den Begräbnisfeierlichkeiten teilnehmen zu können. Aber seitdem Magda alle Rechte, ihr zukünftiges Vermögen oder Erbe dem Orden überlassen hat, kann sie nichts mehr selbst entscheiden, selbst in ihrem Elternhaus darf sie nicht mehr übernachten, allenfalls beim Pfarrer.
Als sie sich das letzte Mal sahen, in Lohberg, wo sie als Kindergärtnerin arbeitete, ließ sie anklingen, dass sie wohl demnächst nach China geschickt würde. „Endlich kann ich als Missionarin arbeiten!“, hatte sie ausgerufen und kindlich in die Hände geklatscht.
Magdalena ist immer schon anders gewesen. Sie ist körperlich das kleinste seiner Kinder. Mit den fast kohlschwarzen Augen und dem dunklen Haar wirkt sie fast ausländisch, wenn auch manche ihrer Geschwister dunkles Haar und dunkle Augen besitzen. Aber Magda zog sich häufig zurück, hatte kaum Freunde und war stattdessen oft in der Kirche zu finden. Seitdem die Dominikaner eine Exerzitien-Woche abgehalten hatten, war die Überzeugung in ihr gereift, Nonne und Missionarin zu werden. Da war sie schon Ende 20, und arbeitete als Schneiderin in der Herrenkonfektion Hutmüller in Hamborn. „Die Magda hat wohl einen Freund“, hatte Barbara, die ihrer Schwester nachspionierte, ihn irgendwann später wissen lassen.
Als er daraufhin seine Tochter zur Rede stellte, kam heraus, dass sie mit Erich, einem Verkäufer im Herrenkonfektionsgeschäft mehrmals ausgegangen war, und was ihn dann richtig wütend machte, war, dass dieser Erich evangelisch war. Eine Mischehe wäre überhaupt nicht in Frage gekommen. Als besorgter Vater löste er das Arbeitsverhältnis bei Hutmüller auf, Magda blieb unter seiner Beobachtung in seinem Haus. Selbst Katharinas Fürsprache konnte ihn nicht erweichen. Dann kamen, Gott sei Dank, die Dominikaner und erweckten bei Magdalena den Missionsgedanken und machten sie auch mit den Gedanken Arnold Janssens, des Gründers des Steyler Ordens, bekannt.
Denn so heißt es in Neuen Testament: „Darum geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern; tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Seid gewiss: Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt.