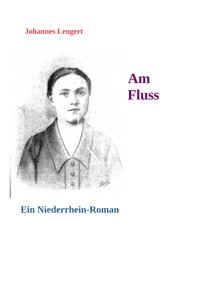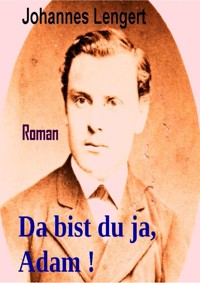9,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Wie entsteht Literatur? Der Hochstapler Klemens Milde schlüpft in verschiedene Identitäten und erlebt eine Menge Abenteuer, über die er schreibt. Er ist Reporter in Südamerika. In Kalifornien wirkt er als Schamane und Arzt und wird wegen Tötungsdelikten angeklagt. Er landet schließlich im Gefängnis. Als sein Studienfreund von der Gefängnishaft erfährt, leistet der Detektivarbeit, um die Wahrheit über Clemens herauszufinden. Er erlebt schließlich eine gewaltige Überraschung. War alles nur ein Spiel mit Fantasie, Fake und Fiktion?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Impressum
Umschlag: Johannes Lengert
Coverfoto: Johannes Lengert
Johannes Lengert
Nussbaumer Str. 3-5
51469 Bergisch Gladbach
Website: JL-Galerie.de
Johannes Lengert
Die Wahrheiten
des Klemens M.
Roman
Leben heißt ein anderer sein.
F. Pessoa
Inhalt:
Vorgeschichte
Teil I
Teil II
Teil III
Teil IV
Teil V
Nachgeschichte
Vorgeschichte
1. Kapitel
Er war fünf Jahre alt, als er das Gedicht aufsagen sollte. Ein Geburtstagsgedicht für den Pfarrer, das seine Tante, die Lehrerin, mit ihm eingeübt hatte. Die Proben waren eine Qual, weil irgendeine Betonung nicht stimmte und weil er manchmal ein Wort oder eine ganze Zeile vergessen hatte.
Die Tante galt als strenge, aber gute Lehrerin, die ihren Schülern etwas beibrachte. Da durfte er nicht versagen. Als er dann vor dem alten großen, schweren Pfarrer in dem etwas fleckigen schwarzen Talar stand, da brachte er kein Wort heraus, auch dann nicht, als ihm deutlich hörbar die Anfangszeile vorgeflüstert wurde. Ein einziger Vorwurf, der sich in dem Blick wiederholte, mit dem er von der Tante bedacht wurde, als er den Raum der Feier verließ.
Trotz seines Versagens strich ihm der alte Pfarrer über den Kopf mit der Aufforderung, sich ein Stück Kuchen in der Küche geben zu lassen. Den Kopf hielt er gesenkt, auf dem Heimweg, beim Abendessen zu Hause. Er wollte ihn nie mehr hochheben.
Diese Szene vergaß er nicht. Sie verfolgte ihn sein ganzes Leben. Er fühlte sich auf der Flucht. Er wusste aber nicht, wohin er fliehen sollte. Damals noch nicht. Zunächst wurde er noch schweigsamer, als er ohnehin schon war. Wenn er aufgefordert wurde, etwas zu erzählen, aus der Schule später oder von Freuden oder von Ausflügen, fiel ihm nichts ein. War er jedoch kurz darauf allein, so entstanden vor seinem inneren Auge Geschichten, die das Erlebte, von dem er nicht erzählen konnte, mit Situationen verknüpften, in denen er nicht nur den Anforderungen gerecht wurde, sondern darüber hinauswuchs und zum Helden wurde, den alle bejubelten.
Im Grunde war er ein guter Schüler. Das letzte Jahr im Kindergarten hatte ihn gelangweilt. Da spielte er lieber allein zu Hause. Einen Drang, endlich zur Schule gehen zu können, verspürte er nicht, weil er sich unter dem Schulleben nichts vorstellen konnte. Obwohl ja die Tante Lehrerin war und der Großvater Lehrer gewesen war.
Lesen und Schreiben lernen fielt ihm nicht schwer. Allmählich bildeten sich auf der Schiefertafel mit den feinen roten Linien aus den Eiern und Spazierstöcken, die anfangs in die Zeilen zu malen waren, Wörter mit o und r, bis schließlich das gesamte Alphabet sich in ganzen Sätzen abbildete. Und umgekehrt gelang es ihm immer besser und schneller, aus dem Wust von Buchstaben, den die Ährenfibel zunächst für ihn darstellte, das bäuerliche Leben von Hans und Grete mitzuerleben. Ebenso die vier Jahreszeiten und alles, was es sonst noch gab. In dieses Leben träumte er sich hinein. Nicht dass er Hans oder Grete wäre, sondern einer, der dabei stand, aber nicht ganz dazugehörte, einer, der in der Nähe war und beobachtete und dann Hans oder Grete hätte sein können.
Die häusliche Strenge setzte sich in der Schule fort. Man saß zu zweit in Bänken, die mit dem Schreibpult verbunden waren. Die vordere Seite der Schreibfläche bildete die Rückenlehne für die vorderen Banknachbarn.
Jungen und Mädchen saßen gemischt. Er saß in der linken Bankreihe ziemlich hinten, so dass er glaubte, sich verstecken zu können. Vor den Blicken der Lehrerin, des Fräulein Dietrichs, denen nichts entging, kein Tuscheln, kein Gähnen, keine nicht gemachte Hausaufgabe. Fürs Schwätzen musste man nach vorn kommen, es gab mit dem Holzlineal Schläge in die Handfläche.
Man musste auch nach vorn kommen, wenn es galt, Verse aus der Bibel vorzutragen oder manchmal auch Gedichte. Das machte ihm nicht so viel aus. Er stand vor einer Gruppe bekannter Gesichter, die es nicht besser als er konnte. Und meistens schnitt er beim Vortragen gut ab. Es war ein bekanntes Publikum anwesend, es gab nicht die vielen Unbekannten wie damals beim Pfarrer, die ihn verunsicherten und ihn verstummen ließen.
Häufig wurde er von der Lehrerin angesprochen, weil er dem Unterricht nicht folgte, und aus seinen Tagträumen gerissen. Du Träumer, rief sie dann. Das war noch nicht einmal böse gemeint. Doch Disziplin musste sein. Alle hören gleichzeitig zu, alle stehen gleichzeitig auf und entbieten dem Fräulein den Morgengruß, alle frühstücken zur selben Zeit im Klassenraum, bevor es danach in geordneten Reihen auf den Schulhof in die große Pause geht.
Das Träumen war für ihn die Möglichkeit, die Welt auszuhalten. Draußen lauerten mache Unannehmlichkeiten. Das waren nicht seine Mitschüler, die sich über ihn lustig machten. Er war kein Außenseiter. Er hatte Freunde, mit denen er sich zum Spielen traf.
Unangenehm war für ihn die fast tägliche Begegnung mit dem großen Hund, einem schwarz-weiß-gefleckten Mischling, der dem Klempner gehörte und der ihm regelmäßig entgegenlief, wenn er auf dem Heimweg war. Er hatte einfach Angst. Obwohl ihn der Hund noch nie gebissen hatte. Angst machte ihm auch, wenn er gescholten wurde, für etwas, das er falsch oder nicht ordentlich gemacht hatte. Gerügt oder korrigiert werden verunsicherte ihn. Er fühlte sich dann nicht vollwertig. Andere hätten das weggesteckt und vergessen. Er trug sein Versagen lange mit sich herum. Nur in gelegentlichen Wutausbrüchen konnte er sich Luft verschaffen. Das war ihm nachher peinlich und machte ihn nicht stärker.
Seitdem er flüssig lesen konnte, las er. Bücher, die im Bücherschrank im Wohnzimmerer standen, und Bücher, die er geschenkt bekommen hatte, dann Bücher aus der Pfarrbücherei, später Bücher aus der Stadtbibliothek, wohin er mit dem Fahrrad fuhr. In der Welt der Bücher konnte er es aushalten. Diese Welt war größer als die von Hans und Grete in der Fibel.
Die katholischen Heilgenlegenden hatten es ihm angetan. Er hatte sie bei einer Großtante aufgestöbert, die in einem katholischen Teil des Landes lebte. Ihre Heiligkeit hatten die Heiligen erlangt, weil sie für ihren Glauben eingetreten waren und, da sie ihm nicht abschworen, mit dem Tode bezahlte hatten. Diese Standhaftigkeit beeindruckte ihn. Diese Stärke hätte er auch gern besessen. Die Todesarten, die in den Märtyrergeschichten auftraten, erfüllten ihn mit einer Art Wollust, wenn er sich vorstellte, wie das jeweilige Opfer auf glühenden Kohlen geröstet wurde, ein anderes mit Pfeilen durchbohrt oder wie mancher Apostel mit dem Schwert enthauptet wurde. Er stellte sich vor, dass er auf dem Boden läge und dass sein Kopf in Kürze vom Rumpf getrennt würde. Bald nach den wollüstigen Schauern der Foltertode und Hinrichtungen trat ein anderes Erschauern an ihre Stelle.
Zu Anfang der Gymnasialzeit sorgten die Erzählungen von Karl May für die entsprechende Gemütsbewegung. Schafften es die Guten noch nach so viel Heimtücke, Hinterlist und Grausamkeit der Bösen den Sieg zu erringen?
Es war die Spannung vor der Lösung des Konflikts, die bisweilen auch auf der Seite der Guten nicht gewaltfrei war, die den Schauer hervorrief. Er versetzte sich in die Lage der Helden, seien es Old Shatterhand, Kara Ben Nemsi oder Winnetou. In den Weiten Nordamerikas oder des Vorderen Orients war er nun der Starke.
Die Lektüre dieser neuen Heldengeschichten verursachten einen Hunger auf weitere Geschichten. Der Hunger ließ sich mit weiteren Karl-May-Erzählungen stillen, die in einer mehr als siebzig bändigen Ausgabe vorlagen. Er las einen Band nach dem anderen und reiste so um die ganze Welt. Unter den Büchern waren auch Heimatromane wie Aus dunklem Tann, Der Peitschenmüller, Der Silberbauer, Der Wurzelsepp und Die Kinder des Herzogs. Die lieh er vornehmlich für seine Großmutter aus, die nach dieser Art von Literatur eine kleine Sucht entwickelte. Denn eigentlich mochte sie Karl May nicht. Ihr Vater nämlich habe diesen Schriftsteller immer schon als Lügenhammel bezeichnet, weil alle die Reisegeschichten erlogen seien. Niemals sei der in fernen Ländern gewesen.
Der Enkel verteidigte den Reiseschriftsteller mit dem Argument, das man so viel ja gar nicht erfinden könne, wie er auf seinen Reisen erlebt habe. Doch die Großmutter blieb bei ihrem Urteil, das sie nicht davon abhielt, sich weitere Heimaterzählungen besorgen zu lassen.
Jahre später erfuhr er, dass die Großmutter in gewisser Hinsicht recht gehabt hatte mit dem Vorwurf der Lügengeschichten. Und noch später wurde ihm klar, dass das sogenannte Lügen ein Wesensmerkmal der Schriftstellerei war. Was er jedoch niemals herausfand, war, ob der Urgroßvater mit der Bezeichnung Lügenhammel auch Mays kleinkriminelle Karriere als Hochstapler mitgemeint hat und ob das Eine ohne das Andere überhaupt möglich war.
Die Abenteuerromane führten zu einer gedanklichen Weite, die der häuslichen Enge und Eingeschränktheit gegenüber stand. Wie auch in der Schule war kein Widerspruch erlaubt. Anordnungen wurden ausgeführt und nicht hinterfragt. Das störte ihn nicht, denn es gab ja die andere Welt, die der Phantasie, in die man sich jederzeit zurückziehen konnte.
Seine strenge Tante trug sogar noch dazu bei, weil sie ihm, als er von einer langwierigen Mittelohrentzündung geplagt, Wochen zu Hause verbringen musste, James F. Coopers Lederstumpf mitbrachte. So lernte er Menschen kennen, die nach Freiheit strebten, die sie in den Weiten Nordamerikas verwirklichen konnten. Die als Einzelgänger sich ihren Weg bahnten und sich keinem Gesetz unterwerfen mussten.
Es war ein voluminöses Buch, das die Tante ihm in die Hand gedrückt hatte. Eigentlich fünf Romane, die in den Zeiten der nordamerikanischen Kolonien spielten, als sie noch zur englischen Krone gehörten. Ein gewisser Nathaniel Bamppo spielt die Hautrolle, trägt aber in den Romanen nach indianischem Brauch verschiedene Beinamen. Er heißt einmal Wildtöter, Pfadfinder und Lange Büchse, Falkenauge oder Lederstrumpf. Ein Pionier, der sich der Enge der Zivilisation zu entziehen sucht. Die Delaware-Indiander des Nordostens werden von den Siedlern zurückgedrängt und wehren sich. Chingachgoog ist der edle Wilde, der auch in Bedrängnis moralisch handelt und daher mit Nathaniel befreundet ist. Die Siedler machen immer mehr Indianerland urbar, der edle Wilde findet bei der guten Tat den Tod.
Es gab auch den Schurken, ohne den keine Heldentaten möglich sind. So suggerierte es die Lektüre. Gegen sie hilft Gewalt und List. Er bevorzugte in seinen heldenhaften Phantasiegeschichten, die sich nach dem Lesen in seinem Kopf aufbauten, die List. Nicht weil er die Gewalt verabscheute. Prügeleien ging er nicht grundsätzlich aus dem Wege. Sondern weil er die seiner Meinung nach intelligentere Lösung vorzog. Dazu brauchte man Wissen. Das wollte er sich aneignen.
Aus der Stadtbücherei lieh er sich auch Friedrich Gerstäckers Die Flusspiraten des Mississippi aus. In der Jugendbuchfassung. Der Piratenchef Kapitän Kelly verübt von einer Flussinsel aus Überfälle auf Warentransporte auf dem Mississippi. Die Flussanwohner und Schiffer fürchten ihn wegen seiner Brutalität, die Piraten verehren ihn. Georgine, seine dortige Frau liebt ihn, obwohl er nur selten bei ihr ist. Doch Kelly führt ein Doppelleben. Meistens lebt er in der Gemeinde Helena mit seiner rechtmäßigen Gattin Hedwig. Hier ist er der Friedensrichter, Anwalt und Arzt Dayton, bei der Bevölkerung beliebt und geachtet, und kann unter diesem Deckmantel seine kriminellen Geschäfte planen und kontrollieren. Natürlich nimmt die Geschichte kein gutes Ende.
Was ihn an der Gerstäcker-Geschichte faszinierte, war weniger das Exotische, das Wilde, das Piratenleben, sondern die Lebensweise der Hauptfigur. Dayton-Kelly oder umgekehrt kann in zwei unterschiedliche Personen schlüpfen. Nicht nur in der Phantasie, sondern im realen Leben. Bei ihm gibt es nicht Wirklichkeit und Traum, sondern zwei Wirklichkeiten oder zwei Leben gleichzeitig.
Damals wusste er noch nicht, dass der Lügenerzähler May von den Landschaftsbeschreibungen und Figuren Gerstäckers und Coopers profitiert hatte und dass Gerstäckers literarisches Vorbild Cooper gewesen war. Es hätte ihn auch nicht interessiert.
Bald fand er auch kein Interesse mehr an den nordamerikanischen Helden und Bösewichtern. Ihm fiel Daniel Defoes Robinson Crusoe in die Hände. Das Buch faszinierte ihn solange, bis ein Tipp der Bibliothekarin ihn zu Alexandre Dumas Der Graf von Montechristo greifen ließ. Er gerät in den Bann eines Rachefeldzugs, den der unbescholtene Edmond Dantès durchführt, nachdem er infolge einer Intrige jahrelang in Kerkerhaft gesessen und durch glückliche Umstände freigekommen war. Es waren auch sich ändernde politische Verhältnisse im Frankreich der ersten Hälfte des 19.Jahrhunderts, die bei der Intrige eine erhebliche Rolle spielen. Er verstand sie beim damaligen Lesen kaum, doch sah er, welche Ausmaße die Vernichtung persönlichen Glücks annehmen konnte und dass das Private sich nicht allein im familiären Raum abspielte.
2. Kapitel
Er war wieder aus dem Rhythmus gekommen. Er hatte im wahrsten Sinne des Wortes kein Taktgefühl. Seine Tanzpartnerin nahm es mit einem gequälten Lächeln hin, wenn er ihr wieder und wieder auf die die Füße trat. Sein Hemd war längst durchgeschwitzt seine Hände waren feucht, und seine eigenen Füße schienen in den großen spitz zulaufenden Schuhen keinen Halt mehr zu finden. Warum hatte er sich die Tanzschule antun müssen? Nur weil er mit den anderen aus der Klasse mithalten wollte? Denn wenn er jetzt nicht mitgemacht hätte, hätte er nie mehr einen Tanzkurs belegt. Tanzen musste man können. Ein gesellschaftliches Muss.
Frauen schätzten Männer, die tanzen konnten. Das wusste er schon jetzt mit fünfzehn. Also musste er diese Höllenqualen erdulden. Auch die Peinlichkeit, wenn eine der beiden Töchter der Tanzlehrerin, die ihre Mutter bei deren Arbeit unterstützten, sich seiner erbarmten und ihm Nachhilfe gaben. Mit einer Leichtigkeit kamen sie herbeigeflogen, boten sich ihm als Partnerin dar und halfen ihm, die richtigen Schritte zu tun. Er ließ sich von ihnen führen, obwohl das seine Aufgabe gewesen wäre.
Und in diesen kurzen Momenten tanzte er scheinbar leichtfüßig. Schwebte durch den Raum, durch den gerade noch eher niedrigen Tanzsaal mit ein paar Spiegeln an der Querseite gegenüber der Eingangstür. Immer im Raum herum, der sich bei jeder Drehung erweiterte und vergrößerte. Er hatte eine strahlende Partnerin im Arm, mit der er sicher vom Walzer in den Foxtrott wechselte, die er beim Tangoschritt knapp über das Parkett gleiten ließ und die die Rumba mit wehendem Röckchen und glühenden Blicken tanzte. Er wurde um seine Kunst und seine Partnerin beneidet. Das konnte er sehen, aus den Augenwinkeln. Die Mädchen, die ihn bei der Damenwahl übersehen hatten, bedauerten ihre Entscheidung. In den Augen seiner Tanzpartnerin, mit der auch zum Abschlussball gehen würde, stiegen Verlangen und Eifersucht auf. Das nachsichtige Lächeln wurde zur lächelnden Bitte. Bleib bei mir bis zum Schlussball! Er hatte es ihnen allen gezeigt.
Abrupt hörte die Musik auf, der langsame Walzer war zu Ende, die Tochter der Tanzlehrerin war verschwunden, er stand allein. Wieder in der Wirklichkeit. Noch eine Viertelstunde, dann konnte er an die frische Luft. Dann wäre die Unterrichtstunde zu Ende, die mühseliger zu ertragen war als manche Mathematik- oder Chemiestunde.
Dann ginge er die zwei Kilometer zu Fuß nach Hause, anstatt die Straßenbahn zu nehmen. Das gäbe ihm ein gewisses Gefühl von Befreiung. Er könnte dann wieder seinen Gedanken nachhängen, sich in starke Personen hinein träumen. Auch wenn es nur gute Tänzer wären, die auf dem gut ausgeleuchteten Parkett eine gute Figur machten und den ersten Preis für ihrer Darbietungen bekamen.
Seit einiger Zeit hatten sich seine Traumwelten verlagert. Er war der galante Dandy, der die jungen Frauen mit seinen Tanzküsten und seiner Eloquenz verführte. Der von seinen vielen Schulfreunden, in Wirklichkeit hatte er gerade einmal zwei, vergöttert und um Rat gefragt wurde, der jeden Tanzwettbewerb gewann und sogar in den Illustrierten auf das Titelblatt rückte, mit seiner neuesten Partnerin im Arm. Er war überdies der geniale Schüler, der in Naturwissenschaften glänzte, ein eigenes Labor besaß, Arzneimittel, Düngemittel und alles Mögliche entwickelte, das die Welt vor Krankheit, Hunger und Armut rettete. Diese Träume halfen ihm, die Zeit bis zur Reifeprüfung zu überstehen.
Die Ergebnisse des Abiturs waren zufriedenstellend. Mehr hatte er gar nicht gewollt. Nie war es ihm in den Sinn gekommen, wirklich Medizin zu studieren, denn dazu hätte man einen sehr guten Abschluss vorweisen müssen. Immerhin standen ihm mit seinem Zeugnis die Universitäten offen. Und er konnte einen Studienort wählen, der soweit wie möglich von seinem Heimatort, seiner Familie, seinem Bekanntenkreis entfernt lag.
Teil I
3. Kapitel
Als ich Klemens an der Universität kennenlernte, hatte ich gerade mit dem zweiten Semester begonnen, während er schon im Hauptstudium war. Dass Klemens Milde ein angenommener Name war, erfuhr ich erst viel später. Er war Tutor im Geographischen Institut und half den Studenten der unteren Semester beim Erlernen wissenschaftlichen Arbeitens.
Ich hatte da anfangs Probleme, denn ich hatte das Fach Geographie nur deshalb als zweites Studienfach neben Anglistik und Germanistik gewählt, weil es mir in der Schule gefallen und mir eine gute Note beschert hatte. Tiefe Kenntnisse hatte ich keine. Die Lücken inhaltlicher und methodischer Art erschienen mir auf einmal so groß, dass ich ich nicht wusste, wie ich sie füllen sollte. Und ich dachte daran, das Geographiestudium aufzugeben, wie vorher schon das Studium der Philosophie, weil das mir abverlangte Arbeitspensum nicht mehr dem entsprach, das ich in der Schule aufgebracht hatte. Kurz: ich musste erst einmal das Arbeiten lernen. Dabei half mir Klemens.
Klemens hatte ein leises, zurückhaltendes Auftreten, war zielstrebig und zäh. Die Geographie war für ihn so eine Art Offenbarungswissenschaft, die nahezu das gesamte Weltwissen in sich vereinte, und er verehrte mit religiöser Inbrunst ihren berühmtesten Vertreter Alexander von Humboldt. Er verfügte über große Überzeugungskraft und pädagogisches Talent. Ich glaube, dass alle Studenten, die er unter seine Fittiche genommen hat, aus dem Tal der Tränen hinausgekommen sind.
Seine Zurückhaltung bedeutete nicht, dass er die Öffentlichkeit oder den großen Auftritt scheute. Diese andere Seite bemerkte ich erst auf eine der vielen politischen Veranstaltungen, die im Auditorium Maximum der Marburger Universität stattfanden.
Laut Helmut Kohl und anderen Vertretern der Konservativen waren drei Universitäten Kaderschmieden des linken Umsturzes, deren Namen in alphabetischer Reihenfolge zu nennen sie nicht müde wurden, nämlich Berlin-Bremen-Marburg. Wie eine Beschwörungsformel, mit der man den Gottseibeiuns bannen möchte.
Immerhin, die Veranstaltungen waren ein politisches Spektakel, wenn auf der Bühne berühmte akademische Honoratioren ihre Ansichten zu irgendwelchen innenpolitischen Geschehnissen oder außenpolitischen Ereignissen, insbesondere in der Dritten Welt, bekundeten und dann die geballte geistige Elite der politischen Studentenverbände vom SHB und MSBSpartakus und KPMDLM etc. zum Meinungsaustausch überging.
Ich entdeckte Klemens auf der Bühne. Damals schlank, mittelgroß, mit hellblonden langen Locken und Nickelbrille, als es auf einer der oben genannten Veranstal-tungen um den Militärputsch in Chile vom 11. September 1973 ging.
Klemens stand am Rednerpult und eröffnete die Informations- und Solidaritätsveranstaltung. Er schilderte mit ruhiger Stimme präzise und ausführlich die politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen in Chile, die Regierungszeit Allendes, den scheinbar unerwarteten Putsch, die Rolle der USA, die Verhaftungen und Foltermethoden und kam dann auf die Flüchtlinge zu sprechen, verstreut in alle Winde. Doch einige von ihnen seien jetzt hier unter uns, in Sicherheit, im Asyl. Die Stimmen im Saal brausten auf. Rhythmisches Klatschen. Un pueblo unido jamás será vencido. Dann stellte Klemens die Redner vor, unter ihnen auch einige Exilchilenen. Wenn sie auf‘s Podium stiegen, schwollen die Begeisterungs- rufe an.
Das konnte ich verstehen. Weil ich ziemlich vorn in der Menge saß, war auch ich von ihrer optischen Erscheinung nicht ganz unberührt. Denn mit ihren, merkwürdigerweise, schwarzgelockten Haaren bildeten sie einen exotischen Kontrast zum mitteleuropäisch blondem Publikum. Besonders zu den hellblonden schlanken Kommilitoninnen oder besser Genossinnen, die die dem Gemetzel entkommenen Freiheitskämpfer liebevoll in die Arme schlossen.
Die haben schon ihre Groupies, dachte ich mir und war ziemlich neidisch. Unter den Klängen von Trommeln und Andenflöten pflegten diese Veranstaltungen zu Ende zu gehen. Ich weiß nicht mehr, ob damals Quilapayún selbst auftrat oder nur eine der Indiogruppen, die sie imitierten. Die Stimmung war gut. Man hatte das Gefühl, seine politische Solidarität zum Ausdruck gebracht zu haben. Ein paar Jahre später wurde man dieser Art von Musik überdrüssig. In jeder Fußgängerzone einer mittelgroßen Stadt kam man nicht umhin, das Pfeifen und dumpfe Trommeln anzuhören. Inzwischen waren unzählige dieser Bands entstanden, die sich grell farbige Ponchos übergeworfen hatten und selbst gepresste CDs feilboten.
Ich habe kurz nach der Chile-Veranstaltung Klemens auf seine politischen Aktivitäten hin angesprochen. Er war schon eine längere Zeit beim SHB. Sein Schwerpunkt in der politischen Arbeit waren die Dritte Welt und die Befreiungsbewegungen. Das lasse sich hervorragend mit seinem Studienfach vereinbaren, und in nicht allzu ferner Zeit werde er all diese Länder bereisen.
Ob ich nicht auch mitmachen wolle. Ich drückte mich um eine konkrete Antwort und wollte stattdessen wissen, wie es denn mit den geflüchteten Genossen weitergehe. Wie ich gesehen hätte, seien diese ja in den besten Händen. Der beherrschte Klemens verzog keine Miene, doch glaubte ich in seinen Zügen Bitterkeit wahrzunehmen. Natürlich wurde ich mit ein paar Floskeln abgespeist, erfuhr erst später, dass er noch die Feier danach organisiert hatte, dann jedoch ziemlich alleine dastand, als die schönen dunklen Jünglinge mit ihren blonden Mädchen verschwanden.
Ich kann seine Emotionen nachvollziehen. Hatte er doch schon seit geraumer Zeit Spanisch gelernt. An diesem Abend war er noch nicht dran. Nein, er war nicht schwul. Er hatte nur ein menschliches und politisches Interesse. Und ich wusste jetzt, dass diese Art von Aktivität nichts für mich war.
4. Kapitel
Klemens Milde hat aus diesen Erfahrungen gelernt. Die politische Arbeit, das Vertrauen in seine erworbenen Kenntnisse hatten ihm eine gewisse Kraft und Stärke verliehen. Öffentliches Auftreten war zwar noch lange mit Lampenfieberanfällen begleitet, die kindliche und jugendliche Schüchternheit war zwar nicht zur Gänze überwunden, doch er hatte sie im Griff. Sie war ihm nicht mehr anzusehen.
An seinem ersten Studienort, in Bochum, haben ihn einige dieser Typen, die lautstark in den Seminaren, in den Foyers, im Audimax oder auch draußen auf der freien Bühne auftraten, beeindruckt. So wollte er auch sein. Männer, mit kräftigem Schnauzbart, langem Haar. So wie ein gewisser Carlos Bouillon oder die Assel-Brüder, flachsblonde Zwillinge, quirlig, nervös, trotzdem mit einer gewissen Ausstrahlung. Alle waren wohl dem SHB oder der linken SPD zuzuordnen, zogen eine große Show ab und ärgerten den damaligen Rektor der Universität.
Nach meinen Nachforschungen besaßen sie nach ihrer aufregenden Studienzeit eine Rechtsanwaltskanzlei samt Notariat in Bochum. Da hatten sie früher genug Spielraum, um schon mal große Auftritte zu üben. Über Bouillon, der bei Clemens so tiefe Spuren hinterlassen hat, war nichts zu erfahren.
Klemens war kein Kind des Ruhrgebiets, wie es so heißt. Auch wenn seine erste Universität die Ruhr-Universität Bochum war, die endlich den Kindern von Bergleuten und Stahlarbeitern universitäre Bildung bringen sollte. Klemens kam aus dem süddeutschen Raum. Unter großer Anstrengung, so vermute ich, muss er sich seinen süddeutschen Tonfall und Akzent abgewöhnt haben.
Ich besitze ein gutes Gehör für Sprachen und Dialekte, und meine linguistischen Studien haben mich den niederdeutschen und oberdeutschen Sprachraum unterscheiden gelehrt. Die Klippe, die er immer abzustürzen drohte, war der S-Laut. Die Zahl sechs sprach er aus wie Sex und umgekehrt. Ich brauche Ihnen nicht zu schildern, welche Sätze so konstruierbar sind. Daraufhin angesprochen, wollte er es nicht wahrhaben.
Ich hätte ihn später, wenn ich dies alles Revue passieren ließ, gern damit geröstet, dass es viele seiner Landsleute im weitesten Sinne gab, die diesen Makel auch nicht los wurden.
Aber das ist ja überflüssige Spinnerei. Vielleicht übte er im Stillen, mit mäßigem Erfolg, denn nach einiger Zeit meldete sich seine Heimat akustisch wieder zurück. Als mir das mit den S-Lauten auffiel und ich meine Bemerkungen machte, wusste ich noch nicht, welchen Weg Klemens - ich nenne ihn jetzt weiterhin so - schon gegangen war und welchen Weg zu gehen er sich noch vorgenommen hatte. Das Sprachtraining war nur ein kleiner Teil davon.
5. Kapitel
Viel später, als ich einmal in San Francisco meine Osterferien verbrachte, sah ich Klemens zufällig wieder. Er war zu einem Meeting zum Thema Welternährungsproblemen im Rahmen der WHO angereist, allerdings unter dem Namen Carl Clement.
Er erzählte es mir, ohne dass er sich verpflichtet sah, seinen derzeitigen Namen zu rechtfertigen, ferner dass er sein Studium in Marburg abgebrochen beziehungs- weise ruhen gelassen habe, um in Südamerika - wie er ironisch lächeln formulierte - auf den Spuren Alexander von Humboldts zu wandeln, jedoch als Clemens Templado. Chile habe er zunächst ausgespart, der Gefährlichkeit wegen, doch mithilfe entsprechender Camouflage und Beziehungen, über die er sich nicht näher ausließ, habe er dann dort einige produktive Jahre verbracht. Er lächelte leicht, wie früher, wenn er jemanden für sich einnehmen wollte. Die alte Nickelbrille hatte er durch eine dunkle Hornbrille ersetzt, die gelockten Haare waren auf der Stirn zurückgewichen, an den Seiten kurz gehalten und leicht ergraut, so dass er den Eindruck eines seriösen Wissenschaftlers oder Arztes machte.
Etwas später ließ er mir die Nachricht zukommen, dass er sich eine neue Legende zugelegt hatte. Um Forschungen zu betreiben. So wie es bei Geheimdienstleuten üblich war, mutmaßte ich.
Klemens Templado war das Kind des Peruaners Gustavo Pablo Templado. Dessen Vater, also sein Großvater, war aus der Schweiz eingewandert, hatte im Bewässerungsgebiet der Küstenebene Avocado-Plantagen aufgebaut und in die Oberschicht hineingeheiratet. Sein Vater Gustavo war nach einem Europa-Besuch in Deutschland geblieben, hatte eine Deutsche kennengelernt, geschwängert und geheiratet. Klemens Templado Lange wuchs in Stuttgart auf, wo sein Vater bei Mercedes eine passable Anstellung gefunden hatte. Diese „Mischehe“ seiner Eltern diente als Erklärung für seine nicht ganz perfekte Beherrschung des Spanischen und seine etwas harte Aussprache.
Nachdem Klemens etwa ein Jahr lang durch Südamerika gereist war, von Kolumbien die Anden entlang bis nach Feuerland, um so einen Eindruck fast aller spanischsprachigen Länder zu bekommen - Brasilien interessierte ihn angeblich nicht -, ließ er sich in Ecuador, einem kleinen Land, in dem er sich binnen kurzem bestens auskannte, nieder.
Der Grund dafür war, so verbreitete er, sei die Bedeutung, die das Land für Humboldts Forschung besaß und demzufolge auch für ihn. In Wahrheit hatte er hier ohne Probleme auf seinen Namen Templado Papiere bekommen, die ihn als Botaniker auswiesen, der an diversen Universitäten der umliegenden Länder wie Bolivien Argentinien und Kolumbien geforscht und gelehrt hatte. In Quito war er Lehrstuhlinhaber für das Fach Ökologie an der Päpstlichen Katholischen Universität.
Er hatte sich einen Namen gemacht bei der Erforschung von Biotopen im Tiefland von Ecuador, wo die Bohrung nach Erdöl ein staatliches Anliegen war. Durch einen polemischen Artikel im Interesse der dort ansässigen indigenen Bevölkerung und zur Erhaltung der Biodiversität und gegen die kurzfristige Profitmaximierung wurde man auch im Erzbistum München und Freising, das intensive Kontakte zur Universität hielt, auf ihn aufmerksam.
Für Klemens, den leidenschaftlichen Geographen, war es ein Leichtes gewesen, sich als Biologen auszugeben. Die Aneignung des entsprechenden Fachwissens war nur eine Frage von einigen Monaten. Bis auf explizit biologische Sachverhalte, z.B. Botanik, Zoologie, Genetik, Mikrobiologie, Biochemie und Biotechnologie war ihm das Denken in ökologischen Zusammenhängen geläufig.
Auf seinen Reisen hatte er Pflanzen und Tiere fotografisch dokumentiert, so dass er auf diesen Fundus immer zurückgreifen konnte. Als der Münchener Kardinal auf ihn aufmerksam wurde, stand er kurz davor, einen Reisebericht zu vollenden, der die Lebensweise der Bevölkerung und die Machenschaften der Ölindustrie im ecuadorianischen Regenwaldgebiet beschrieb und der auf intensiven Gesprächen mit der betroffenen Bewohnern, Arbeitern vor Ort und auch anonymisiert mit Vertretern der Ölkonzerne beruhte. Schon vor der endgültigen Drucklegung versprach der Kardinal, ein Begleitwort zu schreiben.
Dieser Reisebericht, den er Viaje a través del infierno (Reise durch die Hölle) nennen sollte, basierte nach Angaben des Verfassers auf mehrwöchigen Aufenthalten im Oriente, dem tropischen Teil Ecuadors, die immer nur kurz von den kurzen Rückzugphasen in Quito unterbrochen wurden, wo er eine gewisse Präsens zeigen und sich gleichzeitig von den Strapazen des Lebens im Dschungel erholen musste.
In der Hauptstadt lebte er mit Ana María zusammen, einer Studentin aus der weißen Oberschicht, die trotz ihrer Herkunft für die Interessen der indigenen Bevölkerung eintrat und die schon während des Entstehungsprozesses des Buches die Werbetrommel für den Reisebericht rührte und die auch den Titel vorgeschlagen hatte. Sie entsprach dem Schönheitsideal der Mittel- und Oberschicht, war schlank und blond, und offensichtlich war niemals ein Tropfen indianischen Blutes durch die Adern ihrer Familie, die stolz auf ihre reine Abkunft aus dem spanischen Norden war, geflossen. Klemens erinnerte sie stark an die blonden Studentinnen, die sich den exilierten Chilenen an den Hals geworfen hatten. Ihm war bewusst, dass er für Ana María ebenfalls einen gewissen exotischen Reiz besaß, allerdings im umgekehrten Verhältnis, denn er war jetzt ein Nordländer im Süden, dessen, sagen wir einmal, Schwerfälligkeit beim Salsa-Tanzen bei den Einheimischen für Amüsement sorgte.
Wenn er, von seinen Reisen in den Oriente zurück in Quito war und seiner Freundin in wohl dosierten Portionen, so wie man einem hungrigen Tier Futter hinstreut, von seinen Expeditionen erzählte, hatte er zunächst alle Mühe, ihr auszureden, ihn beim nächsten Mal zu begleiten. Dann schilderte er ihr in krassen Szenen die im wahrsten Sinne des Wortes lausigen Unterkünfte, das miserable Essen, die schreckliche Hitze und furchtbaren Regenfälle mit Überschwemmungen, die alles mögliche Getier ans Ufer der Flüsse spülten, die Unberechenbarkeit der dort lebenden Menschen, die fehlende Kultur und alles Mögliche, was das Leben da unten von ihrem Leben hier oben in der klaren Luft der Anden unterschied. Dieser Gefahr wollte sich Ana María nicht aussetzen, schon ihren Eltern zuliebe, die ohnehin schon skeptisch den Deutschen, wie sie ihn zu Klemens Ärger nannten, beäugten.
Die glückliche Rückkehr aus der Wildnis pflegten sie auf Wunsch Ana Marías im Restaurant auf dem Panecillo, der höchsten Erhebung Quitos, zu feiern. Dort trafen sie dann regelmäßig Freunde, die sich gern von dem Abenteurer und Wissenschaftler unterhalten ließen. Und Klemens hatte das Gefühl, dass er seine Kindheit und Jugend und die ersten Lehrjahre auf der Universität weit hinter sich zurückgelassen hatte.
Mir ist nicht bekannt, nach allem, was ich herausbekommen habe, ob Ana María jemals den Bericht über die vermeintliche Höllenreise gelesen hat. Wahrscheinlich glaubte sie ihn schon aus den Erzählhäppchen, die ihr vorgesetzt wurden, zu kennen und hielt daher eine Lektüre für überflüssig.
6. Kapitel
Meine Reise in den Oriente, so beginnt der Bericht, ist keineswegs das, was man einem Touristen als Leitfaden für eine Durchquerung des ecuadorianischen Tieflandes zur Verfügung stellen würde. Es geht nicht um schöne Landschaften, indianische Folklore, exotische Mahlzeiten. Es geht um Tatsachen, es geht um die Dokumentation brutaler Lebensumstände. Es geht um die große Ölkatastrophe am südamerikanischen Äquator, in eben dem Lande, das nach dem nullten Breitengrad benannt ist, nämlich Ecuador. In dessem nördlichen Tiefland einige Quellflüsse des großen Amazonasflusses liegen. Hier herrscht das ganze Jahr über dieselbe Temperatur. Eine feuchte Hitze durchdringt die Landschaft. Tägliche Regengüsse lassen mancherorts die jährliche Niederschlagsmenge auf 6000 mm steigen.
Wir waren am Vormittag von Quito aus losgeflogen, mit einer zweimotorigen Propellermaschine, die schon seit Jahrzehnten ihren Dienst versehen musste. Außer mir waren elf weitere Passagiere an Bord. Geschäftsleute, ihrer Kleidung nach zu schließen, Arbeiter der Ölfelder indianischer Abstammung, drei Frauen, ebenfalls Indias, die, was ihre Kleidung und gesamte Aufmachung betraf, sich an den gerade herrschenden Modeideal der Hauptstadt ausgerichtet hatten und gerade deshalb, da sie sich so aufgeputzt in den Regenwald begaben, klar als sexuelle Dienstleisterinnen zu erkennen waren.
Die kleine Maschine flog durch die untere Wolkenschicht. Die Sicht hatte sich verschlechtert, da die mittäglichen sintflutartigen Regenfälle einsetzten. Ich sah, dass die Scheibenwischer überlastet waren und Sturzbäche von Regenwasser an den kleinen Scheiben herabliefen. Ich weiß nicht, wie der Pilot es schaffte, die Landebahn von Puerto Francisco de Orellana, dem früheren Coca, zu finden. Aber nachdem wir mehrere Male ruckartig an Höhe verloren hatten, fanden die Räder Berührung mit der Landebahn, eigentlich mehr mit den Wasserlachen, die sich darauf gebildet hatten, denn die Maschine glitt wie auf Kufen auf die Eingangshalle des Flughafengebäudes zu, bis sie abrupt zum Stillstand kam.
Die Stadt ist klein, sie verfügt über nicht mehr als rund 40.000 Einwohner, besitzt jedoch einige leidlich bewohnbare Hotels. Ich hatte mir ein Zimmer im Hotel de Lago reservieren lassen, das unmittelbar an der Stelle liegt, wo der von Norden kommende Coca-Flusss in den aus dem Andenraum stammenden und nach Osten strömenden Río Napo ergießt und eine seeartige Vergrößerung schafft und so dem Hotel seinen Namen gegeben hat.
Vom Flughafengebäude war es nur einen halben Kilometer zum See-Hotel, den ich zu Fuß gehen konnte, da der Mittagsregen aufgehört hatte und auch mit keinem weiteren Regenguss mehr zu rechnen war. Keiner der anderen Passagiere schien in meinem Hotel zu logieren. Mit dem Aufhören des Regens verzogen sich die die dicken Wolkenbänke, der Himmel klarte in Teilen auf, so dass ich von meinem Zimmerfenster aus auf den See blicken konnte und mir vorstellte, wie der Río Napo, jetzt vereint mit dem Río Coca und verstärkt um etliche Wassermassen dem Amazonas entgegenstrebte, um östlich vom peruanischen Iquitos in den größten Strom des Halbkontinents zu münden.
Ich war müde, denn solche Inlandsflüge sind anstrengend, und beschloss daher, ein wenig auszuruhen, damit ich vor dem Einbruch der Dunkelheit noch ein Restaurant finden konnte.
Zwei Stunden später betrat ich ein kleines Restaurant, mehr eine Bar, am Flussufer. Im Innern war es schummrig, die Abenddämmerung war noch nicht hereingebrochen, der Wirt sparte offensichtlich am elektrischen Strom, so dass man sich mit dem langsam abnehmenden Tageslicht begnügen musste. Ich bestellte das Tagesgericht und ging davon aus, dass ich von dem gebratenen Meerschweinchen verschont bliebe, das in jeder Ecke der Hauptstadt so wie im ganzen Andenraum angeboten wurde und dessen ich längst überdrüssig geworden war. Das Gericht kam schnell. Ich war der einzige Gast, und auf dem Teller, den mir der zunächst schweigsame Wirt mit nicht ganz sauberen Händen hingestellt hatte, befand sich ein Stück Fisch, aus dem Fluss, wie ich annahm, zusammen mit zerkochten Kartoffeln und einem Stück Kochbanane. Unaufgefordert wurde mir eine Flasche Bier serviert.
Ich mache mir nicht viel aus Essen. Essen ist für mich nur Nahrungsaufnahme. Das Getue um Edelrestaurants, Menüfolgen, traditionelle und gerade angesagte Küche empfand ich immer schon als aufgesetzt und über-flüssig. Wenn ich esse, möchte ich nicht übers Essen reden. Ich möchte beim Essen mit jemandem reden oder wie jetzt gerade darüber nachdenken, mit wem ich demnächst über das große Thema Ölkatastrophe reden könnte.
Ich beschloss, gleich mit dem Wirt anzufangen. Der hatte nichts zu tun, tauschte mit dem Koch irgendwelchen banalen Tratsch über irgendwelche Nachbarn aus und schien nicht unzufrieden, als ich ein paar Fragen an ihn richtete. Ich wollte wissen, wie der Ölboom sich auf das Leben der Stadt ausgewirkt hat, auf das kleinen Nest, das Coca noch vor gar nicht langer Zeit gewesen war.
Ach wissen Sie, Señor, ich komme gut über die Runden. In einer Stunde wird es hier voll. Da kommen die kleineren Leute, die eine Arbeit gefunden haben, die irgendwie mit dem Öl zusammenhängt, essen etwas und trinken ihr Feierabendbier. Ich will nicht klagen, habe mein Auskommen, kann meine Familie ernähren, meine Kinder gehen zur Schule, können später was Größeres im Öl werden, Ingenieur vielleicht. Die werden ja gebraucht. Ich bin nicht neidisch. Manche sind hier richtig reich geworden. Das ist ja auch wieder gefährlich. Die leben in abgeschotteten Häusern, mit Personenschutz. Wenn da mal einer draufgeht, die Polizei unternimmt nichts.
Er kam ganz dicht an mich heran: Hier geht nichts ohne El Capitán.
Auf meinen fragenden Blick hin wurde ich darüber aufgeklärt, dass das der Chef, der Beherrscher der Region, sei und die Geschäfte steuere und ohne den keiner Arbeit finde.
Ich dachte gleich an einen Mafia-Paten oder so etwas Ähnliches, sagte es natürlich nicht, um Genaueres zu erfahren.
Der Capitán wohnt flussaufwärts, und dabei zeigte er mit der Hand nach draußen auf den Río Coca, dessen Fluten jetzt schon nicht mehr zu sehen waren.
Wenn er nicht gerade in Quito oder Guayaquil ist, zieht er sich auf seine Hacienda zurück, ein paar Kilometer von hier in Richtung Nueva Loja.
Ich wusste, das war im Norden, dahin wollte ich sowieso, in die Erdölfelder. Und ich wusste nun auch, über wen ich Informationen brauchte.
Noch einmal rückte der Wirt näher und flüsterte: Es gibt noch die Capitana. Die ist noch bedrohlicher. Die wohnt immer auf dem Landgut.
Kurz darauf verließ ich das Lokal, nachdem ich noch ein zweites Bier getrunken und zur Rechnung ein gutes Trinkgeld gegeben hatte, und spazierte am Flussufer entlang bis zur Hafenstelle, wo die Lastschiffe und die Einbäume vertäut waren, von denen mich einer bald stromaufwärts über den Coca-Fluss tragen würde.
7. Kapitel
Mit ihren Außenbordmotoren erreichen die Einbäume eine hohe Geschwindigkeit. Der Fahrtwind sorgt für Kühle, trotz der immens feuchtheißen Luft im Amazonasbecken. Als ich das erste Mahl, vor einigen Jahren, mit einem solchen Einbaum fuhr, also mich fahren ließ, hatte ich mir eine schwere Erkältung zugezogen, da ich diese Fahrt nur in T-Shirt und leichter Hose unternommen hatte. Daraufhin versah ich mich immer für derartige Expeditionen mit wärmerer Kleidung und vor allem mit Regenschutz. So auch dieses Mal. Und außerdem mit einem Basis-Vorrat an Lebensmitteln und Aguardiente, diesmal einem peruanischen Schnaps, den man für Verhandlungs- und ausführliche Auskunftsgespräche braucht. José, mein Wassertaxi-Fahrer, war mir vom Kneipenwirt empfohlen worden. Er sei vertrauenswürdig, verschwiegen und vor allen Dingen, er kenne sich hervorragend im nördlichen Oriente aus, in erster Linie was die Wasserstraßen angehe, aber auch in Bezug auf die Leute, die an den Flussufern lebten. Ich hoffte, mit seiner Hilfe einiges über die Capitana zu erfahren.
Die Landschaft ist wenig abwechslungsreich. Sitzt man im Boot, so sieht man nichts als einen Fluss, der sich ab und zu verbreitert oder schmaler wird, ein paar schwimmende Inseln aus in sich verhakten Baumstämmen und Ästen. An den Ufern Bäume unterschiedlicher Höhe, für den Ignoranten einfach Biomasse, für den Botaniker jedoch eine Vielfalt schier unendlicher, auch noch unentdeckter Pflanzenarten, deren Untersuchung ich diesmal hintanstellen musste.
Wer Luftaufnahmen von tropischen Regenwäldern kennt, sieht rötlich-braune Wasser, die durch wucherndes Dunkelgrün mäandrieren. Die Fließgeschwindigkeit ist nicht hoch, der Fluss sucht sich sein Bett da, wo er es am einfachsten findet, und so entstehen am Ufer kleine Sandablagerungen, Strände sozusagen, die von oben aus der Luft nicht zu sehen sind.
An einer derartigen Stelle machten wir nach mehreren Stunden Fahrt erstmalig Quartier. Bis zum Einbruch der Dunkelheit fehlte lediglich eine Stunde, und die brauchten wir, um unser Lager aufzuschlagen.
Allerdings sind die Flussufer nicht unbewohnt. Immer dort, wo die Vegetation etwas zurückweicht, wo Landeplätze für Boote existieren, sind Hütten errichtet, auf kleinen Stämmen, die die Behausung vor Hochwasser und unerwünschter Fauna schützen. Kinder und Hunde spielen am Ufer und unter den Stelzen. Hier leben Menschen in Familienverbänden, die sich von der Fischerei ernähren und kleinen Pflanzungen in der Nähe ihrer Hütten, manchmal beträchtlich tief in den Regenwald hinein, die niemand von außen erkennen kann und von denen nicht jedermann wissen soll, was da so wächst. Und wenig überraschend, der Handel floriert, von der Stadt hierher und umgekehrt.
Ich wollte ungestört sein, diesmal keinen Kontakt mit der Flussbevölkerung aufnehmen. Denn ein neugieriger Besucher spricht sich herum. Für meine Aufgabe brauchte ich verschwiegene Informanten.
Nachdem wir den Einbaum an Land gezogen hatten, bauten wir das Zelt mit Mückenschutz auf, ich richtete die Feuerstelle her, suchte trockenes Treibholz und Baumäste zusammen und schichtete alles so auf, dass wir oben an einer Art Spieß die Fische braten konnten, die José im Begriffe war zu fangen. Er hatte mir in dieser Beziehung als Einheimischer einiges voraus, und schon nach kurzer Zeit kam er mit einem halben Dutzend heringsgroßer Fische zurück, deren Art, geschweige denn deren Namen mir unbekannt waren.
José war von mittlerer Statur, muskulös und wendig. Selbstverständlich trug er keinen Lendenschurz und auch keine Frisur, die man von Fotos kennt, auf denen „Urwald- Indianer“ abgebildet sind: Das glatte tintenschwarzblaue Haar im Nacken kurz, über die Ohren gleichmäßig rund geschnitten, die Stirn von einem Pony bedeckt. Frau trug diese Frisur in den zwanziger Jahren des letzten Jahrhunderts, und Anna Wintour trägt sie noch heute. José hingegen band sein schulterlanges Haar zum Pferdeschwanz, zeigte auf seinem gedrungenen Oberkörper ein verwaschenes T-Shirt mit irgendeiner Reklame, darunter eine Cargo-Hose von ebenfalls undefinierbarer Farbgebung, die dann gefälschte Markensneekers sehen ließ, ein Allerwelts-Outfit. Der Globalisierung sei Dank!
Längst ist es dunkel. Nur die Restglut des Feuers lässt unsere gegenseitigen Umrisse erkennen.