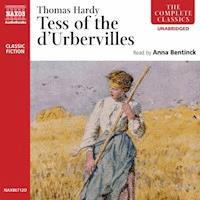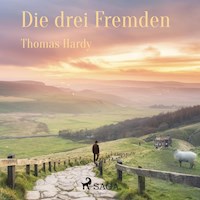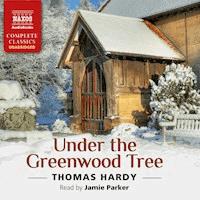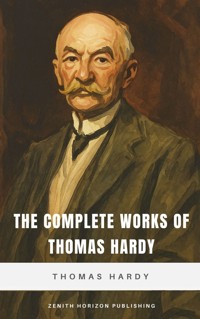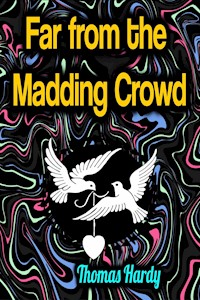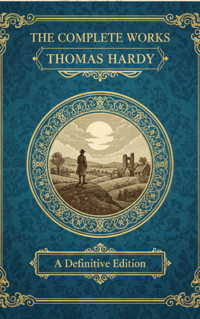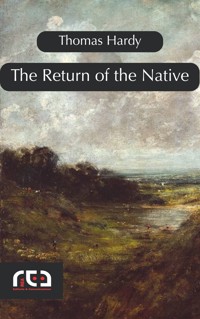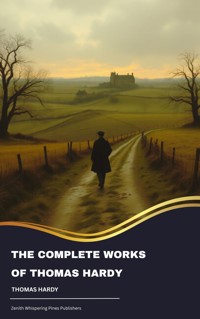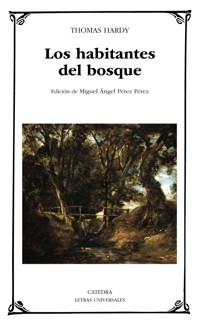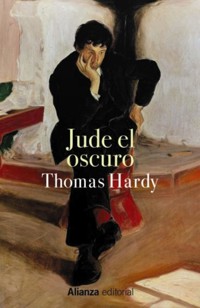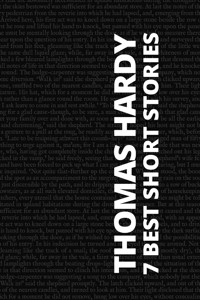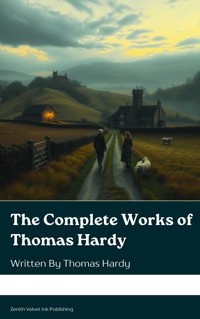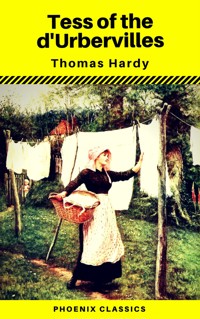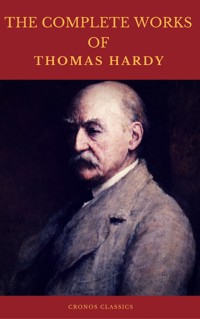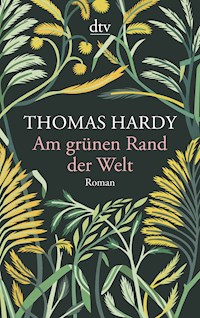
8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Hardys stimmungsvollster Roman, der das ländliche Leben Südenglands in lyrischen Naturschilderungen beschwört. Die fiktive Grafschaft Wessex im Südengland des 19. Jahrhunderts: Bathsheba Everdene ist eine eigenwillige, schöne, junge Frau, die ihre Unabhängigkeit schätzt. Bathshebas Art bleibt den Männern in ihrem Umfeld nicht verborgen und so hat sie gleich drei Verehrer auf einmal, alle unterschiedliche Typen. Da ist der treuherzige, bescheidene Schäfer Gabriel Oak, der ältere, wohlhabende Gutsbesitzer William Boldwood und der hübsche, selbstbewusste, aber rücksichtslose Offizier Frank Troy. Bathsheba bindet sich an keinen Mann langfristig, lässt sich mal mit diesem, mal mit jenem Herren ein. Frank Troy aber zieht sie in einen Bann, der gefährlich ist...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 664
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Über das Buch
Schon bei ihrer Ankunft fasziniert Bathsheba Everdene die ländlichen Bewohner rund um den kleinen Ort Weatherbury im Südwesten Englands. Sie ist schön, kapriziös und kess und damit erregt sie vor allem das Interesse der Männerwelt. Schon bald umkreisen besonders drei Verehrer die freiheitsliebende und unabhängige Erbin: der treuherzige Farmer Gabriel Oak, der wohlhabende Grundbesitzer William Boldwood und der charmante Soldat Francis. Bathsheba genießt das Werben um ihre Gunst und trifft schließlich eine Entscheidung. Doch das Schicksal verfolgt einen anderen Plan.
Von Thomas Hardy ist bei dtv außerdem lieferbar:
Auf verschlungenen Pfaden
Tess
Thomas Hardy
Am grünen Rand der Welt
Roman
Aus dem Englischen von Peter Marginter
Vorwort des Verfassers
Bei den Vorbereitungen zu einer Neuauflage dieses Romans werde ich daran erinnert, daß es in den Monat für Monat in einer Unterhaltungszeitschrift erscheinenden Kapiteln dieses Buches war, wo ich zum ersten Mal das Wort »Wessex« gebrauchte – ein Wort, das aus Urkunden der frühen englischen Geschichte entlehnt ist und dem ich hier eine fiktive Bedeutung als gegenwärtiger Name eines Distrikts gab, der einst zu jenem versunkenen Königreich gehörte. Da die Romane in der Reihe, die ich zu schreiben gedachte, wesentlich von der Art waren, die man als Lokalromane bezeichnet, schienen sie einen Gebietsnamen zu erfordern, der dem Schauplatz eine gewisse Einheit verleihe. In der Meinung, daß die Grenzen einer einzigen heutigen Grafschaft für dieses Vorhaben zu eng wären und daß es gegen einen erfundenen Namen Einwände gäbe, habe ich jenen alten Namen ans Licht geholt. Die so bezeichnete Gegend war nur von ferne bekannt, und ich wurde oft auch von gebildeten Lesern gefragt, wo sie denn liege. Gleichwohl waren Presse und Leserschaft geneigt, mein wunderliches Vorhaben zu begrüßen und folgten mir bereitwillig in den Anachronismus, sich ein Wessex unter Königin Viktoria vorzustellen – ein modernes Wessex mit Eisenbahnen, Briefpost, Mähmaschinen, Fürsorgeanstalten, Sicherheitszündhölzern, Arbeitern, die lesen und schreiben konnten, und Kindern in staatlichen Schulen. Ich glaube aber, ich gehe nicht fehl, wenn ich behaupte, daß man von der Existenz eines zeitgenössischen Wessex, bevor ich sie 1874 in diesem Roman bekanntgab, wenn überhaupt, dann weder in der Literatur noch im heutigen Sprachgebrauch je gehört hatte und daß man demzufolge Ausdrücke wie »ein Wessexer Bauer« oder »das Wessexer Brauchtum« auf keine jüngere Zeit hätte beziehen können als die der normannischen Eroberung.
Ich sah nicht voraus, daß sich dieser Gebrauch des Wortes, der auf eine moderne Erzählung hatte beschränkt bleiben sollen, so weit ausbreiten würde, daß er über die Seiten eben dieser Chroniken hinausgriffe. Aber das Wort wurde bald anderswo aufgenommen, zum ersten Mal in dem inzwischen eingestellten Examiner, der in seiner Ausgabe vom 15. Juli 1876 unter der Überschrift »Der Wessexer Landarbeiter« einen Artikel brachte, der, wie sich herausstellte, keine historische Abhandlung über die Landwirtschaft zu Zeiten der sieben angelsächsischen Reiche war, sondern über das heutige Landvolk der südwestlichen Grafschaften berichtete.
Seither kam der Name, den ich nur für Horizont und Landschaft einer teils wirklichen, teils erträumten Gegend gebrauchen wollte, als zweckmäßige Benennung einer Provinz immer mehr in Umlauf; und allmählich gewann mein Traumland die Handfestigkeit eines Gebiets, wo die Leute hinfahren, sich ein Haus bauen und von wo sie an die Zeitungen schreiben konnten. Aber ich bitte alle gutwilligen und idealgesinnten Leser, dies zu vergessen und der Vorstellung, es gebe Bewohner eines viktorianischen Wessex auch außerhalb dieser Romane, in denen ihre Lebensumstände und ihre Unterhaltungen geschildert werden, mit standhaftem Unglauben zu begegnen.
Überdies wäre das Dorf Weatherbury, in dem die meisten Szenen des vorliegenden Romans aus dieser Reihe spielen, für den Reisenden wohl kaum ohne entsprechende Hinweise in einer bestimmten heutigen Ortschaft zu erkennen, obwohl zu der noch gar nicht so fernen Zeit, als die Erzählung geschrieben wurde, reale Anhaltspunkte für die Schilderungen der Orte und der Personen sich unschwer hätten auffinden lassen. Die Kirche steht noch, zum Glück unversehrt und unrestauriert[1], und auch ein paar von den alten Häusern sind erhalten. Doch die Mälzerei, vormals so charakteristisch für das Kirchspiel, wurde im Verlauf der letzten zwanzig Jahre niedergerissen, ebenso wie die meisten der strohgedeckten, mit Dachluken versehenen kleinen Häuser, in denen einstmals Familien wohnten. Das schöne Spätrenaissancehaus der Heldin findet man noch; allerdings ist es in der Erzählung um einen Hexensprung von einer Meile oder etwas mehr von seiner wirklichen Stelle entrückt, in seinem Aussehen jedoch genau so beschrieben, wie es sich noch heute im Sonnenschein und im Mondlicht darbietet. Das ortsübliche Barlaufspiel, das sich vor nicht allzu langer Zeit noch einer unverwüstlichen Beliebtheit auf dem hartgetretenen Platz vor dem Kirchhof zu erfreuen schien, ist, so weit ich sehe, bei den heutigen Schuljungen völlig in Vergessenheit geraten. Das Bibelorakel mit Hilfe eines Schlüssels, die sehr ernstgenommenen Valentinsgaben, das Festessen nach der Schafschur, die langen, hellen Kittel der Männer und die große Scheuer verschwanden ebenso wie die alten Häuser. Darüber hinaus soll sich auch viel von jener Neigung zu einem guten Trunk verloren haben, für die das Dorf seinerzeit gewissermaßen berühmt war. All diese Veränderungen wurzeln wohl darin, daß die alteingesessenen Dorfbewohner, welche die alten Sitten und Gebräuche wahrten, durch eine Bevölkerung mehr oder minder unseßhafter Tagelöhner verdrängt wurden, was zu einem Bruch in der Stetigkeit der Lokalgeschichte geführt hat und sich verhängnisvoller als alles andere gegen die Bewahrung der Legenden, des Brauchtums, des geselligen Zusammenhalts und der Eigenbrötelei ausgewirkt hat. Unerläßliche Voraussetzung für deren Fortbestand wäre die über Generationen hinweg gewahrte Bindung an den angestammten Grund und Boden.
1895–1902
T.H.
I.Farmer Oak – Ein Ereignis
Wenn Farmer Oak lächelte, reichten seine Mundwinkel fast bis zu den Ohren; von den Augen blieben nur Spalten, und die Fältchen rundum verbreiteten sich über sein Gesicht wie Sonnenstrahlen auf einer Kinderzeichnung.
Gabriel hieß er mit Vornamen, und werktags war er ein junger Mann von vernünftigem Urteil und ungezwungenen Bewegungen, ordentlich gekleidet und auch sonst wohlgeartet. An Sonntagen pflegte er nebulose Ansichten, neigte zu Aufschüben und fühlte sich durch den ›guten Anzug‹ und den Schirm behindert: In summa ein Mann, der sich selbst moralisch in die weite Zone zwischen Kommunionbank und Wirtshaus einordnete, wo die Lauen zu Hause sind – der also in die Kirche ging, aber innerlich gähnte, wenn die Gemeinde beim Credo angelangt war, und an das bevorstehende Mittagessen dachte, während er der Predigt zuhören wollte. Ein recht übler Bursche also für seine kritischen Freunde, wenn sie sich ärgerten, und ein ganz anständiger Mensch, wenn sie bei guter Laune waren; ansonsten für sie ein Mann, dessen Charakterfarbe man als ›Pfeffer-und-Salz‹ bezeichnen konnte.
Da es in Oaks Leben sechsmal mehr Werktage als Sonntage gab, waren es die alten Kleider, die sein Äußeres bestimmten. Das Bild, das sich seine Nachbarn von ihm machten, zeigte ihn immer nur in diesem Aufzug. Er trug einen flachen Filzhut, der am Rand etwas zerdehnt war, weil er bei starkem Wind sicherheitshalber fest auf den Kopf gezogen wurde, und einen weiten, braunen Mantel mit geräumigen Taschen; die Beine steckten in gewöhnlichen Ledergamaschen und Stiefeln von eindrucksvollem Format, die jedem Fuß bequemen Aufenthalt boten und es dem Träger gestatteten, den ganzen Tag über in einem Bach zu stehen und keine Nässe zu spüren – ihr Erzeuger war ein gewissenhafter Mann, der sich bemühte, allfällige Mängel im Zuschnitt durch großzügige Dimensionen und Dauerhaftigkeit aufzuwiegen.
Als Uhr trug Mr. Oak ein Ding bei sich, das man als kleinen Silberwecker bezeichnen konnte, das heißt, nach Form und Zweck eine Taschenuhr, dem Kaliber nach aber ein Wecker. Dieser Apparat war um einiges älter als Oaks Großvater und zeichnete sich dadurch aus, daß er entweder vor oder überhaupt nicht ging. Außerdem drehte sich manchmal der kleine Zeiger lose um den Mittelzapfen, und dann ließen sich zwar die Minuten genau ablesen, aber niemand war sicher, zu welcher Stunde sie gehörten. Plötzlichen Stillstand der Uhr behob Oak durch Schütteln und leichte Schläge, und bösen Folgen der beiden anderen Mängel wußte er zu entgehen, indem er ständig Sonne und Sterne beobachtete und zum Vergleich heranzog oder bei den Nachbarn seine Nase an die Fenster drückte, bis er ausgemacht hatte, welche Stunde drinnen die grünen Zifferblätter auf den Standuhren wiesen. Zu erwähnen wäre noch, daß Oaks Uhrtasche, hochliegend im seinerseits weit unter die Weste hinaufreichenden Leibgurt, schwer zugänglich war und die Uhr daher einen Notbehelf darstellte, an den man nur durch ein seitliches Verrenken des Körpers und ein Verziehen von Mund und Gesicht, das vor Anstrengung rot anlief, herankam, indem man die Uhr wie einen Brunneneimer an der Kette heraufzog.
Einem aufmerksamen Beobachter, der Gabriel Oak an einem gewissen Dezembermorgen – es war sonnig und überaus mild – gesehen hätte, wie er über eines von seinen Feldern ging, wären an ihm wohl auch noch andere Züge aufgefallen. Vielleicht hätte er festgestellt, daß Oaks Gesicht viel Jugendliches in Farbe und Linien bis ins Mannesalter bewahrt hatte: in entlegeneren Winkeln erinnerte sogar noch manches an einen kleinen Jungen. Mit seinem kräftigen und hohen Wuchs wäre ihm ein eindrucksvoller Auftritt sicher gewesen, wenn er darauf mehr Bedacht gelegt hätte. Aber es gibt eine Art Männer, seien sie aus der Stadt oder vom Land, deren Wirkung auf andere nicht so sehr mit Fleisch und Knochenbau, sondern mit etwas Geistigem zu tun hat: Indem sie ihre Größe zeigen, werden sie kleiner. Und so hatte auch Oaks Gangart – aus einer ruhigen Bescheidenheit, die einer Vestalin angestanden hätte und ständig darauf hinzuweisen schien, daß seine territorialen Ansprüche in dieser Welt sehr begrenzt seien – etwas Unauffälliges durch diese nur leicht gebeugte, als solche aber durch ein Vorneigen der Schultern betonte Haltung.
Wenn ein Mensch mehr von der Einschätzung seines Äußeren abhängt als von der Begabung, sich in seiner Haut wohl zu fühlen, mag das ein Mangel sein. Für Oak allerdings traf das nicht zu. Er hatte eben jenen Punkt im Leben erreicht, ab dem nicht mehr ›jung‹ vorangesetzt wird, wenn es um den ›Mann‹ geht. Er befand sich auf dem Höhepunkt männlicher Entwicklung; zwischen Verstand und Gefühl gab es bei ihm eine klare Grenze: Er hatte die Jahre hinter sich, in denen sich beides als Folge der Jugend unterschiedslos vermischt, und er war noch nicht dort angelangt, wo sich beides unter dem Einfluß einer Frau und einer Familie wieder zu Vorurteilen vereinigt. Kurzum, er war achtundzwanzig und Junggeselle.
Das Feld, auf dem er sich an jenem Morgen befand, liegt an der Flanke eines Hügelkamms, der als Norcombe Hill bekannt ist. Über einen Ausläufer dieses Hügels führt die Landstraße, die Emminster mit Chalk-Newton verbindet. Als Oak beiläufig über die Hecke schaute, sah er einen schmucken, gefederten Wagen, gelblackiert und fröhlich gemustert, der von zwei Pferden gezogen wurde. Der Kutscher ging nebenher und hielt seine Peitsche kerzengerade. Der Wagen war mit Hausrat und Blumentöpfen beladen, und zuoberst saß eine junge, hübsche Frau. Gabriel hatte die Szene nicht länger als eine halbe Minute betrachtet, als das Gefährt unmittelbar vor seinen Augen angehalten wurde.
»Wir haben das Heckbrett verloren, Miss«, sagte der Kutscher.
»Das war es also!« erwiderte das Mädchen mit sanfter, dennoch nicht besonders leiser Stimme. »Als es bergauf gegangen ist, habe ich ein merkwürdiges Geräusch gehört.«
»Ich laufe nur rasch zurück.«
»Ja, tu das«, sagte sie.
Die klugen Pferde standen vollkommen ruhig, während die Schritte des Kutschers mit zunehmender Entfernung verklangen.
Das Mädchen oben auf der Wagenladung saß reglos, umgeben von Tischen und Stühlen mit aufwärts gerichteten Beinen, hinter sich eine Eichenbank, vor sich eine Dekoration von Geranientöpfen, Myrten und Kakteen, dazu ein Käfig samt Kanarienvogel – alles vermutlich aus den Fenstern eines eben geräumten Hauses. Außerdem gab es eine Katze in einem Weidenkorb, die unter dem Deckel hervor aus halbgeschlossenen Augen die kleinen Vögel in der Umgebung mit Wohlgefallen betrachtete.
Untätig wartete das Mädchen eine Weile. Das einzige Geräusch, das in der Stille vernehmbar war, kam von dem Kanarienvogel, der auf den Sprossen seines Gefängnisses herumhüpfte. Dann blickte das Mädchen aufmerksam hinunter – nicht auf den Vogel oder die Katze, sondern auf ein längliches, in Papier verschnürtes Paket, das zwischen ihnen lag. Sie schaute sich um, ob der Kutscher schon komme, aber da er nicht zu sehen war, wanderten ihre Augen wieder zurück zu dem Paket, ihre Gedanken schienen um seinen Inhalt zu kreisen. Schließlich hob sie es auf den Schoß und knüpfte die Verpackung auf: Ein kleiner Drehspiegel kam hervor, in dem sie sich prüfend betrachtete. Ihre Lippen teilten sich zu einem Lächeln.
Es war ein schöner Morgen; in der Sonne glühte das rote Jäckchen der jungen Dame wie Scharlach, auf ihrem munteren Gesicht und dem dunklen Haar lag ein mildes Leuchten. Die Myrten, Geranien und Kakteen ihr zu Füßen verliehen mit ihrem frischen Grün dem ganzen Bild – Pferde, Wagen, Mobiliar und Mädchen – einen eigenartig frühlingshaften Reiz. Niemand hätte zu sagen gewußt, was sie in Gegenwart von Spatzen und Amseln und des von ihr unbemerkten Farmers, auf die sich ihr Publikum beschränkte, zu einer solchen Pantomime veranlaßte – und ob sie das Lächeln zunächst nur aufgesetzt hatte, um ihr Talent in dieser Kunst zu prüfen. Schließlich wurde daraus ein echtes Lächeln. Sie errötete vor sich selbst und wurde, als sie das im Spiegel sah, nur noch röter.
Die Verlagerung einer solchen Handlung an einen anderen als den üblichen Ort, wo sie angebracht gewesen wäre – von der Morgenstunde im Schlafzimmer, zu der man sich ankleidet, mitten in eine Reise unter freiem Himmel –, gab dem Unbedeutenden etwas reizvoll Neues, das an sich gar nicht dazugehörte. Die Szene hatte einen eigenen Zauber. Eine der Weiblichkeit zuerkannte Schwäche hatte sich ans Licht der Sonne gewagt, und dieses tauchte sie in den Glanz des Nochniedagewesenen. Gabriel Oak konnte sich ein paar spöttische Gedanken nicht verkneifen, so wenig er an sich zu Kritik neigte. Das Mädchen hatte wirklich keinen Anlaß, in den Spiegel zu schauen. Weder rückte sie ihren Hut zurecht, noch streifte sie ihr Haar glatt oder gab einem Grübchen einen Druck zur Korrektur. Nichts ließ darauf schließen, daß sie, als sie den Spiegel aufgenommen hatte, etwas dergleichen beabsichtigte. Sie besah sich einfach als ein wohlgelungenes, weiblich ausgestaltetes Geschöpf der Natur, und ihre Gedanken schienen zu noch fernliegenden, aber nicht unwahrscheinlichen Träumen abzuschweifen, in denen Männer mitspielten – ein Vorauskosten zu erwartender Triumphe –, wobei das Lächeln offenbar den Herzen galt, die da verloren und erobert wurden. Auch das ließ sich aber nur erraten, denn der ganze Handlungsablauf zeigte zu wenig Absicht, um eine solche Annahme zu rechtfertigen.
Nun waren wieder die Schritte des Kutschers zu hören. Das Mädchen schob den Spiegel in das Papier und legte das Paket zurück an seinen Platz.
Als der Wagen weitergefahren war, verließ Gabriel seinen Späherposten, stieg zur Straße hinunter und folgte dem Gefährt bis zu der Mautstelle ein Stück Weges nach der Talsohle, wo der Gegenstand seines Interesses nun anhielt, um die Gebühr zu bezahlen. Er war noch an die zwanzig Schritt von der Schranke entfernt, als er Zeuge einer Auseinandersetzung wurde. Das Paar, das mit dem Wagen gekommen war, und der Mann an der Mautschranke stritten wegen zwei Pennies.
»Das ist die Nichte der Gnädigen, die obenauf sitzt, und sie sagt, daß es genug ist, was ich dir angeboten hab, du Geizkragen, und daß sie mehr nicht zahlen wird.« So die Worte des Kutschers.
»Meinetwegen. Dann darf die Nichte der Gnädigen nicht durch«, erwiderte der Mauteinnehmer.
Oak blickte von einer Partei zur anderen und dachte vor sich hin. Irgendwie hörten sich die »zwei Pennies« so unbedeutend an. Drei Pennies waren vollgewichtiges Geld, das hätte einen Taglohn schon fühlbar geschmälert und wäre darum nicht so leicht zu entscheiden gewesen: aber zwei Pennies? »Da«, sagte er und drückte dem Mauteinnehmer zwei Pennies in die Hand. »Laß die junge Dame durch.« Dann blickte er zu ihr auf; sie hatte seine Worte gehört und blickte zu ihm herunter.
Gabriels Gesicht war so gebildet, daß es genau die Mitte zwischen der Schönheit des heiligen Johannes und der Häßlichkeit des Judas Ischariot hielt, wie die zwei auf einem Fenster in der Kirche, die er zu besuchen pflegte, dargestellt waren, so daß kein einziger Zug an ihm wegen seiner edlen Linienführung oder des Gegenteils hervorzuheben gewesen wäre. Das schien auch das Urteil des Mädchens mit der roten Jacke und den dunklen Haaren zu sein, denn sie blickte ihn nur beiläufig an und befahl dem Kutscher weiterzufahren. Vielleicht hatte ihr Blick auch eine Spur von Dank ausdrücken wollen, aber sie verlor kein Wort darüber. Noch wahrscheinlicher ist es freilich, daß sie gar keine Dankbarkeit empfand, denn sie hatte ihren Willen nicht durchsetzen können, und wir wissen ja, wie Frauen einen Beistand dieser Art lohnen.
Der Mauteinnehmer sah dem Fahrzeug nach. »Ein sauberes Mädchen«, sagte er zu Oak.
»Aber nicht ohne Fehler«, fand Oak.
»Wie auch nicht?«
»Und der größte davon ist – na: immer dasselbe halt.«
»Dickschädlig, meinst du? Allerdings.«
»O nein.«
»Was sonst?«
Gabriel, den vielleicht doch das mangelnde Interesse der hübschen Reisenden ein wenig kränkte, sah zu der Stelle zurück, wo er sie beobachtet hatte, und stellte fest: »Die Eitelkeit.«
II.Nacht – Die Herde – Drinnen – Desgleichen, aber anderswo
Es war fast zwölf in der Nacht vor dem Thomastag, dem kürzesten Tag im Jahr. Ein unfreundlicher Wind blies von Norden her über den Hügel, wo Oak den gelben Wagen samt Fahrgast ein paar Tage zuvor im Sonnenlicht gesehen hatte.
Norcombe Hill, nicht weit von der einsamen Tollerhöhe gelegen, ist einer von jenen Flecken, die auf einen Wanderer den Eindruck eines Landschaftsbildes machen, das dem Unzerstörbaren so nahe kommt wie kaum etwas anderes auf dieser Welt. Es handelte sich um einen unauffälligen Buckel aus Kalkstein und Erde – ein geläufiges Beispiel für jene glattgeschliffenen Aufwölbungen, die auch am Tag eines ganz großen Aufruhrs unberührt bleiben, wenn viel großartigere Gipfel und schwindelerregende Abgründe in sich zusammenstürzen.
Der Hügel war auf der Nordseite von einem alten, ziemlich verkommenen Buchenwald bedeckt, dessen oberer Rand über die Kuppe reichte und ihre Rundung gegen den Himmel wie mit einer Mähne säumte. In dieser Nacht schützten die Bäume den Südhang vor den heftigsten Windstößen, die gegen den Wald anfuhren, wie nörgelnd in ihm wühlten oder mit leiserem Seufzen über seine Wipfel fegten. Das dürre Laub im Graben brodelte und kochte unter dem Ansturm, und manchmal sog es ein paar Blätter heraus und wirbelte sie über das Gras. Einige wenige Spätlinge unter all dem Abgestorbenen, die noch bis in den Winter hinein an ihren Zweigen gehangen hatten, lösten sich nun und raspelten trocken gegen die Stämme.
Zwischen diesem halb bewaldeten, halb kahlen Hügel und dem verschwimmenden, stillen Horizont, der sich ohne scharfe Grenzen von der Kuppe aus eröffnete, gab es eine geheimnisvolle Zone von dichten Schatten – nur die Geräusche, die von dort kamen, ließen ahnen, daß sie ungefähr Ähnliches verbargen wie das Sichtbare hier. Die dünnen Gräser, die da und dort auf dem Hügel wuchsen, wurden vom Wind einmal heftiger, dann wieder sanfter bewegt, als seien es ganz verschiedene Winde: Der eine rieb sich an ihnen, ein anderer kämmte sie bis auf den Grund, ein dritter bürstete wie ein weicher Besen über sie hin. Das instinktive menschliche Verhalten war, stehenzubleiben und zu lauschen, wie die Bäume zur Rechten und zur Linken, wechselnd wie in den Antiphonen eines Kirchengesanges, klagten und einander riefen; wie die Büsche und anderen Gebilde im Windschatten hierauf die Melodie übernahmen und zu kaum hörbarem Schluchzen dämpften; und wie die weitereilenden Lüfte hierauf südwärts untertauchten, bis nichts mehr zu vernehmen war.
Der Himmel war klar – erstaunlich klar – und das Funkeln all der Sterne schien wie der Rhythmus eines einzigen Körpers, im Takt eines allumfassenden Pulsschlags. Der Polarstern war genau dort, wo der Wind herkam, und seit Einbruch der Dunkelheit hatte sich der Große Bär nach außen gegen Osten gedreht, bis er in rechtem Winkel zur Erdachse stand. Der Unterschied in den Farben der Sterne, von dem man in England mehr aus Büchern als aus Erfahrung weiß, war hier tatsächlich feststellbar. Das machtvolle Feuer des Sirius blendete das Auge mit stählernem Glitzern, Capella war gelb, Aldebaran und Beteigeuze leuchteten in glühendem Rot.
Für jemanden, der in solch einer klaren Mitternacht allein auf einem Hügel steht, wird die Rotation des Erdballs zu einem fast greifbaren Erlebnis. Vielleicht wird dieses Gefühl von dem Panorama der Sterne hervorgerufen, die über das Irdische wandern, vielleicht hängt es auch mit dem weiten Blick zusammen, der sich von einem Hügel aus bietet, mit dem Wind oder mit der Einsamkeit; der Eindruck, daß man dahingetragen wird, ist jedenfalls, was immer die Ursache sein mag, sehr lebendig und unabweislich. Man spricht gern vom Rausch der Geschwindigkeit: Um dieses Vergnügen in epischer Breite auszukosten, muß man zu fortgeschrittener Nachtstunde auf einem Hügel stehen, sich seiner Größe, abgesetzt von der Vielzahl der zivilisierten Menschheit, die eben jetzt in Träumen befangen liegt und diese Fülle an Geschehen versäumt, bewußt sein, sich lange und still dem majestätischen Ziehen durch die Sternenräume hingeben. Es ist schwer, nach so einer nächtlichen Erkundungsfahrt wieder zur Erde zurückzukehren und zu glauben, daß das Bewußtsein solch grandiosen Dahineilens aus einem winzigen Menschenkörper kommt.
Plötzlich war an diesem Ort, vor diesem Himmel, eine unerwartete Lautfolge zu vernehmen. Die Töne waren von einer Klarheit, wie sie der Wind nie hervorbringt, und in einer Sequenz, die es in der Natur nicht gibt. Sie stammte aus Farmer Oaks Flöte.
Die Melodie schwang sich nicht frei durch den Äther, sie hörte sich irgendwie gedämpft an und war überhaupt viel zu schwach, um die Weite zu füllen. Sie kam von einem kleinen, dunklen Objekt unter der Buchenhecke – von einer Schäferhütte, deren nun sichtbare Kontur einem nicht näher Vertrauten kaum etwas über ihren Sinn und Zweck verraten hätte.
Insgesamt erinnerte das Bild an eine kleine Arche auf einem kleinen Ararat, wenn man sich an den Umriß und Bau der Archen in den Spielzeugläden hält – solche Bilder sind ja den Menschen besonders dauerhaft, weil schon sehr früh eingeprägt – und dieses Muster als ungefähr zutreffend hinnimmt. Die Hütte stand auf kleinen Rädern, die ihren Boden etwa fußhoch über die Erde hoben. Solche Schäferhütten werden auf die Weide mitgeführt, wenn die Lammzeit beginnt, und bieten dem Schäfer, wenn er auch nachts zugegen sein muß, einen Unterstand.
Erst seit kurzem hieß Gabriel bei den Leuten ›Farmer‹ Oak. In den zwölf Monaten, die dieser Nacht vorangegangen waren, hatten ihn geduldiger Fleiß und ein nicht weniger beständiger Optimismus so weit gebracht, daß er eine kleine Schaffarm, zu der Norcombe Hill gehörte, pachten und mit zweihundert Schafen bestücken konnte. Vorher war er für eine kurze Zeit Verwalter gewesen, und noch weiter zurück einfach ein Schäfer, der von Kindheit an seinem Vater geholfen hatte, die Herden von Gutsherren zu hüten, bis der alte Gabriel ins Grab gesunken war.
Das Wagnis, ganz allein und ohne Hilfe als sein eigener Herr, nicht als Lohnempfänger, und mit einem noch nicht bezahlten Vorschuß an Schafen zu wirtschaften, gab seinem Leben eine schicksalhafte Wendung, und Gabriel war sich seiner Situation deutlich bewußt. Der erste Fortschritt in dieser neuen Richtung war das Lammen seiner Schafe, und da er sich von Jugend auf mit Schafen auskannte, hatte er sich gehütet, in diesen Tagen die Sorge um sie einem Mietling oder einem Grünschnabel anzuvertrauen.
Der Wind fuhr fort, an den Ecken der Hütte zu rütteln, aber das Flötenspiel verstummte. Ein helles Rechteck erschien in der Seitenwand der Hütte, und in der Öffnung zeigte sich die Gestalt von Farmer Oak. Er trug eine Laterne in der Hand, schloß die Türe hinter sich und war hierauf fast zwanzig Minuten lang in dieser Ecke des Feldes sehr beschäftigt; da und dort tauchte der Laternenschein auf und wieder unter, beleuchtete oder verdunkelte ihn je nach seinem Standort vor oder hinter der Lichtquelle.
Oaks Bewegungen waren von ruhigem Nachdruck, aber langsam, und ihre Überlegtheit paßte gut zu seinem Geschäft. Da Zweckmäßigkeit aller Schönheit zugrunde liegt, hätte niemand seinem stetigen Hin und Her, das wie ein Tanz mit der Herde war, eine gewisse Anmut absprechen können. Obwohl er, wenn es darauf ankam, so blitzartig rasch denken und handeln konnte wie irgendeiner aus der Stadt, dem dies eher angeboren ist, so war seine Stärke im Moralischen, Physischen und Geistigen doch eine statische, die von Anstößen im Grund wenig oder gar nicht abhing.
Sogar in dem ungewissen Mondlicht hätte man bei genauerer Umschau gemerkt, wie Farmer Oak einen Teil dessen, was man etwa als wildwüchsigen Hang bezeichnen konnte, in diesem Winter für seine hochfliegenden Pläne hergerichtet hatte. Verstreut an verschiedenen Stellen wuchsen strohgedeckte Hürden aus dem Boden, zwischen und unter denen sich die weißlichen Formen der braven Mutterschafe raschelnd bewegten. Die Glöckchen, die während seiner Abwesenheit geschwiegen hatten, begannen wieder zu läuten, wegen des rundum dichteren Wuchses der Wolle mehr gedämpft als hell. Dies dauerte so lange, bis sich Oak von der Herde zurückzog. Er ging zu der Hütte, in den Armen ein neugeborenes Lamm, das aus vier Beinen bestand, lang wie von einem ausgewachsenen Schaf, verbunden durch ein schrumpeliges Häutchen, an Substanz etwa die Hälfte der Beine, das fürs erste den ganzen Körper des Tiers darstellte.
Das Bündelchen Leben legte er auf eine Handvoll Heu vor den kleinen Ofen, auf dem eine Kanne mit Milch warmgestellt war. Oak blies in die Laterne und drückte den Docht aus. Seine Lagerstatt war von einer Kerze erhellt, die an einem zurechtgebogenen Draht hing. Ein ziemlich hartes Lager aus ein paar achtlos hingebreiteten Kornsäcken bedeckte zur Hälfte den Boden dieser kleinen Behausung, und auf ihm streckte sich der junge Mann aus, lockerte sein wollenes Halstuch und schloß die Augen. Etwa nach der Zeitspanne, die ein an körperliche Arbeit nicht gewöhnter Mensch für die Entscheidung braucht, auf welche Seite er sich drehen soll, schlief Farmer Oak bereits.
Das Innere der Hütte, wie es sich nun zeigte, war heimelig und einladend; neben der Kerze spiegelte auch das Häufchen roter Glut sein freundliches Licht, soweit es reichte, und selbst Gerät und Werkzeug schien sich darin wohl zu fühlen. In der Ecke lehnte der Schäferstock, und auf einem Bord an der einen Seite standen in Flaschen und Büchsen die einfachen Mittel, mit denen man Schafe verarztet: Weingeist, Terpentin, Teer, Magnesium, Ingwer und Kastoröl waren das Wichtigste. Übereck auf einem Wandbrett gab es Brot, Speck, Käse und einen Becher für das Bier oder den Apfelwein aus der Tonflasche darunter. Neben dem Proviant lag die Flöte, die vorhin dem einsamen Beobachter mit ihrer Melodie die Zeit vertrieben hatte. Belüftet wurde das Gehäuse durch zwei runde Löcher, wie Bullaugen einer Schiffskabine, denen man Bretter vorschieben konnte.
Das von der Wärme angeregte Lamm begann zu blöken, und dieser Laut wurde, wie das bei erwarteten Geräuschen üblich ist, sofort von Gabriels Ohr und Hirn aufgenommen und verstanden. Indem er mit derselben Leichtigkeit, die er im umgekehrten Ablauf bewiesen hatte, nun aus dem tiefen Schlaf zu hellwachem Bewußtsein zurückkehrte, blickte er auf seine Uhr, stellte fest, daß der Stundenzeiger wieder verrutscht war, nahm das Lamm auf die Arme und trug es in die Dunkelheit. Nachdem er das kleine Ding bei seiner Mutter abgesetzt hatte, blieb er noch stehen und schaute prüfend zum Himmel auf, um an dem Stand der Sterne die Zeit abzulesen.
Im Süden standen Hundsstern und Aldebaran auf halber Höhe und zeigten auf die flimmernden Pleiaden, und zwischen ihnen hing das Sternbild des Orion, das nie so lebhaft funkelt wie in dieser Stunde, da es sich über den Horizont aufschwingt. Kastor und Pollux mit ihrem stillen Leuchten standen fast im Zenit; das nüchtern-düstere Quadrat des Pegasus schob sich gegen Nordwesten; von fern durch den Wald glitzerte Wega wie eine Lampe, die in den entlaubten Bäumen hing, und der Thron der Kassiopeia stand schwerelos auf den höchsten Zweigen.
»Ein Uhr«, sagte Gabriel.
Da ihm nicht selten bewußt war, daß seine Art zu leben auch einen gewissen Zauber besaß, blieb er, nachdem er den Himmel als nützliches Instrument betrachtet hatte, noch stehen und überschaute ihn mit dem Wohlgefallen, das einem erlesenen Kunstwerk angemessen ist. Für einen Augenblick schien ihn die beredte Einsamkeit der Szenerie oder, genauer gesagt, ihr völliges Verleugnen von allem, was sie in Gestalt und Laut an Menschlichem einschloß, zu beeindrucken. Es war, als ob es keine Menschen mit ihren Formen, Beziehungen, Sorgen und Freuden – als ob es auf der im Schatten liegenden Hemisphäre kein fühlendes Wesen außer ihm gäbe. Als ob sie alle hinüber auf die Sonnenseite gegangen wären.
In solchen Gedanken, den Blick ins Weite gerichtet, erfaßte Gabriel dann doch, daß das Licht hinter den Ausläufern des Waldes in Wahrheit nicht der niedrige Stern war, für den er es gehalten hatte. Es war kein natürliches Licht, und es war ganz nahe.
Manche Menschen fürchten sich in der Nacht, wenn sie ganz allein sind und nicht die Gesellschaft haben, die sie herbeiwünschen und erwarten; trotzdem greift es die Nerven noch mehr an, wenn sich Instinkt, Gefühl, Erfahrung, Analogie, Erlerntes, Wahrscheinlichkeit und Logik – was immer dem Denken seine Sicherheit gibt – verbündet haben, um das Bewußtsein zu überzeugen, daß es von allem abgeschnitten ist, und dann plötzlich ein geheimnisvoller Schicksalsgefährte auftaucht.
Farmer Oak stieg zum Wald hinauf und zwängte sich durch das Unterholz auf der Windseite. Eine dunkle Masse erinnerte ihn daran, daß es hier einen Schuppen gab, der in den Hang so hineingebaut war, daß der hintere Teil des Dachs sich fast auf Bodenebene befand. Vorn bestand er aus Balken, die mit Brettern verkleidet und mit einem Schutzanstrich von Teer versehen waren. Durch Ritzen im Dach und in den Seitenwänden drang Licht in Punkten und Strichen und verbreitete die Helligkeit, die Oak angezogen hatte. Er trat zur Hinterfront, stützte sich auf das Dach und preßte ein Auge dicht an eine Lücke, so daß er den Raum überblicken konnte.
Drinnen waren zwei Frauen und zwei Kühe. Neben einer der letzteren stand ein Eimer, in dem ein Brei von Kleie dampfte. Eine der Frauen war über die mittleren Jahre hinaus. Ihre Gefährtin war offenbar jung und anmutig: Oak konnte ihr Aussehen nicht richtig beurteilen, weil sie sich fast unter seinem Auge befand und er sie daher so aus der Vogelschau sah, wie der Satan bei Milton zunächst das Paradies erblickt. Sie trug weder Haube noch Hut, hatte sich aber in einen langen Mantel gehüllt und diesen auch als Bedeckung über den Kopf geworfen.
»So – und jetzt nach Hause«, sagte die ältere der beiden, die Hände in die Hüften gestützt, und faßte mit einem Blick zusammen, was sie geleistet hatten. »Hoffentlich kommt die Daisy durch. Nie im Leben hat mich etwas so erschreckt, aber ich will gern noch einmal aufstehen, wenn sie sich erholt.«
Die junge Frau, deren Lider bei der leisesten Verführung durch die Stille zufallen würden, gähnte, ohne die Lippen allzuweit zu öffnen und steckte damit Gabriel an. Mitfühlend gähnte auch er.
»Ich würde uns so viel Geld wünschen, daß wir uns einen Mann für solche Sachen leisten könnten«, sagte sie.
»Weil wir es aber nicht haben, müssen wir es selber tun«, sagte die andere. »Wenn du hierbleibst, mußt du mithelfen.«
»Na, wenigstens der Hut ist weg«, fuhr die Jüngere fort. »Wahrscheinlich ist er über die Hecke geflogen. Zu dumm: So ein leichter Wind – und nimmt ihn mit …«
Die aufrecht stehende Kuh war ein Devon-Rind, mit einer glatten, warmen Haut von kräftigem Indianerrot, einheitlich getönt von den Augen bis zum Schwanz, als ob man das Tier in einen Farbbottich getaucht hätte, und ihr langer Rücken war wie mit dem Lineal gezogen. Die andere Kuh war grau und weiß gescheckt. Neben ihr bemerkte Oak nun ein Kälbchen, etwa einen Tag alt, dessen blöder, auf die zwei Frauen gerichteter Blick verriet, daß es an das Erlebnis des Sehens noch nicht gewöhnt war. Es wandte sich immer wieder zu der Laterne, die es offenbar, da seine ererbten Instinkte noch nicht durch Erfahrung korrigiert waren, für den Mond hielt. Bei den Schafen und Kühen von Norcombe Hill war sichtlich für die Zukunft vorgesorgt.
»Wir sollten uns Hafermehl kommen lassen«, sagte die ältere Frau. »Die Kleie ist aus.«
»Ja, Tante. Ich werde mit dem Pferd hinüberreiten, sobald es hell ist.«
»Aber wir haben keinen Damensattel.«
»Ich kann auch auf dem anderen sitzen. Keine Sorge!«
Oak, der diese Worte hörte, hätte gar zu gern ihr Gesicht gesehen, aber weil ihm das durch den Kapuzeneffekt des Mantels und seine luftige Position verwehrt wurde, mußte er es seiner Phantasie überlassen, das Fehlende zu ergänzen. Selbst bei Objekten, die uns klar vor der Nase stehen, färben und kneten wir ja den Augenschein nach unseren Bedürfnissen. Hätte Gabriel von vornherein freien Blick auf die junge Frau gehabt, so wäre sie von ihm als mehr oder weniger hübsch eingestuft worden, je nachdem, ob seine Seele im Augenblick nach einem Andachtsbild verlangte oder schon mit einem solchen ausgestattet war. Da es ihm aber seit längerem an einem Gegenstand gebrach, der eine zunehmende innere Leere ausgefüllt hätte, und sein Standort der Phantasie keine Grenzen setzte, malte er sich eine strahlende Schönheit aus.
Dank einem der launischen Zufälle, bei denen die Natur, wie eine geschäftige Mutter, scheinbar für eine Sekunde in ihrem rastlosen Tun einhält und ihre Kinder zum Lächeln bringt, ließ das Mädchen nun den Mantel fallen. Schwarzes Haar fiel in Locken über ein rotes Jäckchen. Oak erkannte sie sofort als die Pantomimin – die mit dem gelben Wagen, den Myrten und dem Spiegel; nüchterner ausgedrückt als die Frau, die ihm zwei Pennies schuldete.
Sie stellten das Kalb wieder neben seine Mutter, nahmen die Laterne und gingen hinaus. Das Licht sank immer weiter den Hügel hinab, bis es nur mehr ein Nebelfleck war. Gabriel Oak kehrte zu seiner Herde zurück.
III.Ein Mädchen hoch zu Roß – Man unterhält sich
Der träge Morgen graute. Da nun aber der Ort, wo etwas geschieht, schon darum von neuem wieder interessant wird, ging Oak aus keinem triftigeren Anlaß außer dem, daß sich dort das nächtliche Geschehen zugetragen hatte, wieder in den Wald. Als er da gedankenverloren stand, vernahm er vom Fuß des Hügels her den Hufschlag eines Pferdes, und bald darauf erschien in seinem Blickfeld ein rostrotes Pony, das auf seinem Rücken ein Mädchen trug und den Weg heraufkam, der an dem Kuhstall vorbeiführte. Es handelte sich um die junge Frau aus der vergangenen Nacht. Gabriel fiel sofort der Hut ein, von dem sie erwähnt hatte, daß sie ihn verloren habe. Vielleicht kam sie, um ihn zu suchen. Gabriel stöberte eilig in dem Graben, fand tatsächlich nach etwa zehn Yards den Hut im Laub, nahm ihn und begab sich zu seiner Hütte zurück. Dort schloß er sich ein, lugte aber durch das Bullauge in die Richtung, aus der die Reiterin kommen mußte.
Da war sie schon und blickte erst um sich, dann über die Hecke. Gabriel wollte sich schon aufmachen und ihr den Fund zurückerstatten, als ein unerwartetes Verhalten ihrerseits ihn bewog, das Vorhaben zunächst aufzuschieben.
Hinter dem Kuhstall lief der Weg quer durch das Wäldchen. Es war kein Reitweg, nur ein Fußpfad, und die in geringer Höhe darüber gebreiteten Äste machten es unmöglich, aufrecht unter ihnen hindurchzureiten. Das Mädchen, das keinen Reitrock trug, schaute sich einen Augenblick um, als ob es sich vergewissern wollte, daß niemand in Sicht war, und legte sich dann gewandt hintüber auf den Rücken des Pferdes, den Kopf über seinem Schweif, die Füße an seinen Schultern, die Augen himmelwärts. Rasch wie ein Eisvogel, lautlos wie ein Falke war es in diese Position geglitten. Gabriels Augen hatten kaum zu folgen vermocht. Das hochgewachsene, schlanke Pony schien an derlei gewöhnt und schritt unbeirrt weiter. So kam das Mädchen unter den Ästen durch.
Die Reiterin fühlte sich offensichtlich zwischen Kopf und Schwanz eines Pferdes wie zu Hause, und als nach dem Wäldchen der Grund für ihr außergewöhnliches Benehmen weggefallen war, wechselte sie in eine andere, noch eindeutiger bequeme Stellung. Sie hatte keinen Damensattel, und man erkannte unschwer, daß es für sie unmöglich war, seitwärts und zugleich fest auf dem glatten Leder zu sitzen. Indem sie nun wieder wie eine Gerte in die Senkrechte schnellte und sich noch einmal versicherte, daß niemand um die Wege war, setzte sie sich so in den Sattel, wie es sein Bau verlangte, allerdings kaum von weiblichen Wesen erwartet wurde, und trabte in Richtung der Mühle von Tewnell davon.
Belustigt und vielleicht auch etwas verblüfft hängte Oak den Hut in die Hütte und wandte sich wieder seinen Schafen zu. Eine Stunde verging, dann kehrte das Mädchen zurück, jetzt anständig im Damensitz und mit einem Sack Kleie vor sich. Als es sich dem Kuhstall näherte, kam ihm ein Junge mit einem Milcheimer entgegen und hielt den Zügel, während es aus dem Sattel glitt. Der Junge führte das Pferd weg und ließ den Eimer bei dem Mädchen.
Bald darauf drang in regelmäßigem Takt dumpfes und helleres Zischen aus dem Stall, das vertraute Geräusch des Melkens. Gabriel nahm den verlorenen Hut und stellte sich an dem Weg auf, den das Mädchen vom Hügel herunterkommen würde.
Da war sie schon, in der einen Hand den Eimer, der gegen ihr Knie hing. Der linke Arm, als Gegengewicht ausgestreckt, zeigte genug Blöße, um Oak wünschen zu lassen, daß es Sommer wäre und er ihn ganz ohne Hüllen sehen könnte. Sie kam so munter und frei daher, als wollte sie jeden Zweifel an ihrer Existenzberechtigung von vornherein ausschalten, und diese doch etwas kühne Anmaßung wirkte nicht einmal herausfordernd, weil man bei ihrem Anblick spürte, daß sie eigentlich recht hatte. Wie Pathos aus dem Mund eines Genies nur an Bedeutung steigert, was bei einem mittelmäßigen Künstler lächerlich erschienen wäre, so hob ihr Verhalten die schon offenbaren Qualitäten noch hervor. Sie war ein wenig überrascht, als sie Gabriels Gesicht wie einen Mond hinter der Hecke aufsteigen sah.
Als es nun an dem Farmer war, seine vage Vorstellung von ihren Reizen den Tatsachen anzugleichen, kam dabei nicht weniger, sondern eher etwas anderes heraus. Das fing bei ihrer Größe an. Sie machte einen Eindruck, als sei sie besonders hochgewachsen, aber der Eimer war klein und die Hecke sehr niedrig, und rechnete man ab, was beim Vergleich damit überschätzt wurde, so konnte sie nicht größer sein, als das von den Frauen festgelegte Idealmaß vorschreibt. Alle Züge, auf die es ankommt, waren bei ihr streng und ebenmäßig. Wer über Land reist und Augen für das Schöne hat, wird beobachtet haben, daß in England die Frauen mit klassischen Gesichtszügen selten auch eine entsprechende Figur besitzen, weil das Gesicht in seiner Vollkommenheit im Verhältnis zum übrigen Körper meist zu großflächig ist; wie andererseits eine anmutige, wohlproportionierte Figur von acht Kopfeslängen gewöhnlich in ein nichtssagendes Gesicht übergeht. Man soll aus einem Milchmädchen keine Göttin machen, hätte in diesem Fall aber doch zugeben müssen, daß jede Kritik unangebracht war, und sich darauf beschränkt, die gelungene Beziehung der Teile zum Ganzen eingehend und genießerisch zu betrachten. Der Umriß ließ auf einen schönen Hals und ebensolche Schultern schließen: Seit sie kein Kind mehr war aber hatte die niemand mehr gesehen. Hätte man sie in ein ausgeschnittenes Kleid gesteckt, sie wäre davongelaufen und kopfüber in einen Busch verschwunden. Dennoch war sie alles andere als schüchtern – nur daß sie instinktiv die Grenze zwischen dem, was man sehen, und dem, was man nicht sehen darf, höher ansetzte, als das in der Stadt üblich ist.
Daß auch die junge Frau an ihre Figur und ihr Gesicht dachte, als sie Oaks Blick darauf ruhen spürte, ist nur natürlich und mit Sicherheit anzunehmen. Ein wenig mehr Selbstbewußtsein wäre bereits Eitelkeit gewesen, ein wenig mehr Zurückhaltung hätte ihr Würde gegeben. Die Strahlung des männlichen Auges scheint in ländlichen Gegenden auf das jungfräuliche Gesicht wie ein Kitzel zu wirken: Sie strich mit der Hand über das ihre, als ob Gabriel die rosige Haut durch eine körperliche Berührung erregt hätte, und zugleich nahm sie die Freiheit ihrer Bewegungen zurück ins Schickliche. Trotzdem war es keineswegs das Mädchen, sondern der Mann, der errötete.
»Ich habe einen Hut gefunden«, sagte Oak.
»Er gehört mir.« Sie unterdrückte, weil es ihr schicklicher schien, den Wunsch, laut herauszulachen, und begnügte sich mit einem winzigen Lächeln. »Er ist mir letzte Nacht davongeflogen.«
»Um ein Uhr?«
»Ja – da war es« Sie war überrascht. »Woher wißt Ihr das?«
»Ich war hier.«
»Ihr seid der Farmer Oak, nicht wahr?«
»So ungefähr. Dieses Land habe ich noch nicht lange.«
»Eine große Farm?« fragte sie und schaute um sich. Sie warf das Haar, das im Schatten richtig schwarz war, aus der Stirn, und die Sonne, die nun schon seit einer Stunde am Himmel stand, ließ die Locken in den Farben ihrer Strahlen aufleuchten.
»Nein, nicht groß. Ungefähr hundert.« (Wenn von einer Farm die Rede ist, wird die Bezeichnung für das Flächenmaß von den Landleuten weggelassen, so wie man etwa bei Hirschen einen Zehnender auch einfach ›Zehner‹ nennt.)
»Ich habe den Hut heute früh gesucht«, fuhr sie fort. »Ich mußte nach Tewnell zur Mühle reiten.«
»Ja, das mußtet Ihr.«
»Woher wißt Ihr das?«
»Ich habe Euch gesehen.«
»Wo?« fragte sie, und ein bestimmter Verdacht ließ ihr Gesicht und Körper erstarren.
»Hier, auf dem Weg durch den Wald – und dann weiter den Hügel hinunter«, sagte Farmer Oak mit einer Miene, als wisse er sehr genau, woran er eben dachte, schaute dabei auf einen fernen Punkt in der angegebenen Richtung und kehrte sich hierauf wieder seinem Gegenüber zu, um ihm in die Augen zu blicken.
Was er sah, ließ ihn das Gesicht so plötzlich wieder abwenden, als habe man ihn bei etwas Verbotenem ertappt.
Bei der Erinnerung an die seltsamen Eskapaden unter den Bäumen schlug zunächst dem Mädchen das Herz rascher, dann wurden seine Wangen heiß. Es war eine gute Gelegenheit, eine Frau erröten zu sehen, die sonst nicht dazu neigte. Bis unter das Haar war das Milchmädchen purpurn erblüht wie eine Rose, alle Schattierungen der Züchter durcheilend. Worauf Gabriel so rücksichtsvoll war, den Blick abzuwenden.
Noch schaute der mitfühlende Mann anderswohin und überlegte, wann sie sich so weit erholt haben würde, daß er sich ihr zukehren durfte. Er vernahm ein Geräusch wie von einem dürren Blatt, das der Wind davonträgt, und sah auf. Sie war fort.
Mit einer Miene, die sich zwischen Lachen und Weinen hielt, machte sich Gabriel wieder an seine Arbeit.
Fünf Tage und Abende gingen dahin. Die junge Frau kam regelmäßig, um die gesunde Kuh zu melken und die kranke zu betreuen, gestattete es ihrem Blick aber nie, zu Farmer Oak hin abzuschweifen. Sein Mangel an Takt hatte sie tief gekränkt; nicht weil er etwas gesehen hatte, was er nicht umhinkonnte zu sehen, sondern weil er es sie hatte wissen lassen. Ohne Gebot gibt es keine Sünde, ohne Zeugen nichts Unziemliches. Sie schien zu finden, daß Gabriel sie durch sein Schauen, ohne daß sie etwas dazugetan, zu einer Frau gemacht hatte, die nicht weiß, was sich schickt. In ihm nährte dies bittere Reue; und zugleich war es ein Mißgeschick, das eine verborgene Inbrunst erst anfachte, die er in dieser Beziehung hegte.
Trotzdem hätte die Bekanntschaft in allmählichem Vergessen versiegen können, wenn nicht am Ende dieser Woche ein weiteres Ereignis eingetreten wäre. Eines Nachmittags fiel Frost ein, der gegen Abend immer schärfer wurde, wie Schnüre, die langsam zusammengezogen werden. Es war die Zeit, zu der in den Bauernkaten der Atem der Schläfer an den Laken gefriert und hinter den dicken Mauern der Herrenhäuser den Gästen der Rücken kalt wird, während das Kaminfeuer die Gesichter glühen läßt. Manch Vögelchen im kahlen Geäst wiegte sich an jenem Abend mit leerem Magen in den Schlaf.
Als die Zeit des Melkens heranrückte, schaute Oak wie immer zu dem Kuhstall hinüber. Schließlich wurde ihm aber kalt, er schüttete den trächtigen Schafen noch eine Schicht von wärmendem Stroh auf, ging in die Hütte und heizte den Ofen nach. Der Wind kam unter der Türe herein. Um ihn abzuhalten, legte Oak einen Sack hin und wendete die Hütte etwas weiter gegen Süden, aber da fauchte es nun durch eines der beiden Luftlöcher herein, die in die Seiten eingeschnitten waren.
Gabriel wußte natürlich, daß immer ein Luftloch – und zwar das an der windgeschützten Seite – offenbleiben muß, wenn die Tür zu ist und der Ofen brennt. Als er das windseitige Luftloch geschlossen hatte, wandte er sich um und wollte das andere öffnen. Dann beschloß er aber doch, sich zuerst einmal hinzusetzen und beide Löcher für ein paar Minuten geschlossen zu halten, bis die Temperatur in der Hütte ein wenig angestiegen wäre. Also setzte er sich hin.
Sein Kopf begann auf ungewohnte Weise zu schmerzen, und da er vermutete, daß er nach den vergangenen Nächten, in denen sein Schlaf oft unterbrochen worden war, nun einfach müde sei, wollte Oak aufstehen, das Luftloch öffnen und sich dann eine Ruhepause gestatten. Er schlief jedoch ein, ohne die notwendige Vorbereitung getroffen zu haben.
Nie erfuhr Gabriel, wie lange er bewußtlos dagelegen hatte. Als er wieder zu Sinnen kam, schien ihm zunächst, daß etwas Merkwürdiges vorging. Sein Hund heulte, sein Kopf schmerzte fürchterlich – jemand schleifte ihn herum, Hände lösten ihm das Halstuch.
Als er die Augen aufschlug, stellte er fest, daß die Abenddämmerung ganz unerwartet fortgeschritten war. Das Mädchen mit den so anziehenden Lippen und weißen Zähnen befand sich an seiner Seite – und mehr noch, erstaunlich mehr: Sein Kopf lag in ihrem Schoß, sein Gesicht und sein Nacken waren unangenehm feucht, und ihre Finger knöpften seinen Kragen auf.
»Was ist denn los?« fragte Oak lallend.
Die Frage schien sie zu erheitern, aber nicht so sehr, daß sie an ihrer Situation besonderes Vergnügen empfunden hätte.
»Nichts mehr«, erwiderte sie, »da Ihr nicht tot seid. Es ist ein Wunder, daß Ihr in dieser Hütte nicht erstickt seid.«
»Ah, die Hütte!« murmelte Gabriel. »Zehn Pfund habe ich dafür bezahlt. Aber die verkaufe ich jetzt und setze mich unter ein Strohdach, wie sie es früher getan haben, und zum Schlafen rolle ich mich auf eine Strohschütte. Schon einmal ist mir das um ein Haar passiert!« Gabriel unterstrich seine Worte, indem er mit der Faust auf den Boden schlug.
»An der Hütte liegt es eigentlich nicht«, stellte das Mädchen in einem Ton fest, der es als eines dieser neuartigen weiblichen Phänomene auswies, die einen Gedanken zu Ende denken, bevor sie mit dem Satz beginnen, der ihn mitteilen will. »Ihr hättet Euer Hirn anstrengen sollen. So etwas Dummes: Die Luftlöcher verstopft lassen!«
»Ja, das war’s vermutlich«, gab Oak geistesabwesend zu. Er bemühte sich, mit dem Gefühl zurechtzukommen, daß er so mit ihr beisammen war, mit seinem Kopf auf ihrem Kleid, bevor das Gegenwärtige von dem Vergangenen aufgesogen wurde. Er hätte gewünscht, daß sie wüßte, was in ihm vorging, aber es wäre nicht schwieriger gewesen, einen Duft mit einem Netz einzufangen, als zu versuchen, so unartikulierte Empfindungen in die groben Maschen der Worte zu fassen. Er blieb daher stumm.
Sie half ihm beim Aufsetzen. Oak wischte sein Gesicht trocken und schüttelte sich. »Wie kann ich Euch danken?« erkundigte er sich schließlich, nachdem etwas von seiner natürlichen Bräune und Röte in sein Gesicht zurückgekehrt war.
»Oh, keine Ursache«, entgegnete das Mädchen mit einem Lächeln, das auch gleich für Gabriels nächste Äußerung galt, was immer er sagen mochte.
»Wie habt Ihr mich gefunden?«
»Ich bin zum Melken gekommen, und da habe ich gehört, wie Euer Hund geheult und an der Hüttentür gekratzt hat. Ein Glück, denn die Daisy hat jetzt bald keine Milch mehr, und nach der nächsten oder übernächsten Woche werde ich nicht mehr herkommen. Der Hund hat mich gesehen, er ist zu mir gesprungen und hat mich am Rock gepackt. Da bin ich herübergekommen und erst einmal um die Hütte herumgegangen, um zu schauen, ob die Luken verlegt sind. Mein Onkel hat so eine Hütte, und ich habe ihn zu seinem Schäfer sagen gehört, daß er nicht einschlafen darf, ohne eine Luke offenzulassen. Dann habe ich die Tür aufgemacht, und Ihr seid dagelegen wie ein Toter. Ich habe Euch mit Milch angeschüttet, weil kein Wasser da war und ich nicht daran dachte, daß das keinen Sinn hat, weil die Milch warm ist.«
»Vielleicht wäre ich gestorben«, sagte Gabriel, mehr zu sich selbst als zu ihr.
»O nein!« widersprach sie. Derart Tragisches schien ihr nicht zu behagen: Wenn man einen Menschen vom Tod errettet hat, muß das, was es zu sagen gibt, auf die Bedeutung der Tat abgestimmt werden – und davor scheute sie zurück.
»Ich vermute, Ihr habt mir das Leben gerettet, Miss – Ich kenne nur den Namen Eurer Tante – Wie heißt Ihr?«
»Das werde ich Euch nicht sagen – lieber nicht. Ich sehe keinen Grund dafür, denn in Zukunft werde ich Euch kaum mehr begegnen.«
»Trotzdem wüßte ich es gern.«
»Ihr könnt Euch bei meiner Tante erkundigen – sie wird es Euch sagen.«
»Ich heiße Gabriel Oak.«
»Ich nicht. So bestimmt, wie Ihr Euren Namen aussprecht, scheint er Euch sehr zu gefallen, Gabriel Oak.«
»Es ist der einzige, den ich habe. Damit muß ich mich abfinden.«
»Ich habe meinen nie leiden können. Er hört sich komisch an.«
»Vielleicht werdet Ihr bald einen anderen haben.«
»Gott behüte! Was Ihr Euch alles über andere Leute zusammenreimt, Gabriel Oak!«
»Nein, Miss – verzeiht, ich dachte, Ihr hättet vielleicht nichts dagegen. Aber mir ist schon klar, daß ich gegen Euch nicht aufkomme, wenn ich zu sagen versuche, was mir auf der Zunge liegt. Ich war nie sehr klug im Kopf. Aber ich danke Euch. Bitte – gebt mir Eure Hand!«
Sie zögerte, ein wenig verwirrt von dem altväterischen Ernst, mit dem Oak eine so lockere Unterhaltung beschloß. »Gut«, sagte sie endlich und gab ihm ihre Hand. Die zusammengepreßten Lippen drückten aus, daß es nichts zu bedeuten habe.
Er hielt die Hand nur einen Augenblick lang. Aus Furcht, seine Gefühle zu zeigen, tat er das Gegenteil und berührte ihre Finger nur ganz leicht, als mangle es ihm an Selbstvertrauen.
»Tut mir leid«, sagte er gleich darauf.
»Was?«
»Daß ich Eure Hand nicht länger gehalten habe.«
»Ihr dürft sie noch einmal haben: Da –« Sie reichte ihm die Hand ein zweites Mal. Oak hielt sie diesmal länger – auffällig lange sogar. »Wie weich sie ist – und jetzt im Winter. Gar nicht aufgesprungen oder rauh.«
»Nun – das reicht jetzt«, sagte das Mädchen, ohne ihm die Hand zu entziehen. »Aber ich nehme an, daß Ihr sie küssen wollt? Ich erlaube es Euch.«
»Daran habe ich überhaupt nicht gedacht«, gestand Gabriel schlicht. »Aber ich werde gern –«
»Nein, das werdet Ihr nicht!« Sie nahm ihre Hand zurück. Gabriel begriff, daß er schon wieder taktlos gewesen war.
»Und jetzt könnt Ihr herausfinden, wie ich heiße«, sagte sie mit leichtem Spott und ging.
IV.Gabriels Entschluß – Der Besuch – Der Irrtum
Überlegenheit an einer Frau ist für das andere Geschlecht in der Regel nur dann erträglich, wenn sie unbewußt bleibt. Dennoch geschieht es, daß eine solche Überlegenheit dem Mann, der sich gern einfangen lassen möchte, nicht unerwünscht kommt.
Dieses wohlgeartete und hübsche Mädchen begann im Gefühlsleben des jungen Farmers Oak alsbald eine bemerkenswerte Rolle zu spielen.
Liebe ist wahrhaftig der schlimmste Wucher: Wer sein Herz gegen ein anderes hingibt, wie das im Fall einer reinen Leidenschaft geschieht, hofft auf unverhältnismäßigen Profit für seine Seele; auf niedrigerer Ebene ist es der Gewinn an körperlicher Lust oder materiellem Besitz. Jeden Morgen kalkulierte Oak seine Chancen, als handle es sich um den Stand einer Aktie. Die Ähnlichkeit zwischen Oaks Hund, der auf sein Fressen, und Oak selbst, der auf das Mädchen wartete, war so auffällig, daß der Farmer sie als peinlich empfand und den Hund nicht anschaute. Dennoch spähte er jedesmal wieder durch die Hecke, bis sie zur Stunde erschien, und so vertieften sich seine Gefühle für sie, ohne daß auf ihrer Seite etwas Vergleichbares stattgefunden hätte. Noch hatte sich Oak nicht zurechtgelegt, was er sagen wollte, und da er auch nicht fähig war, Liebesschwüre zu erfinden, bei denen sich das Ende auf den Anfang reimt – nichts Aufwühlendes
»voll Lärm und Raserei, was nichts bedeutet« –,
sagte er gar nichts.
Seine Nachforschungen ergaben, daß das Mädchen Bathsheba Everdene hieß und ihre Kuh noch etwa eine Woche lang Milch hatte. Ihm graute vor dem achten Tag.
Der achte Tag traf schließlich ein. Nun gab die Kuh in diesem Jahr keine Milch mehr, und Bathsheba Everdene kam nicht mehr auf den Hügel. Gabriel befand sich auf einem Tiefpunkt, wie er vor kurzem für ihn kaum vorstellbar gewesen wäre. Er pfiff nicht mehr, sondern fand Genuß daran, »Bathsheba« vor sich hin zu sagen, fand plötzlich Geschmack an schwarzem Haar, obwohl er schon als Junge für Braun geschwärmt hatte, und zog sich so in sich zurück, daß der Raum, den er im Bewußtsein anderer Menschen einnahm, nicht mehr der Rede wert war. Die Liebe ist stark im Bereich des Möglichen, in der Wirklichkeit macht sie schwach; die Ehe hingegen verwandelt die Einbuße in Zugewinn, dessen Umfang in unmittelbarem Verhältnis zu dem Stellenwert der Blödigkeit stehen soll – und das zum Glück oft auch tut –, die er ersetzt. Oak sah nun einen Ausweg in diese Richtung und sprach zu sich: »Entweder ich mache sie zu meiner Frau, oder ich tauge zu überhaupt nichts mehr!«
Inzwischen zerbrach er sich den Kopf über irgendeinen triftigen Anlaß, um bei Bathshebas Tante anzuklopfen.
Den Vorwand verschaffte ihm endlich der Tod eines Mutterschafs, das ein gesundes Lamm zurückließ. An einem Tag, der sich sommerlich gab, aber durch und durch Winter war – ein schöner Januarmorgen mit genug Blau am Himmel, um frohgestimmte Menschen mehr davon verlangen zu lassen, bei zeitweiligem Aufleuchten von silbrigem Sonnenschein –, legte Oak das Lamm in einen makellosen Sonntagskorb und stapfte über die Felder zum Haus von Mrs. Hurst, der Tante. George, der Hund, lief hinterher mit einer Miene, in der sich seine Besorgnis über die riskante Wendung ausdrückte, welche die Schäferei zu nehmen schien.
Der blaue Holzrauch, der aus dem Schornstein kräuselte, hatte Gabriel seltsam angeregt. Abends hatte er ihn in seiner Phantasie zu seinem Ursprung hinab verfolgt, den Herd vor sich gesehen – und daneben Bathsheba. Sie war zum Ausgehen gekleidet, denn Gabriels Zuneigung machte die Kleider, die sie auf dem Hügel getragen hatte, zu einem Bestandteil ihrer Person; sie waren in der Frühzeit seiner Liebe ein notwendiger Bestandteil des begehrenswerten Ganzen, das sich Bathsheba Everdene nannte.
Gabriel hatte sich fein herausgeputzt – ein Kompromiß zwischen adretter Sorgfalt und dekorativer Nachlässigkeit, halbwegs zwischen sonnigem Markttag und verregnetem Sonntag. Er reinigte gründlich die silberne Uhrkette mit Kreidepulver, zog den Schuhen frische Senkel in die Löcher, deren Messingränder er poliert hatte, und drang bis in das Herz des Wäldchens vor, um sich einen neuen Spazierstock zu schneiden, den er auf dem Rückweg heftig zurechtschnitzte, holte vom Grund der Kleidertruhe ein frisches Taschentuch, zog die leichte, mit den Ranken einer eleganten, die Vorzüge von Rose und Lilie ohne deren Mängel vereinigenden Blume gemusterte Weste an und verwandte alle Pomade, die er besaß, auf sein sonst trockenes, sandfarbenes und unentwirrbar krauses Haar, bis es eine ganz neue, prächtige Tönung hatte, irgendwo zwischen Guano und Mörtel, und an seinem Kopf klebte, wie die Brotkrumen an einem Schnitzel oder Tang an einem Felsklotz bei Ebbe.
Nur das Tschilpen von ein paar Spatzen auf der Dachtraufe störte die Stille um das kleine Haus, und man konnte sich dabei vorstellen, daß es der Gesellschaft auf dem Dach genau so wie unter diesem vor allem um Skandal und Tratsch ging. Es schien kein gutes Omen, und als ein recht unzeitiges Vorspiel zu seinem Auftritt bemerkte Oak, als er eben beim Gartengatter anlangte, wie dahinter eine Katze beim Anblick des Hundes George sich feindselig buckelte und die Haare sträubte. George achtete nicht darauf; er hatte das abgebrühte Alter erreicht, in dem man jedes überflüssige Gebell als Atemverschwendung vermeidet – auch die Schafe verbellte er nur auf Befehl und tat es dann mit so völlig distanziertem Ausdruck wie der Übermittler eines Bannstrahls, der hin und wieder nicht anders kann, als der Herde zu ihrem eigenen Wohl einen Schrecken einzujagen.
Hinter einigen Lorbeerbüschen, in die sich die Katze geflüchtet hatte, drang eine Stimme hervor:
»Arme Kleine! Hat dich so ein widerliches Hundetier fressen wollen? So eine arme Kleine!«
»Ich bitte um Vergebung«, widersprach Oak der Stimme, »aber George ist wirklich wie ein Lämmchen hinter mir hergegangen.«
Der Satz war kaum zu Ende, als Oak ein Zweifel hinsichtlich der Person überkam, der seine Antwort gegolten hatte. Niemand zeigte sich, und er hörte, wie sich die Betreffende zwischen den Büschen zurückzog.
Gabriel überlegte, und er tat es so angestrengt, daß ihm die Mühe des Denkens die Stirn furchte. Wenn das Ergebnis einer Verhandlung ebenso leicht einen Wandel zum Schlimmeren wie zum Besseren bringen kann, wirkt alles Unvorhergesehene sich in lähmender Furcht vor einem Mißerfolg aus. Ein wenig geknickt näherte sich Gabriel der Haustür: Die Voraussetzungen, welche die Wirklichkeit soeben geschaffen hatte, waren ganz andere als die, auf welche hin er sich vorbereitet hatte.
Bathshebas Tante war im Haus. »Könntet Ihr Miss Everdene wissen lassen, daß jemand da ist, der gern mit ihr sprechen würde?« begann Mr. Oak. (Auf dem Land ist es kein Beweis für mangelnde Kinderstube, wenn man sich selbst als einen Jemand bezeichnet; es kommt vielmehr aus einer feinfühligen Bescheidenheit, von der das Stadtvolk, das seine Visitenkarten abgibt und sich anmelden läßt, keine Ahnung hat.)
Bathsheba war nicht zugegen. Die Stimme hatte offenbar ihr gehört.
»Wollt Ihr hereinkommen, Mr. Oak?«
»O danke«, sagte Gabriel und folgte der Tante zum Kamin. »Ich habe ein Lamm für Miss Everdene gebracht. Ich habe mir gedacht, daß sie es vielleicht aufziehen möchte. Mädchen tun das gern.«
»Mag sein«, erwog Mrs. Hurst. »Obwohl sie hier nur zu Gast ist. Wenn Ihr ein bißchen warten wollt, wird Bathsheba gleich da sein.«
»Ja, ich werde auf sie warten«, sagte Gabriel und setzte sich. »Das Lamm ist aber nicht der wirkliche Grund, weshalb ich gekommen bin. Um es kurz zu machen: Ich wollte sie fragen, ob sie nicht heiraten möchte.«
»Tatsächlich?«
»Ja. Wenn sie es nämlich möchte, würde gern ich es sein, der sie heiratet. Wißt Ihr, ob es auch noch andere junge Männer gibt, die hinter ihr her sind?«
»Laßt mich nachdenken«, sagte Mrs. Hurst und stocherte im Feuer, obwohl kein Anlaß zum Schüren vorlag. »Ja, natürlich – eine ganze Menge. Ihr versteht ja, Farmer Oak, wie das bei einem so hübschen Mädchen ist, – sehr gebildet ist sie auch … Sie hätte einmal Erzieherin werden sollen, wißt Ihr, nur daß sie zu ungebärdig dafür war … Nicht daß die jungen Leute hierher kommen würden, aber – gütiger Himmel! – wie es halt bei einer Frau ist, muß sie wohl ein Dutzend haben.«
»Das ist schlimm«, fand Farmer Oak und blickte betrübt auf einen Sprung in den Steinfliesen. »Ich bin nichts Besonderes und hätte nur eine Chance gehabt, wenn ich der Erste gewesen wäre … Nun, da muß ich nicht länger warten, denn das war alles, weshalb ich gekommen bin. So ziehe ich eben wieder ab, Mrs. Hurst –«
Als Gabriel etwa zweihundert Meter am Rand der Hochfläche gegangen war, hörte er, wie jemand hinter ihm »Hoi! Hoi!« rief – und das in einer höheren Tonlage, als man diesen Ruf sonst auf den Feldern zu hören gewohnt ist. Er schaute sich um und sah ein Mädchen, das ihm nachlief und ein weißes Taschentuch schwenkte.
Oak blieb stehen. Die Gestalt kam näher. Es war Bathsheba Everdene. Gabriels Gesicht rötete sich; das ihre war es schon – anscheinend aber nicht vor Aufregung, sondern vom Laufen.
»Farmer Oak – ich –« sagte sie und legte eine Atempause ein. Sie stellte sich vor ihm auf, das Gesicht verzogen, und stemmte eine Hand in die Seite.
»Ich habe Euch eben besuchen wollen«, sagte Gabriel, bevor sie zu Wort kam.
»Ja – das weiß ich«, keuchte sie. Ihr Herz schlug wie bei einem kleinen Vogel, Schweiß stand auf der erhitzten Stirn wie der Tau auf einem Pfingstrosenblatt, bevor es die Sonne trocknet. »Ich habe nicht gewußt, daß Ihr um meine Hand bitten wolltet, sonst wäre ich sofort aus dem Garten ins Haus gekommen. Ich bin Euch nachgelaufen, um Euch zu sagen – daß meine Tante nicht recht getan hat, als sie Euch fortschickte.«
Gabriel lebte auf. »Es tut mir leid, daß Ihr meinetwegen so rasch laufen mußtet«, sagte er und bereitete sich darauf vor, dankbar entgegenzunehmen, was ihm in den Schoß fallen wollte. »Wartet noch, bis Ihr wieder bei Atem seid.«
»Es war einfach falsch – wenn die Tante behauptet hat, daß ich schon einen Verehrer habe«, fuhr Bathsheba fort. »Ich habe keinen, mit dem ich gehe – und ich habe auch nie einen gehabt. Und da – wie es heutzutage schon mit uns Frauen steht – habe ich mir gedacht, daß es doch zu dumm wäre, wenn Ihr geht und glaubt, ich hätte gleich mehrere.«
»Oh, das ist aber wirklich eine gute Nachricht!« rief Oak. Er lächelte auf seine besondere Art und wurde rot vor Freude. Die Hand, die sie in die Seite gepreßt hatte, lag nun anmutig auf ihrem Busen, um das heftig pochende Herz zu beruhigen, und er streckte die seine nach ihr aus. Aber kaum hatte er ihre Hand gefaßt, da entschlüpfte sie seinen Fingern wie ein Aal und verbarg sich hinter Bathshebas Rücken.
»Ich habe eine hübsche kleine Farm«, sagte Gabriel, schon nicht mehr ganz so sicher.
»Ja, die habt Ihr.«