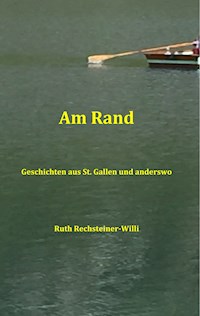
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Geschichten entdeckt sie überall. Auf langen Spaziergängen und wenn sie durch die Gassen ihrer Heimatstadt schlendert. Geschichten schlummern in den Tiefen ihrer eigenen Phantasie und warten nur darauf, aufgeschrieben zu werden. Geschichten zu hören, zu lesen, zu erzählen - und besonders, sie zu schreiben entwickelte sich im Laufe ihres Lebens zu einer Leidenschaft. Sie fühlt sich ein in ihre Protagonisten und oft sind es keine leichten Geschichten. Sie erzählt vom Leben der einfachen, gebeutelten Menschen und verknüpft sie mit ihren eigenen Gedanken.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 221
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ich widme meine Geschichten jenen Menschen, deren persönliche Geschichte niemand wahrnimmt.
Inhalt
Vorwort
Geschichten aus St. Gallen
Ein Tag in der Stadt
Reife Pflaumen
Verborgene Hausgeschichten
Gallus und die Jungfrau Maria
Anja verändert sich
Familientreffen
Die Kräuterfrau verbreitet Düfte
Patrick
Unfug
Die heilige Pflicht
Im Treuacker
Farben und Fabrikarbeiterinnen
Nachruf auf tausend Schuhe
Flora gab es schon immer
Einladung zum Tee
Dreissig Jahre
Die neue Stimme Afrikas
Nachspiel
Hausorchester im Tropenhaus
Am Rand
Begegnungen von Ausserhalb
Das Unfassbare gärt im Untergrund
Feierabendgespräch
Ein neuer Anfang
Das volle Leben
Ausgesetzt
Eiszeit
Silvias Bratpfanne
Blech und Leder
Feuerwerk
Haltlos
Das Böse lauert
Ein Wolkenturm ist kein Trugschluss
Licht- und Windträume
Eine banale Geschichte
Gefährliche Hügel
Seltsame Begegnung
Geschichten unterwegs
Was auf der Strecke bleibt
Ersatzzug
Gefangen in der Vergangenheit
Baustelle
Der Blick übers Ganze
Auf dem Weg nach Rapperswil
Zum Beispiel Edi
Lautlos schweben
Geschichten von Schnee
Ein Ball aus Schnee
Nie mehr Weihnachten
Geldflüsse
Mache dich auf
Elefanten an Weihnachten
Zu spät fürs Leben
Aufbruch im Schnee
Zehn Mal Heiligabend
Weihnächtliche Begegnung
Vorwort
Meine Augen schauen ins Weite des Sees. Ins Weite gehen die Gedanken und bleiben hängen an Geschichten. Unzählige Geschichten geschehen jeden Tag. Auf kurzen Wegen schon lauern sie am Rand und bleiben Randgeschichten, werden selten aufgeschrieben. Sind sie deshalb weniger wichtig?
Wenn sich zwei begegnen, beginnt eine kleine Geschichte mit den beiden Menschen. Sie nehmen einander wahr, erzählen einander oder auch nicht. Auch dann geschieht etwas, wenn scheinbar nichts geschieht. In der Begegnung sind Geschichten verborgen.
So entstehen meine Geschichten. Ich pflücke sie am Weg, nehme Menschen wahr, erlausche ihre Geschichte und vielleicht verbindet sie uns. Geschichten fliegen mir zu als Idee. Das Privileg von Autoren und Autorinnen ist, das Leben neu zu erfinden, so wie es auch hätte sein können.
Viele Geschichten entstanden nach Begegnungen mit Menschen in meiner Heimatstadt St. Gallen. Da bin ich schliesslich am häufigsten. Geschichten von Menschen, die ich kaum kenne, aber auch von solchen, die mir vertraut sind.
Andere Geschichten wurden mir eingeflüstert auf Bahnreisen, wenn im Rhythmus des fahrenden Zuges Geschichten Gestalt angenommen haben.
Manche Geschichten drängten sich auf weiten Reisen auf oder manifestierten sich im unerschöpflichen Quell meiner Phantasie. Wahr sind sie alle, auch wenn sie nicht tatsächlich so geschehen sind. Wahr bedeutet authentisch sein. In diesem Sinn sind sie wahr, weil sie alle in irgendeiner Weise mit mir zu tun haben. 53 Geschichten haben ihren Platz gefunden in diesem Buch; eine für jede Woche des Jahres.
So vielfältig wie Begegnungen sind, so vielfältig sind auch die Geschichten in diesem Buch. Begegnungen wird es auch geben mit dir und Ihnen, die dieses Buch lesen. Ich freue mich darauf!
Ruth Rechsteiner
Geschichten aus St. Gallen
Ein Tag in der Stadt
Dieser Augenblick bevor sie sich wirklich aus den Augen verloren, ein Erkennen von Gemeinsamem. Das Staunen über die Blume. Kennen sie den Namen? Beide schüttelten den Kopf. Es war auch ohne Belang, wie sie hiess. Aber dass sie betrachtet wurde, das machte sie gross. Ein Augenblick. Und im einen Augenblick dieses Gefühl des Erkennens. Und schon vorbei.
Bestand das Leben vielleicht aus lauter solchen Augenblicken des staunenden Erkennens? Und wenn dieses Erkennen geteilt wurde, aus der Erfahrung geteilten Lebens? Sie ging ihren Weg durch die vertraute Stadt. Blumen gab es keine mehr. Der Lärm störte sie und die vielen Menschen holten sie aus den staunenden Gedanken. Sie überquerte die Strasse, näherte sich dem Hotel, in dem sie zwei Tage wohnen würde.
Auch damals waren die Blumen blau und winzig gewesen. Das kleine Mädchen hatte selbstvergessen gestaunt. Seine Beinchen waren kurz, der Weg zum Waldrand darum lang. Aber es wollte ihn bewältigen. Zum ersten Mal allein, nicht an der Hand der Mutter, des Vaters, ganz damit beschäftigt, einen Fuss vor den anderen zu setzen und dabei das Gleichgewicht zu halten. Bis es vom Schwerpunkt ihres Windelpaketes auf den Blumenteppich in Blau plumpste. Da sass es nun, das kleine Mädchen. Zum ersten Mal allein und fern von beobachtenden Augen. Es zupfte an den winzigen Blümchen, nahm eines in den Mund, verzog das Gesicht. Es schmeckte nach nichts Vertrautem. Seine Händchen streichelten über die winzigen Blütenblätter. Laute des Wohlbehagens.
Damals nahm das staunende Betrachten von blauen Blüten ein abruptes Ende – erinnerte sie sich. Die Bilder von Blau verflüchtigten sich. Das kleine Mädchen wurde gefunden, ausgeschimpft vom Vater, der es voller Angst gesucht hatte. Die frühe Freiheit war vorbei. Wieder galt es, die Welt an der Hand des Vaters, der Mutter zu entdecken – und nicht allein auf wackligen Beinen.
Der Aufenthalt in der vertrauten Stadt könnte auch zu einer Entdeckungsreise werden – einfach loslaufen, entdecken, was man nicht mehr kannte? Ihr Leben war wohlgeordnet. Abgesichert. Überschaubar und in festen Bahnen. Sie wusste was zu tun war – und auch, was nicht. Loslaufen? Entdecken, was es allenfalls zu entdecken gab? Den Teppich aus blauen Blüten wieder finden? Der Gedanke hatte etwas Verlockendes und Erschreckendes. Man wusste ja nie, wie das ausgehen könnte. Ins Nichts schweiften ihre Augen und blieben dann hängen an der weissen Zimmerdecke. Die Schatten waren wie Figuren aus einer anderen Welt. Und lockten. Wohin? Sie nahmen Konturen an, bewegten sich in einem wilden Tanz. Sie wollte Teil dieses Tanzes sein – doch noch lag sie starr auf dem Bett. Die Erinnerung an die Begegnung vom Morgen liess sie nicht los. Es lag etwas Vertrautes im Ausdruck des Gesichtes jenes Mannes.
Später hatte das kleine Mädchen dann und wann Entdeckungsreisen gemacht. Oft nur in ihrem kleinen Zimmer. Das war auch von Kobolden bevölkert gewesen, Wichteln, Heinzelmännchen und schrecklichen Waldschratten, von denen ihr Vater jeweils vor dem Ins-Bett-gehen erzählt hatte. Diese Entdeckungsreisen waren ungefährlich und grenzenlos. Niemand hinderte es daran, sich in den Fantasiewelten zu tummeln. In seiner Welt war alles möglich und so lernte es immer neue Schichten des Lebens kennen.
Der Ernst des Lebens beginne jetzt, hatte man ihr gesagt, als sie mit dem nigelnagelneuen Schülerthek zum ersten Mal an der Hand der Mutter zum Schulhaus ging. Sie hatte es nicht eilig, in das düstere Haus zu kommen. Die vielen fremden Kinder erschreckten sie. Herr Koller, der Lehrer, war freundlich, lächelte ihr aufmunternd zu. Vielleicht war die Schule gar nicht so schlimm? Jedenfalls hatte Herr Koller wunderschöne Blumen an die Wandtafel gemalt, mit farbiger Kreide! Sie hatte gar nicht gewusst, dass es das gab. Jedes Kind bekam eine Schiefertafel und eine Schachtel mit Griffeln drin. Am liebsten hätte sie sofort zu malen begonnen. Sie getraute sich nicht. Sie begann zu zählen, das hatte sie schon von der Grossmutter gelernt und war stolz darauf: 41 Kinder! Sie hatten kaum Platz im Schulzimmer. Und dann durften sie endlich auf die Schiefertafel schreiben. Richtig schreiben! Herr Koller zeichnete drei Striche, zwei in die Höhe und einen mitten drin. Das sei ein H, sagte er. Der erste Buchstabe! Sie gab sich grosse Mühe, ihn schön zu schreiben, denn schreiben und lesen, das wollte sie so rasch als möglich lernen. Diese geheimnisvolle Welt der Bücher kennen lernen. Geschichten selber lesen, ohne darauf warten zu müssen, dass die Grossmutter Zeit zum Erzählen hatte. Das war der Hauptgrund, warum sie es durchaus sinnvoll fand, jeden Tag in die Schule zu gehen.
Es wurde Zeit, das Hotelzimmer zu verlassen. Ein etwas mulmiges Gefühl im Bauch. Reden vor vielen Leuten machte ihr immer noch Mühe. Doch sie spielte ihre Rolle gut. Lächelte, strahlte Selbstsicherheit aus und liess sich nichts von dieser diffusen Angst anmerken. Elegant und mit sicherem Schritt würde sie sich hinter das Rednerpult stellen und mit fester Stimme ihren Vortrag halten. Wohl wissend, dass ein guter Teil der Anwesenden ihre Meinung in keiner Weise teilte. Sie würde sich selbstsicher geben und überzeugen. Diese Rolle hatte sie eingeübt immer und immer wieder.
Sich anders zu geben als man sich fühlte, das hatte das kleine Mädchen früh gelernt. Je nach dem, wessen Liebe es wollte, war es das angepasste, liebe Mädchen, so wie ihre Mutter es haben wollte, oder das neugierige, ein wenig freche Kind – so wie es ihrem Vater gefiel. Was war richtig? Der Vater wurde laut – und konnte doch auch so herzlich lachen, Geschichten erzählen, ihm die Geheimnisse der Welt erklären. Die Mutter war still und oft hatte das Mädchen das Gefühl, dass es gar nicht drauf an kam, ob es da war oder nicht. Mit der Zeit durfte das kleine Mädchen, das nun Schülerin war, allein in den nahen Wald. Oft zusammen mit Freundinnen. Der blaue Blumenteppich lockte nicht mehr, dafür die Höhle in der lehmigen Wand. Von oben sah man sie nicht, versteckt hinter Laubwerk. Weil es einmal verträumt einen Schritt zu viel gemacht hatte und abrutschte, hatte es die Höhle entdeckt. Es fühlte sich wohl darin. Die dämmrige Kühle weckte in ihm ein Gefühl von Geborgenheit. Niemand hinderte es daran, seinen Träumen nachzuhängen. Mit der Zeit richtete es sich häuslich ein. Eine alte Wolldecke, die Mutter hatte deren Verschwinden noch nicht bemerkt, ihre Lieblingspuppe, ein paar Äpfel und Nüsse als Notvorrat machten die geheime Höhle zu seinem zweiten Daheim.
Höhlen hatten es ihr auch später angetan, doch nur wenn sie das Tageslicht noch sehen konnte. In Höhlen konnte man sich vor dem Leben verstecken. Konnte sich ausklinken aus dem, was erforderlich war. Doch eine Höhle wie damals fand sie nie wieder. Manchmal waren es Hotelzimmer oder ein kleines Haus in den Bergen. Dort fand sie für eine kurze Weile den Zauber des Rückzugs von damals. Sich ausklinken von den Forderungen des Alltages, nicht immer wieder entscheiden müssen, was zu tun war oder auch nicht, die tausenderlei Verpflichtungen für eine Weile einfach zu vergessen, das lockte sie auch jetzt, immer wieder einmal. Einfach die Seele baumeln lassen und dabei zu spüren, was ihr im Innersten wichtig war – und dann diese stille Leere aus Nichts.
Der Saal füllte sich. Sie schaltete den Laptop auf, überprüfte ihre Präsentation. Sie war bereit, sich der Menge zu stellen. Sie wusste, ihre Erscheinung war perfekt. Die Frisur sass, die Bluse gebügelt, Jeans und die elegante Jacke dem Anlass angemessen. Es galt, sich den Gepflogenheiten des Publikums anzupassen. Und dieses gab viel auf die äussere Erscheinung. Sie wollte Geld für ihr Projekt, das ihr so am Herzen lag. Genügend Geld, um Zeit zu haben, sich mit der Kultur des fremden Landes auseinander zu setzen, damit sie den Frauen klar machen konnte, dass es um das Wohl ihrer Töchter ging und nicht darum, ihre Kultur in Frage zu stellen. Dafür war sie gerne bereit, die geforderte Rolle zu spielen. Erwartungsvolle Gesichter, gelangweilte, skeptische, schauten ihr entgegen. Manche der Männer, Frauen waren in der Minderheit, blätterten in ihren Unterlagen. Sie setzte ihr gewinnendes Lächeln auf und begrüsste, laut, langsam, deutlich. Dann die Pause – der kurze Augenblick, bevor sie zu reden beginnen würde. Die irritierende Pause. Hatte sie den Faden verloren? Irritierte Blicke und dann – ungeteilte Aufmerksamkeit. Jetzt würden sie zuhören. Sie wusste es von anderen Gelegenheiten. Das Rezept war gut. Wenn die Aufmerksamkeit nachlassen würde, dann einfach wieder Pause – spannungsvolle Pause. In der Musik liebte sie diese Pausen, weil sie gespannte Neugier weckten. Würde das Orchester weiter spielen? Welche Botschaft legte der Komponist in die Pause? Der kurze Augenblick, bevor es weiterging. Würde es weitergehen? Nur dieser Augenblick war real. Was vergangen, vorbei. Die Zukunft ungewiss. Wie die kurze Begegnung am Morgen bei der blauen Blume. Der Augenblick des Staunens, des Erkennens von Gemeinsamem. Fast verlor sie den Faden. Doch die Routine liess sie weiter reden. „Die Kultur des Landes muss als fundamentaler Teil des Lebens in die Entwicklungspolitik integriert werden“, hörte sie sich sagen. „Doch die Verstümmelung der weiblichen Genitalien hat nichts mit Kultur zu tun, sondern ist eine brutale Menschenrechtsverletzung.“ Sie hatte die Aufmerksamkeit der Leute im Saal. Das Sprechen fiel ihr immer leichter. Es war ihr Herzensanliegen. Sie setzt sich dafür ein, dass kein Mädchen mehr diese Tortur erleiden muss. Dafür kämpft sie.
Dieser Entscheid bedeutete aber auch, die bergende Höhle zu verlassen, sich der Öffentlichkeit auszusetzen. Zu argumentieren und zu überzeugen. Unzählige Vorträge hatte sie schon gehalten. In ihrer Heimat ging es darum, zu sensibilisieren, auf das Problem aufmerksam zu machen und Geld zu sammeln für ihr Projekt. Einige Monate verbrachte sie darum zu Hause, bevor sie wieder ins afrikanische Land flog, das ihr zur zweiten Heimat geworden war. Sie bewegte sich inzwischen mit Leichtigkeit zwischen den beiden Kulturen. Die elegante Frau verwandelte sich in eine mit bunten Gewändern. Im afrikanischen Land brauchte sie keine Tricks damit ihr zugehört wurde. Die Menschen, vor allem die Frauen, waren aufmerksam. Doch zu überzeugen waren sie nicht so leicht.
„Ich will die Leute davon überzeugen, dass die Armen, die Arbeiter auch Rechte haben“, hörte sie ihren Vater sagen. Das war damals noch nicht so leicht zu verstehen. Aber sie war stolz darauf, dass ihr Vater jeweils am 1. Mai im Umzug mitmarschierte. Die Mutter war nicht einverstanden. „Was denken die Leute?“ sagte sie. Was die Leute dachten, vor allem ihre Mitschüler und Mitschülerinnen, das bekam sie selber auch zu spüren. „Dein Vater ist ein Sozi?“, fragten sie. Zuerst antwortete sie mit einem stolzen Ja. Mit der Zeit kam dieses Ja zurückhaltender, andere fanden Sozi offensichtlich nicht so toll. Einmal redeten sie in der Schule über Wörter, die man nicht so ohne Weiteres verstehen konnte: Zivilcourage bedeute, für etwas einzustehen, bei dem die Mehrheit anderer Meinung ist. Sie meldete sich zu Wort: „Dann hat mein Vater Zivilcourage!“ Ein Murmeln ging durch die Klasse. Doch in diesem Moment war es ihr egal. Sie war stolz auf ihren Vater, der Zivilcourage zeigte.
Später, als sie mehr und mehr ahnte, was Politik bedeutete, wurde ihr klar, dass ihr Vater keineswegs den einfachen Weg gewählt hatte. Sie liebte die Stadt, in der sie aufgewachsen war, erfuhr aber immer mehr, dass die Ansichten ihres Vaters nicht jene der Mehrheit waren. Es kam darauf an, gut auszusehen, schöne Kleider zu haben, sich die Hände nicht schmutzig zu machen. Ihr Vater hatte derbe Hände, meist hatte es etwas Schmutz unter den Fingernägeln. Sie verstand auch, warum. Wenn sie ihn am Bahnhof besuchte, ihm stolz zuschaute, wie er mit seinem langen Hammer „die Bremsen kontrollierte“ wie er sagte, indem er an bestimmten Stellen unter die Bahnwagen schlug, dann war sie überzeugt, dass er eine sehr wichtige Aufgabe erfüllte. Schliesslich war sie schon oft Zug gefahren und wusste, wie wichtig gut funktionierende Bremsen waren. Ihr Vater hatte schmutzige Hände. „Mit meiner Hände Arbeit verdiene ich unser Brot“, sagte er stolz. Auch andere Väter hatten schmutzige Hände – doch viele nicht. Womit verdienten diese ihr Brot? Darauf wusste sie vorläufig keine Antwort.
Sie sprach seit einer halben Stunde. In manchen Gesichtern zeichnete sich Betroffenheit ab. Die Aufmerksamkeit hatte sie von den Zuhörenden. Sie spürte, dass sich die meisten der Anwesenden noch nie ernsthaft mit der Tatsache auseinandergesetzt hatten, dass mit der Beschneidung der Mädchen Menschenrechte verletzt wurden. Sie hielt ihren Vortrag in nüchternem Ton, gab Zahlen und Fakten bekannt. Und die waren erschreckend. Ihr Publikum konnte damit umgehen. Darunter konnte es sich etwas vorstellen. Von der Entwürdigung der Frauen sprach sie auch. Stille die man fast schneiden konnte, breitete sich im Saal aus. Das Thema kam an. Ihr Anliegen wurde verstanden! Das machte sie glücklich. Ein ähnliches Gefühl wie am Morgen, als sie mit dem unbekannten Mann in stiller Übereinkunft vor der blauen Blume stand. Verstanden zu werden beflügelte sie, im Kleinen wie im Grossen. Ein paar Menschen mehr waren sensibilisiert worden für ihr Herzensanliegen und – das vor allem – mit der Zeit würden immer weniger Mädchen die Tortur erleiden mussten. Sie wusste auch, dass sie mit grosszügiger finanzieller Unterstützung für ihr Projekt rechnen konnte. Das beruhigte das Gewissen der Herren im dunklen Anzug.
Alle hatten sie saubere Hände, ihre Anzüge waren tadellos, und sie wusste, dass diese Herren über viel Geld verfügten. Inzwischen wusste sie auch, dass man das „tägliche Brot“ durchaus auch mit „sauberen Händen“ verdienen konnte. Viel Geld sogar. Viele dieser Herren bezogen Traumsaläre, Boni und weitere Vergünstigungen – doch war dieses Geld wirklich erarbeitet und darum verdient? So wie es ihr Vater verdient hatte?
Sie schaute in die Runde, verabschiedete sich und verliess das Kongresszentrum. Noch war es nicht Zeit, ins Hotelzimmer zurück zu kehren. Sie beschloss, mit der Standseilbahn zu den nahen Weihern zu fahren – dort wo Weite war bis zum See. Und heute war er da, der See! Nicht immer zeigte er sich, dann wenn nur Nebel oder Dunst war, die Stadt fast nicht zu sehen, weil der Nebel wie graue Zuckerwatte auf ihr lag. Doch auch das mochte sie. Es war so ähnlich wie sich in der Höhle zu verbergen. Wenn die Menschen ganz überraschend aus dem grauen Nichts traten. Doch heute war er da, der See – und zwar zum Greifen nahe. Der Föhn würde wohl bald zu Ende gehen. Die drei Weiher hoch über der Stadt waren voller Geschichten. Ob sie auf dem Grund, zwischen Algen und Wasserpflanzen nur darauf warteten wieder entdeckt zu werden? Gemächlichen Schrittes begann sie mit der Umrundung. Von früher wusste sie, dass sie dafür eine Stunde brauchen würde. Die Luft war noch warm am frühen Herbsttag. Doch die prachtvollen Bäume liessen schon etwas ahnen vom Farbenfest vor dem ersten Frost. Sie atmete tief durch, beglückt über ihren erfolgreichen Vortrag. Auch das gehörte zu ihr. Sie wollte Erfolg haben, ankommen bei den Menschen. Geschichten von früher stiegen langsam an die Oberfläche. Der Weiher hatte sie wohl bewahrt.
Genau gegenüber lag der Rosenberg – ja, und hinter dem Berg war ihre Kinderheimat. Sie dachte gerne daran zurück! Ein in sich geschlossenes Quartier mit vielen Kindern, grossen Gärten um die Genossenschaftshäuschen. Auf wenigen Quadratmetern, dafür mit einem grossen Estrich, in dem man so schön spielen konnte an Regentagen, entfaltete sich das Familienleben. Die beiden Brüder schliefen im zweitgrössten Zimmer und sie hatte das kleinste dessen Fenster genau gegenüber dem Haus lag, wo ihre beste Freundin wohnte. Von Fenster zu Fenster flüsterten die beiden stundenlang, erzählten einander die geheimsten Gemeinnisse und nahmen an, niemand höre sie.
Weitblick hatte sie jetzt – bis zum Bodensee. Heute schien er grenzenlos. Der leichte Nebel schluckte das gegenüberliegende Ufer. Ein weites Meer. Vom Wasser in den Nebel und bis zum Himmel. Leichten Sinnes genoss sie den Weitblick, der alles offen liess und vieles verbarg. Wasser, fliessend oder still wie ein Bergsee, hatte es ihr von jeher angetan.
Die Ferien ihrer Kindheit waren erfüllt vom Geräusch des Bergbaches – ganz nahe beim Holzhaus hüpfte er über Felsbrocken, brachte Geröll mit. Er lockte – und war doch verboten, weil zu gefährlich, wie ihre Mutter fand. Mit ihren beiden kleinen Brüdern entwischte sie dennoch dann und wann. Sie bemerkten nichts von der Kälte des Wassers, weil sie ganz vertieft waren in den Bau einer Staumauer. Unten hüpfte das Wasser fröhlich weiter und oben bildete sich ein kleiner See. Im Bergdorf waren sie glücklich, die drei. Fast unbegrenzte Freiheit – auch wenn ihr, als der Ältesten – oft die Verantwortung für die Brüder aufgebürdet wurde.
Dann kam es zu jenem letzten Sommer zu dritt. Der ältere Bruder konnte nicht mehr gehen. Ein Tumor wuchs in seinem Kopf. Keine Spiele mehr am Wasser – und doch waren sie irgendwie glücklich. Lebten den Augenblick und dachten nicht an Künftiges. Dem Bruder tat die Bergluft gut. Er lernte sogar wieder ein paar Schritte zu gehen. Die Hoffnung wuchs, dass er vielleicht die Krankheit besiegen könnte. Seit diesem glücklichen Drei-Geschwister-Sommer ist auch dieses Bergdorf ein Stück Heimat für sie. Sie sieht lachende Kinder. Fröhliche Wasserspiele und fühlt sich wieder ganz. Zwei Brüder gehörten in ihr Leben. Doch einer hat sich früh verabschiedet von dieser Welt. Nur ein paar Monate später starb er. Noch so klein, nur acht Jahre alt war er geworden. Es war ihre erste Erfahrung mit dem Tod. Nur gerade vier Jahre älter konnte sie die Endgültigkeit nicht einordnen, wartete darauf, dass das Unfassbare rückgängig gemacht werden konnte. Der andere Bruder wurde immer stiller. Er hatte niemanden mehr zum Spielen. Immer stiller und stiller wurde er, zog sich in sich selbst zurück. Noch ahnten beide nicht, dass eine leise Sehnsucht nach dem verlorenen Bruder ein Leben lang anhalten würde.
Sie setzte sich auf die Bank unter der grossen Linde, schaute zum Rosenberg. In Gedanken erklomm sie die Stufen vom Bahnhof bis zuoberst. Während der Sekundarschule ging sie diesen Weg viermal am Tag – und zwar meist mit Freude. Sie genoss den Wechsel der Jahreszeiten, des Wetters. Ob Sonne, Nebel, Regen oder gar Schnee, sie liebte diese Wege, die ihr Zeit zum Träumen liessen. Der Rosenberg war die Welt der Reichen, der Schoren die Welt der Arbeiter. Diese unterschiedlichen Welten lernte sie früh kennen. Nach dem Aufstieg über die vielen Stufen hüpfte sie jeweils leichten Schrittes wieder viele Stufen den Berg hinunter. Eine eigene Welt öffnete sich ihr, wenn sie durch das grosse Tor schritt, das zur Strasse führte wo ihr Zuhause war. Eine steile Strasse, über die man schlitteln konnte im Winter. Schnee gab es genug und es fuhr lediglich ein einziges Auto, das ihres Nachbarn. Das Gartentörchen quietschte, bevor sie um die Ecke bog, im Frühsommer holte sie sich eine Kirsche vom Spalierbaum und schon stand sie vor der schweren Haustüre mit den geschnitzten Fensterrahmen.
Ob es sie fröstelte wegen des aufkommenden Abendwindes? Oder waren es die Erinnerungen, die sie mit aller Macht überkamen an diesem Ort? Jedenfalls setzte sie ihren Spaziergang fort. Der See war inzwischen fast verschwunden. Da und dort wurden die Lichter in den Häusern angezündet. Spaziergänger gab es nur noch wenige. Auch für sie wurde es Zeit, zum Hotel zurück zu kehren. Sollte sie den Weg rund ums Klösterchen gehen durch den Wald zurück in die Stadt? Sie entschloss sich für den direkten Weg, wollte in der Stadt noch verweilen.
Der Schluchtenweg war steil und kurvig – doch sie liebt ihn heiss! Die Naturbrücke liess sie auch jetzt wieder staunen, und das Rauschen der Steinach war wie Musik in ihren Ohren. Sie zog ihre eleganten Schuhe aus und bewältigte den Weg barfuss, achtete kaum auf die feinen Kieselsteinchen, fühlte sich wieder ganz jung, wie damals, als sie jeweils diesen Weg als Sekundarschülerin gegangen war, wenn sie die Frauenbadi besuchte. Der Weg weckte neue Bilder.
Die Sekundarschule – eigentlich Mädchensekundarschule – die Lehrerinnen waren Nonnen – nur Fräulein Widmer, ihre Klassenlehrerin, war eine Weltliche. Sie unterrichtete Deutsch, Geschichte und Französisch. Französisch war nicht so ihr Ding, dafür umso mehr die anderen Fächer. Geschichte – sie tauchte jeweils richtig ein in ferne Zeiten, fand spannend, wie damals die Menschen gelebt hatten. Besonders gern schrieb sie Aufsätze, die meistens zu lang wurden. Nur Mädchen gab es im Schulhaus, etwa vierhundert. Die einzigen Männer waren der Priester und der Hauswart. Die Abwesenheit des männlichen Geschlechts weckte die Phantasie der Mädchen, und so war der Weg in die Singstunde – die in der Knabensekundarschule besucht wurde – besonders spannend. Vor und hinter dem Klassenzug ging je eine Nonne, die vordere rief jeweils – durchaus militärisch – „Blick nach links!“; dort gab es keine Buben am Fenster. Dafür pfiffen diese überlaut und verstohlen wagten die Mädchen Blicke. Der Schulstoff war spannend, die Lehrerinnen gut, und auch in der Klasse fühlte sie sich wohl. Weil in dieser Schule Mädchen aus der ganzen Stadt zusammen kamen, war auch deren Herkunft verschieden, nicht wie im Schoren, wo alle mehr oder weniger aus den selben Verhältnissen kamen.
Sie beschloss im Stadtpark bis zum Theater und der Tonhalle zu spazieren. Die meisten Bäume im Park waren noch dieselben wie in ihrer Jugend. Das Theater lag damals noch mitten in der Stadt am Marktplatz, ein verschnörkeltes Gebäude mit roten Plüschsesseln. Diese Welt lernte sie während der Sekundarschule kennen. Goethes Faust, erinnerte sie sich. Die Mädchen hatten damals den wahren Gehalt des Stückes, trotz sorgfältiger Vorbereitung durch die Deutschlehrerin, kaum verstanden. Viel wichtiger war es, sich schön anzuziehen, schminken war noch nicht erlaubt. An die Spannung im Saal mit dem riesigen roten Vorhang erinnerte sie sich genau.
Zum Stadtpark gehörte aber schon damals die Tonhalle, neben den verschiedenen Museen. Diese Tonhalle brachte ihr die klassische Musik nahe. Musik zu hören und dazu die Musizierenden selbst zu beobachten, sich einzuprägen, wo die Geigen, die Celli, die Bratschen und die Bläser sassen. Aufmerksam zu hören, wann die verschiedenen Instrumente ihren Einsatz hatten und dabei zu beobachten, wie das Orchester in der geheimnisvollen Sprache des Dirigenten der Musik den besonderen Charakter verliehen. Diese Erfahrungen konnte sie später als Journalistin durchaus nutzen, wenn sie über Konzerte berichtete.
Die Museen lernte sie viel später zu schätzen, als sie längst verheiratet war. Ihr Mann wusste viel über die Ausstellungen im Historischen oder im Naturmuseum zu erzählen. Wie herrlich war es, an einem kalten Wintertag durch den verschneiten Stadtpark zu bummeln und in der Wärme der alten Häuser sich in andere Welten zu versetzen! Und – sie erinnerte sich, wie einmal in den beiden Stunden im Museum, sich der Stadtpark in ein wunderbares Wintermärchen verwandelte.
Doch jetzt war noch Spätsommer. Zwar konnte man den Herbst schon riechen, sie genoss die Wärme am Abend. Trotzdem wurde es langsam Zeit, ins Hotel zurück zu kehren. Sie nahm den direkten Weg, am Theater vorbei über den Marktplatz bis ins Klosterviertel. Bei der Kathedrale verweilte sie wieder, schaute über den grossen Platz, die Klostertürme und konnte es nicht lassen, das schwere Tor des Domes zu öffnen. Der weite Barockraum empfing sie freundlich. Damals wurde er restauriert. Überall waren Gerüste aufgestellt, die Farben der Deckenbilder wurden erneuert, die Stukkaturen ausgebessert.
Es war nun definitiv Zeit, ins Hotel zurück zu kehren, ein Katzensprung vom Klosterplatz zum Hotel. Sie löste sich nur ungern von den Erinnerungsbildern, doch jetzt meldete sich auch ihr Magen, sie beschloss zuerst einmal dessen Bedürfnisse zu stillen. In der nahen Pizzeria bestellte sie einen Teller Pasta und ein Glas Rotwein. Nur wenige Leute waren im Lokal, so dass sie ungehindert ihren Gedanken nachhängen konnte.
Sie genoss ihre Pasta und bestellte gleich noch ein Glas Wein, weil es in der Pizzeria so gemütlich war und im Hotel ohnehin niemand auf sie wartete. Weit waren ihre Gedanken zurück geschweift. Sie hatte Mühe, die Gegenwart wahr zu nehmen. Und so überliess sie sich ihren Erinnerungen.
Sie winkte dem Kellner, bezahlte und, immer noch in Gedanken versunken, verliess sie das Restaurant und ging die wenigen Schritte bis zum Hotel.





























