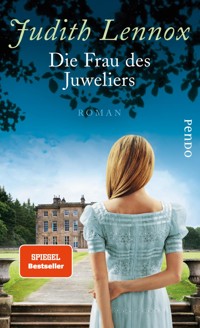17,48 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Aufregend und rastlos ist das Leben der Mulgraves, die mit ihren drei Kindern die schönsten Gegenden Europas bereisen – bis der Ausbruch des Zweiten Weltkriegs die Familie zwingt, in England sesshaft zu werden. Klug und selbstständig nimmt die achtzehnjährige Faith ihr Schicksal in die Hand. In den Kriegsjahren bewährt sie sich als Ambulanzfahrerin und kümmert sich selbstlos um die Verwundeten. Doch dann trifft sie Guy wieder, den sie liebt, solange sie denken kann … Eine großartige und berührende Familiensaga, die die stürmische erste Hälfte des 20. Jahrhunderts umspannt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
In Erinnerung an meine Mutter
Übersetzung aus dem Englischen von Mechtild Sandberg
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe8. Auflage 2009
ISBN 978-3-492-95345-0
© Judith Lennox 1998
Titel der englischen Originalausgabe:
»Footprints on the Sand«, Corgi Books / Transworld Publishers Ltd., London 1998
© der deutschsprachigen Ausgabe:
Piper Verlag GmbH, München 2001
Umschlagkonzept: semper smile, München
Umschlaggestaltung: Cornelia Niere, München
Umschlagabbildung: Susan Fox, Trevillion Images
Datenkonvertierung E-Book:
Teil I
Die Sandburg
1920 – 1940
1
DAS ERSTE MAL sah sie ihn am Strand. Er stand im Sand und warf seinem Hund einen Stock ins Meer hinaus. Sein emporgeschwungener Arm hing vor einem metallgrauen Himmel. Der Hund paddelte durch das eisige Wasser. Einziges leuchtendes Signal in der grauen Eintönigkeit war sein roter Schal. Sie beobachtete, wie er sich bückte und den Hund streichelte, ohne sich an den Wasserspritzern zu stören, die aus dem Fell aufstoben, als das Tier sich schüttelte. Als er den Stock ein zweites Mal hinausschleuderte, weiter jetzt, drückte sie die Augen zu und sagte zu sich: Wenn er ihn diesmal wiederbringt, suche ich mir einen Beruf. Sie öffnete die Augen wieder. Über den Wellen kaum erkennbar war der Kopf des Hundes, der den Stock zwischen seinen Zähnen hielt. Da wandte sie sich ab und ging ins Hotel zurück.
Es war April, kalt und trübe in Deauville, wo Poppy mit ihrer Mutter und ihren Schwestern Urlaub machte. Wegen des Krieges waren die Vanburghs seit dem Sommer 1914, seit mehr als fünf Jahren also, nicht mehr im Ausland gewesen. Aber Deauville war noch genau so, wie Poppy es in Erinnerung hatte: der lange helle Sandstrand, die Promenade, das Kasino, die Restaurants und Geschäfte. Wären nicht die jungen Männer in den Rollstühlen gewesen, auf der Suche nach einer Sonne, die sich niemals zeigte – Poppy, die es vor Langeweile und Rastlosigkeit fast zerriß, hätte meinen können, immer noch in ihrer ereignislosen edwardianischen Kindheit eingesperrt zu sein.
Das Frühstück im Hotel wurde unweigerlich von den Nörgeleien ihrer Mutter begleitet. »Schrecklich, dieser Kaffee … nach allem, was wir durchgemacht haben … und das Brot, eine grauenhafte Farbe … ach, und die Zimmer, eiskalt …« Jeden Morgen hätte Poppy, die an die versehrten jungen Männer am Strand denken mußte, am liebsten gesagt: Ja, Mama, aber wenigstens hattest du keine Söhne! Doch sie schwieg und überließ es Rose und Iris, ihre erregte Mutter zu beschwichtigen.
Sie hatte es sich angewöhnt, nach dem Frühstück allein spazierenzugehen. In den Fuchspelz eingepackt, den sie im vergangenen April zum Geburtstag bekommen hatte, ging sie mit langen Schritten am Wasser entlang und ließ sich vom unaufhörlichen Wind das helle Haar ins Gesicht peitschen, während sie darüber nachdachte, was sie mit ihrem Leben anfangen sollte. In zwei Wochen würde sie einundzwanzig werden. Vor drei Jahren war sie von der Schule gegangen, und das einzig Bemerkenswerte an diesen drei Jahren war, wie ihr schien, daß überhaupt nichts passiert war. Selbst wenn sie scharf nachdachte, konnte sie sich nicht an ein einziges besonderes Ereignis erinnern. Sie war weder verlobt noch verheiratet, und der Strom junger Männer, die im Haus der Vanburghs in London vorgesprochen hatten, war mit dem Fortschreiten des Krieges merklich dünner geworden. Sie hatte keinen Beruf und wußte auch keinen, der sie besonders gelockt hätte. Dank der Hinterlassenschaft ihres Vaters, aus der sie ein kleines monatliches Einkommen bezog, brauchte sie nicht für Brot und Lohn zu arbeiten, und sie konnte sich nicht vorstellen, einen der Berufe zu ergreifen, die junge Frauen ihres Alters üblicherweise ausübten – Krankenschwester, Lehrerin, Stenotypistin. Aber irgend etwas mußte sie tun, das war ihr klar. Am Beispiel ihrer älteren Schwestern sah sie nur allzu deutlich, was aus ihr werden würde, wenn sie weiterhin einfach in den Tag hineinlebte. Rose hatte mit siebenundzwanzig bereits die Gewohnheiten und fixen Ideen einer alten Jungfer entwickelt, und Iris, die vierundzwanzig war, beschäftigte sich mit Spiritismus.
Der regenfeuchte Wind und die tiefhängenden Wolken, die den Horizont verwischten, waren bedrückend. Sie haßte Deauville; es schien ihr so ewig gleich und selbstzufrieden wie ihr Zuhause. Dreimal täglich der Marsch am Strand entlang – vor dem Frühstück, nach dem Mittagessen, vor dem Abendessen! Poppy schlug die Absätze ihrer Schuhe tief in den feuchten Sand, als könnte sie durch die Veränderung dieser Mikrolandschaft das eingefahrene Einerlei ihres Lebens ändern.
Das zweite Mal sah sie ihn an einem kalten Freitagmorgen. Er baute eine Sandburg. Wegen des ungewöhnlich kühlen Wetters und der frühen Stunde war der Strand leer bis auf sie und ihn und den Hund, der am Wasser herumtollte. Die Burg wuchs unter seinen Händen zu einem spektakulären Bauwerk mit Türmen, Zinnen und Brücken, die Mauern verziert mit Muscheln und Seetang. Es war die schönste Sandburg, die Poppy je gesehen hatte. Sie fand es erstaunlich, daß ein erwachsener Mensch bereit war, so viel Energie in etwas zu stecken, das so kurzlebig war.
Er war groß und kräftig, sein Haar einige Nuancen dunkler als ihr eigenes, und seine großen Hände formten den Sand mit Zartheit. Sein Mantel war lang und schwer und hatte einen Persianerkragen. Der scharlachrote Schal, der locker um seinen Hals lag, flatterte im Wind, und auf dem Kopf trug er einen schwarzen Schlapphut, der unverkennbar bessere Tage gesehen hatte. Gewiß, daß er, in seine Arbeit vertieft, ihre Anwesenheit nicht bemerkt hatte, beobachtete sie ihn, wie er flache Muscheln in ockerbraune Mauern drückte. Faszinierend, mit welcher Hingabe er sich diesem kindlichen Unternehmen widmete! Ihrer Schätzung nach war er mindestens zehn Jahre älter als sie. Schon wollte sie ihn auslachen, insgeheim über ihn spotten – aber da durchbrach ein Licht die graue Wolkendecke, der erste Sonnenstrahl seit zwei Wochen, und fiel golden auf die Türme und Zinnen, so daß die Burg flüchtig zu märchenhaftem Leben zu erwachen schien.
Poppy wandte sich ab, überrascht von den Tränen, die ihr in die Augen sprangen, und als sie davonging, hörte sie ihn hinter sich rufen: »Es fehlen noch ein paar Fahnen, finden Sie nicht auch?«
Sie blickte zurück. Er stand aufrecht, die Hände in den Taschen, und sah ihr nach. Sie war es schon gewöhnt, daß Männer sie so ansahen, und stellte nur den Kragen ihres Mantels auf, ehe sie hocherhobenen Kopfes weiterging.
Aber allein in dem Hotelzimmer, das sie mit ihren älteren Schwestern teilte, ertappte sie sich dabei, daß sie Fahnen, Flaggen, Banner auf das Hotelschreibpapier kritzelte. Und später, vor dem Abendessen, schob sie heimlich einen Cocktailspieß aus ihrem Glas in ihren Handschuh. Albern, sagte sie sich. Morgen würde die Sandburg verschwunden sein, fortgespült von der Flut.
Als sie am nächsten Morgen erwachte, wurde ihr augenblicklich bewußt, daß sich etwas verändert hatte. Die grauen Wolken waren hellem Sonnenlicht gewichen, das durch die Ritzen der Läden ins Zimmer strömte. Ein breiter Streifen weißen Lichts lag auf dem blankpolierten Fußboden. Poppy stand auf und kleidete sich an. Sie spürte die Wärme auf ihren nackten Armen und ihrem Kopf, als sie aus dem Hotel trat und die Promenade hinunterlief.
Er war da. Es war nicht dieselbe Burg, es war eine neue, größer und noch prachtvoller. Sie nahm die Papierfähnchen aus der Tasche.
»Hier«, sagte sie, und er sah zu ihr auf und lachte.
»Sie müssen bestimmen, wo sie hinsollen.«
Sie stieß einen Cocktailspieß in einen Turm, einen zweiten in die Ecke der Wehrmauer. Dann lief sie zum Hotel zurück, zu ihrer nörgelnden Mutter und ihren langweiligen Schwestern.
Vorgeblich waren sie wegen der Gesundheit ihrer Mutter nach Deauville gereist; in Wirklichkeit, vermutete Poppy, weil ihre Mutter hoffte, unter den anderen Briten, die hier Urlaub machten, geeignete Ehemänner für ihre drei unverheirateten Töchter zu finden. Iris war einmal verlobt gewesen, aber ihr Bräutigam war 1916 in der Schlacht an der Somme gefallen.
»Sie hat eine Fotografie von Arthur, aber das Bild ist ihm nicht sehr ähnlich, und jetzt kann sie sich eigentlich gar nicht mehr erinnern, wie er ausgesehen hat«, sagte Poppy eines Tages zu Ralph. Nur war er da noch nicht Ralph, sondern noch Mr. Mulgrave.
Sie gingen am Wasser entlang. Er war immer da, wenn sie zu ihrem Morgenspaziergang kam, und sie waren ganz von selbst miteinander ins Gespräch gekommen. In der warmen Frühlingssonne hatte er Mantel und Schal abgelegt und trug nur ein Jackett mit Flicken an den Ellbogen.
Poppy sagte etwas zaghaft: »Und Sie, Mr. Mulgrave? Haben Sie auch …?«
Er verstand nicht gleich, dann lachte er erheitert. »Für König und Vaterland gekämpft? Um Gottes willen, nein. Eine schauderhafte Vorstellung.«
»Oh!« Sie dachte an die Plakate, die sie gesehen hatte (»Dein Land braucht dich!«), an Drückeberger und gewisse Zeitungsartikel, die sie gelesen hatte. »Waren Sie ein Verweigerer aus Gewissensgründen?«
Er lachte aus vollem Hals. »Das ist so ziemlich das einzige, was noch schlimmer ist, als in einem Schützengraben zu hocken und sich bombardieren zu lassen – aus Gewissensgründen bei Wasser und Brot in einer kalten Gefängniszelle zu hocken.«
Sie hatten vor einem kleinen Café angehalten. »Ich habe mörderische Kopfschmerzen«, sagte er. »Wollen wir einen Kaffee trinken?«
Poppy wußte, daß sie Ralph Mulgrave, wenn sie sich von ihm zum Kaffee einladen ließ, etwas gestattete, was die Grenzen ihrer Freundschaft sprengte; etwas, das nicht mehr akzeptabel war. Sie hatte ihrer Mutter nichts von Ralph Mulgrave erzählt; er war, sagte sie sich, nichts weiter als ein netter Mensch, mit dem sie sich hier die Zeit verkürzte.
Das Café war düster und schmuddelig, sehr französisch, nicht die Art von Lokal, dessen Besuch Mrs. Vanburgh ihren Töchtern erlaubt hätte. Ralph bestellte Kaffee und für sich einen Brandy dazu. »Gegen den Kater«, erklärte er, und Poppy lächelte, ohne zu verstehen. Dann sagte er: »Ich bin die letzten Jahre viel auf Reisen gewesen. Mexiko – Brasilien – die pazifischen Inseln …«
»Oh, wie aufregend!« rief Poppy und ärgerte sich, daß sie sich wie ein naives kleines Schulmädchen anhörte. »Ich wollte immer reisen, aber ich bin nie über Deauville hinausgekommen.«
»Entsetzliches Pflaster«, erklärte er. »Ich hasse den ganzen verdammten Norden – da bekommt man doch nur Asthma.«
Es gelang Poppy, ihren Schock darüber zu verbergen, daß er es wagte, in ihrer Anwesenheit zu fluchen.
»In Brasilien habe ich eine Zeitlang in einem Zinkbergwerk gearbeitet«, berichtete Ralph weiter. »Man kann da ein Vermögen verdienen, aber meine Lunge hat es auf die Dauer nicht mitgemacht. Und ich habe einen Roman geschrieben.«
»Einen Roman! Wie heißt er?«
»Nymphe, mein Engel.« Er löffelte Zucker in seinen Kaffee.
Poppy riß die Augen auf. Die Vanburghs waren weder eine besonders kulturbeflissene noch an modischen Trends interessierte Familie, aber sogar sie hatte von dem Roman gehört. Sie erinnerte sich an Onkel Simons entrüstetes Gestammel, als er über das Buch gesprochen hatte.
»Was Sie alles schon gemacht haben!«
Ralph zuckte die Achseln. »Na ja, es hat mir ein bißchen Geld eingebracht. Aber ich bin kein großer Schriftsteller, wenn ich ehrlich sein soll. Ich male lieber.«
»Sie sind Maler?«
»Ich zeichne gern.« Er kramte in seiner Tasche und brachte einen Bleistiftstummel zum Vorschein. Den Blick scharf auf Poppy gerichtet, begann er auf den freien Rand der Speisekarte zu zeichnen. Plötzlich nervös, meinte Poppy, die Pause im Gespräch überbrücken zu müssen.
»Rose wollte gern als Landarbeiterin aushelfen, aber Mama hat es ihr nicht erlaubt, und Iris hat eine Zeitlang im Krankenhaus gearbeitet, aber sie fand das sehr anstrengend. Ich wollte auch etwas tun, und als ich mit der Schule fertig war, habe ich beim Verbandrollen geholfen, aber ich war ziemlich ungeschickt. Die Dinger haben sich immer wieder aufgewickelt. Und jetzt weiß ich überhaupt nicht, was ich tun soll – ich meine, Frauen, die Busse oder Traktoren fahren, gibt es jetzt ja nicht mehr, nicht wahr. Ich könnte wahrscheinlich Lehrerin oder Krankenschwester werden, aber ich weiß gar nicht, ob es dazu bei mir reicht, und Mama wäre es sowieso nicht recht. Ich sollte heiraten, nur gibt’s ja fast keine jungen Männer mehr, und –«
Sie schlug sich mit der Hand auf den Mund und brach ab.
Er sah sie an und sagte ruhig: »Aber natürlich werden Sie heiraten. Schöne Frauen finden immer einen Ehemann.« Dann drehte er die Speisekarte um, so daß sie die Skizze sehen konnte, die er in der einen Ecke aufs Papier geworfen hatte. Das herzförmige Gesicht von hellen Locken umrahmt, die großen, runden Augen und der volle Mund, der so gar nicht der Mode entsprach. Es erschreckte und erregte sie, sich zu sehen, wie er sie sah.
»Oh!« stieß sie atemlos hervor. »Sie sind wirklich gut.«
Ralph schüttelte den Kopf. »Ich wollte Maler werden, aber es hat nicht hingehauen.« Er riß die Ecke der Speisekarte ab und überreichte sie ihr. »Ihr Bild, Miss Vanburgh.«
Die seltenen Male, die Poppy fähig war, klar zu denken (wenn sie nicht damit beschäftigt war, sich sein Gesicht vor Augen oder seine Worte ins Gedächtnis zu rufen), erschreckte sie die Erkenntnis, wie leicht sie sich auf verbotenes Terrain hatte locken lassen. Die Besuche in dem kleinen Café wurden zur Gewohnheit; eines Tages sagte Ralph nicht Miss Vanburgh, sondern Poppy zu ihr, und sie ihrerseits nannte ihn Ralph. Er führte sie in ein anderes Café, tiefer im Gewirr der Hintergassen der Stadt, wo Freunde ihn umarmten und sie mit Küssen und Komplimenten empfingen. Er erzählte ihr von sich: daß er mit sechzehn aus dem Internat durchgebrannt und seither nie wieder nach England zurückgekehrt war. Er war in ganz Europa herumgereist, hatte in Scheunen und Straßengräben genächtigt und war dann weitergezogen bis nach Afrika und zu den Inseln im Pazifischen Ozean.
Ralph haßte England und alles, was es verkörperte. Er haßte den ewigen grauen Nieselregen, die puritanischen Schuldgefühle der Engländer bei jeglichem Genuß, die Selbstgefälligkeit, mit der sie an ihre Überlegenheit glaubten. Sein großes Ziel war es, genug Geld zu sparen, um sich einen Schoner kaufen zu können. Mit dem wollte er auf dem Mittelmeer herumschippern und nebenbei mit Wein handeln. Er war ein Mensch, der leicht Freundschaften schloß, aber das wußte Poppy schon – wenn sie mit Ralph durch Deauville bummelte, winkte ihnen praktisch an jeder Ecke irgend jemand zu. Er war amüsant, intelligent, sensibel und unkonventionell, und sie wußte auch, daß sie sich auf den ersten Blick in ihn verliebt hatte, an dem Morgen schon, als sie ihn mit seinem Hund beobachtet hatte. Daß außer ihr alle Welt ihn zu lieben schien, fand sie befriedigend und beunruhigend zugleich: Einerseits war es ihr Bestätigung, daß sie ihre Zuneigung nicht an den Falschen verschwendete; andererseits schloß es nicht aus, daß ihre Liebe, die so einzigartig, so außergewöhnlich schien, dies gar nicht war.
Eines Tages entwischte sie ihrer Mutter und ihren Schwestern gleich nach dem Mittagessen, um sich in der Straße hinter dem Hotel mit Ralph zu treffen. Er hatte ein Automobil gemietet, einen blitzenden cremefarbenen Wagen mit offenem Verdeck, in dem er mit ihr die Küste hinunterfuhr, um ihr eine Kostprobe der ausgefalleneren Vergnügungen zu geben, die Trouville zu bieten hatten. Er wolle mit ihr eine Freundin besuchen, erklärte er, eine weißrussische Gräfin, die in einem hohen, schmalbrüstigen und recht baufälligen alten Haus in einer etwas finsteren Seitenstraße wohnte. Er machte Poppy mit Elena bekannt, die dunkel, exotisch und alterslos war, ganz wie man es von einer weißrussischen Gräfin erwartete. Die Party im Haus, die bereits seit mehr als vierundzwanzig Stunden im Gange war, hatte nichts mit den Festen gemein, die Poppy bisher erlebt hatte. Ihrer Erfahrung nach waren größere Festlichkeiten steife und förmliche Angelegenheiten, bei denen man nur seine Limonade zu verschütten, eine falsche Bemerkung zu machen oder einmal zu oft mit demselben Partner zu tanzen brauchte, um sich gesellschaftlich unmöglich zu machen. Hier wurde ihr Champagner gereicht, nicht Limonade. Hier irrte sie sich in der Tür, als sie ins Badezimmer wollte, und geriet in ein Schlafzimmer, in dem sich ein Pärchen in inniger Umschlingung auf einer karminroten Chaiselongue räkelte. Hier tanzte sie den ganzen Nachmittag mit Ralph, ihren Kopf an seine Schulter gedrückt, während er mit seinen großen, zarten Händen ihren Rücken streichelte.
Auf der Rückfahrt nach Deauville sagte sie: »Ich kann dich morgen nicht treffen, Ralph. Es ist mein einundzwanzigster Geburtstag, und ich muß den Tag mit Mama und meinen Schwestern verbringen.«
Er runzelte ein wenig die Stirn, sagte aber nichts, und sie fügte ziemlich verzweifelt hinzu: »Und in ein paar Tagen reisen wir nach Hause.«
»Willst du das?«
»Natürlich nicht! Aber ich muß.«
»Wieso?«
Die Wirkung des Champagners hatte nachgelassen. Sie war müde und hatte Kopfschmerzen. »Was soll ich denn sonst tun?«
»Du könntest hierbleiben. Bei mir.«
Das Herz klopfte ihr plötzlich bis zum Hals. »Wie denn?« flüsterte sie.
»Du bleibst einfach. Du fährst nicht zurück. So habe ich es gemacht.«
Sie wollte sagen: Du hast gut reden, du bist ein Mann, aber sie kam nicht dazu, weil sie gerade in die Straße eingebogen waren, die zum Hotel führte, und dort auf dem Trottoir wie drei Rachegöttinnen ihre Mutter und ihre beiden Schwestern warteten.
Im dichten Verkehr war kein Entrinnen möglich. Poppy war drauf und dran, unter den Sitz zu kriechen, aber Ralph hielt sie zurück. »Ich werde mich vorstellen«, sagte er selbstsicher und warf seine Zigarette aus dem Wagen, bevor er neben Mrs. Vanburgh und ihren Töchtern anhielt.
Für Poppy war es ein Alptraum. Ralph ließ seinen ganzen Charme spielen, sprach mit tadellosem Akzent und fluchte nicht ein einziges Mal, doch Mrs. Vanburgh durchschaute ihn. Solange sie auf der Straße standen, wahrte sie die Form, doch im Hotel kannte sie kein Pardon mehr. Poppy sagte manchmal die Wahrheit (Ralph komme aus einer angesehenen englischen Familie) und log häufig (sie hätten sich nur ein-, zweimal getroffen und lediglich eine kurze Spritztour durch Deauville gemacht), aber ihre Mutter witterte mit Recht das Schlimmste. Auf scharfe Fragen über Ralphs berufliche Laufbahn, seinen Wohnort und seine Pläne für die Zukunft mußte Poppy schniefend und schnüffelnd eingestehen, daß er keinen festen Wohnsitz hatte und unter anderem als Fremdenführer, Flugzeugführer und Bootsbauer gearbeitet hatte. »Ein Hans Dampf in allen Gassen, der nichts Richtiges gelernt hat«, stellte Mrs. Vanburgh mit verächtlich gekräuselten Lippen fest, dabei hatte Poppy ihr noch tunlichst verschwiegen, daß Ralph eine Zeitlang in Menton als Eintänzer sein Geld verdient und sich einen Winter lang als Zuckerrübendieb vor dem Verhungern gerettet hatte.
Wäre nicht am folgenden Tag Poppys Geburtstag gewesen, sie hätten noch am selben Abend den Zug nach Calais bestiegen, um nach England zurückzukehren. So aber blieben sie, und Poppy ließ die Feier, eine steife, lustlose Angelegenheit, die ihre Krönung in einem Anstandsbesuch bei zwei älteren Damen fand, die Mama noch aus ihrer Schulzeit kannte, gottergeben über sich ergehen. Obwohl alle so taten, als wären die schändlichen Ereignisse des Vortags nicht gewesen, blieb eine unerfreuliche Spannung in der Luft.
Poppy hatte auf ein Zeichen von Ralph gehofft – Blumen vielleicht –, aber es kam nichts. Er wußte, daß sie Geburtstag hatte, aber er rührte sich nicht. Ihr taten die Kiefermuskeln weh von der Anstrengung des ewigen krampfhaften Lächelns, und als sie auf ihre erneute Anfrage am Empfang des Hotels hörte, daß niemand eine Nachricht für sie hinterlassen hatte, war ihr, als hätte sie einen Messerstich ins Herz erhalten.
Als sie bis zum Abendessen noch immer nicht von ihm gehört hatte, war ihr klar, daß entweder ihre Mutter ihn vergrault hatte oder seine Absichten von Anfang an nicht ehrlich gewesen waren. Vielleicht hatte sie sich nur eingebildet, Ralph mache sich mehr aus ihr als aus all den anderen Frauen, mit denen er befreundet war. Was sollte ein attraktiver und erfahrener Mann wie Ralph Mulgrave schon in einem naiven Ding wie Poppy Vanburgh sehen? Morgen würden sie nach England zurückkehren. Sie konnte sich ihres Lebens dort kaum erinnern – es erschien ihr wie ein Traum –, aber sie konnte sich die Leere vorstellen, die auf sie wartete. Tränen brannten ihr in den Augen, aber sie drängte sie zurück. Als das Abendessen vorüber war, ihre Mutter verstohlen gähnte und Iris und Rose es kaum erwarten konnten, sich zum Bridge mit dem Colonel und seinem Bruder zusammenzusetzen, stand Poppy auf.
»Ich gehe noch einmal ans Meer, Mama. Ich möchte zum Abschied ein letztes Mal den Sonnenuntergang sehen.«
Ehe ihre Mutter sie aufhalten konnte, verließ sie den Saal. Der Wind draußen hatte aufgefrischt. Sie schlang fröstelnd ihre bloßen Arme um ihren Oberkörper. In rotgoldener Glut ging am Horizont die Sonne unter und übergoß das gekräuselte Wasser und die Federwolken mit ihren Farben. Poppy blickte lange abschiednehmend zum Meer hinaus, und als sie sich schließlich herumdrehte, sah sie ihn hinter sich stehen.
»Ralph! Ich dachte, du würdest nicht mehr kommen.«
»Es ist doch dein Geburtstag«, entgegnete er. »Ich habe dir ein Geschenk mitgebracht.« Er hielt ihr ein gefaltetes Blatt Papier hin.
Sie glaubte, es wäre wieder eine Skizze, aber als sie das Papier aufschlug, sah sie, daß es ein Formular war, sehr amtlich und ganz in Französisch. In ihrer Verwirrtheit verstand sie kein Wort des Gedruckten.
»Es ist eine Heiratserlaubnis, eine Sondergenehmigung«, sagte er. »Ich bin dafür heute eigens nach Paris gefahren.«
Sprachlos starrte sie ihn an.
»Wir können uns morgen nachmittag trauen lassen. Und dann können wir in den Süden reisen. Ich habe eine ganz fabelhafte Idee, weißt du. Wasserkühler. Mit Wasserkühlern kann man bestimmt ein Vermögen verdienen.«
»Ralph«, sagte sie leise. »Ich kann doch nicht –«
»Natürlich kannst du.« Er umschloß ihr Gesicht mit seinen Händen und hob es leicht an. »Ich habe es dir doch gesagt, Poppy, Liebste. Du gehst einfach. Du packst ein paar Sachen ein und deinen Paß und gehst.«
»Das wird Mama niemals erlauben –«
»Du brauchst die Erlaubnis deiner Mutter nicht. Du bist einundzwanzig.« Ralph küßte sie auf die Stirn. »Es liegt jetzt allein an dir, Poppy. Wenn es dir lieber ist, brauchst du mich nur fortzuschicken. Dann gehe ich, und du siehst mich nie wieder. Oder du kannst mit mir kommen. Bitte, komm mit. Ich zeige dir die schönsten Flecken der Erde. Dir wird nie wieder kalt sein, du wirst dich nie wieder langweilen, du wirst nie wieder einsam sein. Bitte sag, daß du mitkommst.«
Das Blatt Papier zitterte in ihrer Hand. »Oh, Ralph«, flüsterte sie, dann lief sie ins Hotel zurück.
In dieser Nacht verlor Poppy ihre Unschuld in einem Hotel irgendwo zwischen Deauville und Paris. Am nächsten Tag wurden sie getraut und reisten sofort nach Süden weiter. In Zimmern, deren Läden dicht geschlossen waren, um die sengende Glut der südlichen Sonne abzuwehren, liebten sie sich.
Ralph hielt sein Versprechen: Poppy sah die provenzalischen Hügel und die herrlichen Strände der Côte d’Azur. Sie langweilte sich nie, sie fühlte sich niemals einsam. Die Geburt ihrer Tochter Faith im Dezember, knapp neun Monate später, besiegelte ihr Glück. Inzwischen lebten sie in Italien, in einem großen umbrischen Bauernhaus. In den mageren Monaten hielten sie sich mit Poppys Einkommen und den Tantiemen von Ralphs Buch über Wasser. Ralph war damit beschäftigt, den Wasserkühler zu perfektionieren, der ihm so viel einbringen sollte, daß er sich den ersehnten Schoner würde kaufen können. Poppy stellte sich vor, wie sie durch blaue Gewässer segelten, das Kind im Schatten eines Sonnenschirms in einem Moseskörbchen an Deck. In den frühen Morgenstunden, wenn sie noch im Bett lagen und das Sonnenlicht in weißen Streifen durch die Ritzen der Läden fiel, pflegte Ralph Poppy in die Arme zu nehmen und ihr die Route zu beschreiben, die der Schoner auf dem Mittelmeer nehmen würde. »Neapel, Sardinien … und dann Zakynthos – Zakynthos ist die schönste Insel, die du dir vorstellen kannst, Poppy.« Vor ihrem geistigen Auge sah sie den weißen Sand und die türkisgrünen Wellen.
Häufig kamen Freunde von Ralph zu Besuch. Manchmal blieben sie ein paar Tage, oft mehrere Monate. Ralph war großzügig mit seiner Zeit, seiner Gesellschaft, seiner Gastfreundschaft, und im Haus herrschte stets geräuschvolles Leben. Als sie im April nach Griechenland gingen, waren Ralphs Freunde mit von der Partie, litten mit ihnen auf der stürmischen Überfahrt, schwatzten und lachten mit ihnen, während sie auf Mulis durch die felsigen Hügel des Isthmus ritten. Poppy, die daheim in London kaum je die Küche hatte betreten dürfen, hatte mittlerweile gelernt, wie man Paella und Frittata machte, wie man Braten schmorte und Soßen würzte. Sie kochte gern, aber Hausarbeit war ihr ein Greuel. So lebte man denn in einem freundschaftlichen Chaos, in dem für den Magen gut gesorgt war.
Ein Jahr später kam Jake auf die Welt. Er war ein lebhaftes, anstrengendes Kind, das kaum Schlaf brauchte. Sie waren inzwischen wieder in Italien, diesmal in Neapel. Der Wasserkühler war kein Erfolg gewesen, und sie hatten daher den Kauf des Schoners aufschieben müssen. Nun lebten sie zusammen mit zwei Töpfern in einem alten Mietshaus mit großen, düsteren Zimmern, in denen es nach frischem Ton und Farbe roch. Ralph war für die finanzielle Seite des Töpfergeschäfts zuständig. Seine Freunde, denen Poppy den Spitznamen »die Untermieter« gegeben hatte, waren ihm und seiner Familie nach Neapel gefolgt. Poppy hatte derweilen erkannt, daß Ralph ein Mensch der Extreme war. Er hatte keine Bekannten – er liebte den anderen entweder von ganzem Herzen, oder er lehnte ihn rundweg ab. Bei denen, die er liebte, kannte seine Großzügigkeit keine Grenzen. Er besaß die Gabe, jedem seiner Freunde das Gefühl zu vermitteln, er wäre der wichtigste Mensch in seinem Leben. Er liebte, stellte Poppy fest, wie ein Kind – kritiklos und ohne Vorbehalte. Sie hielt sich vor, ihre Eifersucht auf die »Untermieter« sei absurd, ein Zeichen beschämender Engherzigkeit.
Nicole wurde 1923 geboren. Die Entbindung war schwierig und langwierig. Zum ersten Mal seit ihrer Heirat weinte Poppy nach ihrer Mutter. Nach der Geburt ging es ihr nicht gut. Ralph übernahm es, das Neugeborene zu versorgen. Er liebte Nicole abgöttisch und erklärte sie unverzüglich zum hübschesten und intelligentesten seiner drei Kinder.
Als Poppy sich wieder ganz erholt hatte, übersiedelte die Familie Mulgrave nach Frankreich, wo Ralph eine Bar pachtete. Da seine vorherigen Geschäftspartner, die beiden Töpfer, sich mit dem Gewinn aus dem gemeinsamen Unternehmen aus dem Staub gemacht hatten, waren er und Poppy nun so knapp bei Kasse, daß sie es sich nicht leisten konnten, eine Köchin oder eine Kinderfrau zu engagieren. Poppy stand stundenlang in der Küche und kochte Eintopfgerichte aus Knochen und Suppenhühnern, während die Kinder unbeaufsichtigt blieben und eine Dummheit nach der anderen machten. Manchmal war sie so todmüde, daß sie am Herd einschlief. Sie begann sich über die »Untermieter« zu ärgern, die den Gewinn aus der Bar vertranken, aber als sie sich bei Ralph darüber beklagte, sagte der nur verdutzt: »Aber das sind doch meine Freunde, Poppy!« Es gab einen erbitterten Streit.
Genya de Bainville, eine alte Freundin von Ralph, rettete sie. Nachdem sie von ihrer Ankunft in der Nachbarschaft gehört hatte, suchte sie eines Tages die Bar auf, sah Poppys graues Gesicht und Ralphs verdrossene Miene und lud die ganze Familie auf ihr Schloß ein. Sie war eine polnische Emigrantin, die einen wohlhabenden Franzosen geheiratet und nach seinem Tod das Schloß La Rouilly geerbt hatte. Spuren früherer Schönheit waren auch heute noch in ihrem schmalen Gesicht mit den hohen Wangenknochen zu erkennen, aber die südliche Hitze hatte den zarten Teint verbrannt, und er war so spröde und furchig geworden wie die Felder und Weingärten ihres Guts. Auch von ihrem früheren Reichtum war nicht viel geblieben. Große Teile von La Rouilly waren baufällig, und obwohl Genya über Sechzig war, half sie, genau wie die Mulgraves, bei der Weinlese.
La Rouilly war ein quadratischer Bau mit vielen Fenstern, von deren grünen Schlagläden fast die gesamte Farbe abgeblättert war. Die Rasenflächen waren gelb und vertrocknet, der Garten eine Wildnis aus krankheitsbefallenen Begonien und Rosen, die gewaltige Mengen Blätter, aber kaum Blüten trieben. Hinter dem Schloß lag ein brackiger grüner Weiher, jenseits davon Wald. Weinstöcke überzogen die Hänge der sanftgewellten Hügel.
Poppy liebte La Rouilly. Sie hätte für immer hier leben mögen und gern ihre Tage damit zugebracht, Sarah, der Köchin, in der riesigen Küche zur Hand zu gehen, oder draußen Blumen und Früchte zu ziehen. Kinder und »Untermieter« waren in den vielen Räumen von La Rouilly leicht untergebracht, und Genya war, wie Ralph, ein geselliger Mensch, der gern andere um sich hatte.
Aber als der Herbst kam, wurde Ralph von Ruhelosigkeit gepackt, neue ehrgeizige Ziele beanspruchten seine Zeit und sein Geld, und seinen Träumen vom idealen Heimatland, vom schönstgelegenen Haus, vom großen Gewinn folgend, nahmen sie das Nomadenleben wieder auf. In einem Jahr reisten sie nach Tahiti und Goa; im nächsten nach Shanghai. In Shanghai bekamen sie alle das Denguefieber, und eine Zeitlang mußte befürchtet werden, daß Nicole sich nicht davon erholen würde. Nach dieser Erfahrung bestand Poppy darauf, in Europa zu bleiben.
Jeden Sommer, wenn der Erfolg, auf den Ralph gehofft hatte, sich wieder nicht eingestellt hatte, kehrten sie nach La Rouilly zurück und halfen dort, von Genya mit offenen Armen aufgenommen, bei der Weinlese. Poppy maß den Lauf der Jahre an der Größe ihrer Kinder, die sie mit den knorrigen Weinstöcken verglich. 1932 hatte Jake seine ältere Schwester Faith zu deren Empörung und Zorn eingeholt.
Und 1932 kam Guy.
Ralph brachte Guy Neville eines Abends im August mit nach La Rouilly.
Poppy stand gerade in der Küche und rupfte die Hühnchen für das Abendessen, als Ralph von der Hintertür rief: »Wo ist der verdammte Kellerschlüssel, Poppy?«
»Ich glaube, Nicole hat ihn«, rief sie zurück. »Kann sein, daß sie ihn irgendwo vergraben hat.« Sie hörte Ralph fluchen und fügte hinzu: »Sie ist mit Felix im Musikzimmer.«
Felix, ein Komponist und Stammgast in La Rouilly, gehörte zu den »Untermietern«, die Poppy die liebsten waren.
»Du lieber Gott –« schimpfte Ralph laut. »Ich habe jemanden mitgebracht.«
Ein junger Mann trat aus dem Schatten an die Küchentür. Er sagte zaghaft: »Entschuldigen Sie, daß ich einfach so reinplatze, Mrs. Mulgrave. Die hier habe ich Ihnen mitgebracht.«
Er überreichte ihr einen Strauß aus Mohnblumen und Margeriten. »Es sind nur Wiesenblumen«, fügte er entschuldigend hinzu.
»Wie schön!« Poppy nahm lächelnd den Strauß entgegen. »Ich suche gleich mal eine Vase für sie. Und Sie sind –?«
»Guy Neville.« Er bot ihr die Hand.
Er war hoch aufgeschossen und mager, mit rötlich glänzendem Haar, sie schätzte ihn auf neunzehn oder zwanzig. Seine Augen waren ungewöhnlich, von einem intensiven Blaugrün, sehr tief liegend, mit schweren Lidern, die sich fältelten, wenn er lächelte. Er sprach das kultivierte Englisch der gehobenen Mittelklasse, das Poppy aus ihrer Kindheit kannte, und ganz unerwartet überkam sie ein Anflug von Wehmut. Eilig rechnete sie nach, ob das Abendessen für einen zusätzlichen Gast reichen würde, und wischte sich die blutigen Hände an ihrer Schürze ab.
»Ich bin Poppy Mulgrave. Bitte, entschuldigen Sie. Das ist eine Arbeit, die ich hasse. Die Federn sind schon schlimm genug, aber –« Sie schnitt ein Gesicht.
»Ich kann die Hühner ausnehmen, wenn es Ihnen recht ist. Es ist bestimmt nicht halb so schlimm wie eine Lungensektion.« Er ergriff das Messer und machte sich sogleich an die Arbeit.
»Sind Sie Arzt?«
»Medizinstudent. Ich bin im Juni mit meinem ersten Jahr fertig, und jetzt reise ich ein bißchen durch die Gegend.«
Die Tür flog auf, und Faith stürmte herein. »Nicole heult, weil Papa ihr gesagt hat, daß sie den Schlüssel ausgraben muß. Aber es ist immer noch besser als das fürchterliche Gekeife.«
Faith, in einem langen Spitzenunterrock, der über den Boden schleifte, und einem alten Pullover von Poppy mit Löchern an den Ellbogen, war elfeinhalb, klein und dünn, ein vernünftiges Kind, auf das Poppy sich immer verlassen konnte, was sie von Faiths beiden Geschwistern nicht behaupten konnte. Faith warf einen Blick auf den jungen Mann am Küchentisch und flüsterte: »Eines von Papas herrenlosen Hündchen?«
»Ich glaube, ja«, flüsterte Poppy zurück. »Aber er kann gut Hühner ausnehmen.«
Faith ging um den Tisch herum, um Guy besser sehen zu können. »Hallo!«
Guy blickte auf. »Hallo!«
Sie sah ihm einen Moment zu, dann sagte sie: »Es ist immer viel mehr von dem Zeug da« – sie deutete auf den Berg von Eingeweiden – »als man vermutet, nicht wahr?«
Er lachte. »Ja, da hast du recht.«
»Felix gibt Nicole Gesangsunterricht und bringt Jake das Klavierspielen bei, aber mit mir wäre absolut nichts anzufangen, sagt er, weil ich überhaupt kein Gehör habe«, erklärte sie ihm.
»Geht mir genauso«, sagte Guy. »Wenn ich mal den richtigen Ton treffe, ist es reiner Zufall.«
Wieder an Poppys Seite, murmelte Faith: »Er sieht ganz verhungert aus, findest du nicht auch?«
Poppy musterte Guy. Faith hat recht, dachte sie. Er sah aus, als hätte er seit Wochen nichts Richtiges mehr gegessen. »Die Hühner müssen ewig kochen, ehe sie gut sind, sie sind ziemlich alt und zäh. Tu doch einfach Brot und Käse auf den Tisch, Schatz, ja?«
Da zu dieser Zeit noch zehn andere Gäste in La Rouilly logierten, die alle Ralphs Zeit und Aufmerksamkeit für sich beanspruchten, beschloß Faith, sich Guys anzunehmen. Sie fand ihn interessant. Er hatte die Hühner mit einer so sorgsamen Präzision ausgenommen – jeder Mulgrave hätte einfach wild drauflosgefuhrwerkt, um zwar das gleiche Ergebnis zu erhalten, aber dabei eine Riesenschweinerei anzurichten. Beim Abendessen stritt er mit Ralph, jedoch mit einer Höflichkeit und Zurückhaltung, wie man sie nie zuvor in La Rouilly erlebt hatte. Weder knallte er sein Weinglas auf den Tisch, um seinen Argumenten Nachdruck zu verleihen, noch stürmte er eingeschnappt aus dem Zimmer, als Ralph ihm mitteilte, er habe idiotische Ansichten. Jedesmal, wenn Poppy aufstand, sprang auch Guy auf, um ihr beim Einsammeln der schmutzigen Teller zu helfen oder um ihr die Tür zu öffnen.
Erst in den frühen Morgenstunden versiegten Wein und Gespräch. Poppy war lange zuvor zu Bett gegangen, und Ralph war in seinem Sessel eingenickt. Guy sah auf seine Uhr und sagte: »Ich hab’ gar nicht gemerkt – ich bin ja wohl von allen guten Geistern verlassen. Ich muß sofort los.«
Er holte seinen Rucksack aus der Küche und lief in die Finsternis hinaus. Faith folgte ihm. Auf dem mit Kies bestreuten Vorplatz machte er halt und sah sich mit zusammengekniffenen Augen um.
»Alles in Ordnung?«
»Ich habe die Orientierung verloren. Ich weiß nicht mehr, wo es ins Dorf geht.«
»Wollen Sie nicht über Nacht hierbleiben?«
»Nein, das wäre eine Zumutung …«
»Sie könnten eines von den Mansardenzimmern haben, aber schön ist es da oben, ehrlich gesagt, nicht – da bröckelt dauernd was von der Decke runter. Es wär’ bestimmt gemütlicher, in der Scheune zu übernachten.«
»Ginge das? Wenn es keine Umstände …«
»Überhaupt nicht«, versicherte Faith. »Ich hole Ihnen eine Decke.«
Nachdem sie die Decke und ein Kopfkissen besorgt hatte, führte sie ihn in die Scheune. »Sie brauchen sich nur einen Packen Stroh zusammenzuschieben und sich in die Decke zu wickeln. Nicole und ich schlafen manchmal hier draußen, wenn es sehr heiß ist. Am besten geht man hoch rauf, wegen der Ratten.«
Er leerte seinen Rucksack auf dem Stroh aus.
Sie sah zu. »Alles gefaltet!«
»Das lernt man im Internat.«
Sie schüttelte ihm das Kissen auf und zog einen Kerzenstummel aus ihrer Tasche. »Den können Sie haben, wenn Sie lesen wollen.«
»Danke, aber ich hab’ eine Taschenlampe. Bei den Mengen, die ich getrunken habe, würde ich womöglich noch die Scheune abbrennen.«
Am nächsten Morgen brachte sie ihm das Frühstück: zwei weiße Pfirsiche und ein Brötchen, in ein schmuddeliges Geschirrtuch gewickelt, dazu eine große Tasse schwarzen Kaffee. Er schlief noch. Nur sein Kopf und ein ausgestreckter Arm waren zu sehen. Faith betrachtete ihn einen Moment. Wie still er dalag, ganz anders als Jake, der im Schlaf ständig schniefte und rumorte. Leise sprach sie seinen Namen.
Er stöhnte und schlug blinzelnd die Augen auf. Als er sie sah, sagte er: »Ich habe fürchterliche Kopfschmerzen.«
»Das passiert Papas Gästen leider oft. Ich habe Ihnen etwas zu essen gebracht.«
Er setzte sich auf. »Ich habe keinen großen Hunger.«
Sie setzte sich neben ihn ins Stroh und drückte ihm die Kaffeetasse in die Hand. »Dann trinken Sie wenigstens den Kaffee. Ich hab’ ihn extra für Sie gemacht.«
Guy sah auf seine Uhr. »Elf Uhr – du meine Güte …« Er schüttelte den Kopf.
»Außer Genya und mir ist noch niemand auf. Das heißt, wo Jake ist, weiß ich nicht. Er ist mein Bruder«, erklärte sie. »Wir haben ihn seit« – sie zählte nach – »seit Dienstag nicht mehr gesehen.«
Es war Sonntag. Guy sagte: »Machen sich deine Eltern keine Sorgen?«
Faith zuckte die Achseln. »Jake verschwindet manchmal wochenlang. Mama hat natürlich ein bißchen Angst um ihn. Trinken Sie den Kaffee, Guy«, fügte sie fürsorglich hinzu. »Dann geht’s Ihnen gleich wieder besser.«
Er trank, aß etwas von dem Brötchen. Nach einer Weile sagte er: »Jetzt muß ich aber gehen.«
»Warum?«
»Ich möchte eure Gastfreundschaft nicht ausnutzen.«
Faith war fasziniert. Keinem der »Untermieter« war es je eingefallen, so etwas zu sagen. »Papa hat bestimmt nichts dagegen, wenn Sie bleiben. Im Gegenteil, er wird es Ihnen wahrscheinlich übelnehmen, wenn Sie gerade heute wieder verschwinden. Er hat nämlich Geburtstag. Erst fahren wir raus und sehen uns ein Boot an, das er kaufen will, und dann machen wir am Strand ein großes Picknick. Wir machen an seinem Geburtstag immer ein Picknick am Strand. Er erwartet bestimmt, daß Sie mitkommen.«
»Im Ernst?«
»Im Ernst«, versicherte sie mit Entschiedenheit. »Wo haben Sie Papa eigentlich kennengelernt, Guy?«
Er machte ein verlegenes Gesicht. »Ich wollte per Anhalter nach Calais fahren. Mir sind in Bordeaux meine Brieftasche und mein Paß gestohlen worden, weißt du. Am besten gehe ich wahrscheinlich zum nächsten Konsulat.«
Sie betrachtete ihn aufmerksam. Seine dunklen Wimpern waren länger als ihre eigenen. Sie fand das ungerecht. »Woher kommen Sie denn?«
»Aus England. Ich wohne in London.«
»In was für einem Haus?«
»Ach, es ist nur ein ganz gewöhnliches Londoner Stadthaus aus rotem Backstein. Du weißt schon.«
Sie nickte, obwohl sie es nicht wußte. »Und da wohnen Sie mit Ihren Eltern und Ihren Geschwistern?«
»Nein, nur mein Vater und ich leben dort.«
»Haben Sie keine Mutter?«
»Sie ist gestorben, als ich noch sehr klein war.«
»Und fühlt Ihr Vater sich jetzt nicht einsam, wo er ganz allein ist?«
Er schnitt eine Grimasse. »Er behauptet, nein. Er hat mich gedrängt, wegzufahren. Er ist der Ansicht, daß Reisen den Horizont erweitert.«
»Dann müssen die Mulgraves einen unermeßlichen Horizont haben«, sagte sie. »Wir sind nämlich dauernd auf Reisen.«
Er sah sie erstaunt an. »Und was ist mit der Schule? Hast du eine Hauslehrerin?«
»Mama hat es ein paarmal versucht, aber sie gehen immer gleich wieder. Die letzte hatte Angst vor Spinnen, da können Sie sich wohl vorstellen, was sie von La Rouilly hielt. Jake geht manchmal zur Dorfschule, aber er prügelt sich immer mit den anderen Jungs. Felix gibt uns Musikunterricht, und einer von den Untermietern hat uns Schießen und Reiten beigebracht. Papa sagt, das sind die wichtigsten Dinge.«
In den folgenden Tagen murmelte Guy hin und wieder: »Ich sollte jetzt wirklich verschwinden …«, aber Faith beschwichtigte ihn, und sehr bald begann der besondere Zauber von La Rouilly zu wirken, und nach einer Weile bekam sein Leben einen neuen Rhythmus, der dem der anderen glich: Er stand spät auf, saß stundenlang bei ausgedehnten Mahlzeiten, diskutierte und trank mit Ralph bis in die frühen Morgenstunden, verbrachte den Tag in Gesellschaft von Poppy oder Felix oder den Kindern.
Wenn sie auf dem schleimigen, von Fröschen bevölkerten Weiher hinter dem Schloß ruderten, pflegte Jake Guy zu drängen, ihm Geschichten aus dem Internat zu erzählen.
»Und ihr mußtet jeden Morgen ein kaltes Bad nehmen? Auch wenn ihr gar nicht dreckig wart? Warum denn?«
»Für Gott, vermute ich«, antwortete Guy.
Die drei Mulgrave-Kinder starrten ihn verständnislos an.
»Frisch gewaschen ist man Gott näher«, erklärte Guy und fügte mit einem Achselzucken hinzu: »Ist natürlich absolut lächerlich.«
»Erzähl vom Frühstück«, sagte Nicole.
»Porridge und Kippers. Porridge ist so eine Art Haferschleim, und Kippers sind geräucherte Heringe mit haufenweise Gräten.«
»Das klingt ja ekelhaft.«
»Es hat auch ekelhaft geschmeckt. Aber man mußte es essen.«
»Warum?«
»Das gehörte zu den Regeln.«
»Wie die Mulgrave-Regeln«, warf Faith ein.
Er fragte neugierig: »Was sind die Mulgrave-Regeln?«
Faith warf ihrem Bruder und ihrer Schwester einen Blick zu. »Bleibt Papa aus dem Weg, wenn er schlecht gelaunt ist«, zitierte sie. »Versucht Papa zu überreden, Mama das Haus aussuchen zu lassen.«
»Wenn die Einheimischen feindselig sind«, steuerte Jake bei, »dann sprecht in einer fremden Sprache, um sie durcheinanderzubringen.«
»Und wenn sie richtig gemein sind und Steine auf euch werfen, dann laßt euch nie, nie anmerken, daß es euch weh tut«, schloß Nicole. »Und haltet um jeden Preis zusammen.« Sie sah Guy an. »Bist du immer am selben Ort zur Schule gegangen?«
»Seit ich zwölf war, ja.«
Faith nahm ihm die Ruder ab. »Wir haben nie länger als ein Jahr am selben Ort gelebt. Abgesehen natürlich von La Rouilly. Aber da sind wir immer nur ein paar Monate am Stück. Weißt du, daß wir dich schrecklich beneiden? Du bist ein richtiger Glückspilz.«
»Also, die Schule war in Wirklichkeit reichlich langweilig. Überhaupt nicht beneidenswert.«
Faith richtete ihre bekümmerten graugrünen Augen auf ihn. »Aber deine Sachen waren doch immer am selben Platz. Du hattest deine eigenen Teller und Stühle, nicht das Zeug von anderen Leuten. Du konntest schöne Sachen für dich haben, und sie sind nicht verlorengegangen, du mußtest sie nicht aufgeben, weil sie nicht mehr in den Koffer gepaßt haben. Du hast jeden Tag zur selben Zeit dein Essen gekriegt.« Ihr Ton war beinahe ehrfürchtig. »Und du mußtest nie Socken mit Löchern anziehen.«
»So habe ich das noch nie betrachtet.«
Faith begann, das Boot über den See zu rudern. Mit ihren mageren Armen zog sie die Ruder kraftvoll durch das Wasser. »Ein richtiger Glückspilz«, sagte sie noch einmal.
Im folgenden Sommer kam er wieder nach Rouilly. Faith lag oben auf dem Dach in der Sonne, als sie ihn sah, zunächst nur ein kleines Strichmännchen, dann unverkennbar Guy, der den langen, gewundenen Weg nach La Rouilly heraufkam. Und auch im nächsten Sommer kam er und im Sommer darauf. Und immer fühlte sich Faith für ihn verantwortlich. Sie allein spürte eine Verletzlichkeit bei ihm, eine dunklere Seite hinter der zur Schau getragenen Unbeschwertheit, eine Bereitschaft, die Last der Welt auf seine Schultern zu nehmen. Wenn sie ihn trüber Stimmung antraf, schlug sie kurzweilige Zerstreuungen vor oder neckte ihn einfach so lange, bis sein Gesicht sich aufhellte. Der schönste Moment im ganzen Jahr, dachte sie bei sich, der Moment, den sie am liebsten in Bernstein gefaßt hätte, war der, wenn Guy Neville nach La Rouilly zurückkehrte.
Jeden Sommer schwammen sie im dicken, grünen Wasser des Weihers. Jeden Sommer pflückten sie die wilden Erdbeeren an den Feldrainen und spülten sie mit dem herben Weißwein aus der Schloßkellerei hinunter. Jeden Sommer stellte sich die ganze Familie samt Untermietern und Gutsarbeitern auf der Treppe von La Rouilly auf, wenn Guy mit seiner Brownie-Box ein Gruppenfoto schoß.
Im Sommer 1935 suchten sie im Wald nach Trüffeln. Nicole schlug mit einem Stock lustlos auf das Unterholz ein.
»Wie sehen sie überhaupt aus?«
»Wie schmutzige Steine.«
»Wir brauchen ein Trüffelschwein.«
»Jake hat Genyas Schwein.«
»Ich mag Trüffeln sowieso nicht. Und es ist viel zu heiß, um hier rumzulaufen.« Nicole ließ sich einfach auf den Waldboden fallen, streckte ihre nackten Beine aus und lehnte sich mit dem Rücken an einen Baumstamm. »Spielen wir Scharade.«
»Das geht doch nicht zu zweit.« Faith spähte durch das dunkle Geäst des Waldes. »Ich kann Jake und Guy nirgends sehen.«
»Und das Schwein auch nicht.« Nicole kicherte. »Dann spielen wir eben Gedankenverbindung.«
Gedankenverbindung war ein unheimlich kompliziertes Spiel, das Ralph sich ausgedacht hatte. Faith ließ sich auf einem Ast über Nicole nieder. »Viel zu heiß. Ich hab’ jetzt schon Kopfweh.«
»Dann Lieblingssachen.«
»Na schön. Aber stell mir bloß keine Fragen über Musik. Da kann ich mich nämlich nie erinnern.«
Nicole sah zu Faith hinauf.
»Du mußt die Wahrheit sagen, das weißt du!«
»Ehrenwort!«
»Also, Lieblingsstrand?«
»Zakynthos.«
»Mir hat’s auf Capri besser gefallen. Lieblingshaus?«
»La Rouilly natürlich.«
»Natürlich.«
»Jetzt bin ich dran. Lieblingsbuch?«
»Sturmhöhe. Und mein absoluter Lieblingsheld – natürlich Heathcliff.«
»Mit dem zu leben wäre eine Qual«, sagte Faith. »Er würde sich aufregen, wenn sein Toast angebrannt oder nicht genug Zucker in seinem Kaffee wäre.«
»Und du, Faith?«
»Ich, was?«
»Wer ist dein absoluter Lieblingsheld?«
Faith hockte auf ihrem Ast und baumelte mit den Beinen. Hin und wieder durchdrang ein Sonnenstrahl das Grün der Bäume und blendete sie.
»Die Wahrheit, bitte«, rief Nicole von unten.
»Ach, das ist doch ein blödes Spiel.« Sie sprang auf die Erde.
»He, das ist nicht fair.« Nicole war verärgert. »Du hast es versprochen. Wenigstens mußt du mir sagen, wie er aussieht. Ist er dunkel oder blond?«
»Dunkel.«
»Und seine Augen – blau oder braun?«
Sie dachte, sie sind blaugrün und dunkel wie das Mittelmeer, wenn es im Schatten liegt. Eine unerklärliche Niedergeschlagenheit hatte sie erfaßt, und sie begann zu laufen, rannte durch das dichte Grün aus wildem Knoblauch vor Nicole davon.
Nicoles Stimme folgte ihr. »… gemein von dir, Faith!« Aber sie rannte weiter, den Hang hinunter, bis sie außer Hörweite war.
Die Vegetation wurde dichter und üppiger, als sie die Böschung hinunterlief. Weißschäumender Schierling und Brombeergestrüpp reichten ihr bis zu den Hüften, und Klebkraut riß an ihrem Rock. Sie zog ihn hoch und stopfte ihn in ihren marineblauen Schlüpfer. Hohe grüne Stengel schlugen gegen ihre Oberschenkel. Oben bildeten die Bäume ein dunkles Gewölbe, das hier und dort von einem Strahl glänzenden Lichts durchbohrt wurde. Die Hitze drückte sie nieder wie eine körperliche Last, als sie in die Talmulde hinunterlief. Die Bäume lichteten sich, und Sonnenschein lag auf dem Gewirr von Sträuchern und Büschen. Überall auf Blumen und Blättern sah sie Bläulingsfalter mit sanft wippenden blaßblauen Flügeln sitzen, die von einer dünnen schwarzen Borte umrandet waren. Als Faith näher kam, flatterten sie in die Luft wie kleine Fetzen zarter blauer Seide, die der Wind erfaßt hat.
Die Schlange sah sie nicht, sie lag zusammengerollt unter welken Blättern und Gras. Einen Moment schien die Erde sich unter ihrem Fuß zu winden, dann stach etwas in ihren Knöchel. Sie sah die Schlange davongleiten und blickte hinunter zu den zwei kleinen Einstichen, die sie in ihrer Haut hinterlassen hatte. Merkwürdig, dachte Faith, wie sich schlagartig alles um einen herum verändern kann. Was eben noch erfreulich und alltäglich gewesen war, schien nun finster und bedrohlich. Sie stellte sich vor, wie das Gift durch ihre Adern kroch, ihr Blut verseuchte und ihr Herz zum Stillstand brachte. Voll Angst sah sie sich um, konnte aber im ersten Moment niemanden entdecken. Der Wald schien abweisend, leer, furchteinflößend. Dann sah sie oben auf der Böschung einen Schatten, der sich bewegte. Laut rufend begann sie, den Hang hinaufzuklettern.
»Faith?«
Als sie Guys Stimme hörte, blickte sie in die Höhe. »Ich bin von einer Schlange gebissen worden, Guy.«
»Rühr dich nicht«, sagte er hastig. »Halt dich ganz still.« Und schon rannte er, mit einem Stock Nesseln und Gestrüpp auseinanderschlagend, die Böschung hinunter. Als er sie erreichte, kniete er vor ihr nieder, zog ihr die Sandale vom Fuß und drückte seinen Mund auf ihren Knöchel, um die Wunde auszusaugen. Hin und wieder hielt er inne und spie das Gift ins Gras. Nach einer Weile überfiel Faith eine innerliche Kälte, die sie frösteln machte, und Guy zog seine Jacke aus und legte sie ihr um. Dann hob er sie auf seine Arme.
Ihr Fuß tat so weh, als hätte ihn jemand mit einem Hammer zertrümmert. Die Sonne, die sie durch das dunkle Geäst der Bäume sehen konnte, war eine metallische, gleißende Scheibe, die im Gleichtakt mit ihrem schmerzenden Fuß pulsierte. Guy, der sie fest in den Armen hielt, lief, die tiefhängenden Äste mit den Schultern aus dem Weg stoßend, durch den Wald so schnell er konnte. Als sie den Schutz der Bäume hinter sich ließen, traf die Glut der Sonne sie mit voller Kraft. Hitze und Dürre hatten aus dem Rasen ein braches Feld rissiger Erde gemacht; die Grashalme waren strohige gelbe Stoppeln. Der Himmel selbst schien zu glühen. Poppy, die im Gemüsegarten Unkraut jätete, schrie laut auf, als sie Guy mit Faith kommen sah, und rannte ihnen über die verdorrte Rasenfläche entgegen.
Die nächsten Tage brachte Faith auf dem mitgenommenen alten Sofa in der Küche zu, den Fuß hochgelagert auf einem Turm von Kissen. Die »Untermieter« bemühten sich nach Kräften, ihr die Zeit zu vertreiben. »Felix hat mir vorgesungen«, berichtete sie Guy, »und Luc und Philippe haben mit mir Poker gespielt, und die Kinder waren natürlich alle hier, um sich den Schlangenbiß anzusehen. Ich bin das gar nicht gewöhnt, Guy – sonst bekommen immer Nicole und Jake die geballte Aufmerksamkeit, weil sie hübscher sind als ich und begabter und überhaupt viel liebenswerter.«
Das Erbe der Mulgraves und der Vanburghs hatte sich bei Faith in einer Ausformung niedergeschlagen, die dem konventionellen Bild von Schönheit nicht entsprach. Faith war verzweifelt über ihre hohe, knochige Stirn, ihr helles Haar, das weder richtig lockig war noch glatt, und ihre onyxgrünen Augen, deren Blick stets bekümmert wirkte, ganz gleich, wie ihr zumute war.
Guy zauste ihr das Haar. »Da hast du wohl für mich gar keine Zeit mehr.«
Sie sah ihn an. »Oh, für dich habe ich immer Zeit, Guy. Du hast mir das Leben gerettet. Das heißt, daß ich immer in deiner Schuld stehen werde. Ich gehöre jetzt für immer dir, nicht wahr?«
Im Herbst reisten sie nach Spanien. Drei von Ralphs Freunden hatten dort einen Bauernhof gekauft und waren wild entschlossen, mit dem Anbau von Safran ein Vermögen zu machen. »Das Zeug wird mit Gold aufgewogen, Poppy«, erklärte Ralph. Sie hatten früher schon einmal eine Weile in Spanien gelebt, in Barcelona und Sevilla, und Poppy freute sich auf blaues Meer, Zitronenbäume und Springbrunnen in schattigen Innenhöfen.
Sie war entsetzt, als sie den Hof sah, auf dem sie in Zukunft zusammen mit Ralphs Freunden leben sollten. Das Haus, ein weitläufiger flacher Bau, der völlig verwahrlost wirkte, stand am Rand eines Dorfs auf einer weiten Ebene. Die kleinen Fenster blickten auf Meilen konturlosen Landes hinaus, so ausgedörrt, daß Poppy sich nicht vorstellen konnte, daß hier je etwas wachsen würde. Die einzigen Farben unter dem blassen Himmel waren Rot, Ocker und Braun. Im Dorf lebten klapprige alte Esel und arme Bauern, deren Lebensweise, dachte Poppy, sich seit den Zeiten der Pest wohl kaum verändert hatte. Wenn es regnete, wurde der Staub zu beinahe knietiefem Schlamm. Schlamm war überall; selbst die Hütten der Bauern schienen aus Schlamm gemacht.
Im Haus gab es weder fließendes Wasser noch einen Herd. Das Wasser mußte am Dorfbrunnen geholt, das Essen am offenen Feuer zubereitet werden. Die Safranpflanzer, alles Männer, schienen bisher von ungesäuertem Brot und Oliven gelebt zu haben – im ganzen Haus lagen Brotkrusten und Olivensteine herum. Einer von Ralphs Freunden sagte, als er Poppy die Küche zeigte: »Ich bin wirklich froh, daß du da bist. Du kannst uns endlich mal was Richtiges kochen.«
Poppy sah sich in der Küche um und hätte am liebsten die Flucht ergriffen.
Am Ende der ersten Woche erklärte sie Ralph, dieses Leben sei unmöglich. Er sah sie verständnislos an. »Schau dir doch das Haus an«, erläuterte sie. »Das Dorf. Dieses kalte, von Armut gebeutelte Land.« Sie müßten hier weg, sie müßten in die zivilisierte Welt zurückkehren.
Ralph war verwirrt. Das Haus sei doch ganz in Ordnung, die Menschen, mit denen sie zusammenlebten, ebenso. Warum um alles in der Welt sollten sie von hier weggehen?
Poppy begann zu streiten, und Ralph wurde wütend. Ihre Stimmen schwollen an, schallten durch das ganze Haus und brachen sich an den rußgeschwärzten Decken. Ralph blieb stur – sie würden ein Vermögen machen, wenn sie nur Geduld hätte, und außerdem habe er ihr gesamtes gemeinsames Einkommen aus seinen Tantiemen und der Hinterlassenschaft von Poppys Vater in Knollen und Ausrüstung angelegt. Sie könnten gar nicht weggehen. Als Poppy in wildem Zorn einen Teller nach ihm warf, floh Ralph auf seine Safranfelder und betäubte seine verletzten Gefühle mit einer Flasche sauren Weins.
Poppys Zorn löste sich in tiefe Niedergeschlagenheit auf, sobald sie allein war. Sie ließ sich auf den nächsten Stuhl fallen und weinte. In den folgenden Wochen tat sie ihr Bestes, um das Haus ein wenig wohnlicher zu machen, aber es widerstand all ihren Bemühungen. Ralphs Freunde hinterließen mit zermürbender Regelmäßigkeit ihre schmutzigen Fußstapfen in jedem Zimmer; das Küchenfeuer, das die Kälte und die Feuchtigkeit nicht vertrug, pflegte unweigerlich im ungünstigsten Moment auszugehen. Frischgewaschene Leintücher und Handtücher wurden stockig, bevor sie trockneten. Sie litt darunter, daß keine Frau ihres Alters auf dem Hof war, mit der sie sich hätte austauschen können.
Als der Winter endlich dem Ende zuging und ein zaghafter Frühling sich ankündigte, begann ihr heftiges Unwohlsein zu schaffen zu machen. Zwölf Jahre waren vergangen, seit sie Nicole, ihr letztes Kind, geboren hatte, darum kam sie zunächst gar nicht auf den Gedanken, daß sie noch einmal schwanger sein könnte. Sie schrieb die wiederkehrenden Anfälle von Übelkeit und die Lethargie, die sie plagten, der verhaßten Umgebung zu, dem immer feuchten Haus und der tristen Landschaft. Aber als sie nach einigen Monaten einen Arzt in Madrid aufsuchte, eröffnete der ihr, daß sie schwanger sei und das Kind im September zur Welt kommen werde. Poppy atmete auf vor Erleichterung: Ihr Kind würde in La Rouilly geboren werden, und der gute alte Dr. Lepage würde ihr beistehen.
Wenn auch manches in ihrem Leben mit Ralph sich nicht so entwickelt hatte, wie sie es erwartet hatte (aber was hatte sie überhaupt erwartet, als sie vor so langer Zeit mit ihm nach Paris durchgebrannt war?), so hatte sie doch ihre Schwangerschaften und die Zeit, als ihre Kinder klein gewesen waren, immer sehr genossen. Jetzt noch ein Kind zu bekommen, welch ein herrlicher Luxus! Ihre ersten drei waren so rasch hintereinander geboren, daß sie nach Nicoles Geburt beinahe zu erschöpft gewesen war, um sich rückhaltlos an dem Kind zu freuen. Poppy strickte kleine Jäckchen, nähte Nachthemdchen und träumte von Frankreich und ihrem kleinen Sohn, der in der Wiege neben ihrem Bett lag. Sie war sicher, daß sie einen Jungen zur Welt bringen würde.
Und tatsächlich brachte sie einen Jungen zur Welt, aber nicht in Frankreich, sondern in Spanien. Ihr Sohn wurde zwei Monate zu früh geboren, in dem Schlafzimmer, das sie mit Ralph teilte. Es gab im Umkreis von fast hundert Kilometern keinen Arzt; eine schwarzvermummte Frau aus dem Dorf stand ihr bei der Entbindung bei. Poppy hatte keine Wiege, aber wie das Schicksal es wollte, brauchte sie auch keine. Das Kind lebte nur wenige Stunden. Ihren kleinen Sohn im Arm lag sie im Bett und glaubte, ihn mit ihrer Willenskraft am Leben erhalten zu können. Er war zu schwach, um von ihrer Brust zu trinken. Die Hebamme bestand darauf, einen Priester zu holen, der das Kind auf den Namen Philip taufte, nach Poppys Lieblingsonkel. Als der Junge schließlich aufhörte zu atmen, nahm Ralph ihn weinend aus Poppys Armen.
Eine Woche später schlug Ralph vor, sie sollten vorzeitig nach Frankreich abreisen. Poppy weigerte sich. Sie hatte seit Philips Geburt und Tod kaum gesprochen; jetzt sagte sie klar und deutlich nein. Als Ralph ihr erklärte, daß sich der Boden als ungeeignet für den Anbau von Safran erwiesen hatte und das Haus vielen seiner Freunde zu abgelegen war, um auf Besuch zu kommen, daß er außerdem einen ganz neuen fabelhaften Plan hätte, wie der finanzielle Verlust, den sie erlitten hatten, wieder wettgemacht werden könne, schüttelte sie nur den Kopf. Den ganzen Tag saß sie auf der Veranda im Schatten und starrte auf die verdorrten Überreste der Pflanzen auf dem Feld und zum fernen Friedhof.
Mitte Juli, als in Madrid der Bürgerkrieg ausbrach, drängte Ralph sie von neuem zur Abreise. Wieder lehnte Poppy ab. Erst als einer von Ralphs Freunden ihr klarmachte, daß das Chaos, das Spanien zu überrollen drohte, eine Gefahr für die Kinder sei, erlaubte sie Faith, die Sachen zu packen.
Zwei Tage später brachen sie auf, reisten zunächst über Land nach Barcelona und von dort aus auf einem Schiff voller Flüchtlinge, Soldaten und Nonnen nach Nizza. Poppy, die an Deck saß und die spanische Küste langsam hinweggleiten sah, war, als würde ihr das Herz aus dem Leib gerissen.
In La Rouilly versuchte sie, Genya zu erklären, wie sie sich fühlte. »Ich mußte ihn ganz allein dort zurücklassen, an diesem schrecklichen Ort. Es ist furchtbar, ihn dort ganz allein zu wissen.« Poppy brach ab und zwinkerte heftig. »Das Leben dort war grauenhaft. Ich dachte, ich würde wahnsinnig werden. So trostlos und trist, und alle schienen bettelarm zu sein. Ich habe in der Zeitung gelesen, daß sie jetzt die Kirchen niederbrennen und die Priester töten, und ich muß ständig denken – ich denke dauernd, was ist, wenn sie die Gräber schänden, Genya? Was, wenn –« Poppy umklammerte Genyas schmales Handgelenk. Sie sah aus, als würde sie gleich zusammenbrechen.
Genya drückte sie an sich. Poppy wurde vom Weinen geschüttelt. Nach einer Weile schenkte Genya ihr ein Glas Kognak ein und drückte es ihr in die zitternde Hand.
»Trink, Poppy, Liebes – damit dir wieder warm wird. Ich habe eine Cousine in Madrid. Wenn du mir den Namen des Dorfes sagst, in dem ihr gelebt habt, kann Manya vielleicht hinfahren und nachsehen, ob alles in Ordnung ist.«
Poppy starrte sie an. »O Genya! Wirklich? Würdest du das tun?«
»Es kann allerdings eine Weile dauern. Wohin will Ralph denn diesen Herbst?«
Poppy zuckte die Achseln. »Das weiß ich nicht. Du kennst ihn doch – ich erfahre es erst an dem Tag, an dem er mir sagt, ich soll packen.« Ihr Ton war bitter. »Vielleicht gehen wir an die Riviera. Ralph mag die Riviera im Winter.«
»Dann schreibe ich dir postlagernd nach Nizza, sobald ich etwas gehört habe.«
Poppy stand auf und ging zum Fenster. Mit schleppender Stimme sagte sie: »Weißt du, Genya, daß ich neulich morgens die Läden aufgemacht habe und nicht wußte, in welchem Land ich bin? Nach einiger Zeit beginnt alles gleich auszusehen. Bäume mit welkendem Laub und Felder, auf denen nichts zu wachsen scheint, und armselige kleine Häuser. Es beginnt alles gleich auszusehen.«
Aber sie sagte Genya nicht, wie heftig sie Ralph grollte: Das konnte sie keinem Menschen sagen. Der Groll war wie etwas Lebendiges, eine verzehrende Leidenschaft, stärker selbst als ihr Schmerz, und sie nährte ihn ständig. Obwohl sie wußte, daß es ungerecht war, Ralph die Schuld an Philips Tod zu geben – schließlich hatte ihr Körper das Kind zu früh ausgetrieben –, blieb der Groll unvermindert. Wenn er sie nicht an diesen fürchterlichen Ort geschleppt hätte; wenn er nicht darauf bestanden hätte zu bleiben, obwohl sie ihn angefleht hatte, abzureisen. Sie tat etwas, was sie nie zuvor getan hatte: Sie schlief nicht mehr mit ihm, sagte, sie habe sich von den Strapazen der Entbindung noch nicht erholt. Es war ihr eine Genugtuung, Ralphs gekränktes Gesicht zu sehen, wenn sie seine Zärtlichkeiten zurückwies.
Diesen Winter verbrachten sie in Marseille, in einer gemieteten Wohnung im alten Teil der Stadt. Ralph war mit seinem neuesten Projekt beschäftigt, dem Verkauf marokkanischer Teppiche. Poppy reiste jeden Monat einmal nach Nizza und fragte auf der Post nach einem Brief. Er traf im Februar ein. Genya schrieb: »Meine Cousine Manya konnte das Dorf besuchen, wo ihr gelebt habt. Die Kirche und der Friedhof sind unversehrt, Poppy. Manya hat Blumen auf das Grab gelegt.«
Allein auf der Promenade, den Blick auf den Kiesstrand gerichtet, weinte Poppy. Nach einer Weile wurde ihr bewußt, daß die grauen Wellen und der verhangene Himmel sie an jenen lang vergangenen Urlaub in Deauville im Jahr 1920 erinnerten. Sie wußte – wußte es schon seit einigen Wochen –, daß Ralph, verletzt durch ihre Kälte, mit einer jungen Frau namens Louise, die bei ihnen zu Gast war, ein Verhältnis angefangen hatte. Louise, ein albernes junges Ding, schwärmte Ralph mit einer kritiklosen Bewunderung an, die Balsam für seine gekränkte Eitelkeit war. Poppy wußte, daß sie jetzt die Wahl hatte: Sie konnte Ralph weiterhin bestrafen und ihn so Louise oder deren Nachfolgerin in die Arme treiben; oder sie konnte sich ihm wieder zuwenden und ihm zeigen, daß sie ihn immer noch liebte, auch wenn manches sich verändert hatte. Sie dachte an ihre Kinder, und sie erinnerte sich eines Mannes, der am Strand eine Sandburg gebaut hatte: ein Werk der Vergänglichkeit, aber von einer Schönheit, die sie ergriffen hatte. Poppy schneuzte sich, wischte die Tränen weg und machte sich auf den Weg zum Bahnhof.
Zu Hause zeigte sie Ralph Genyas Brief. Er sagte nichts, sondern ging zum Fenster und blieb dort mit dem Rücken zu ihr stehen. Aber sie sah, daß das Blatt Papier in seinen Händen zitterte. Sie ging zu ihm, legte ihm die Arme um die gebeugten Schultern und küßte seinen Nacken. Sie bemerkte, daß er fülliger geworden war und daß sein Haar jetzt mehr grau als blond war. Obwohl sie dreizehn Jahre jünger war als Ralph, fühlte sie sich in diesem Moment ebensoviel älter. Lange Zeit blieben sie so stehen und hielten einander umschlungen, dann gingen sie zu Bett und liebten sich.