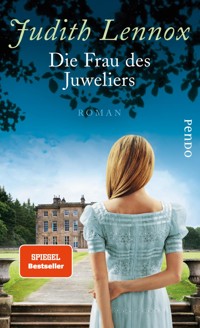9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Gartenpavillon der Familie Summerbayes, genannt »Winterhaus«, ist ein Ort der Zuflucht für drei Freundinnen, die während der turbulenten Jahre zwischen den Weltkriegen in der idyllischen Umgebung von Cambridge aufwachsen. Die drei Mädchen schwören, einander ein Leben lang alles anzuvertrauen und zusammenzuhalten – aber das Schicksal lässt sie ganz unterschiedliche Wege einschlagen …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Übersetzung aus dem Englischen von Mechtild Sandberg
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe19. Auflage 2010
ISBN 978-3-492-95347-4
© Judith Lennox 1996
Titel der englischen Originalausgabe:
»The Winter House«, Corgi Books / Transworld Publishers Ltd., London 1996
© der deutschsprachigen Ausgabe:
Piper Verlag GmbH, München 1998
Umschlagkonzept: semper smile, München
Umschlaggestaltung: Cornelia Niere, München
Umschlagabbildung: plainpicture / Millennium
Datenkonvertierung E-Book: CPI
Teil 1
1918–1930
1
Den Rest ihres Lebens haßte sie Schnee. Er begann vor Morgengrauen zu fallen, und um elf, als die Telegramme eintrafen, hatte er die vertraute Londoner Landschaft gebleicht.
Vater und Mutter waren den ganzen Tag aus, es öffnete daher niemand die Telegramme. Sie blieben auf dem Tisch im Vestibül liegen: erschreckend, bedrohlich. Dennoch verlief Robins Tag wie immer. Am Vormittag Unterricht bei Miss Smith, Mittagessen und Mittagsschlaf und dann ein Nachmittagsspaziergang im Park. Als Robin abends um halb neun zu Bett ging, war sie gewiß, daß alles in Ordnung sei. Wie könnte das Leben seinen normalen Lauf nehmen, wenn Stevie oder Hugh etwas zugestoßen wäre?
Später überlegte sie oft, was sie geweckt hatte. Es konnte nicht der Jammerschrei ihrer Mutter gewesen sein – das Haus war zu groß, zu solide gebaut, als daß ihr Schrei Robins Schlafzimmer hätte erreichen können. Jedoch plötzlich hellwach, kletterte sie aus dem Bett und schlich auf nackten Füßen in ihrem Nachthemd leise nach unten. Das Vestibül war leer, trübe erleuchtet von einer einzigen elektrischen Lampe.
»Stevie – Hugh – alle beide …« Robin erkannte die Stimme ihrer Mutter kaum wieder.
»Wir fahren gleich in aller Frühe ins Krankenhaus, Liebes.«
»Meine Söhne – meine schönen Söhne!«
Robin ließ die Klinke der Wohnzimmertür los. Sie ging durch den Flur zurück ins Eßzimmer und trat durch die breite Terrassentür ins Freie. Sie blieb nicht stehen; auf kleinen bloßen Füßen stapfte sie durch den Schnee bis zum Ende des Gartens.
Zwischen den Rhododendren und den Überresten alter Gartenfeuer stehend, blickte sie zum Haus zurück. Es hatte endlich aufgehört zu schneien. Der Mond stand in unheilvollem Gelb-Orange an einem schwarzen Himmel. Das Haus, das Robin ihr siebenjähriges Leben lang kannte, hatte nichts Vertrautes mehr. Es hatte sich von Grund auf verändert, erblaßt im Schnee und von bronzefarbenem Licht umrissen. Sie spürte instinktiv, daß alles sich verändert hatte, daß der Winter durch Backstein und Ziegel ins Haus eingedrungen war und die Räume mit Frost überzogen hatte.
Sie sagten ihr, daß zwar Stevie niemals aus Flandern heimkehren, Hugh jedoch nach Hause kommen würde, sobald es ihm gut genug ginge. Richard und Daisy Summerhayes reisten unverzüglich zu dem Feldlazarett ab, in dem Hugh um sein Leben kämpfte, und ließen Robin in der Obhut von Miss Smith. Später wurde Hughs langsame Genesung zum Maß der verstreichenden Zeit. Sie schwankten ständig zwischen Hoffnung und Verzweiflung. Die dunkle Zeit unmittelbar nach dem Eintreffen der Telegramme; die Trauerfeier für Steven, die Robin als ein wirres Durcheinander von Blumen, Gesang und Tränen erlebte. Das hatte nichts zu tun mit Stevie, ihrem strahlenden und geliebten großen Bruder. Zuversicht, als Hugh die ersten Schritte machte und als er aus dem Lazarett nach Hause kam. Eine Wiederkehr der Dunkelheit nach seinem Zusammenbruch. Nach dieser zweiten Heimkehr änderte sich vieles: Das Haus wurde ordentlicher, weil Unordnung bei Hugh Angst und Widerwillen hervorrief. Richard Summerhayes gab seine politischen Ambitionen auf, und die Ziele, die er für seine Söhne gehabt hatte, wurden auf seine Tochter übertragen. Robin – nicht Steven, nicht Hugh – würde nach Cambridge gehen und Altphilologie studieren wie einst Richard. Der Strom von Gästen, die zum Londoner Haus der Summerhayes' zu pilgern pflegten – zu den Madrigal-Abenden, den Lyriklesungen, den politischen Diskussionen –, wurde eingedämmt, weil Hugh keinen Lärm vertrug. Richard kaufte ein Automobil, um seinen Sohn aus der Geborgenheit, in die er sich zu Hause vergrub, herauszulocken. Ihr lärmendes, fröhliches Leben gehörte der Vergangenheit an, wurde zurückgezogen und still.
Dennoch wurde Hugh nicht richtig gesund. Sein Arzt erklärte Richard und Daisy mit Nachdruck, daß ihr Sohn vor allem Frieden und Ruhe brauche. Richard Summerhayes begann, sich nach einer anderen Stellung umzusehen, und bekam schließlich das Angebot, die Leitung der humanistischen Abteilung einer Knabenschule in Cambridge zu übernehmen. Obwohl es eine Einkommenseinbuße mit sich brachte, nahm er das Angebot an, weil er die Stille und Weite der Fens selbst erlebt hatte.
Die gepflügten Felder waren schwarze, konturlose Rechtecke. Graue Schatten lagen wie Schmutz auf Dämmen und Wegen. An den geschützten Abhängen und in Furchen hielt sich noch Reif, und die Sonne war, wenn sie an diesem Tag überhaupt aufgegangen war, verschwunden.
Das Automobil rumpelte klappernd auf der Straße dahin. Das Land war so flach, daß Robin Summerhayes das Haus sehen konnte, lange bevor sie es erreichten. Ihr Groll nahm zu, als das klobige gelbe Gebäude langsam größer wurde. Als ihr Vater schließlich bremste, mußte sie sich auf die Lippen beißen, um nichts zu sagen.
Die Sorge ihrer Eltern galt wie immer Hugh. Bemüht, kein Aufhebens um ihn zu machen, dennoch besorgt, ob seine angeschlagenen Nerven die Reise vertragen hatten. Robin betrachtete das Haus. Es war ein viereckiger Kasten mit vier Fenstern und einer Tür, wie eine Kinderzeichnung. Drinnen gingen Küche, Eßzimmer, Wohnzimmer, Arbeitszimmer und Vestibül von einem schmalen dunklen Flur ab. Ihre Möbel waren schon aufgestellt, aber Kartons mit Porzellan, Wäsche, Kleidern und Büchern standen überall herum.
»Dein Zimmer, Robin«, sagte Daisy Summerhayes aufmunternd, als sie im oberen Stockwerk eine Tür öffnete.
Das Zimmer wirkte, wie der Rest des Hauses, so kalt und traurig wie ein Raum, der allzulange leer gestanden hat. Die Tapete war verblichen, und Robins vertraute Möbel schienen alle nicht richtig hineinzupassen.
»Es muß natürlich gestrichen werden«, bemerkte Daisy, »und ich nähe dir neue Vorhänge. Na, was meinst du, Schatz? Es ist doch hübsch, nicht?«
Am liebsten hätte sie geschrien: »Es ist scheußlich! Ich hasse es!«, aber sie tat es nicht aus Rücksicht auf den armen Hugh. Sie murmelte unfreundlich: »Es geht schon« und rannte hinaus.
In Blackmere Farm gab es weder elektrischen Strom noch Gas, noch fließendes Wasser. Auf den Regalen in der Spülküche standen reihenweise Petroleumlampen, und der einzige Wasserhahn über dem Keramikspülbecken wurde vom Brunnen gespeist. Robin stieß die Hintertür auf und dachte wütend, daß sich die Familie Summerhayes, als sie sich von London verabschiedet hatte, gleichzeitig von der Zivilisation verabschiedet hatte.
Draußen musterte sie finster den Garten, den großen, verwilderten Rasen und die ungepflegten Blumenbeete. Der ferne Horizont hing tief und war schnurgerade, und die Schwärze der Felder verschmolz mit den Wolken. Robin lief auf einen schmalen Streifen silbrigen Graus zu. Die Feuchtigkeit des hohen Grases durchnäßte ihre Schuhe und Strümpfe. Als sie den Fluß erreichte, blieb sie stehen und sah durch das Schilf in klares, dunkles Wasser hinunter. Eine Stimme in ihrem Kopf meinte, wie herrlich es wäre, hier im Sommer zu schwimmen, doch Robin achtete nicht auf sie und dachte statt dessen an London. Sie hatte den Lärm und die Betriebsamkeit geliebt. Dieses Haus dagegen schien wie von einer riesigen öden Wüste umgeben. Nein – keine Wüste, es tropfte und gluckste hier ja überall. Ein Moor. Wenn sie sich umsah, konnte sie weit und breit keine anderen Menschen oder Häuser sehen.
Aber so ganz stimmte das nicht. Flußabwärts stand eine große Holzhütte. Robin stapfte die Böschung entlang hin.
Die überdachte Veranda der Hütte ragte über das Wasser, das sich hier in einem tiefen kreisrunden, von Schilf umkränzten Becken sammelte. Robin kletterte auf die Veranda. Efeu überwucherte das Geländer, schlängelte sich an den überlappten Holzdielen entlang, verhängte das Fenster. Sie rieb das staubige Glas mit dem Ärmel ab und spähte ins Innere. Dann drehte sie den Türknauf. Zu ihrer Überraschung ging die Tür knarrend auf. Ein paar Efeuranken rissen ab. Spinnweben setzten sich klebrig in Robins Haar, als sie eintrat. Etwas Kleines, Dunkles huschte über den Boden.
Sie hatte es für ein Sommerhäuschen gehalten, wußte aber sofort, daß es das nicht war. In der Mitte des Raums stand ein eiserner Ofen. Robin kniete vor ihm nieder, öffnete die rostige Tür, und ein Rinnsal Asche sickerte ihr auf die Knie. Sommerhäuser hatten keine Kohleöfen.
An der Wand hinter dem Ofen waren Bücherregale. Ein von Fliegenkot gesprenkelter Spiegel mit einem Rahmen aus großen, flachen Muscheln hing an einer anderen Wand. Als Robin hineinblickte, tat sie es mit der verstiegenen Vorstellung, daß ein anderes Gesicht ihr begegnen könnte, nämlich das Gesicht der Person, die in dem Eisenbett an der Wand geschlafen und sich an dem Feuer des Ofens gewärmt hatte. Aber sie sah nur ihr eigenes Gesicht – dunkelbraune Augen, hellbraunes Haar, auf einer Wange eine graue Spinnwebe. Sie setzte sich auf eine Ecke des Bettgestells, zog ihren Pullover über die Knie und stützte das Kinn in die Hände. In der Ferne hörte sie die Stimmen ihres Vaters und Hughs, und ihre Gedanken wurden zurückgezogen zu jenem schrecklichen Tag im Jahr 1918. Sechs Jahre war das jetzt her, aber sie erinnerte sich immer noch mit schrecklicher Klarheit an jenen Tag, an dem die Telegramme gekommen waren. Für so vieles waren sie die Ursache gewesen: für Richard Summerhayes' und Robins Pazifismus und für dieses Exil. Ihr Zorn schwand, und als sie draußen Schritte hörte, rieb sie sich mit dem Ärmel die Augen.
»Da bist du, Rob.« Hugh schaute zur Tür herein. »Was ist denn das für ein finsteres Loch?«
Hugh war über einen Kopf größer als Robin, und sein welliges Haar war heller. Seine hellbraunen Augen lagen tief in einem schmalen Gesicht mit hohen Wangenknochen und einer scharfen Nase.
»Ich hätte es gern für mich.«
Hugh sah sich skeptisch um, musterte den Ofen, das Bett, die Veranda.
»Die Bude muß für eine Schwindsüchtige gebaut worden sein. Sie hat bestimmt das ganze Jahr hier draußen gelebt, das arme Ding.«
Robin fiel auf, daß Hugh genau wie sie vermutete, in der Hütte müsse früher eine Frau gewohnt haben. Durch den Spiegel vielleicht.
»Es ist ein Winterhaus, stimmt's, Hugh? Kein Sommerhaus.«
Hugh lachte, aber er sah müde und blaß aus. »Es sollte abgerissen und niedergebrannt werden, Robin. Ich meine – Tuberkulose …«
»Ich mach es sauber. Ich schrubb es von oben bis unten mit Desinfektionsmittel.«
Einer der kleinen Muskeln neben Hughs Auge zuckte. Robin nahm ihren Bruder bei der Hand und führte ihn auf die Veranda hinaus.
»Schau«, sagte sie leise.
Die Welt lag vor ihnen ausgebreitet. Rauhreif hing an den Schilfgräsern und machte jede Rispe zu einem kleinen Wimpel. Die Sonne schien durch die lichter werdenden grauen Wolken, und in der dunklen Wasserfläche vor der Veranda spiegelten sich Schilf, Sonne und Himmel.
»Im Sommer«, sagte sie, »werden wir ein Boot haben und bis in alle Ewigkeit rudern. Wir werden uns hoffnungslos verirren.«
Hugh sah zu seiner Schwester hinunter und lächelte.
In dieser Verbannung begann sie, alle möglichen Dinge zu sammeln, und bewahrte sie im Winterhaus auf. Körbe mit blassen Muscheln; Marmeladengläser voll langer Schweiffedern; die abgeworfene Haut einer Schlange, spröde und trocken; einen Kaninchenschädel aus papierfeinem weißem Bein. Sie sammelte auch Menschen, und ihre Wißbegierde, ihr brennendes Interesse daran, wie andere lebten, trugen ihr häufig Zurechtweisungen von Daisy ein. Es ist ungezogen, andere Leute anzustarren, Robin. Was für Fragen! Die Frau, die zum Putzen ins Haus kam, der Mann, der am Fluß Weidenruten sammelte und Aalfallen aus ihnen machte, der Hausierer, der vom Krieg traumatisiert auf einem Bein von Dorf zu Dorf humpelte und Wäscheklammern und Streichhölzer verkaufte – mit allen unterhielt sie sich endlos.
Und Helen und Maia. Robin begegnete Maia Read im ersten Halbjahr in der Schule und Helen Ferguson im folgenden Sommer, als sie auf dem Fahrrad die Fens durchstreifte. Maia war dunkel und schön und selbst in der gräßlichen Schulturnhose elegant. Sie war scharfsinnig und auf eine stille Weise rebellisch und interessierte sich nicht im entferntesten für die Politik, die Robins Leidenschaft war.
Helen wohnte im benachbarten Weiler Thorpe Fen. Als Robin sie auf dem Weg von der Bushaltestelle zu ihrem Haus das erstemal sah, trug sie ein weißes Kleid, weiße Handschuhe und einen Hut, wie Robins dunkler Erinnerung nach ihre Mutter ihn vor dem Krieg getragen hatte.
Helen sagte höflich: »Sie gehen sicher in die Lukaskirche, Miss Summerhayes. Das ist von Blackmere aus näher, nehme ich an.«
»Wir gehen nicht zur Kirche. Wir sind Agnostiker. Die Religion ist nur ein Mittel, um die soziale Ordnung zu bewahren«, erklärte Robin, die ihr Fahrrad den durchfurchten Trampelpfad entlangschob, genau in dem Moment, als Helen mit rotem Gesicht ein großes gelbes Backsteinhaus erreichte und eine Pforte mit dem Schild »Pfarrhaus« aufstieß.
Irgendwie, obwohl so vieles gegen sie sprach, überlebte die Freundschaft und gedieh. Maia und Helen wurden bald in das geschäftige Leben der Familie Summerhayes eingespannt. Eine Entschädigung, dachte Robin oft, für die schreckliche Unwirklichkeit der Fens.
Im warmen Frühling 1928 hockten sie auf Kissen auf der Veranda des Winterhauses und freuten sich auf ein freies Leben.
»Nur noch ein Halbjahr«, sagte Robin. Die Arme um die hochgezogenen Beine geschlungen, lehnte sie an der Wand und kaute auf einer Haarsträhne. »Dann sind wir erwachsen. Nie wieder Lacrosse. Nie wieder lächerliche Regeln und Vorschriften.«
»Ich heirate mal einen reichen Mann«, sagte Maia. »Dann wohne ich in einem gigantischen Haus mit ganz vielen Bediensteten. Ich habe die tollsten Kleider – Vionnet, Fortuny, Chanel …« Maias helle blaue Augen waren halb geschlossen. Licht und Schatten spiegelten sich auf ihrem schönen Profil. »Alle Männer werden sich in mich verlieben.«
»Das tun sie doch jetzt schon«, bemerkte Robin säuerlich. Es war eine Qual, mit Maia durch Cambridge zu gehen: Köpfe drehten sich, Botenjungen fielen von ihren Fahrrädern. Sie beschattete ihre Augen und sah blinzelnd aufs Wasser. »Ich hole meinen Schwimmanzug. Es ist bestimmt warm genug.«
Sie lief durch den Garten und verschwand im Haus. In ihrem Zimmer warf sie ihre Kleider ab und schlüpfte in ihren Schulbadeanzug, schwarz und unförmig, auf dem Rücken mit »R. Summerhayes« bestickt. Als sie über den Rasen zurückrannte, hörte sie von der Veranda her Helens Stimme.
»Ich wünsch mir ein kleines Haus. Nichts Großartiges. Und Kinder natürlich.«
»Ich will nie Kinder haben.« Maia hatte ihre Strümpfe ausgezogen und ließ ihre nackten Beine von der Sonne bräunen. »Ich kann Kinder nicht ausstehen.«
»Daddy hat gesagt, wir müssen Mrs. Lunt entlassen. Sie trinkt. Ich glaube, Daddy wäre froh, wenn sie abschwören würde, obwohl das natürlich ziemlich Low Church ist.« Helens Stimme war gedämpft. Zwei Stufen auf einmal nehmend, sprang Robin die Holztreppe hinauf. »Daddy sagt, ich bin jetzt alt genug, um das Haus zu führen. Ich bin ja schließlich schon achtzehn.«
»Aber du kannst doch nicht …« Robin starrte sie entsetzt an. »Ich meine … abstauben … die Basare veranstalten und all das. Das kannst du doch nicht, Helen. Ich könnte es nie. Lieber würde ich sterben.«
»Ach, es ist ja nicht für immer. Nur bis wir die richtige Lösung gefunden haben. Und Briefe schreibe ich gern. Daddy hat gesagt, er kauft mir vielleicht eine Schreibmaschine.«
»Wir dürfen nie die Verbindung untereinander verlieren.« Robin schlüpfte unter dem Holzgeländer der Veranda hindurch und blieb einen Moment zum Sprung bereit über dem dunklen, glasigen Wasser stehen. »Wir müssen einander versprechen, daß wir jeden wichtigen Meilenstein im Leben einer Frau zusammen feiern.«
Sie ließ das Geländer los und sprang ins Wasser. Die Kälte raubte ihr fast den Atem, und als sie die Augen öffnete, konnte sie über sich gedämpftes, grünschimmerndes Licht sehen. Sie stieß durch die Wasseroberfläche ins Sonnenlicht und schüttelte den Kopf, daß die Wassertropfen wie Glasperlen um sie flogen.
Maia sagte: »Wir müssen unsere erste Arbeitsstelle feiern –«
»Die Hochzeit.«
»Ich hab nicht vor zu heiraten.« Robin, die im Teich Wasser trat, warf ihr nasses Haar zurück.
»Dann eben den Tag, an dem wir die Unschuld verlieren«, sagte Maia lachend. Sie zog ihren Trägerrock über ihren Kopf und hängte ihn über das Verandageländer.
»Maia«, flüsterte Helen. »Du kannst doch nicht –«
»Nein?« Maia knöpfte ihre Bluse auf, faltete sie ordentlich und legte sie neben den Trägerrock. Nur in ihrem Hemdhöschen stand sie groß und langbeinig auf der Veranda.
»Du hast doch auch vor, deine Unschuld zu verlieren, oder, Robin?«
Helen wandte sich ab, rot vor Verlegenheit.
Robin begann auf dem Rücken über den Teich zu schwimmen. »Ich denke schon. Wenn ich einen Mann auftreiben kann, der nicht erwartet, daß ich ihm die Hemden wasche und die Knöpfe annähe, nur weil er in mich verknallt ist.«
Maia sprang wie von der Sehne geschnellt. Es spritzte kaum, als sie ins Wasser eintauchte. Sie schwamm Robin entgegen. »Ich glaube nicht, daß irgendein Mann das von dir erwarten würde, Robin, mein Schatz.« Sie schnippte mit dem Finger gegen den losen Knopf, der vom Träger des unförmigen Schwimmkostüms baumelte, das Robin anhatte.
»Also gut. Verlust der Unschuld und erste Arbeitsstelle. Was noch?«
»Auslandsreisen«, sagte Helen auf der Veranda. »Ich würde wahnsinnig gern reisen. Ich bin nie über Cambridge hinausgekommen.« Einen Moment erfaßte Robin stürmische Erregung, in die sich sogleich Niedergeschlagenheit mischte. Das Leben wartete auf sie, aber sie mußte erst noch Jahre Latein und Griechisch hinter sich bringen.
»Und was hast du vor, Robin? Wenn du nicht heiraten willst.«
»Girton, nehme ich an.« Als ihr Vater ihr mitgeteilt hatte, daß sie die Stipendiatenprüfung bestanden hatte, war sie eher bedrückt als beschwingt gewesen.
Sie begann eine Runde um den Teich zu schwimmen. Viele Gedanken schossen ihr durch den Kopf: an die schmutzigen Hütten der Landarbeiter in den Fens; an die triumphierenden Radioberichte nach der Beendigung des Generalstreiks; an ihre Eindrücke jedesmal, wenn sie durch Cambridge ging, wo so viele Mädchen, die jünger waren als sie, für niedrige Löhne lange Stunden eintönige Arbeit taten.
»Robin will die Welt verändern, stimmt's, Robin?«
Maias Ton war sarkastisch. Aber Robin, die unter der Veranda kaltgemacht hatte, zuckte nur die Achseln und blickte nach oben.
»Komm doch auch rein, Helen. Ich bring dir das Schwimmen bei.«
Helen schüttelte den Kopf. Das von blondem Haar umrahmte Gesicht unter dem breitkrempigen Strohhut zeigte eine Mischung aus Furchtsamkeit und Verlangen.
»Aber vielleicht plansche ich ein bißchen.« Sie lief ins Winterhaus und kam wenige Minuten später barfuß wieder heraus. Weißen Rock und Unterröcke raffend, setzte sie sich auf die Kante der Veranda und tauchte die Füße ins Wasser. Sie schnappte nach Luft.
»Ist das kalt! Wie haltet ihr das aus?«
Hugh kam über den Rasen zu ihnen. Robin winkte und rief ihn. Helen zog errötend ihre Zehen aus dem Wasser und glättete ihren Rock, Maia hingegen, der das durchnäßte Hemdchen am schlanken Körper klebte, schwamm zu ihm hin und lächelte.
»Kommst du rein, Hugh, Darling?«
Er sah lächelnd zu ihr hinunter. »Bestimmt nicht. Ihr seid ja verrückt. Es ist gerade mal April – ihr werdet zu Eis erstarren.«
Seine Stimme wurde zu Robin hinübergetragen, die an der tiefsten Stelle im Teich tauchte. Sie atmete tief durch und schoß noch einmal abwärts durch Wasser und Tang, bis ihre kalten, gefühllosen Finger etwas berührten, das halb vergraben im sandigen Grund steckte. Aufwärts steigend, stieß sie aus dem Wasser heraus und schnappte gierig nach Luft. Ihre Finger waren weiß geworden, ihre Nägel bläulich, aber in ihrer Hand lag eine Süßwassermuschel, ganz ähnlich denen, die den Spiegel im Winterhaus umrahmten.
Sie hörte Hugh sagen: »Ich fahr dich nach Hause, ja, Helen? Und, Maia, du bleibst doch zum Essen, nicht wahr?«
Später zog Robin in Daisys Zimmer Rock und Bluse aus und ließ sie zu Boden fallen. Das neue Kleid glitt leicht über ihren Kopf, dunkelbrauner Samt, die gleiche Farbe wie ihre Augen. Widerstrebend sah sie in den Spiegel. Das Kleid war sehr schön: tief angesetzte Taille, knielang, an Hals und Ärmel mit cremefarbener Spitze abgesetzt.
»Gefällt es dir nicht?«
»Es ist wunderschön.« Robin machte ein hoffnungsloses Gesicht.
»Es liegt nicht am Kleid – es liegt an mir. Ich wollte, ich wäre groß wie Maia – oder ich hätte einen Busen wie Helen. Sieh mich doch an. Klein und dünn und Haare wie eine Maus.«
Den Mund voller Stecknadeln, kniete sich Daisy auf den Boden und begann den Saum hochzustecken.
»Was meinst du, bin ich gewachsen?«
Daisy schüttelte den Kopf: Robin seufzte. Daisy murmelte: »Wenn du aus der Schule bist, kannst du hohe Absätze tragen.«
Von draußen war das Geräusch eines näher kommenden Automobils zu hören. Robin zog den Vorhang zur Seite und sah zu, wie Hugh, von einer Schar Wochenendgäste verfolgt, vom Wagen zum Haus hinkte.
»Hugh hat Richard gesagt, daß er gern Privatunterricht geben würde.«
»Oh …« Mit einem strahlenden Lächeln umarmte Robin ihre Mutter.
Daisy griff wieder zu den Stecknadeln. »Wenn er nur ein nettes junges Mädchen kennenlernen könnte.«
»Ich finde, er sollte Helen heiraten. Die beiden verstehen sich unheimlich gut. Und Helen will sowieso nur heiraten und Kinder haben.«
»Du sagst das so, Robin, meine Liebe, als wäre es unangebracht für eine Frau, sich eine Familie zu wünschen.«
»Ach, Familie«, versetzte Robin wegwerfend. »Einkaufen, nähen, kochen. Man verliert seine Selbständigkeit und muß sich das Geld von seinem Mann zuteilen lassen, als wäre man ein Kind oder ein Dienstbote.«
Sie wurde rot und zog hastig das Kleid über den Kopf. Selbst ihr Vater, Anhänger der sozialistischen Fabier-Gesellschaft und hartnäckiger Verfechter der Frauenrechte, gab Daisy jede Woche einen festen Betrag für den Haushalt und dazu ein monatliches Taschengeld für ihre Garderobe. Daisy stand mit dem Rücken zu ihr; Robin war sich mit schlechtem Gewissen ihrer Taktlosigkeit bewußt.
An diesem Abend waren sie zehn Personen beim Essen: die vier Summerhayes; Maia; der Maler Merlin Sedburgh; Hughs alter Schulfreund Philip Shaw; Ted und Mary Warburton von der Sozialdemokratischen Vereinigung Cambridge; und Persia Mortimer, die vor langer Zeit Daisys Brautjungfer gewesen war. Persia hatte eine Vorliebe für Perlen, indische Schals und erstaunliche Kopfbedeckungen. Merlin (Robin konnte sich nicht erinnern, Merlin jemals nicht gekannt zu haben) konnte Persia nicht ausstehen und gab sich keine Mühe, es zu verbergen. Es amüsierte Robin, daß Persia in ihrer Unbekümmertheit seine Abneigung nie wahrgenommen hatte.
»Ich habe gehört«, sagte Persia beim Pudding, »daß du jetzt Landschaften malst, Merlin, Darling.«
Merlin grunzte und starrte Maia an. Er hatte sie schon den ganzen Abend angestarrt.
»Landschaften bieten eine solche Vielfalt, findest du nicht auch? Und eine Landschaft kann man nicht ausbeuten.«
Merlin, der sich gerade eine Zigarette anzündete, zwinkerte. Er war ein großer, massiger Mann mit zottigem ergrauendem Haar. Seine Jacken waren oft an den Ellbogen durchgescheuert. Daisy flickte seine Kleider und hatte immer etwas zu essen für ihn. Sie war der einzige Mensch, zu dem Merlin nie unhöflich war.
»Ausbeuten?« wiederholte Merlin, sich Persia zuwendend.
»Nun, es ist doch eine Art von Prostitution, nicht?« Persia zog ihren weiten Ärmel aus dem Dessert.
Richard Summerhayes' Mundwinkel zuckten. »Vielleicht bezieht sich Persia auf deine letzte Ausstellung, Merlin.«
Richard, Daisy und Robin waren nach London gereist, um sich Merlins neueste Arbeiten anzusehen. Der Titel der Ausstellung war »Akte in einer Mansarde« gewesen und hatte dasselbe Modell in einer Vielfalt von Posen vor dem Hintergrund von Merlins großer, aber düsterer Mansarde gezeigt.
»Eigentlich«, erklärte Persia, »habe ich alles Figürliche gemeint. Porträts, Familiengruppen, Akte natürlich. Das sind alles Übergriffe. Unbefugtes Eindringen in die Seele. Darum ziehe ich meine kleinen Abstrakten vor.«
Persia machte riesige Stoffcollagen, die bei einigen der Bloomsbury-Clique ungeheuer populär waren.
Maia sagte: »Wenn ich also zum Beispiel Merlin Modell stünde – dann würden Sie sagen, ich prostituiere mich?«
Persia berührte Maias Hand. »Im übertragenen Sinn, Darling, ja.«
Merlin prustete geringschätzig.
»Aber wenn ich mich dafür entscheide …«
»Aha!« unterbrach Richard erheitert. »Gutes Argument, Maia. Der freie Wille –«
»Es käme doch eher darauf an, meinst du nicht, Richard, ob Mr. Sedburgh Miss Read für ihre Dienste als Modell bezahlen würde.«
»Der Austausch von Arbeit gegen Geld verleiht natürlich der Beziehung Würde, Ted.«
»Du meinst, wenn man sie bezahlt, dann ist sie keine Hure?«
»Mr. Sedburgh!« Hughs Freund Philip Shaw war schockiert. »Es sind Damen anwesend.«
Er sprach, erkannte Robin, von Maia, die in ihrer weißen Bluse und dem marineblauen Rock heiter, unberührt und rein aussah.
»Kaffee«, sagte Daisy energisch und räumte das Dessertgeschirr ab. Zum Kaffeetrinken und Rauchen begaben sie sich in den Salon. Richard Summerhayes hatte für die übliche Trennung der Geschlechter nach dem Abendessen nichts übrig. Da nicht genug Sitzgelegenheiten da waren, ließ sich Philip Shaw anbetend zu Maias Füßen nieder, und Robin setzte sich aufs Fensterbrett.
»Donald arbeitet gerade am Programm für dieses Jahr, Richard«, bemerkte Ted Warburton. »Wann kann er dich für einen Vortrag eintragen?«
Richard Summerhayes runzelte die Stirn. »Oh – am liebsten irgendwann im Herbst, Ted. Die Prüfungen verschlingen immer soviel Zeit im Sommer.«
»Und das Thema?«
»Der Völkerbund vielleicht – oder – lassen Sie mich überlegen – die Folgen der russischen Revolution.«
Robin zupfte ihren Vater am Ärmel. »Die russische Revolution bitte, Pa.« Sie hatte eine verschwommene Erinnerung an die gedämpften Feiern im Haus Summerhayes anläßlich der sozialistischen Revolution von 1917. Gedämpft, weil Hugh sich gerade mit seinem Bataillon nach Frankreich eingeschifft hatte.
»Und ich glaube, Mary hat das Datum für den Wohltätigkeitsbasar festgesetzt.«
»Auf den zehnten Juni, Daisy.«
»So bald schon? Da werden wir uns sputen müssen, nicht wahr, Robin?«
»Aber Miss Summerhayes hat vielleicht Besseres zu tun«, meinte Ted Warburton neckend. »Ein junger Mann vielleicht …?«
Robin zog ein finsteres Gesicht. Richard Summerhayes sagte: »Robin fängt im Oktober im Girton College an, Ted. Sie studiert Altphilologie.« Der Stolz in Richards Ton war deutlich zu hören, doch Robins Miene wurde noch finsterer, und sie entfernte sich, um nichts mehr hören zu müssen.
Daisy, die ihr folgte, flüsterte: »Ich weiß, daß Ted einen immer necken muß, Robin, aber …«
»Das ist es nicht. Es ist nur …« Je länger sie darüber nachdachte, desto größer wurde ihr Widerwille, die nächsten drei Jahre Altphilologie zu studieren. Sie stellte sich das Girton College sehr ähnlich ihrer Schule vor: borniert, beengend, eine Brutstätte intensiver Freundschaften und gleichermaßen überhitzter Eifersüchteleien und Ressentiments.
Aber sie konnte die wahre Ursache ihrer plötzlichen schlechten Laune unmöglich nennen. So murmelte sie statt dessen: »Es ist immer das gleiche. Die Männer sitzen in den Ausschüssen und halten die Reden, und die Frauen kochen den Tee und veranstalten die Wohltätigkeitsbasare.«
»Öffentlich reden zu müssen, wäre mir furchtbar, Robin, mein Schatz«, sagte Daisy behutsam. »Und dein Vater hat wirklich nicht die Zeit herumzulaufen und durchlöcherte Pullover zu sammeln.«
»Du hast die Zeit dazu auch nur, weil du keinen Beruf hast. Wenn du arbeiten würdest wie Pa, hättest du die Zeit nicht.«
»Dann ist es ja gut, daß ich nicht arbeite«, antwortete Daisy leichthin. »Wenn wir keine Basare und Banketts veranstalten würden, brächten wir das Geld für den Vortragssaal nicht zusammen. Und dann könnte keiner Reden halten.«
Daisys Logik war wie immer unschlagbar. Robin knallte die zarten Porzellantassen auf ein Tablett und stürmte in die Küche. Dann schlüpfte sie durch die Spülküche hinaus und lief über den mondbeschienenen Rasen zum Winterhaus.
Als sie dort, die Ellbogen auf das Geländer gestützt, auf der Veranda stand, legte sich allmählich ihr Zorn. Der Mondschein glänzte auf dem Fluß und dem Teich, in dem sie am Nachmittag geschwommen waren, und übergoß die fernen Hügel mit seinem Licht. Aus dem offenen Wohnzimmerfenster schallte Gesang herüber: »Since first I saw your face, I vowed, to honour and renown ye …«
Sie hörte Schritte, und als sie den Kopf drehte, sah sie Merlin über den Rasen kommen. Seine Zigarette glühte rot in der Dunkelheit.
»Ich mußte weg von dieser Frau. Und Madrigale konnte ich noch nie ausstehen. Ich hoffe, du hast nichts dagegen, daß ich dich in deinen Backfischgrübeleien störe, Robin.«
Sie kicherte. Er stellte sich neben sie auf die Veranda, so daß ihre Ellbogen einander leicht berührten.
»Zigarette?«
Sie hatte noch nie geraucht, aber sie nahm eine, weil sie gern den Eindruck lässiger Welterfahrenheit erwecken wollte. Merlin zündete sie ihr mit der Glut seiner eigenen Zigarette an. Robin sog den Rauch ein und verschluckte sich.
»Das erstemal? Wirf sie in den Fluß, wenn du sie nicht magst.«
Ein anderes Lied erklang. Maia sang das Madrigal, das Richard als Solo für sie gesetzt hatte: »Der silberne Schwan«. Gletscherklar und beinahe unirdisch schwebte ihre Stimme durch die kühle Nacht.
Robin, die Merlins Gesichtsausdruck sah, sagte unwirsch: »Du bist wohl auch in sie verliebt?«
Er blickte zu ihr hinunter. »Keineswegs. Sie ist Eis bis ins Innerste. Hör sie dir doch an. Das ist unmenschlich. Ohne jegliches Gefühl.« Schweigend lauschten sie der zweiten Strophe des Liedes. Dann bemerkte er: »Ich würde Maia natürlich gern malen. Aber ins Bett gehen würde ich lieber mit dir.«
Robin lachte verlegen. Merlin sagte erheitert: »Ich werde es natürlich nicht tun. Schließlich bin ich seit Jahren in Daisy verliebt, und das wäre doch ziemlich inzestuös. Außerdem siehst du mich wahrscheinlich nur als widerwärtigen alten Onkel.«
Sie kicherte wieder und ärgerte sich sofort, daß sie sich wie ein Schulmädchen benahm. Dann schüttelte sie den Kopf.
»Nein? Na schön –«
Er neigte den Kopf und küßte sie. Seine Lippen waren trocken und fest, und seine Finger strichen durch ihr kurzes feines Haar. Dann ließ er sie los.
»Noch eine Premiere? Allerhand, kleine Robin.« Er musterte ihr Gesicht. »Du mußt mir verzeihen. Ich habe zuviel getrunken. Falls es ein Trost ist – es werden andere kommen, bessere. Ich beneide sie.«
Ein Matrose, der von seinem in Liverpool liegenden Schiff zu seiner Mutter nach Trumpington reiste, begann ein Gespräch mit Maia, als sie eines Sonntags nach einem Besuch bei Robin mit der Eisenbahn nach Hause fuhr. Insgeheim machte sie das Spiel, das sie immer machte: ein Punkt, wenn er sie ansprach; zwei, wenn er sich erbot, ihre Schultasche zu tragen; drei, wenn er sie zu einer Tasse Tee einlud; und dicke fünf Punkte, wenn er sie aufforderte, mit ihm ins Kino zu gehen. Zehn für einen Kuß, und sie mußte immer lachen, wenn sie überlegte, wie viele Punkte sie für einen Heiratsantrag kassieren würde: der Verehrer in einem schmutzigen Dritte-Klasse-Wagen vor ihr auf den Knien – das wäre doch für jedes Mädchen auf einer kurzen Eisenbahnfahrt ein Triumph.
Sie hatte noch nie einen Heiratsantrag bekommen; hatte in der Tat niemals mehr als zwei Punkte eingeheimst. Nicht, weil die Angebote nicht erfolgten, sondern weil Maia stets die Einladungen zum Tee, ins Kino, zu einem Spaziergang im Park ablehnte. Dem Mann, den sie kennenlernen wollte, würde sie nicht in einem Eisenbahnabteil dritter Klasse begegnen.
Das Stück vom Bahnhof zu ihrem Elternhaus in der Hills Road ging sie zu Fuß. Sie konnte die lauten Stimmen ihrer Eltern schon hören, als sie den Schlüssel ins Schloß schob. Diese Stimmen – manchmal hysterisch, manchmal mürrisch – hatten früher einmal die Macht besessen, sie so zu ängstigen, daß sich ihr Magen zusammenkrampfte und sie sich mit dem Kissen über dem Kopf und den Fingern in den Ohren in ihrem Bett verkroch. Aber man gewöhnte sich an alles.
Mr. und Mrs. Read waren im Wohnzimmer. Die Tür stand offen, und sie mußten sie gesehen haben, als sie vorüberging, aber sie nahmen mit keinem Wort von ihr Notiz. Zornige Worte folgten Maia, als sie die Treppe hinaufging. »Du hörst mir ja überhaupt nicht zu … genausogut könnte man gegen eine Wand reden … ob ich glücklich bin, ist dir doch völlig gleichgültig …« Die alte Leier: Der Streit stand also offensichtlich schon in voller Blüte, und sein spezifischer Anlaß war längst vergessen. Es blieben nur die Beleidigungen, die Tränen, das Schmollen. Bis zum Abendessen würde er vergessen sein.
Maia schloß ihre Zimmertür hinter sich. Während sie ihr Nähkästchen aus dem Schrank holte, versuchte sie nicht daran zu denken, daß solche Worte in Wahrheit niemals vergessen wurden: sie nagten, sie höhlten langsam aus, sie zerstörten. Niemand brauchte ihr den Grund des Streits zu sagen. Ihre Eltern stritten immer um das gleiche. Geld, immer war es das Geld. Lydia Read gab es aus, während Jordan Reads Einkommen aus seinen Anlagen stetig schwand. Über dem ganzen Haus hing ein Hauch von Schäbigkeit; die oberen Räume wurden nicht mehr regelmäßig geputzt, und das Abendessen war, wenn nicht gerade Gäste kamen, einfacher und weniger reichlich als früher. Es machte Maia angst, den langsamen, gnadenlosen Verfall mit ansehen zu müssen, der sich in den Spinnweben zeigte, die sich in den Dienstbotenzimmern in der Mansarde ausbreiteten (seit dem Krieg hatten die Reads nur noch ein Dienstmädchen, das im Haus wohnte), und in den vielen kleinen, unangenehmen Einsparungen – das Zeitungsabonnement war gekündigt, sie aßen Hammel statt Rind und machten im Wohnzimmer nur Feuer, wenn Besuch da war. Aber nichts, was nach außen sichtbar war, dachte Maia, die sich daran gewöhnt hatte, zwei Leben zu führen. Ein sichtbares und ein geheimes.
Maia zog ihre Strümpfe aus und fädelte die Nadel ein. Dann begann sie zu stopfen; mit winzigen, sorgfältigen Stichen. Sie stopfte schon Gestopftes, dachte sie, den schönen Mund zu einer Grimasse verzogen.
Am folgenden Nachmittag vergoß Sally, das Mädchen, beim Tee die Milch. Als sie unter Zurücklassung eines großen dunklen Flecks auf dem Teppich gegangen war, sagte Lydia Read: »Wir müssen sie entlassen, Jordan. Sie ist unmöglich.«
»Ja, wir müssen sie entlassen«, stimmte Jordan Read zu. »Aber nicht weil sie unmöglich ist.«
Maia sah ihren Vater hastig an.
»Wir müssen sie entlassen«, wiederholte Jordan, »weil wir sie nicht mehr bezahlen können.«
»Sei nicht albern. Was zahlen wir dem Mädchen – sechzehn Pfund im Jahr?«
Jordan Read antwortete nicht. Er stand aus seinem Sessel auf und ging hinaus. Lydia goß sich eine zweite Tasse Tee ein. Ihre Lippen und Nasenflügel waren weiß, und ihre Augen, das gleiche helle Saphirblau wie die Maias, waren schmal geworden.
Als Jordan Read wieder ins Wohnzimmer kam, warf er Lydia ein Bündel Papiere in den Schoß.
»Lies das, Lydia. Dann wirst du sehen, daß wir uns nicht nur kein Mädchen mehr leisten können. Wir können auch deine Schneiderrechnungen, Maias Schulgeld und sogar die Fleischerrechnungen nicht mehr bezahlen.«
Maia sprang auf, aber ihre Mutter sah sie mit einem funkelnden Blick an und zischte: »Wir trinken Tee, Maia. Vergiß nicht deine Manieren.«
Maia zitterten die Knie. Sie sank wieder in ihren Sessel.
Eines der Papiere fiel von Lydias Schoß und flatterte über den Boden. Maia starrte es fasziniert an. Es war ein Bankauszug. Die Zahlen am Ende der Reihen, alle in Rot, machten ihr angst.
Lydia sagte wütend: »Du weißt genau, daß ich mit Zahlen nichts anfangen kann.«
Aber ich, dachte Maia. Jedes Jahr die Beste in Mathematik. Wenn sie die Papiere an sich genommen und durchgesehen hätte, dann hätte sie genau gewußt, was sie zu bedeuten hatten. Sie verhießen Unsicherheit und Entbehrung, das Ende all ihrer Zukunftspläne.
»Ich kann selbst nicht mit Zahlen umgehen, Lydia. Sonst wäre es nie soweit gekommen.«
Einen Moment lang tat Maia ihre Mutter beinahe leid. Jordan Reads Stimme klang gelassen, beinahe erheitert, als hätte er eine Partie Bridge verloren oder wäre beim Cricket im Aus gelandet.
»Die Bank hat mir heute geschrieben und alles bestens erklärt. Wir sind erledigt. Wir sitzen in der Patsche.«
Weiß vor Wut starrte Lydia ihn an. »In der Patsche …«
»In der Patsche – in der Klemme – wir sind pleite. Ja, mein Kind. Nenn es, wie du willst.«
Lydia entgegnete leise: »Und was gedenkst du gegen diese Patsche zu unternehmen, Jordan?«
»Tja, wenn ich das wüßte! Auf der Gemeindewiese ein Zelt aufschlagen? Oder ich könnte mir ja vielleicht eine Kugel in den Kopf jagen?«
Maia krampfte ihre Hände ineinander, damit sie nicht zitterten. Lydia hatte sich ihre dritte Tasse Tee noch nicht eingeschenkt. In ihrer Stimme schwang nun echte Furcht, als sie flüsterte: »Wir verlieren das Haus?«
Jordan nickte. »Es sind schon zwei Hypotheken darauf, und eine dritte räumt mir die Bank nicht ein.«
Zum erstenmal mischte Maia sich ein. »Aber deine Anlagen, Daddy. Deine Aktien und Obligationen …?«
Jordan zwirbelte die Enden seines Schnäuzers. »Ich habe die falschen Papiere gekauft, Liebchen. Hatte nie einen Riecher für so etwas. Die Bergwerke haben durch den Streik hohe Verluste gemacht – und wer will heute noch teures Porzellan und Kristall, wenn er fast das gleiche für den halben Preis bei Woolworth bekommen kann.«
»Porzellan? Bergwerke? Was hat denn das mit uns zu tun?« kreischte Lydia. »Willst du mir sagen, daß man mich aus meinem eigenen Haus hinauswerfen wird, Jordan?«
»Darauf läuft es hinaus. Aber wir werden sicher eine kleine Mietwohnung finden.«
Lydias Gesicht war verzerrt und häßlich. »Lieber sterbe ich!«
Einen Moment lang starrten ihre Eltern einander wortlos an. Maia blickte weg, sie wollte den Ausdruck in ihren Augen nicht sehen. Aber sie konnte ihre Ohren nicht verschließen.
»Wenn du im Ernst glaubst, ich werde mein eigenes Haus aufgeben, um in irgendeinem schmutzigen Slum –«
»Es ist nicht dein Haus, Lydia. Es gehört der Bank. Sogar ich verstehe das.«
»Du bist ein Narr, Jordan, ein elender Narr!«
»Das habe ich nie bestritten. Aber wenigstens bin ich kein Ehebrecher.«
Sie schnappte nach Luft. »Wie kannst du es wagen –«
»Ich mag in Geldangelegenheiten ein Narr sein, Lydia, aber die Art von Narr bin ich nicht.«
»Lionel ist ein Mann.«
Sie hatten Maias Anwesenheit völlig vergessen, brauchten sie nicht mehr als Publikum. Maia stand aus ihrem Sessel auf und ging aus dem Zimmer, die Treppe hinauf.
Und dennoch bestand selbst jetzt dieses andere Leben, dieses zweite Leben, weiter. Ihr weißes Chiffonkleid lag auf dem Bett ausgebreitet, erinnerte daran, daß sie heute abend zum Essen Gäste hatten. Obwohl ihr kalt war und ein wenig übel, machte Maia Toilette, kleidete sich um und bürstete ihr Haar. Sie war gespannt, ob an diesem Abend endlich die Fassade eingerissen werden würde. Ob die zwei Leben zu einem verschmelzen würden. Sie stellte sich vor, wie sie zu dem Herrn, der neben ihr saß, sagte: »Mutter hat ein Verhältnis mit dem Vorsitzenden des Tennisklubs, und Daddy ist bankrott.« Würde dann irgend etwas passieren? Oder würde Sally einfach weiter die Charlotte russe servieren und der Gast eine höfliche Erwiderung murmeln? Maia begann zu lachen und mußte plötzlich die Fäuste auf ihre Augen drücken, um nicht zu weinen. Als sie in den Spiegel blickte, sah sie, daß ihre Nase nur ein klein wenig gerötet war; sie würde etwas Puder von ihrer Mutter benutzen.
Doch das Abendessen, wie verwandelt wenn die Reads Gäste hatten, war eine kultivierte und elegante Angelegenheit. Jordan Read war höflich, Lydia charmant, und Maia selbst sprühte. Die Blicke der beiden Herren, Mamas Cousin Sydney und Mr. Merchant, der in Cambridge ein Geschäft hatte, folgten ihr überallhin. Wären sie in der Eisenbahn gewesen, dachte Maia, wieder versucht zu lachen, wie viele Punkte hätte sie gemacht?
Als sie gegangen waren und Maia wieder in ihrem Zimmer saß, tat ihre ungewisse Zukunft sich wie ein Abgrund vor ihr auf. Sie sah sich als kleine Verkäuferin in einem Modegeschäft oder als Mathematiklehrerin an irgendeiner öden Mädchenschule. Ihre Mutter würde sie verlassen, das wußte sie jetzt, und ihr Vater – sie konnte sich nicht vorstellen, was aus ihrem Vater werden würde. Obwohl ihr seit langem klar war, daß es keine Sicherheit gab, erkannte sie jetzt, daß Sicherheit, wie alles andere, etwas Relatives war. Die Schule langweilte sie, aber sie fürchtete sich davor, sie verlassen zu müssen. Dieses Haus war schäbig, aber es gab viele, die weit schäbiger waren. Wenn ihre Eltern sich trennten, bei wem würde sie leben?
Ich besitze nichts, dachte Maia niedergeschlagen. Sie legte ihr Kleid ab, ihre Strümpfe, ihre Unterwäsche. Als sie das Kleid in den Schrank hängte, musterte sie sich im Spiegel. Die langen weißen Glieder, der kleine, hohe Busen, der flache Bauch. Und ihr Gesicht: Die Lippen wie ein Amorbogen geformt, kurzes dunkles Haar, blaue Augen.
Sie besaß doch etwas. Eine ganze Weile stand sie da und starrte ihr Spiegelbild an und wußte, daß sie im Gegensatz zu ihrem Vater ihr Vermögen klug anlegen würde.
In den folgenden Wochen führten Lydia und Jordan Read getrennte Leben. Sie nahmen die Mahlzeiten niemals zusammen ein und sprachen kaum miteinander. Lydia war viel aus; Jordan hielt sich in seinem Arbeitszimmer auf. Maia hatte keine Ahnung, wie er die Zeit verbrachte.
Zum Halbjahr ging Maia von der Schule ab. Sie begann zu arbeiten, fünf Vormittage in der Woche als Gouvernante zweier kleiner Mädchen. Die Mädchen waren ganz niedlich, aber die Arbeit langweilte Maia, die Kinder nie interessiert hatten. Immerhin, es vertrieb ihr die Zeit. Sie ahnte, daß etwas Schreckliches, Unaufhaltbares geschehen würde. Sie sparte die Hälfte ihres Lohns und gab den Rest für Kleidung aus, weil sie um keinen Preis arm oder mutlos aussehen wollte. Zwei Abende in der Woche besuchte sie einen Buchhaltungskurs, wo sie ihre Rechentalente wiederentdeckte. Als Buchhalterin zu arbeiten, konnte sie sich dennoch nicht recht vorstellen. Bei dem Wort dachte sie an Hornbrillen und schlechtsitzende Tweedkostüme.
Sie saß im Wohnzimmer und nähte, als es draußen läutete. Es war ein Mittwochnachmittag, und ihr brummte der Kopf von Bruchrechnungen und unregelmäßigen französischen Verben. Wegen der Augusthitze hatte sie die Jalousien im Wohnzimmer halb heruntergezogen. Sonnenlicht flirrte auf den grün und cremefarben gestreiften Wänden und dem gewachsten Holzfußboden.
Da Sally nicht öffnete, ging Maia zur Tür. Draußen wartete Lionel Cummings, der Vorsitzende des Tennisklubs ihrer Mutter. Er war um die Vierzig, leicht übergewichtig und trug einen Schnurrbart. Er hatte einen gestreiften Blazer an, eine weiße Flanellhose und hielt einen Strohhut in der Hand.
Maia bat ihn, im Wohnzimmer zu warten, während sie ihre Mutter holte. Ihre Eltern waren im Garten, ausnahmsweise einmal zusammen, und sie bemerkte den Blick ihres Vaters, als sie den Namen des Besuchs nannte. In diesem Augenblick haßte sie ihre Mutter; so leidenschaftlich, daß es ihr körperlich weh tat und sie so schnell wie möglich zur Terrasse zurücklaufen mußte.
Lionel Cummings stand auf, als Maia ins Wohnzimmer kam.
»Mutter pudert sich nur noch die Nase. Sie werden sich ein paar Minuten mit meiner Gesellschaft begnügen müssen, Mr. Cummings.«
Er zwirbelte seinen albernen Schnurrbart. »Ich bin entzückt, Miss Read. Ein Vergnügen.«
Sie haßte auch ihn, für die rücksichtslose Verachtung gegen ihren Vater, die sein Besuch in diesem Haus zeigte. Sie wollte ihre Mutter dafür bestrafen, daß sie ihren Vater quälte, und sie wollte diesen dummen, eitlen Menschen dafür demütigen, daß er an der Zerstörung ihrer Familie mitwirkte.
Sie setzte ihr gewinnendstes Lächeln auf. »Ein heißer Tag, nicht wahr, Mr. Cummings? Soll ich Ihnen etwas Kaltes zu trinken holen?«
Er schüttelte den Kopf. Sie setzte sich auf das Sofa und klopfte auf den freien Platz neben sich. »Setzen Sie sich doch, Mr. Cummings. Ich habe Sie neulich abend im Klub spielen sehen. Eine phantastische Vorhand. Meine Vorhand ist einfach hoffnungslos.«
Sie hatte ihn am Haken, sie wußte es. Es war ja so einfach. Man brauchte ihnen nur ins Auge zu sehen, sie anzulächeln und ihnen das Gefühl zu geben, sie seien groß und stark und tüchtig. Lionel Cummings war ein Narr.
»Ich könnte Ihnen ein paar Stunden geben, Miss Read.«
»Ach, das wäre wunderbar. Aber ich arbeite jetzt vormittags, wissen Sie, und nachmittags bin ich zu müde, um in den Klub zu gehen.«
»Sie Arme! Sie sollten sich nicht überanstrengen, eine hübsche junge Frau wie Sie.«
Sein Oberschenkel berührte den ihren, und sie konnte Whisky und Tabak in seinem Atem riechen. Ihren Ekel verbergend, stand Maia auf.
»Vielleicht könnten Sie es mir jetzt zeigen, Mr. Cummings.«
»Lionel. Nennen Sie mich Lionel.«
»Lionel«, sagte Maia mit einem künstlichen Lächeln.
Er hatte einen Arm um sie gelegt und hielt ihr Handgelenk mit seiner freien Hand umfaßt, als Lydia ins Zimmer kam. Sie hielt hörbar die Luft an, und ihr Blick verfinsterte sich. Lionel Cummings ließ Maia verlegen los.
Maia fühlte sich mächtig in ihrer Rächerinnenrolle. »Mr. Cummings wollte mir nur helfen, meine Vorhand zu verbessern, Mami«, erklärte sie und setzte sich.
Es bereitete ihr ein perverses Vergnügen, im Zimmer zu bleiben, unerwünschte Zeugin ihres schwülstigen Geredes. Immer wenn Lionel Cummings gerade nicht hersah, warf Lydia ihrer Tochter einen Blick zu, zog die Augenbrauen hoch und sah vielsagend zur Tür. Doch Maia blieb hartnäckig sitzen, zornig auf der Sofakante hin und her rutschend, die Finger an den Mund gedrückt.
Schließlich sagte Lydia zuckersüß: »Mußt du nicht noch deine Stunden vorbereiten, Maia? Und ich dachte, du wolltest Sally beim Pudding helfen.«
»Ich hab mich schon für die ganze Woche vorbereitet.« Maia schlug ihre langen Beine übereinander und ließ ihren Rock über die Knie hochrutschen. Lionel Cummings bekam Stielaugen. »Und du weißt doch, daß ich überhaupt nicht kochen kann, Mami.«
Genau in dem Moment hörten sie es: einen kurzen, lauten Knall, bei dem die Nippes auf dem Kaminsims und die Gläser in der Vitrine klirrten.
Lydia flüsterte: »O mein Gott« und stürmte aus dem Zimmer. Maia sprang auf, folgte aber nicht. In dem kurzen Augenblick zwischen dem Schuß und dem Schrei ihrer Mutter überfielen Furcht, Entsetzen und Schuldgefühl sie mit solcher Macht, daß die Farben der Wände sich zu Schwarz verdunkelten und die Streifen hellen Sonnenscheins auf dem Boden sich zu einem einzigen winzigen Lichtpunkt zusammenzogen. Die Hitze, die Dunkelheit des Zimmers, die Glut von Jugend und Sexualität verschmolzen mit dem Schrecken des plötzlichen Todes, so daß sie später eines nicht vom anderen trennen konnte. Als die Dunkelheit sich schließlich lichtete, lag sie auf dem Boden. Das Zimmer war leer, und die Schreie ihrer Mutter hallten durch das Haus.
Nun begann alles zu zerfallen. Die Tage verloren ihre Struktur, die Grenzen zwischen Vormittagen, Nachmittagen und Abenden waren aufgehoben, so daß Maia oft die ganze Nacht hellwach lag oder bei Tag plötzlich einschlief. Freunde und Verwandte kamen, um Maia und ihrer Mutter im Wohnzimmer zu kondolieren. Aber manchmal konnte sie sich der Namen der Leute, mit denen sie gesprochen hatte, nicht erinnern, und immer konnte sie im taktvollen, ehrfürchtigen Gesäusel eine andere Stimme hören. Die Stimme ihres Vaters. »Tja, das wüßte ich auch gern. Ich könnte mir ja vielleicht eine Kugel durch den Kopf jagen?«
Dennoch lautete das Urteil nach dem Leichenschauverfahren Tod durch Unfall. Jordan Read war dabeigewesen, die Gewehre zu reinigen, die er zur Jagd auf Wildenten benutzte, und dabei war es zu diesem tödlichen Unfall gekommen. Durch Geldsorgen abgelenkt, hatte er einen törichten und tödlichen Fehler begangen.
Als Lydia Read an diesem ersten grauenvollen Nachmittag einen Moment mit ihrer Tochter allein gewesen war, hatte sie gezischt: »Erzähl keinem, was er gesagt hat. Bloß nicht!« Maia hatte sofort gewußt, wovon ihre Mutter sprach. Wie hypnotisiert vom funkelnden eisigen Blau der Augen ihrer Mutter, hatte sie stumm genickt. Aber sie hatte sowieso nie die Absicht gehabt, irgend jemandem – sei es Verwandten, Polizei oder Geschworenen – die Worte ihres Vaters zu wiederholen. Unklare Erinnerungen an das Schicksal von Menschen, die sich das Leben genommen hatten, bedrängten sie: Sie durften nicht in geweihter Erde beigesetzt, sondern mußten an Straßenkreuzungen begraben werden, damit ihre Seelen nicht wandern konnten. Sie war überwältigt von Scham und Entsetzen. Daß er seiner Familie so etwas antun konnte! Daß er den Schmerz seiner Tochter so gering achten sollte! Als der Coroner Maia unter Eid fragte, ob ihr Vater je Selbstmordabsichten angedeutet habe, antwortete sie mit einem klaren und entschiedenen Nein.
An die Beerdigung danach hatte sie kaum Erinnerungen. Sie ließ sich von den Leuten die Hand schütteln; sie blickte ihnen durch ihren schwarzen Schleier in die Augen und versuchte zu erkennen, ob sie es errieten. Sie fragte sich, als sie erst Robin und dann Helen umarmte, ob auch dies als Meilenstein im Leben einer Frau zählte. Ob der Selbstmord eines Vaters ebenso bedeutsam war wie der Verlust der Unschuld oder die erste Auslandsreise. Sie fand, ja.
Robin flüsterte ihr zu: »Du mußt eine Weile zu uns kommen, Maia – du brauchst Ruhe. Meine Eltern möchten, daß du kommst.« Maia faßte Robin beim Ärmel und stieß sie in eine Ecke des Zimmers.
»Ich halte das nicht aus. Lauft mit mir weg, ja?«
Als Maia durch eine Seitentür hinausschlüpfte und durch den Garten rannte, wußte sie, daß sowohl Robin als auch Helen hinter ihr waren. Sie holten sie ein, als sie mit flatterndem schwarzem Schleier und fliegendem Mantel, dessen leichter Stoff sich von der Geschwindigkeit ihres Laufs hinter ihr blähte, die Hills Road hinunterrannte.
»Maia –« Helen war außer Atem. »Wohin wollen wir überhaupt?«
Maia hielt kaum inne, um ihre Freundinnen anzusehen. »Auf den Fluß, dachte ich.« Sie kramte in ihren Taschen und fand genug Münzen, um ein Punt zu mieten.
Hinterher war sie gerührt, daß sie ihren verrückten Wunsch, in schwarzer Trauerkleidung auf dem Cam dahinzugleiten, nicht einen Moment in Frage gestellt hatten.
»Wie Charon«, sagte Robin, die stakte.
»Oder die drei Nornen.« Maia zog die Nadeln aus ihrem Hut und warf ihn aus dem Boot. Er blieb kurz an der gefiederten Rispe eines Schilfrohrs hängen, dann fiel er ins Wasser, schaukelte einen Moment auf und nieder, bevor er unterging und verschwand.
Helen, die neben Maia saß, legte ihr tröstend die Hand auf den zitternden Arm. Tränen des Mitleids standen in ihren Augen. »Arme Maia. So ein schrecklicher Unfall.«
Maia schüttelte heftig den Kopf. »Kein Unfall.« Sie schlug ihre Hand auf ihren Mund, als wollte sie die Worte aufhalten, die ihr wider besseres Wissen entkommen waren.
Helen sagte beschwichtigend: »Aber natürlich war es ein Unfall, Maia, du Arme«, doch Maia spürte, daß Robin, die hinten im Boot stand, sie anstarrte.
»Maia …?«
»Daddy hat sich das Leben genommen.« Die Worte klangen spröde und abgehackt. Maia war heiß und übel. »Ich weiß es. Er hat es gesagt.«
»Aber bei der Untersuchung –«
»– hab ich gesagt, daß es ein Unfall war. Natürlich. Hättest du das nicht getan?«
Sie sah erst Robin, dann Helen herausfordernd an. In der Stille stieg Ärger in ihr auf. »Na los, was hättet ihr denn getan?« wiederholte sie, wohl wissend, daß ihre Stimme mehr aggressiv und ärgerlich klang als bekümmert. »Jetzt findet ihr mich wohl beide schlecht. Unehrlich …«
Ihre Fingernägel bohrten sich in ihre Handflächen und zerrissen die dünne schwarze Seide ihrer Handschuhe. Das Boot schwankte, als Robin den Staken niederlegte und nach vorn kam, um sich ihr gegenüber zu setzen.
Helen sagte sanft: »Wir denken nicht schlecht von dir, Maia. Wir möchten dir nur helfen.«
»Du hast das getan, was du für das Beste gehalten hast, Maia.« Robins Miene war ernst. »Keine von uns hat durchgemacht, was du durchgemacht hast. Wir können uns kaum vorstellen, was für eine schlimme Zeit du hinter dir hast. Und Helen hat recht – wir wollen alles tun, um dir zu helfen. Das mußt du uns glauben.«
Maia fühlte, wie ihre verkrampften Hände auseinandergezogen wurden. Helens adrett behandschuhte Rechte umschloß die eine Hand, Robins schmuddelige Finger umfaßten die andere. Maia flüsterte: »Ich möchte nie wieder darüber sprechen. Nie wieder«, und hörte ihre gemurmelten Versprechen.
Ein anderes Versprechen als jenes, das sie einander im Frühling gegeben hatten. Ein dunkleres Geheimnis, das sie miteinander verband, vielleicht unlösbar. Sie hatte ihren Segen gebraucht, erkannte sie.
Und konnte endlich weinen. Zum erstenmal seit Wochen erinnerte Maia sich, daß sie bei ihren Freundinnen einen Ort sicherer Zuflucht gefunden hatte, an den sie jederzeit zurückkehren konnte, wenn sie es brauchte. Das Schilf, die anmutigen Brücken, die den Fluß überwölbten, und die Schwäne, die am Ufer entlangglitten, verschwammen vor Maias Augen, als sie zu weinen begann.
Helen und ihr Vater nahmen jedes Jahr am Erntefest teil. Es wurde im Gemeindesaal der Kirche abgehalten, Speisen und Getränke von Lord Frere, dem größten Grundbesitzer von Thorpe Fen, gestiftet. Die Freres lebten im Großen Haus, das zwischen Thorpe Fen und dem Nachbardorf gelegen war; es hatte einen anderen, würdigeren Namen, aber für die Bewohner von Thorpe Fen war es immer nur das Große Haus.
Das Erntefest war eine der wenigen Dorfveranstaltungen, auf die Helen sich stets freute. Die Beschränkungen und Zwänge, die das Dorfleben bestimmten, schienen sich dann ein wenig zu lockern, und sie fühlte sich an die Abende erinnert, die sie gelegentlich bei den Summerhayes verbrachte; chaotisch, verwirrend und laut, aber dennoch herrlich.
Im ersten Jahr ihrer Bekanntschaft mit den Summerhayes hatte sie der Familie gemischte Gefühle entgegengebracht. Robins Gleichgültigkeit gegenüber der Religion, die in Helens Leben eine entscheidende Rolle spielte, hatte sie tief erschüttert. Ihr wurde heute noch heiß, wenn sie sich an den Tag erinnerte, an dem ihr Vater die Wahrheit entdeckt hatte: »Die Summerhayes sind Atheisten, Helen. Sie haben keinen Glauben. Man muß daher ihre Moral in Frage stellen.«
Einen ganzen Monat lang hatte sie danach Robin und Hugh und Daisy und Richard gemieden. Aber sie hatte sich doch wieder zu ihnen hingezogen gefühlt. Das Leben war – ein anderes Wort fiel ihr nicht ein – öde gewesen ohne sie – und Daisy hatte verletzt gewirkt, Robin war zornig gewesen, und Richard hatte sie als Sängerin für das neue Lied gebraucht, das er für sie und Maia geschrieben hatte. Hugh hatte Helen herzlich umarmt, als sie wiedergekommen war, und seitdem hatte sie sich über Atheismus und mangelnde Moral keinerlei Gedanken mehr gemacht. Sie brauchte die Summerhayes, und diese (sie wagte kaum, es zu glauben) schienen sie zu brauchen. In diesem Fall konnte sie ihrem Vater nicht zustimmen. Doch sie war vorsichtig, rationierte ihre Besuche und hielt sie kurz. Und niemals erwähnte sie vor ihrem Vater Richards und Daisys manchmal exotische Gäste.
Nach dem Erntemahl begann der Tanz. Elijah Readman schrubbte auf seiner Geige, und Natty Prior spielte die Ziehharmonika. Helen, die neben ihrem Vater in einer Ecke des Saals saß, ertappte sich dabei, daß sie mit den Füßen wippte. Die schweren Stiefel der Dorfbewohner traten stampfend auf den Holzboden; die Tänzer drehten sich und umkreisten einander, bildeten in ihren farblosen Gewändern, die hier durch ein buntes Tuch, dort durch eine billige Perlenkette aufgehellt waren, immer neue Muster in dem dämmrig erleuchteten Saal.
Der Tanz endete, und Adam Hayhoe stand auf, um zu singen. Seine kräftige Stimme ging beinahe unter im rhythmischen Klappern der Holzschuhe und im Klatschen zahlloser Hände, doch Helen kannte den Liedtext von vielen früheren Erntefesten, und ihre Lippen bewegten sich zu der Melodie. »As I walked out one May morning, one May morning so early …«
Sie hörte ihren Vater flüstern: »Seine Lordschaft ist da. Helen – kommst du mit, um ihn mit mir zusammen zu begrüßen?«
Sie schüttelte schnell den Kopf. Sie hatte Angst vor Lord Frere; und sie hatte niemals den gräßlichen Nachmittag in Brackonbury House vergessen, als sie mit den Frere-Mädchen spielen sollte, von diesen jedoch hochmütig ignoriert worden war.
»Es ist so kalt draußen.«
»Natürlich, mein Kind.« Er legte seine Hand auf ihre Schulter. »Sobald Seine Lordschaft und ich miteinander gesprochen haben, gehen wir nach Hause.« Julius Ferguson sah sich mit großen blaugrauen Augen im überfüllten Saal um. »Ich werde froh sein, wenn diese Tradition stirbt. Ich habe immer das Gefühl, daß in diesen Festen mehr als nur eine Spur Heidentum steckt.«
Er ging aus dem Saal, und Helen schloß die Augen und überließ sich wieder der Musik.
Jemand sagte: »Möchten Sie tanzen, Miss Helen?«
Adam Hayhoe stand vor ihr. Adam war groß, dunkel, kräftig, der Dorfzimmermann. Sie konnte sich nicht an eine Zeit erinnern, da sie Adam nicht gekannt hatte.
»Ach, das wäre schön, Adam.«
Er nahm ihre Hand und führte sie in den Kreis, der sich gebildet hatte. Die Musik begann wieder zu spielen, der Kreis teilte sich in zwei, die sich dem uralten Muster folgend miteinander verschlangen, auflösten, neue Figuren bildeten. Schneller und schneller wurde der Tanz, die vertrauten Gesichter der Dorfbewohner und der schäbige Saal sahen verändert aus im Rausch von Geschwindigkeit und Lust. Auch Helen lachte; auch Helen fühlte sich dazugehörig. Sie lag in Adams Armen und ließ sich herumwirbeln, während sie kleine Kreise innerhalb des größeren drehten.
Der Tanz endete, der Saal hallte wider von Musik und Gelächter. Die Dorfbewohner griffen durstig nach ihren Bierkrügen; Helen tupfte sich das heiße, schweißfeuchte Gesicht mit ihrem Taschentuch.
»Ein Glas Zitronenlimonade, Miss Helen?«
Sie sah ihn lächelnd an. »Nein, danke, Adam. Ich glaube, ich brauche ein bißchen frische Luft.«
Er ging mit ihr zur Seitentür und hielt sie ihr auf. Als die Tür hinter ihnen zufiel, standen sie plötzlich in der Stille.
»Ach, war das ein Spaß«, sagte Helen immer noch außer Atem. »Ich tanze schrecklich gern.«
Der Vollmond leuchtete gelb, und Sterne sprenkelten den tintenschwarzen Himmel. Kein Lüftchen bewegte Gras und Schilf; nur Stille und kühle frische Luft, in der ein erster frostiger Hauch des Winters lag.
»Schön«, sagte Helen aufblickend.
»›Wenn die Winde leise atmen und die Sterne helle funkeln.‹«
Sie vernahm kaum Adams geflüsterte Worte und sah ihn überrascht an. »Adam! Das ist doch Shelley, nicht? Ich wußte gar nicht, daß Sie Gedichte mögen.«
Er antwortete nicht, und ihre Worte hingen wie ein Echo in ihren Ohren; die Stimme, der die gedehnten Vokallaute der Fens fehlten, der Ton, der gönnerhaft und herablassend war und sie von Adam Hayhoe trennte, den sie immer gern gehabt hatte. Sie wurde rot, suchte nach Worten der Entschuldigung, aber bevor sie sie fand, blickte sie auf und sah ihren Vater kommen.
»Du meine Güte, Helen – wo hast du denn deinen Mantel? Du wirst dich erkälten.«
Auf dem Heimweg vergaß Helen ihre Verlegenheit und sah wieder zum Himmel und den Sternen hinauf. Der schönste Ort auf Erden, dachte sie, als sie sich bei ihrem Vater einhakte. Sie rief sich den Vers ins Gedächtnis, aus dem Adam zitiert hatte.
Träumend von dir erwache ich Aus erstem süßem Schlaf im Dunkeln Wenn die Winde leise atmen Und die Sterne helle funkeln.
Plötzlich war es fast Oktober, und Daisy packte den großen Koffer, den Robin nach Girton mitnehmen würde. Stapel geflickter und gebügelter Röcke und Blusen türmten sich auf ihrer Kommode, stumme Mahner an ein Los, mit dem sie sich immer noch nicht abgefunden hatte. Kalter Wind und peitschender Regen, die passende Untermalung zu Robins Stimmung, rissen vorzeitig die Blätter von den Weiden am Fluß. Sie schloß sich im Winterhaus ein und sah zu, wie die dicken Tropfen an der Fensterscheibe herunterrannen. In Pullover und Mantel vermummt, las sie eine Stunde lang ungestört und legte die Bücher erst zur Seite, als sie draußen auf der regennassen Veranda Schritte hörte.
Hugh stieß die Tür auf. »Ma läßt dir sagen, daß es gleich Zeit zum Mittagessen ist, Rob.«
Robin setzte sich auf.
»So eine Art Festessen – Cremetorte, dein Lieblingsdessert –« Hugh brach ab und sah sie scharf an. »Hoppla – hast du geheult? Was ist denn?« Er hielt ihr sein Taschentuch hin.
»Ich habe die traurigen Stellen gelesen. Little Nell – David Copperfields Mutter.« Robin wich Hughs Blick aus und schneuzte sich. Hugh war nicht überzeugt. »Na komm, ich besuche dich, sooft ich kann, Rob. Und ich komme jedes Wochenende und hole dich nach Hause.«
So hoffnungslos mißverstanden, fühlte sie sich nur noch undankbarer und niedergeschlagener. »Das ist es doch gar nicht –« Als sie sich auf ihrem Sessel bewegte, fielen die Bücher zu Boden.
»Was ist es dann?« Hugh hockte sich zu ihr auf die Armlehne und sah zu ihr hinunter. Er zauste Robin das wirre Haar, das sie an diesem Morgen zu bürsten vergessen hatte, und sagte: »Nun komm schon, mir kannst du es doch sagen.«
Die Wahrheit, die sie so lange zurückgehalten hatte, sprang ihr über die Lippen, ehe sie es verhindern konnte.
»Ich will nicht nach Girton.«
Hugh machte einen Moment große Augen, dann sagte er: »Doch nicht weil du Angst hast, daß du Heimweh bekommst?«
»Heimweh!« Robin wies mit heftiger Bewegung zum Fenster. »Schau dir das doch mal an, Hugh. Naß, grau und leer. Wie soll ich da Heimweh bekommen?« Sie schüttelte den Kopf. »In Girton wird es bestimmt genauso sein wie in der Schule, ganz sicher. Du weißt, wie ich die Schule gehaßt habe. Und dann auch noch Altphilologie!« Ihr Ton war voll tiefer Geringschätzung.
»Du könntest vielleicht das Fach wechseln, könntest Geschichte studieren … oder Literatur.« Hugh sah Robins Blick. »Oh.« Er schwieg einen Moment. Dann sagte er: »Du mußt es ihnen sagen.«
»Ich weiß.« Seufzend fuhr sich Robin mit den Fingern durch die Haare, daß sie hinterher nach allen Seiten abstanden. Als sie ihre Galoschen überzog, hörte sie Hugh zaghaft sagen: »Versuch es ihnen schonend beizubringen, ja, Rob? Du weißt, wieviel es Pa bedeutet hat, daß du das Stipendium bekommen hast.« Dann öffnete sie die Tür des Winterhauses, sprang die Treppe hinunter und rannte über den durchweichten Rasen zum Haus.
Sie bemühte sich wirklich, es ihnen schonend beizubringen, aber irgendwie ging alles schief. Sie verstimmte ihren Vater, indem sie erklärte, drei Jahre lang graue Vergangenheit zu studieren, wäre nichts als Zeitverschwendung; sie verstimmte ihre Mutter, weil sie sich weigerte, auch nur einen Bissen von ihrem aufwendig zubereiteten Essen zu nehmen. Aber das schlimmste war, daß Hugh blaß wurde, als sie verzweifelt rief: »Ich habe doch nie eine Wahl gehabt! Weil Stevie tot ist – und Hugh krank, muß ich nach Girton.« Ein Blick um den Tisch zeigte ihr, daß sie sie alle verletzt hatte. Sogar Hugh, der so verständnisvoll gewesen war. Mit einem Schrei der Wut und der Verzweiflung stürmte sie aus dem Zimmer, riß ihren Mantel vom Haken und lief aus dem Haus.
Sie rannte durch Matsch und Pfützen bis zum Bahnhof von Scham. Wunderbarerweise war ihr Portemonnaie in ihrer Manteltasche. Und der Zug nach Cambridge stand abfahrbereit auf dem Gleis. Als Robin im Abteil saß, starrte sie in die graue nasse Landschaft der Fens hinaus und versuchte ihre Gedanken zu ordnen. Es roch gewaltig nach abgebrochenen Brücken und verbrannten Schiffen.
Auf dem Bahnhof von Cambridge, als sie mitten in der Menge eilender Menschen stand, hörte sie den Bahnhofsvorsteher die Abfahrt des Zuges nach London ankündigen. Ein plötzlicher Anfall von Heimweh nach London, nach dem Leben, das sie einmal gekannt hatte, überkam sie. Sie dachte an die Einsamkeit und die Stille von Blackmere. Sie mußte fort.
Robin machte sich auf den Weg zum Haus von Maias Verwandten. Nach dem Tod von Maias Vater war das Haus der Reads von der Bank beschlagnahmt worden, Lydia Read hatte vor, sich wieder zu verheiraten, und Maia lebte jetzt bei dem Vetter ihrer Mutter, Sydney, und seiner Frau Margery.
Gerade war Helen bei Maia angekommen. »Daddy mußte ein früheres Gemeindemitglied in Cambridge besuchen«, erklärte sie, »da habe ich mir gedacht, ich mache ein paar Einkäufe und schau dann bei Maia vorbei. Wie schön, daß ich dich auch sehe, Robin.«
Maia ging in die Küche, um Tee zu machen. Robin, die sie beobachtete, sah, daß sie sich verändert hatte. Sie wirkte älter, dünner, hart. »Dein Vater muß dir schrecklich fehlen.«
Maia goß kochendes Wasser in die Kanne und zuckte die Achseln. »Es ist komisch, wie schnell man sich an alles gewöhnt.« Sie senkte die Lider, ihren Blick verbergend. »Aber ich muß mir Arbeit suchen. Ich bin mit meinem Buchhaltungskurs fertig, jetzt werde ich mich nach etwas umsehen.« Sie nahm Tassen und Untertassen aus dem Schrank. »Und du, Robin? Hast du immer noch vor, die erste Professorin für Altphilologie in Cambridge zu werden?«
»Ich geh nicht hin.« Robins Stimme klang bedrückt. »Ich hab's meinen Eltern vorhin gesagt. Es gab einen fürchterlichen Krach.«
»Oh.« Maia richtete nie. Sie goß drei Tassen Tee ein.
»Aber wenn du nicht aufs College willst«, fragte Helen, »was tust du dann?«
»Ich hab keinen Schimmer.« Robin hielt ihre Teetasse in beiden Händen und haßte sich. Sie, die stets vorgehabt hatte, soviel zu vollbringen, hatte soeben beim ersten ernsthaften Schritt ins Erwachsenenleben die Flinte ins Korn geworfen. Bald würde sie zu ihrer Familie zurückkehren müssen, von neuem die Enttäuschung im Gesicht ihres Vaters sehen.
Maia fragte: »Was willst du denn tun?«
Schon wollte Robin wieder sagen, ich habe keinen Schimmer, als ihr der Bahnhof und der Zug einfielen.
»Am liebsten würde ich wieder nach London gehen.«
Maia erwiderte nichts, zuckte aber vielsagend die Achseln. Da kam Robin plötzlich ein wundervoller, beängstigender Gedanke. Sie griff in ihre Tasche und zog ihr Portemonnaie heraus.
»Ich habe nur – ach, du meine Güte, fünf Shilling und sieben Pence.«
»Ich kann dir was geben, Darling. Genug für die Fahrt nach London. Ich muß zwar mein Leben hier bezahlen, aber Margery kann warten.«
Maia ging aus dem Zimmer. Helen rief mit runden Augen: »London! Oh, wie aufregend. Robin – du kannst doch nicht –«
Und ob sie konnte. Auch wenn die Vorstellung sie gleichzeitig faszinierte und erschreckte – sie konnte.
Maia kam mit einem kleinen Beutel zurück. »Hier sind ein Paar Strümpfe, Seife, ein Waschlappen und eine Zahnbürste. Du hast sicher nicht an diese Dinge gedacht. Und hier sind zwei Pfund.«
Sie reichte Robin die Scheine, die Robin in ihre Geldbörse steckte. Auch Helen kramte in ihrer Tasche und brachte eine Handvoll Münzen zusammen. »Ich sage Daisy und Richard, daß es dir gutgeht«, versprach sie, als sie Robin die Münzen in die Hand schüttete, »damit sie sich keine Sorgen machen.«
Maia hockte sich auf die Tischkante und riß eine Packung Zigaretten auf. »Verändere die Welt, Robin, mein Schatz.« Ihre hellen Augen zogen sich zusammen, als sie lachte: »Ich werde wohl eine Weile in diesem Nest hier festsitzen – der Märchenprinz scheint anderweitig beschäftigt zu sein –«
»– der einzige junge Mann, den ich in letzter Zeit kennengelernt habe, ist der neue Hilfspastor, und der hat eine Warze auf der Nase –«
»– und da wir mit Buchhaltungskursen und Wohltätigkeitsbasaren und anderen Gemeindeangelegenheiten zu tun haben, mußt du jetzt wenigstens das Fähnlein hochhalten, Robin, und deine Mädchenträume verwirklichen.« Maias Ton war zynisch, als sie Robin den Beutel hinhielt. »Los, mach dich auf den Weg. Und beeil dich, der Zug nach London fährt um Viertel nach.«