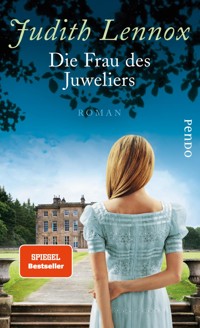9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Bei einer Autopanne begegnet der Frauenschwarm Richard der jungen Isabel, einer Frau aus eher kleinen Verhältnissen. Umso erstaunter ist der Gutsbesitzersohn, als sie ihn zurückweist. Dennoch verliebt er sich in sie – eine Liebe, die chancenlos scheint und trotzdem in eine Ehe mündet, die viele Stürme des Schicksals überdauern soll. Doch Isabel verpasst den Zeitpunkt, um ihrem Mann von ihrer Vergangenheit zu erzählen. Denn es gibt ein Geheimnis, das sie und diejenigen, die sie am meisten liebt, eines Tages einholen wird … Mit feinem menschlichem Gespür erzählt Judith Lennox in ihrem mitreißenden Roman von Liebe, Loyalität und der Stärke einer Familie.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Für Ewen und Amanda, in Liebe
Übersetzung aus dem Englischen von Mechtild Sandberg
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe
5. Auflage 2010
ISBN 978-3-492-95336-8
© Judith Lennox 2008
Titel der englischen Originalausgabe:
»Before the Storm«, Headline Review, London 2008
© der deutschsprachigen Ausgabe:
Piper Verlag GmbH, München 2007
Umschlagkonzept: semper smile, München
Umschlaggestaltung: Cornelia Niere, München
Umschlagfoto: plainpicture
Teil 1
Die rote Königin
1909–1928
1
ALS RICHARD FINBOROUGH IM HERBST 1909 auf der Fahrt durch Devon war, ließ ihn unversehens sein Automobil im Stich. Schlechtes Wetter war aufgezogen, seit er sich am frühen Nachmittag von seinen Freunden, den Colvilles, verabschiedet hatte, und er hegte schon eine ganze Weile den Verdacht, dass er auf dem Weg über Exmoor irgendwo falsch abgebogen war.
Er lenkte den Wagen an den Straßenrand. Regen schlug ihm ins Gesicht, ein stürmischer Wind, der das welke Laub von den Bäumen fegte, zerrte an seinem Jackett und drohte, ihm den Hut vom Kopf zu reißen. Als er sich im schwindenden Licht den de Dion ansah, stellte er fest, dass hinten eine Blattfeder beschädigt war. Nur ungern gab er seinen ursprünglichen Plan auf, in Bristol zu übernachten, und machte sich auf die Suche nach einer näher gelegenen Unterkunft. Einige Kilometer weiter zeigte ein Wegweiser die Ortschaft Lynton an. Der Wagen schlingerte, als er in die Abzweigung einbog.
In Lynton mietete er sich in einem Hotel ein. Am nächsten Morgen nach dem Frühstück ließ er den Wagen zur Reparatur in eine Schmiede bringen, während er selbst einen Rundgang durch den Ort machte, der hoch oben auf einem Felsen über dem Bristol Channel lag. Lynmouth, das Nachbardorf, kauerte unten am Wasser. Richard konnte von seinem Aussichtspunkt aus die schäumenden Wellen erkennen, die im anhaltenden Sturm wie wilde Horden weißer Pferde über das Meer jagten. Man nannte diesen Teil von Nord-Devon scherzhaft auch »die kleine Schweiz«, was ihn nicht wunderte: Die tiefen Einschnitte zwischen den Hügeln und das steile Auf und Ab der Fußwege, über denen sich die Häuser an schroffe Wände klammerten, waren beeindruckend.
Er beschloss, nach Lynmouth hinunterzugehen. Der stürmische Wind und der abschüssige Weg geboten Aufmerksamkeit bei jedem Schritt. Unten im Dorf vereinigten sich zwei Bergbäche, die nach den schweren Regenfällen zu reißenden Flüssen voll Treibgut aus den bewaldeten Tälern angeschwollen waren, zu einem schäumenden Strom, ehe sie ins Meer mündeten. Niedrige Häuser drängten sich um den Hafen, und die Fischerboote lagen am Kai vertäut, vermutlich weil den Fischern das Wetter zum Hinausfahren zu schlecht war. Immer wieder gingen heftige Regenschauer nieder; wie ein Schwamm sog das Land das Wasser auf. Richard verfluchte den de Dion, der daran schuld war, dass er bei diesem Wetter hier festsaß, mitten in der Wildnis.
Flatterndes Rot am äußersten Ende der Hafenmole zog seinen Blick auf sich, und bei genauerem Hinsehen konnte er im wogenden Grau und Braun des sturmbewegten Wassers eine Frauengestalt ausmachen. Sie stand zu Füßen eines trutzigen steinernen Turms auf der Mole, die den Hafen auf einer Seite mit schützendem Arm umfasste. Er hob die Hand über die Augen, um sie gegen den Regen abzuschirmen: Ein blauweißer Rock unter einer roten Jacke und langes schwarzes Haar, wie eine wehende Fahne im Wind. Der Sturm rüttelte an ihr, der Gischt sprühte hoch über ihr auf; nicht weit von ihr tobte das Wasser. Sie war zu nah am Rand – eine etwas stürmischere Welle würde genügen, sie in die See zu reißen. Es beunruhigte ihn, dass sie an so ungeschützter Stelle stand, und er war froh, als sie sich vom Wasser abwandte und zum Kai zurückging.
Neugierig wartete er im Schutz einer Türnische. Als sie näher kam, sah er, dass sie völlig durchnässt war. Sie musste lange im Regen gestanden haben. Er lüftete den Hut, als sie an ihm vorüberging, und sie, erst jetzt auf ihn aufmerksam geworden, sah sich nach ihm um. Aber sogleich wandte sie sich wieder ab, so heftig, dass ihre nassen schwarzen Haare flogen, und hielt auf die Straße zu, die nach Lynton hinaufführte.
In den darauffolgenden Tagen kam sie ihm mehrmals in den Sinn. Das schwarze Haar, die stolze Haltung, als sie in dem regenschweren langen Rock und der durchnässten roten Jacke an ihm vorübergegangen war. Wie eine Königin – eine rote Königin, dachte er.
Der Sturm ließ nach, die Fischerboote fuhren wieder auf See hinaus. Der Himmel, über den Wolkenfetzen flogen, leuchtete in einem verwaschenen Graublau. Die Gullys waren verstopft, und weit oben am felsigen Ufer hatte sich ein breiter Streifen Strand- und Treibgut gesammelt.
Das Hotel hatte um diese Zeit, außerhalb der Saison, kaum Gäste außer ihm. Im Speisesaal traf Richard einige alte Herren an, die vermutlich das Jahr über hier in Pension lebten, und ein junges Paar, vielleicht in den Flitterwochen, das Händchen haltend und kichernd an seinem Ecktisch saß. Als die Bedienung ihm das Essen brachte, ergriff Richard die Gelegenheit, um sie nach der Frau am Hafen zu fragen.
Sie sah ihn verständnislos an. »Eine junge Frau«, erklärte er, »Anfang zwanzig, vermute ich. Schwarze Haare. Sie hatte eine rote Jacke an.«
Sie stellte ihm seinen Teller mit der Scholle in Buttersoße hin. »Ach, Sie meinen wahrscheinlich Miss Zeale, Sir.«
»Miss Zeale?«
»Genau. Isabel Zeale. Eigentlich ist das ein Bridporter Name, aber sie stammt nicht von hier. Kann sein, dass sie aus Bristol kommt, ich weiß nicht.«
»Aber sie lebt hier?«
Die Bedienung nickte vage in landwärtiger Richtung. »Oben im Orchard House. Sie war Mr. Hawkins’ Haushälterin. Er ist vor drei Wochen gestorben, der arme alte Herr.«
Am folgenden Morgen ließ Richard sich den Weg zum Orchard House erklären, ehe er den steilen Hang hinter dem Ort hinaufstieg. Wälder, in denen sich immer wieder tiefe Felsschluchten auftaten, begleiteten ihn zu beiden Seiten. Nach einiger Zeit zweigte eine schmale, von Hecken und hohen Buchen geschützte Straße voller Pfützen von der Hauptstraße ab. Die Luft roch nach feuchter Erde und moderndem Laub.
Das Haus war leicht zu finden, sein Name schmückte in verschnörkelten schmiedeeisernen Lettern die Gartenpforte. Der weiß getünchte Bau stand, von der Straße zurückgesetzt, in einem Garten, dem der Sturm sichtlich zugesetzt hatte. Über die ganze Front des Hauses zog sich eine von Kletterpflanzen überwachsene Glasveranda. Die Vorhänge an den Fenstern waren zugezogen, Tor und Tür verschlossen, das ganze Anwesen, dachte Richard, wirkte unbewohnt.
Er wollte gerade wieder gehen und weiter den Hang hinaufsteigen, als die Haustür geöffnet wurde und Isabel Zeale heraustrat. Sie hatte wieder die rote Jacke an, diesmal zu einem dunklen Rock.
Richard öffnete das Tor. »Miss Zeale!«
Stirnrunzelnd ging sie ihm entgegen. »Ja?«
»Darf ich Sie vielleicht um ein Glas Wasser bitten?«
Sie schwieg einen Moment, als erwöge sie, ihn abzuweisen, dann sagte sie: »Warten Sie hier«, und ging zurück ins Haus. Ein paar Minuten später kam sie mit einem Glas in der Hand wieder.
»Vielen Dank.«
»Woher wissen Sie meinen Namen?«
»Die Bedienung in meinem Hotel hat ihn mir gesagt. Ach, ich bin übrigens Richard Finborough.«
Sie hatte die Arme verschränkt und sich zur Seite gedreht. Seine dargebotene Hand schien sie nicht zu bemerken. Während er das Wasser trank, betrachtete er ihr Profil, die gerade, klassisch geformte Nase, den Schwung der leicht aufgeworfenen Lippen. Der Kontrast zwischen dem schwarzen Haar und der beinahe durchscheinenden Blässe ihres Gesichts war aufregend.
Um die Spannung zu lösen, die er in dem Schweigen zwischen ihnen zu spüren meinte, fragte er: »Leben Sie schon lange hier?«
»Seit zweieinhalb Jahren.«
»Es ist eine sehr abgelegene Gegend.«
»Ja. Gerade das gefällt mir.« Sie wandte sich ihm zu. Der Blick ihrer hellen grünblauen Augen war feindselig. »Wenn Sie mich jetzt entschuldigen würden. Ich muss zurück an die Arbeit.«
»Aber ja, natürlich.« Er reichte ihr das Glas. »Danke für das Wasser, Miss Zeale.«
Sie faszinierte ihn. Diese Augen, diese ungewöhnliche, fremdartige Schönheit – hier draußen, auf dem Land, so unerwartet wie die Entdeckung einer exotischen Blume auf einer Bergwiese.
Keine der verwöhnten Londoner Frauen seiner Bekanntschaft konnte es an apartem Reiz mit ihr aufnehmen. Und ihre abweisende Kälte sah er nur als Herausforderung an. Er war ein gut aussehender, wohlhabender und selbstbewusster Mann und Zurückweisung nicht gewöhnt, schon gar nicht von einer Hausangestellten.
Am Nachmittag erhielt er Nachricht, dass sein Wagen fertig war. Während er in der Wohnstube des Schmiedshauses wartete, geriet er mit der Frau des Schmieds ins Gespräch, das sich, wie von ihm beabsichtigt, bald Isabel Zeale zuwandte.
»Sie stammt nicht aus Lynton, nicht wahr?«, bemerkte er.
Die Frau des Schmieds lachte verächtlich. »Die nicht.«
»Und woher kommt sie?«
»Keine Ahnung, Sir. Die ist sich zu gut für unsereins. Man kann froh sein, wenn sie einen grüßt.« Sie fegte unnötig heftig mit ihrem Staubwedel über den Kaminsims. »Wenn Sie mich fragen, wird die sowieso bald verschwunden sein.« Der Ton der Schmiedsfrau verriet deutlich, dass Isabel Zeale ihr gar nicht schnell genug aus Lynton verschwinden konnte.
»Sie meinen, weil ihr Arbeitgeber gestorben ist?«, fragte er. »Da wird sie sich wohl eine neue Stellung suchen müssen.«
Wieder das verächtliche Lachen. »Oh, um solche wie die braucht man sich keine Sorgen zu machen. Die fallen doch immer auf die Füße.«
Jemand klopfte von draußen ans Fenster. Es war der Schmied, der seinen Wagen gebracht hatte, und Richard ging hinaus, um den de Dion in Empfang zu nehmen.
Am nächsten Morgen erwachte er zeitig. Der Himmel war strahlend blau, Straßen und Häuser lagen in goldenem Morgenlicht. Er hatte eigentlich vorgehabt, ohne weiteren Aufenthalt nach London aufzubrechen, aber nachdem er Morgentoilette gemacht hatte, holte er nicht seinen Wagen, sondern unternahm in der frischen Salzluft noch einmal einen Gang durch den Ort. Sein Weg führte ihn am Kirchhof vorbei. Als er zwischen Eiben und Grabsteinen eine Gestalt bemerkte, blieb er stehen und wartete, bis Isabel Zeale aus dem Friedhof trat. Sie trug Schwarz, und ihr Gesicht war verschleiert. Eines der Gräber, noch nicht durch einen Stein gekennzeichnet, war, wie er sah, mit frischen Rosen geschmückt.
»Guten Morgen, Miss Zeale«, sagte er.
»Guten Morgen, Mr. Finborough.«
Lächerlich, wie sehr es ihn beglückte, dass sie seinen Namen behalten hatte. »Ich wollte gerade den Berg hinauf«, sagte er. »Darf ich Sie begleiten?«
»Ganz wie Sie wollen«, antwortete sie gleichgültig.
Seine Bemerkungen über den schönen Tag und die Gewalt des vergangenen Sturms gingen ins Leere. Auf Fragen antwortete sie kurz und kühl. Als sie vor dem Haus anhielten, musterte er den schönen alten Bau und sagte unwillkürlich: »Ich kann mir vorstellen, dass es Ihnen schwerfällt, von hier wegzugehen. So eine Idylle findet man so leicht nicht wieder.«
Ihr Gesicht war hinter dem Schleier verborgen, aber ihre Stimme war so kalt und hart wie Eis. »Ich weiß, was im Ort über mich geredet wird, Mr. Finborough.«
Erstaunt starrte er sie an. »Entschuldigen Sie, aber –«
»Ich weiß nicht, was für Geschichten Sie gehört haben, aber keine davon ist wahr. Am besten vergessen Sie den ganzen Klatsch. Und wenn Sie jetzt so freundlich wären, mich vorbeizulassen …«
Er bemerkte, dass er direkt vor der Pforte stand. Er hielt sie für sie auf, und sie trat in den Garten.
Noch einmal richtete sie das Wort an ihn. »Bitte sprechen Sie mich nicht wieder an. Ich möchte einfach nur meine Ruhe haben, und ich bitte Sie, das zu respektieren.«
Sie wandte sich zum Haus. Er wartete, bis sie die Tür hinter sich geschlossen hatte, dann ging er.
Während der Rückfahrt nach London, auf der er den de Dion bis zum Äußersten forderte, ließ der Zorn ihn kaum einen Moment los. Der Ton, in dem diese Frau mit ihm gesprochen hatte, war beleidigend gewesen, ihr Verhalten zeigte eine Art von Verachtung, mit der er selbst höchstens einen unlauteren Geschäftspartner behandelt hätte. In der Stadt zurück, fuhr er direkt in die Firma, wo sein Stellvertreter, John Temple, einen großen Teil seines Zorns abbekam.
Richard Finborough lebte seit sieben Jahren in London. Mit achtzehn hatte er Irland, wo in County Down das Haus seiner Eltern stand, den Rücken gekehrt, weil er wusste, dass es in diesem Land keine Zukunft für ihn gab. Nach den irischen Landkriegen, dem Aufstand der Pächter gegen die Großgrundbesitzer und den danach erlassenen Reformgesetzen, den land acts, war von Raheen, dem Gutsbesitz der Familie Finborough, nicht mehr geblieben als das Haus und dreißig Morgen Park. Richards Vater, der starb, als sein Sohn gerade sechzehn Jahre alt war, hatte noch auf dem Sterbebett die britische Regierung wegen ihres Verrats an den anglo-irischen Familien verflucht. Richard teilte die Bitterkeit seines Vaters nicht, zumal er nie den Wunsch gehabt hatte, sein Leben als Bauer oder Gutsherr zuzubringen. Er hatte schon früh gesehen, welch zerstörerische Wirkung die Enttäuschung haben kann, wie sie einen Menschen aushöhlt und verändert.
Er war deshalb froh gewesen, das Gut in der Obhut seiner Mutter zurücklassen zu können, um nach London zu gehen, wo er sehr schnell Fuß fasste. Er liebte diese Stadt mit ihrer brodelnden Energie und Betriebsamkeit, in der man das Geld beinahe riechen konnte. Der Handel war ihr Geschäft, am deutlichsten war das in der City und im Hafen zu spüren, wo die großen Schiffe ihre Waren aus dem Empire abluden und ihre Frachträume mit den Erzeugnissen der Baumwollspinnereien und Eisengießereien füllten, bevor sie zu ihrer nächsten Reise um die Welt in See stachen.
Richard hatte zunächst bei einer Importgesellschaft gearbeitet, die von einem Freund der Familie geleitet wurde. Nach drei Jahren hatte er sich selbstständig gemacht. Er hatte entdeckt, dass er von Natur aus mit einem gut entwickelten Geschäftssinn ausgestattet war, fähig, kaltblütig und unsentimental zu handeln, und dass er ein Gespür für aufstrebende Industriezweige besaß und solche, die ihre beste Zeit überschritten hatten und sich im Niedergang befanden. Sobald er volljährig geworden war, verkaufte er, was von den finanziellen Anlagen seines Vaters noch übrig war. Der Erlös aus den Papieren war bescheiden, aber ein Grundstück in einem der besten Viertel Londons, Restbestand eines früher einmal beachtlichen Grundbesitzes in der Stadt, brachte ihm eine große Summe ein.
Mit einem Teil des Geldes hatte er die drängendsten Schulden auf dem irischen Besitz bezahlt. Danach blieb ihm genug, um einen Teeverpackungsbetrieb zu kaufen und eine kleine Knopfmacherei im East End von London. Ein Anfang, sagte er sich; der erste Schritt auf dem Weg zu dem Geschäftsimperium, das er, Richard Finborough, aufzubauen gedachte. Früher waren die Finboroughs reich und mächtig gewesen, mit großartigen Besitzungen und Ländereien zu beiden Seiten der irischen See. Die Zeit, der Lauf der Geschichte und unkluge finanzielle Manöver seines Vaters hatten der Familie das fast alles genommen. Der Verlust hatte Richards Ehrgeiz hervorgerufen, die frühe Bedrohung völligen Ruins ihn gespeist. Richard Finborough würde nicht rasten noch ruhen, solange Glanz und Wohlstand der Familie nicht wiederhergestellt waren.
Er blieb an diesem Abend seiner Rückkehr nach London lang in der Firma; es war neun vorbei, als er nach Hause in seine Wohnung in Piccadilly kam. Der Zorn über Isabel Zeale hatte nachgelassen, andere, komplexere Gefühle hatten sich eingestellt. Er verzichtete auf den Imbiss, den sein Diener ihm zubereiten wollte, zog sich nur um und ging gleich wieder. Nachdem er in seinem Klub zu Abend gegessen hatte, begab er sich in die Charles Street zu einem Empfang, auf dem er, wie er wusste, Violet Sullivan antreffen würde.
Violet war die jüngere Tochter des Großindustriellen Lambert Sullivan, eine hübsche, selbstsichere junge Frau, die gern flirtete. Richard verband seit einigen Monaten eine lose Beziehung mit ihr, ein-, zweimal hatte er sogar mit dem Gedanken gespielt, sie zu heiraten. Sie hatte einen appetitlichen Körper, und eine Verbindung mit der mächtigen Familie Sullivan konnte nur zu seinem Vorteil sein.
An diesem Abend jedoch vermochte sie ihn nicht zu fesseln. Die koketten Augenaufschläge und das mädchenhafte Gekicher kamen ihm künstlich und berechnend vor, das Gesicht mit der makellosen Haut, die wie Elfenbein schimmerte, nichtssagend, das Geplauder dümmlich. Immer wieder schob sich beim Gespräch mit ihr Isabel Zeales Bild mit seiner geheimnisvollen, beinahe unirdischen Schönheit vor Richards Blick.
Er verabschiedete sich früh. Der Himmel war sternenklar. Eine Zeit lang ging er ziellos vor sich hin und genoss nach den überheizten Räumen die Kühle der Nacht. Später setzte er sich in ein Pub, bestellte einen Brandy und dachte an den Morgen zurück.
Ich weiß, was im Ort über mich geredet wird, Mr. Finborough.
Am Tag zuvor hatte die Schmiedsfrau ganz unverhohlen ihre Abneigung gegen Isabel Zeale gezeigt. Man brauchte nicht allzu viel Phantasie, um sich denken zu können, was die Leute an ihr auszusetzen hatten. Ihr Stolz, ihre Zurückhaltung, ihr Verlangen, in Ruhe gelassen zu werden, und natürlich ihre Schönheit boten Anlass genug zu Unmut und Klatsch. Sie war vermutlich eine unkonventionelle Frau, und in kleinen, weltfernen Dörfern und Gemeinden erregte seiner Erfahrung nach Misstrauen, wer sich nicht an die Konventionen hielt.
Richard trank den Brandy aus und bestellte sich noch einen. Die geballte Missbilligung von Isabel Zeales Nachbarn galt natürlich dem unmoralischen Lebenswandel, den man ihr unterstellte. Die Männer begehrten sie, und die Frauen beneideten sie. Sein Interesse an ihr – seine Fragen an die Bedienung und die Schmiedsfrau – hatten zweifellos Kopfschütteln und geringschätzige Kommentare hervorgerufen. Es war gut möglich, dass er, ohne es zu wollen, zu Isabel Zeales Schwierigkeiten beigetragen hatte. Und jetzt begriff er auch, dass sie wahrscheinlich geglaubt hatte, sein Interesse an ihr wäre durch den Dorfklatsch geweckt worden; dass sie geglaubt hatte, er hätte sie angesprochen, weil er sie für eine leichte Person hielt.
Richard senkte den Kopf in die Hände. Zu peinlich war ihm seine Unüberlegtheit. Vergiss die Frau, sagte er sich. In London gab es Hunderte schöner Frauen, Hunderte von Meilen trennten London von Lynton. Er brauchte sie nie wiederzusehen.
Angenehm benebelt vom Alkohol, machte er sich auf den Weg quer durch die Stadt zum Haus seiner Geliebten, Sally Peach.
In den folgenden Tagen konzentrierte sich Richard auf die Arbeit und seine geschäftlichen Pläne. Die Teeverpackungsfabrik hatte Möglichkeiten, aber das Werksgelände war beschränkt und erlaubte keine Erweiterung; und die Knopfmacherei bestand eigentlich nur aus einem Schuppen, in dem Frauen in Reihen nebeneinander mit zusammengekniffenen Augen bei schlechtem Licht arbeiteten. Beide Unternehmen mussten wachsen, wenn sie überleben und gedeihen sollten. Die Arbeiter begannen, höhere Löhne zu fordern; wenn die Leute erst mehr verdienten, würden sie auch mehr ausgeben können, und das wollte sich Richard zunutze machen. Er wusste, dass die Zeiten vorbei waren, da es allein die Bedürfnisse der Reichen zu bedienen galt, und wollte sich auf keinen Fall von Veränderungen, die seiner Meinung nach unausweichlich waren, überrollen lassen. Er würde kein Vermögen damit verdienen, dass er edle Tees an die Reichen verkaufte; ganz anders würde es wahrscheinlich aussehen, wenn er den Leuten, die kein so dickes Portemonnaie hatten, einen preiswerteren Tee in attraktiver Verpackung anbot.
Und was die Knopfmacherei anging, so waren Knöpfe aus Perlmutt, Schildpatt und Glas zwar eine feine Sache, aber ihre Herstellung war aufwendig und teuer. Richard suchte schon seit einiger Zeit nach einem billigeren und praktischeren Material. Anfang des Jahres hatte er Sidney Colville kennengelernt, einen Chemiker, der sich für die Eigenschaften und Verwendungsmöglichkeiten von Casein-Kunststoffen wie Galalith interessierte. Er war ein merkwürdiger Geselle, ein menschenscheuer Eigenbrötler, der sich manchmal wochenlang in seine Arbeit vergrub und dann für niemanden zu sprechen war. Viel Zeit verbrachte er im West Country bei seiner invaliden Schwester Christina. Richard fand, es wäre an der Zeit, ihn wieder einmal zu besuchen.
Er verabredete sich mit den Colvilles und vereinbarte mit John Temple, dass dieser ihn während seiner Abwesenheit vertreten würde. Er war sich durchaus bewusst, dass nicht allein der Wunsch, sich über Casein-Kunststoffe zu informieren, ihn erneut nach Devon trieb. Diesmal, nahm er sich vor, würde er sehr behutsam vorgehen. Sidney Colville und Isabel Zeale hatten etwas gemeinsam: Sie waren beide sehr empfindlich.
Richard traf am späten Nachmittag in Lynton ein, als der Himmel sich schon zu verdunkeln begann. Voll Ungeduld, Isabel Zeale wiederzusehen, fuhr er nicht erst zum Hotel, wie er eigentlich vorgehabt hatte, sondern lenkte den Wagen gleich die steile, schmale Straße hinauf, die zum Orchard House führte.
Nachdem er den Wagen abgestellt hatte, trat er zur Pforte und erblickte drüben, im Garten, Isabel Zeale. Ihr Anblick traf ihn beinahe wie ein Stich ins Herz, merkwürdige Gefühle bewegten ihn: Freude und Angst und etwas wie gespannte Erwartung, als wäre er im Begriff, eine lange, schwierige Reise anzutreten. Und obwohl sie kaum mehr als ein Dutzend Worte gewechselt hatten, erschien sie ihm so vertraut, als kennte er sie schon seit Langem.
Einige Minuten lang beobachtete er sie unbemerkt. Der Wind fegte über den ungeschützt am Hang liegenden Garten, riss an ihrem Haar und bauschte ihren Rock. Sie wirkte wie getrieben bei ihrer Arbeit, beinahe zornig in ihrer Resolutheit. Ein Hieb mit der Sichel, und ein Gewirr struppigen Buschwerks fiel. Ein weites Ausholen mit dem Rechen, und die braunen Kastanienblätter auf dem Rasen waren in Häufchen gesammelt. Aber der Wind hatte aufgefrischt und wirbelte das Laub auf, noch während Isabel Zeale sich abmühte. Ihre Schultern erschlafften, als begänne sie zu ermüden.
Beim Geräusch seiner Schritte auf dem Aschepfad drehte sie sich um.
»Warten Sie«, sagte er. »Ich helfe Ihnen.«
Er zog sein Jackett aus, warf es über einen Ast des Baums und ergriff den Rechen.
»Was soll das?«, fuhr sie ihn heftig an.
»Ich möchte Ihnen helfen.«
»Bitte gehen Sie, Mr. Finborough.« Ihre Stimme zitterte vor Zorn.
Er fuhr fort, das welke Laub auf den Komposthaufen neben der Rasenfläche zu rechen. »So ein großer Garten bedeutet viel Arbeit für einen allein.«
Schweigen. Dann sagte sie kurz: »Sonst ist immer ein Junge aus Lynmouth für die schweren Arbeiten heraufgekommen, aber er war seit etwa einem Monat nicht mehr hier.«
»Und warum nicht?«
Sie zog ihre Jacke um sich, als brauchte sie Schutz, und sah ihn mit kühlem Blick an. »Was glauben Sie wohl, Mr. Finborough?«
»Ich habe keine Ahnung.«
»Er kommt nicht mehr – oder seine Mutter erlaubt ihm nicht mehr zu kommen –, weil ich jetzt ganz allein hier bin. Ich könnte ihn ja mit meiner Verworfenheit infizieren«, sagte sie sarkastisch.
Zorn und Anstrengung hatten ihre blasse Haut leicht gerötet, ihre Schönheit wirkte dadurch umso lebhafter.
»Wirklich?«, fragte er und erwartete beinahe einen Schlag ins Gesicht.
Aber sie schien nur noch ein wenig mehr in sich zusammenzusinken. »Warum müssen die Menschen immer das Schlimmste annehmen?«, fragte sie bitter. »Ist das Leben nicht auch so schwer genug, ohne Schlechtigkeit zu sehen, wo keine ist?«
»Vermutlich ist den Leuten einfach langweilig. In diesen kleinen Dörfern bietet das Leben sicher wenig Abwechslung, vor allem im Winter. Da liefert jeder, der ein bisschen aus dem Rahmen fällt, willkommenen Gesprächsstoff.«
Sie runzelte die Stirn. »Ich habe es nie darauf angelegt, aus dem Rahmen zu fallen. Ich wollte immer nur unbemerkt bleiben.«
»Hören Sie einfach nicht auf den Klatsch.«
»Tu ich ja. Aber dass sie ihn auch schlechtgemacht haben…«
»Sie sprechen von Ihrem Arbeitgeber?«
»Ja. Charles war in den letzten Monaten seines Lebens sehr hinfällig. Natürlich habe ich ihn beim Gehen gestützt, wenn wir im Dorf waren. Natürlich habe ich ihm geholfen, seine Schuhe auszuziehen, wenn der Rheumatismus ihn so sehr plagte, dass er sich nicht bücken konnte. Vermutlich hat das jemand beobachtet, der am Haus vorüberkam. Ich weiß es nicht. Ich kann nicht verstehen, dass die Leute alles gleich auf so gemeine Weise auslegen müssen.« Sie sah ihn fragend an. »Warum sind Sie gekommen, Mr. Finborough?«
Jetzt war das ganze Laub in einem Haufen zusammengerecht. »Weil ich gern ein Feuerchen mache«, antwortete er lächelnd, zog ein Feuerzeug heraus und knipste es an. Das welke Laub fing schwelend Feuer. »Nein, im Ernst, ich bin gekommen, weil ich mich bei Ihnen entschuldigen wollte, Miss Zeale. Zu Hause in London wurde mir klar, dass ich Sie wahrscheinlich in eine schwierige Lage gebracht hatte. Ich wollte Ihnen sagen, dass ich keinerlei Hintergedanken hegte, als ich Sie damals ansprach.«
»Sie kommen jetzt aus London?«
»Ja.«
»Und ich soll Ihnen glauben, dass Sie die weite Fahrt nur gemacht haben, um mir das zu sagen?«
»Aber nein. Ich habe geschäftlich in der Nähe von Woolacombe zu tun.«
»Oh.« Sie wurde rot.
Das Feuer hatte sich ausgebreitet, hier und dort züngelten Flammen aus dem knisternden Laubhaufen.
»Als wir uns das letzte Mal begegnet sind«, erklärte Richard, »saß ich hier wegen einer Autopanne fest. Ganz allein in der Fremde.« Er lachte ein wenig. »Da sucht man Gesellschaft. Sie waren mir gleich nach meiner Ankunft in Lynton aufgefallen. Es war ein sehr stürmischer Tag, und da ich die See bei Sturm immer faszinierend finde, bin ich nach Lynmouth hinuntergegangen. Da habe ich Sie am Ende der Mole gesehen. Sie standen vor einem alten Turm, dem Wasser viel zu nahe, fand ich. Es hat mich beunruhigt.«
Sie antwortete mit einem kurzen, geringschätzigen Lachen. »Zum Nachdenken gehe ich immer zum Rhenish Tower hinunter. Das tut mir gut.«
»Worüber haben Sie denn –« Er unterbrach sich hastig. »Oh, entschuldigen Sie. Das geht mich natürlich gar nichts an.«
Einen Moment schwieg sie, dann blickte sie zum Haus zurück und sagte: »Es ist kein Geheimnis. Ich habe über meine Zukunft nachgedacht. Ich muss bald von hier fort.«
Er erinnerte sich, wie sie dort gestanden hatte, viel zu nahe am Rand der Steinmauer in den Wind gelehnt. »Es hat – gefährlich ausgesehen.«
»Es war nicht gefährlich. Was hätten Sie getan, Mr. Finborough, wenn ich ins Wasser gefallen wäre? Wären Sie hineingesprungen, um mich zu retten?« Ihr Ton war spöttisch.
»Ja, ich denke, das hätte ich getan«, sagte er ruhig.
»Wie unerhört ritterlich, sich um jemanden, den man gar nicht kennt, solche Sorgen zu machen.«
»Haben Sie nie so starke Sehnsucht nach Gesellschaft verspürt, Miss Zeale, dass Sie bereit waren, jeden Fremden auf der Straße anzusprechen?«
Ihr Gesicht verschloss sich wieder. »Einmal«, sagte sie leise. »Aber das ist lange her. Heute nicht mehr.« Das Feuer erlosch langsam; ihre Züge verloren die vorübergehende Lebhaftigkeit, und sie fröstelte. »Ich muss gehen. Ich habe noch eine Menge zu tun. Guten Abend, Mr. Finborough.«
Darauf bedacht, sich nicht zu bald wieder im Orchard House sehen zu lassen, verbrachte Richard die folgenden Tage bei den Colvilles in dem gemieteten Cottage in der Nähe von Woolacombe, wo Sidney Colville, ausnahmsweise mitteilsam gestimmt, sich redlich bemühte, ihm die chemische Zusammensetzung von Casein-Kunststoffen zu erklären, und dabei unzählige Blätter Papier mit Formeln vollkritzelte. Immerhin gingen sie ab und zu ins Freie hinaus, um frische Luft zu schöpfen. Sidney, der ein leidenschaftlicher Vogelliebhaber war, erzählte ihm alles über die Seevögel, die sie sahen, und Richard hörte höflich zu, während er in Gedanken bei Isabel Zeale war.
Als er Ende der Woche wieder in Lynton war, versuchte er, Näheres über sie zu erfahren, und hörte, dass sie vor mehr als zwei Jahren, im Sommer 1907, ihre Stellung im Orchard House angetreten hatte. Charles Hawkins, ihr Arbeitgeber, war bis zum Tod seiner Frau sieben Jahre zuvor Leiter eines Knabeninternats gewesen. Seine Eigenheiten hatten die Leute im Dorf geduldet, die seiner Haushälterin nicht. Die Art wie diese sich kleidete, ihr Akzent, dem das für Devon typische Gutturale fehlte, ihre Zurückhaltung neugierigen Fragen gegenüber – das alles hatte bei den Dorfbewohnern Groll hervorgerufen. Ja, sogar dass sie gern und viel las, hatte Misstrauen erregt. In den Augen der Leute war sie eine hochnäsige Person, die sich für etwas Besseres hielt, das war leicht zu erkennen. Von der schwersten Sünde jedoch, die sie begangen hatte, wurde nur in Andeutungen gesprochen. So dreist, ihm rundheraus zu sagen, dass Isabel Zeale ihre Stellung als Haushälterin dazu benutzt hatte, Charles Hawkins’ Geliebte zu werden, war dann doch niemand. Aber es war klar, was alle dachten.
Das nächste Mal sah Richard sie im Ort. Er war nach dem Frühstück zum Hafen hinuntergegangen, und als er nach Lynton zurückkam, sah er sie nicht weit entfernt vor sich. Sie hatte die rote Jacke an und trug einen Einkaufskorb. Noch während er sie beobachtete, wurde sie von mehreren Männern, die aus dem Pub getorkelt kamen, so derb angerempelt, dass ihr der Einkaufskorb aus der Hand fiel. Er hörte Gelächter und Johlen, als ein Laib Brot in den Rinnstein rollte und Mehl aus einer geplatzten Tüte auf die Pflastersteine stäubte.
Isabel Zeale bückte sich, um die Sachen einzusammeln. Ein Kohlkopf rollte Richard vor die Füße. Er hob ihn auf und eilte zu ihr. »Hier.« Er legte das Gemüse in den Korb. »Warten Sie, ich helfe Ihnen gleich.«
Sie packte ihn am Ärmel. »Nein. Lassen Sie sie gehen.«
»Aber sie haben Sie absichtlich angerempelt. Ich habe es genau gesehen. Das kann man ihnen nicht einfach durchgehen lassen.«
Leise und eindringlich sagte sie: »Wenn Sie sich jetzt einmischen, muss ich es nachher büßen. Sie fahren in ein paar Tagen wieder ab, Mr. Finborough, ich kann das nicht. Ich habe keine andere Bleibe.«
Widerstrebend nickte er und half ihr den Rest ihrer Sachen einsammeln. Das Brot lag im Matsch, und ihre Zeitung war durchweicht.
»Dann erlauben Sie mir wenigstens, die beschädigten Einkäufe zu ersetzen«, sagte er.
»Nein, danke.« Sie war sehr blass. »Aber wenn Sie so freundlich wären, mich noch ein Stück zu begleiten – nur zur Sicherheit…«
Er nahm ihr den Korb ab, und sie gingen zusammen die Straße hinauf. Kurz vor der Ecke rief einer der Betrunkenen ihnen nach: »Für reiche Kerle hast du was übrig, stimmt’s, Liebchen? Und reiche alte Kerle sind dir die liebsten.« Die anderen Männer lachten. Richard sah, wie Isabel Zeale die Lippen zusammenpresste.
Er ließ ihr einige Minuten Zeit, ihre Fassung wiederzugewinnen, dann fragte er, während sie aufwärtsstiegen: »Was waren das für Männer?«
»Die Salters? Das sind Fischer – Brüder –, sie wohnen in Lynmouth.«
»Sind sie Bekannte von Ihnen?«
»Anfangs –« Sie brach ab. Dann sagte sie leise: »Als ich hierherkam, war ich sehr einsam. Ich habe vielleicht ein-, zweimal mit Mark Salter ein paar Worte gewechselt. Es war dumm von mir, er hat es völlig falsch ausgelegt.«
»Werden Sie häufig so belästigt?«
»Jetzt, wo Mr. Hawkins mich nicht mehr beschützen kann, sind sie mutiger geworden.«
»Mutig nennen Sie das?« Er sah sie an.
Sie warf den Kopf zurück. »Sie machen mir keine Angst. Mark Salter bildet sich ein, ich müsste seine Frau werden. Sie spielen die Beleidigten, weil ich ihn abgewiesen habe. Als würde ich auch nur daran denken, einen so primitiven Menschen zu heiraten.«
Als sie die schmale, von Hecken und Buchen gesäumte Straße zum Haus erreichten, wollte sie ihm den Korb abnehmen. »Vielen Dank, Mr. Finborough. Jetzt komme ich schon zurecht.«
»Unsinn. Ich bringe Sie vor die Tür.«
Die Schatten der Buchenzweige bildeten ein netzartiges Muster auf der Straße; jenseits der Bäume verdeckte dichtes Haselgebüsch Hügel und Dorf.
Es war angenehm, Seite an Seite mit ihr durch das lichtgesprenkelte Halbdunkel zu gehen. Einer dieser Dorfrüpel wollte sie also heiraten; und was wollte er selbst – Richard Finborough – von ihr? Er begehrte sie, ja, aber was er empfand, war nicht nur körperliches Verlangen. Er wollte noch etwas anderes: ihre Aufmerksamkeit vielleicht, ihre Wertschätzung. Er wollte diese Gleichgültigkeit überwinden, die sie ihm gegenüber an den Tag legte und die ihn kränkte.
Sie waren am Haus angekommen. Einen Moment schien sie unschlüssig, als sie vor der Gartenpforte anhielten, dann sagte sie hastig: »Darf ich Ihnen eine Tasse Tee anbieten, Mr. Finborough?«
Er dankte ihr. Auf dem Weg zur Haustür erzählte sie ihm, dass ein Neffe ihres verstorbenen Arbeitgebers, ein Mr. Poole, der in Indien lebte, das Haus erbte. »Ich habe heute Morgen einen Brief von ihm bekommen«, sagte sie. »Er hat vor, so bald wie möglich nach England zu kommen. Ich hatte gehofft …«
»Was?«
»Dass Mr. Poole in Indien bleiben würde. Und mich beauftragen würde, mich um das Haus zu kümmern. Naiv, ich weiß.«
»Ist es nicht möglich, dass er Sie als Haushälterin behält?«
Sie sperrte die Haustür auf. »Mr. Poole hat Frau und Kinder. Irgendjemand würde sich bestimmt berufen fühlen, Mrs. Poole über mich aufzuklären, und ich würde entlassen werden.« Sie ging ins Haus. Richard folgte ihr. »Außerdem«, fügte sie hinzu, »würde ich es wahrscheinlich mit fremden Menschen hier gar nicht aushalten.« Der Blick der klaren grünlichblauen Augen traf kurz den seinen, als sie sagte: »Ich habe Charles nämlich wirklich geliebt. Nicht in dem Sinn natürlich, wie es der Klatsch mir vorwirft – aber ich habe ihn geliebt.«
Als er ins Haus trat, verspürte er neben Neugier und Interesse flüchtigen Triumph. Er hatte die äußerste Mauer der Festung erstürmt. Im Vestibül stand, neben den an Haken hängenden Tweedjacken und Ölmänteln, ein Elefantenfuß als Schirmständer. Auf dem Fensterbrett gruppierten sich wie Planeten, die durch den Weltraum rasten, drei Globen. Bücher stapelten sich in deckenhohen Regalen im langen Flur, einige davon neu, die meisten jedoch alt und abgegriffen, mit nur noch an Fäden hängenden Rücken. In den Zimmern, deren Türen offen standen, waren noch mehr Regale mit noch mehr Büchern.
Die Holzdielen glänzten; es roch nach Bienenwachs und Lavendel.
»Ein schönes Haus«, bemerkte er. »Ich kann verstehen, dass Sie gern bleiben würden.«
Sie strich mit der Hand über das glatte alte Eichenholz des Treppengeländers. »Es war meine Zuflucht.«
»Erzählen Sie mir von Mr. Hawkins.«
Zum ersten Mal sah er sie lächeln. »Er war ein ungewöhnlicher Mensch. Ich habe nie jemanden wie ihn gekannt. Er wusste – ach, einfach alles. Er war so liebenswürdig. Und ich habe so viel von ihm gelernt. Ich durfte jedes Buch lesen, das mich interessierte, ganz gleich welches.« In ihrer Stimme klang staunende Bewunderung. »Er hat mich an meinen Vater erinnert, auch wenn mein Vater nicht die gleichen Chancen hatte.«
»Was ist mit Ihrem Vater?«
»Er ist an der Schwindsucht gestorben.«
»Und Ihre Mutter?«
»Sie ist kurz nach meiner Geburt gestorben.«
Sie ging weiter. Am Ende des Korridors öffnete sie eine Tür, und sie traten in eine große Küche. Auf Hochglanz polierte Kupfertöpfe hingen, nach Größe geordnet, an der Wand gegenüber. Das Geschirr stapelte sich ordentlich aufgeräumt auf Borden, Spülstein und Boden blitzten.
Er stellte den Einkaufskorb auf den Tisch. »Was haben Sie vor, wenn Sie hier weggehen?«
»Ich werde mir eine neue Stellung suchen.«
»In Devon?«
»Nein, das glaube ich nicht. Mr. Hawkins hat mir ein wirklich gutes Zeugnis ausgestellt, aber Klatsch spricht sich schnell herum. Ich werde mir wohl eine ganz andere Gegend suchen müssen, auch wenn ich am liebsten hierbleiben würde. Ich war glücklich hier.«
Sie ging zum Spülstein und füllte den Teekessel mit Wasser. Und er nutzte die Gelegenheit, während sie mit dem Rücken zu ihm stand, um sie zu betrachten, die schmalen Schultern, die zierliche Taille, die Rundung der Hüften zu bewundern.
»Sind Ihre Geschäfte in Devon gut verlaufen, Mr. Finborough?«, fragte sie ihn.
»Ja, ich denke schon.« Er erzählte ihr von Sidney Colville und dessen Interesse an Casein-Kunststoffen. »Das ist das Material der Zukunft. Es hat ganz außergewöhnliche Eigenschaften – man kann ihm jede beliebige Form und Farbe geben.« Er lachte. »Wollen Sie wissen, woraus es hergestellt wird, Miss Zeale?«
»Woraus?«
»Aus Kuhmilch.« Er lachte wieder. »Ist das nicht verrückt? Ich werde Knöpfe aus Kuhmilch fabrizieren. Aber ich muss die technischen Einzelheiten verstehen, bevor ich mein Geld in den Prozess stecke.«
»Mr. Hawkins hat einmal eine Blume mit dem Messer halbiert, um mir die verschiedenen Bestandteile zu zeigen. Er sagte, wenn man nicht weiß, woraus etwas gemacht ist, könne man es nicht wirklich begreifen.«
»Ganz meine Meinung. Manches ist natürlich schwieriger zu fassen als anderes, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich mein Ziel immer erreiche, wenn ich nicht lockerlasse.«
Sie stand weit entfernt von ihm auf der anderen Seite des Raums, offenbar immer noch misstrauisch. »Das kann ich mir denken, Mr. Finborough«, sagte sie. »Das kann ich mir denken.«
Am nächsten Morgen stand Richard früh auf und verließ das Hotel noch vor dem Frühstück. Wie an einer unsichtbaren Schnur gezogen, ging er durch den Ort bergan zu der schmalen baumbeschatteten Straße, die zum Haus führte. Die Sonne stand noch tief, Farn und Unterholz lagen im Nebel, sodass es schien, als ragten die Bäume aus dem Nichts in die Höhe. Seine Gedanken überschlugen sich, er fühlte sich gehetzt, von einer drängenden Energie getrieben.
Als er zum Haus kam, sah er die Gartenpforte weit offen stehen. Auf Rasen und Fußweg lag Müll verstreut, Kartoffelschalen und Fischköpfe, alte Zeitungen hingen in den Rosenbüschen, auch die Veranda war nicht verschont geblieben.
Isabel Zeale trat mit einem Besen in der Hand aus dem Haus. Sie blieb abrupt stehen, als sie ihn bemerkte. »Füchse«, erklärte sie schnell. »Die hinterlassen immer ein Chaos.«
Er wusste, dass sie log. Nicht Füchse, sondern Menschen hatten hier in der Nacht ihr Unwesen getrieben. Aber an ihrer trotzig entschlossenen Miene erkannte er, dass es keinen Sinn hatte, ihr zu widersprechen.
»Ich helfe Ihnen«, sagte er.
»Das ist nicht nötig.«
Er beachtete die Zurückweisung nicht. »Am besten wäre eine Schaufel. Wissen Sie, ob im Schuppen eine steht?«
Nach den Aufräumungsarbeiten bat sie ihn ins Haus, damit er sich frisch machen konnte. Als er aus dem Badezimmer kam, sagte er: »Und jetzt brauchen wir dringend ein kräftiges Frühstück. Würden Sie es uns machen, Miss Zeale? Sie können das bestimmt besser als die Köche im Hotel, die lassen immer den Schinkenspeck anbrennen.«
Während sie in der Küche hantierte, erzählte er ihr von seiner Kindheit in Irland, von Angelausflügen und Spielen am Strand; wie bitterlich er geweint hatte, als er mit acht Jahren von zu Hause fortmusste, um in England ein Internat zu besuchen, wie er die Tage bis zu den Schulferien gezählt hatte. Er erzählte und nahm dabei alles um sich herum mit einer großen Klarheit wahr: den Duft des bratenden Schinkenspecks, den intensiven Geruch der Orangenmarmelade, das Zischen des heißen Fetts, das Geräusch ihrer Schritte auf dem gefliesten Boden. Und vor allem die Frau – das dunkle Haar, das ihr über die Wange fiel, das feine Handgelenk unter der Manschette ihres Blusenärmels, an der sich ein Knopf geöffnet hatte. Er hätte alles darum gegeben, diese schlanke weiße Hand zu streicheln, diese zarte Haut zu küssen, ihren Duft einzuatmen. Ihm schwindelte beinahe vor Verlangen nach Isabel Zeale.
Sie stellte ihm einen Teller hin. Als er sie fragen hörte: »Geht es Ihnen gut, Mr. Finborough?«, merkte er, dass seine Hände zitterten.
»Ganz ausgezeichnet«, antwortete er und begann zu essen, obwohl er plötzlich den Appetit verloren hatte und die Eier mit Schinken, die Miss Zeale für ihn zubereitet hatte, nach nichts schmeckten.
An diesem Nachmittag wanderte er über die Felsklippen westlich von Lynmouth, und während er vom Kap zu den Wellen hinunterschaute, die an die Felsen brandeten, dachte er an Isabel Zeale. Er sah sie vor sich, stolz und aufrecht, mit dem vollen glänzend schwarzen Haar, der hellen Haut und den grünblauen Augen, die wie Aquamarine schimmerten. Was an ihr hielt ihn hier, zwang ihn zu bleiben, obwohl Vernunft und gesunder Menschenverstand ihn drängten, nach London zurückzukehren und sie nie wiederzusehen?
Offenbar hatte er sich in sie verliebt. Er quittierte den Gedanken mit einem rauen Lachen, das beinahe wie ein Stöhnen klang. Der Wind schlug plötzlich um und peitschte ihm Regen ins Gesicht. Er war die ersten fünfundzwanzig Jahre seines Lebens gut zurechtgekommen, ohne sich zu verlieben – warum musste es ausgerechnet jetzt passieren? Warum ausgerechnet hier? Warum musste es ausgerechnet diese Frau sein? Isabel Zeale stand gesellschaftlich weit unter ihm. Sie war eine Angestellte, eine Haushälterin. Sie hatte, gelinde gesagt, einen zweifelhaften Ruf und war mit ihrem abweisenden Stolz und ihrer scharfen Zunge nicht gerade liebenswert. Vielleicht, sagte er sich ironisch, hatte er es nicht anders verdient, nachdem er jahrelang der Form halber Liebe geheuchelt und den Frauen nur etwas vorgemacht hatte, den Debütantinnen, mit denen er getanzt, den jungen Mädchen, mit denen er geflirtet hatte, den verheirateten Frauen, die, von ihren reichen, wesentlich älteren Ehemännern gelangweilt, das Abenteuer mit ihm gesucht hatten.
Als es nach einer Weile stärker zu regnen begann, kehrte er um. Die See war grau und glanzlos, und es wurde jetzt schnell dunkel. Er wusste, dass er abreisen sollte; abreisen und niemals zurückkehren. Was sollte das, für eine Frau wie Isabel Zeale den edlen Ritter zu spielen? Er wusste, dass es ihm nicht genug war, der gute Freund zu sein, der ihr den Einkaufskorb trug und die Gartenarbeit abnahm. Warum aber suchte er sie immer wieder auf? Wollte er sie mürbe machen, sie sich verpflichten, ihr eine Art emotionale Bindung aufzwingen, das Gefühl, dass sie ihm etwas schuldete? Das wäre gemein, ein unanständiges Ausspielen seiner finanziellen und gesellschaftlichen Überlegenheit. Er wäre dann keinen Deut besser als die Salters.
Isabel Zeale war mittellos, hatte keine Freunde, würde bald auch heimatlos sein. Ihr ganzes stolzes Beharren auf ihrer Selbstständigkeit änderte nichts daran, dass sie, eine alleinstehende Frau, zu den Schutzlosesten der Gesellschaft gehörte. Und durch ihre aufsehenerregende Schönheit war sie umso stärker gefährdet. Den größten Gefallen konnte er ihr tun, wenn er ihr den Namen einer Witwe oder eines älteren Ehepaars nannte, die eine Haushälterin brauchten.
Doch nicht einmal das konnte er für sie tun. Die Beziehung zwischen ihnen, wenn man es überhaupt so nennen konnte, beruhte ja gerade darauf, dass er ihre untergeordnete gesellschaftliche Stellung ignorierte. Nähme er nun plötzlich darauf Bezug, so wäre das demütigend für sie. Sie würde sich in ihrem Stolz, der vermutlich ihr Halt war, verletzt fühlen. Da war es besser, er kehrte einfach nach London zurück.
Ja, genau das musste er tun, und zwar so bald wie möglich, ohne weiteres Hin und Her. Er musste dieser absurden Neigung, dieser Obsession ein Ende bereiten. Auch wenn der Gedanke daran, Isabel Zeale nie wiederzusehen, ihm unsagbar wehtat, war es das einzig Vernünftige, das wusste er.
Bei seiner Rückkehr ins Hotel wurde ihm ein Telegramm ausgehändigt. John Temple teilte ihm mit, dass es in der Teeverpackungsfabrik gebrannt hatte, und bat ihn, unverzüglich nach London zu kommen. In aller Eile packte Richard seine Sachen, bezahlte die Rechnung und lief zu seinem Wagen. An der Straßenkreuzung, wo der Wegweiser Richtung Bridgwater und London zeigte, bremste er scharf. Während er starr in die regenverschleierte Dunkelheit vor ihm blickte, dachte er an den Brand in der Fabrik und die tausend Dinge, die es für ihn zu erledigen gab. Er spürte geradezu, wie die Zeit verrann, und schlug voll Ungeduld mit der flachen Hand aufs Lenkrad. Dann zog er kurz entschlossen den Wagen herum und nahm die andere Straße.
An der schmalen Straße, die zum Orchard House führte, tauchte er in die Finsternis der Bäume und Hecken. Tief hängende Zweige schlugen gegen die Motorhaube, und das Licht der Scheinwerfer bahnte nur einen schwach erleuchteten Pfad durch die Dunkelheit. Im dichten Regen hätte er das Haus beinahe übersehen, obwohl er angestrengt nach ihm Ausschau hielt. Im letzten Moment bremste er ab, stieg aus und landete knöcheltief in einer Pfütze.
Die Pforte war geschlossen, die Veranda dunkel. Aber er kannte sich hier inzwischen aus, ging entschlossen den Weg zwischen den Blumenbeeten hinauf und klopfte laut an die Haustür. Nur hinter einem der verhangenen Fenster war ein trüber Lichtschein zu erkennen, und er musste ein zweites Mal klopfen, ehe drinnen das Geräusch von Schritten hörbar wurde.
Die Tür wurde einen Spalt aufgezogen. Er sprach zu dem schmalen Lichtstreifen. »Ich bin es, Richard Finborough«, sagte er. »Ich bitte um Verzeihung, dass ich Sie zu so später Stunde noch störe, Miss Zeale. Ich werde dringend nach London zurückgerufen. In einer meiner Fabriken hat es gebrannt, und ich muss sofort abreisen. Aber vorher muss ich unbedingt noch mit Ihnen sprechen.«
»Es ist spät, Mr. Finborough.«
»Bitte.«
Sie zögerte einen Moment, dann machte sie die Tür auf. Er folgte ihr ins Wohnzimmer. Neben einem Sessel stand ein Nähkorb, und auf einem Beistelltisch lag ein aufgeschlagenes Buch.
»Ich störe Sie. Ich bitte nochmals um Entschuldigung.« Er setzte sich nicht, sondern ging ruhelos im Zimmer umher. »Sie haben mir gesagt, dass Sie fortgehen, sobald der Neffe von Mr. Hawkins aus Indien hier eintrifft. Und dass er voraussichtlich in etwa einem Monat ankommt. Ist das richtig?«
»Ich glaube, ja.«
»Und Sie beabsichtigen, sich eine andere Anstellung zu suchen.«
»Ich habe schon mit der Suche begonnen. Ich muss ja. Ich habe zwar etwas Geld gespart, aber…« Sie schwieg.
»Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass ich Sie nie wiedersehen soll.«
Sie entgegnete trocken: »Das werden Sie schon schaffen, Mr. Finborough.«
»Nein, das glaube ich nicht.«
»Mr. Finborough –«
»Bitte, hören Sie mich an.« Er runzelte die Stirn. »Ich war glücklich und zufrieden, bevor ich Ihnen begegnet bin. Ich hatte meine Arbeit und meine Londoner Freunde, das war mir genug. An dem Tag, an dem mein Wagen streikte, hatte ich nichts anderes im Sinn, als diesem gottverlassenen kleinen Nest schnellstens wieder den Rücken zu kehren und es zu vergessen.«
»Ich habe Ihre Gesellschaft nie gesucht«, sagte sie kalt.
»Das stimmt.« Er lachte kurz auf. »Eher das Gegenteil. Trotzdem muss ich unaufhörlich an Sie denken, wenn ich Ihnen fern bin. Und wenn ich bei Ihnen bin –«
»Oh, bitte verschonen Sie mich«, rief sie, und er brach verblüfft ab.
»Miss Zeale?«
»Ich kenne jedes Wort.« Ihre Stimme zitterte – vor Zorn, wie er erschüttert erkannte. »Ich habe diese Litaneien so satt – die Beteuerungen ewiger Liebe, die Behauptungen, ohne mich nicht leben zu können, und was sonst noch alles dazugehört.«
»Es tut mir leid, wenn ich Sie langweile«, sagte er pikiert. »Aber vielleicht lassen Sie mich trotzdem ausreden.«
»Nein. Ich will nichts hören.« Sie hatte sich von ihm entfernt. Beide Arme fest um ihren Oberkörper geschlungen, sagte sie: »Ich lasse mich nicht beleidigen. Nichts, was Sie sagen, könnte mich dazu bewegen, meine Pläne zu ändern.«
»Nichts?«, fragte er, die Brauen hochgezogen.
»Gar nichts.«
Dennoch gab er nicht auf. »Sie haben mir Ihre Aversion gegen mich ja schon bei unserer ersten Begegnung deutlich gezeigt. Aber in letzter Zeit hatte ich den Eindruck, sie sei nicht mehr ganz so heftig. Miss Zeale – Isabel –«
Sie unterbrach ihn. »Bilden Sie sich wirklich ein, Sie wären der Erste? Wenn ja, dann täuschen Sie sich. Ich wurde seit meinem ersten Tag hier in Lynton immer wieder von Männern wie Ihnen belästigt.«
Ihre Worte waren ein Schock. Für sie war er nicht anders als diese primitiven Kerle, die sie auf der Straße angepöbelt hatten. »Von Männern wie mir«, wiederholte er langsam. »Klären Sie mich auf, Miss Zeale. Was würde ein Mann wie ich als Nächstes tun?«
Sie ging zur Tür und öffnete sie weit. »Gehen Sie bitte. Ich lasse mich nicht weiter beleidigen.«
»Ich möchte aber, dass Sie es mir sagen.«
Er hörte, wie sie heftig Atem holte. »Nun gut. Als Nächstes würden Sie mir Geld bieten. Auf mehr oder weniger taktvolle Art. Ich nehme an, bei Ihnen wäre wahrscheinlich ein gewisses Taktgefühl zu erwarten, Mr. Finborough. Und dann würden Sie vielleicht eine kleine Wohnung in Barnstaple oder Exeter für mich mieten. Und dann –«
»So schätzen Sie mich also ein«, sagte er verärgert. »Sie glauben, ich wäre hergekommen, um Sie zu meiner Geliebten zu machen. Um Sie zu kaufen.«
»Ist es nicht so?«
Er konnte nicht sprechen vor Zorn und wandte den Blick zum Fenster, wo sachte die Zweige einer Kletterrose an die Scheiben schlugen. Sein Zorn wich Enttäuschung und Ernüchterung. »Ich bin hergekommen, um Ihnen zu sagen, dass ich Sie liebe«, entgegnete er.
»So ein Unsinn«, erwiderte sie voller Verachtung.
»Wieso sagen Sie das?«
Sie trat einen Schritt auf ihn zu; es sah beinahe aus, als wollte sie ihm ins Gesicht schlagen. »Ich mag nur in einem gottverlassenen kleinen Nest leben, Mr. Finborough, ich mag nur eine Haushälterin sein – aber ich bin nicht dumm.«
»Das habe ich auch nie angenommen.« Der Zorn erwachte von Neuem. »Kalt, ja – abweisend, unhöflich und unfreundlich zweifellos. Aber dumm – niemals.«
»Es tut mir leid, wenn ich einen falschen Eindruck vermittelt habe; wenn Sie sich durch mich ermutigt glaubten –«
»Keine Sorge, das haben Sie nicht getan, Miss Zeale. Ganz bestimmt nicht.«
»Dann gibt es wirklich keine Entschuldigung für Ihr Erscheinen hier, Mr. Finborough. Ich habe Sie eigentlich für einen Gentleman gehalten und erwartet, dass Sie sich anders verhalten würden als die Leute, die mir hier das Leben schwer machen.«
Ihre Worte schienen in der nachfolgenden Stille zu vibrieren. Er nahm Hut und Handschuhe. »Danke, Miss Zeale, dass Sie Ihre Gefühle so deutlich ausgedrückt haben. Danke für Ihre – Unverblümtheit. Da meine Gesellschaft Ihnen offensichtlich zuwider ist, will ich Sie nicht länger belästigen.«
Er ging. Wenige Minuten später fuhr er den Weg zurück, den er gekommen war. Zum Teufel mit ihr, sagte er sich. Besser ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Er konnte froh sein über den glimpflichen Ausgang. Aber er war nicht froh. Er war nur unglücklich. Die Reifen quietschten, als er den Wagen mit hohem Tempo auf die Straße nach London lenkte.
Er fuhr schnell, viel zu schnell für die schmalen Straßen und das schlechte Wetter. Wasserfontänen spritzten hinter den Reifen des de Dion auf; ein-, zweimal merkte er, wie sie die Bodenhaftung verloren, und hatte Mühe, den Wagen wieder unter Kontrolle zu bringen. In einem kleinen Dorf stellte er ihn ab und ging in ein Pub, wo er einen Whisky bestellte. Während er wartete, erblickte er im Spiegel über dem Kaminsims sein weißes Gesicht, das regennasse, wirre rote Haar und die blitzenden Augen, in deren Ausdruck sich Wut, Ärger und Angriffslust mischten. Kein Wunder, dass der Wirt sich so beeilte, ihm seinen Scotch zu bringen, dachte er grimmig und amüsiert zugleich. Kein Wunder, dass die anderen Gäste Abstand hielten.
Als er später wieder in seinen Wagen stieg, ließ er nicht gleich den Motor an, sondern starrte eine Zeit lang reglos zum Fenster hinaus in den Regen, der die dunklen Formen der Häuser verwischte. Er konnte ihrer Voreingenommenheit die Schuld an dem Desaster geben oder seinem eigenen ungeschickten Verhalten. Aber das änderte nichts. Die Wahrheit war, dass er sich eine Zukunft ohne Isabel Zeale nicht mehr vorstellen konnte, auch wenn er sich das bis zu diesem Augenblick nicht eingestanden hatte. Es half nichts, sich ins Gedächtnis zu rufen, dass er sie kaum kannte, dass sie ihm gesellschaftlich nicht ebenbürtig war und dass ihm die Vernunft gebot, eine Frau seines eigenen Standes zu heiraten, die vielleicht Geld mit in die Ehe bringen würde. Er war schon an sie gebunden, auch wenn er nicht verstand, wie es dazu gekommen war.
Bisher hatte er im Leben alles bekommen, was er wollte. Und er wollte das Beste von allem, was es zu bieten hatte – Macht, Reichtum, Erfolg. Nachdem er sich einmal entschlossen hatte, den Wohlstand der Familie Finborough wiederherzustellen, hatte er dieses Vorhaben mit ganzer Kraft in Angriff genommen und viel von dem Terrain, das sein Vater verloren hatte, wiedergewonnen. Was die Frauen anging, so log er nicht, wenn er sagte, dass er noch nie einen Korb bekommen hatte.
Richard schloss die Augen und nickte ein. Als er wieder erwachte, war das Pub geschlossen, und hinter den Fenstern des Hauses brannte kein Licht mehr. Er wendete den Wagen und fuhr nach Lynton zurück. Es hatte aufgehört zu regnen, und der Himmel war klar. Durch das fast kahle Geäst der Buchen über der schmalen Straße zum Orchard House fiel das Licht des Vollmonds. Vor dem Haus hielt er an und wartete.
Einige Stunden später, als es allmählich hell wurde, stieg er aus dem Wagen, um sich die Füße zu vertreten. In der Nacht war es kalt geworden, und die Pfützen waren rundum von einem filigranen Eisrand eingefasst. Als er auf dem Ascheweg zum Haus ging, meinte er, drinnen den Schein einer Öllampe zu erkennen. Dann wurde die Tür geöffnet, und Isabel Zeale kam heraus. Sie trug ein Umschlagtuch über ihrem Nachthemd, und das dunkle Haar fiel ihr lang und schwer den Rücken hinunter.
Sie ging ihm entgegen, und er bemerkte, wie müde das blasse, von Schatten gezeichnete Gesicht aussah.
»Es tut mir leid, wenn ich Sie geweckt habe«, sagte er. »Ich habe mich bemüht, leise zu sein.«
»Was wollen Sie von mir, Mr. Finborough?«, fragte sie flüsternd.
»Wenn ich Ihnen gestern Abend zu nahe getreten bin, so bitte ich dafür um Entschuldigung. Aber ich entschuldige mich nicht dafür, dass ich Ihnen meine Liebe gestanden habe.«
Sie schloss einen Moment die Augen. »Mr. Finborough, wenn Sie auch nur einen Funken Anstand haben, nur die geringste Achtung vor mir, dann gehen Sie jetzt bitte.«
Er schüttelte den Kopf. »Noch nicht. Sie haben mich gefragt, was ich von Ihnen will. Ich möchte, dass Sie meine Frau werden, Isabel.« Mit einer abwehrenden Handbewegung schnitt er ihr das Wort ab. »Sagen Sie jetzt nichts. Ich muss nach London. Aber denken Sie darüber nach. Bitte, denken Sie darüber nach. Ich komme in einer Woche wieder. Dann können Sie mir Ihre Antwort geben.«
Er ging zur Straße zurück, warf einen letzten Blick auf sie, als er den Wagen wendete. Sie stand im Garten, eine reglose weiße Gestalt, zu Eis erstarrt.
Zurück in London, vernahm Richard mit Erleichterung, dass bei dem Brand in der Fabrik niemand verletzt worden war, und vertrieb sich, wenn er nicht gerade die vom Feuer angerichteten Schäden besichtigte, die Zeit damit, Isabel Zeale Geschenke zu schicken.
Treibhausblumen am ersten Tag, einen spektakulären Strauß, der vom Blumengeschäft in London per Eisenbahn bis nach Lynton befördert wurde. In einer Buchhandlung in Charing Cross suchte er einen Band mit Gedichten von Christina Rossetti für sie aus, mit Goldschnitt und in rotes Leder gebunden. Auf das Vorsatzblatt schrieb er »In Liebe für Isabel von Richard«, und erfreute sich an dem Gedanken, wie oft er diese Widmung in den kommenden Jahren noch schreiben würde.
Am folgenden Tag sandte er ihr eine Topfkamelie, am Tag darauf einen Stapel Modezeitschriften mit den neuesten Schöpfungen der Salons. Dann einen schwarzseidenen Regenschirm mit Perlmuttgriff, weil es dort, wo Isabel Zeale lebte, so viel regnete.
Das letzte Geschenk wählte er aus, nachdem er sich vorgestellt hatte, wie mutterseelenallein sie dort in Lynton in ihrer Festung saß. Er ließ den Weidenkorb mit dem King-Charles-Spanielwelpen von einem Boten nach Lynton bringen. Auf der Karte, die dem Geschenk beilag, stand: »Er heißt Tolly. Die Finborough-Hunde heißen alle Tolly. Ich habe keine Ahnung, warum. R.«
Kein Parfum, keine Seidenstrümpfe, kein Schmuck, nichts, was den Eindruck erweckt hätte, er wolle sich eine Intimität anmaßen, die noch nicht bestand. Er wollte sie umwerben, nicht verschrecken.
Als die Woche um war, fuhr er wieder nach Devon. Er war aufgeregt und fühlte sich so lebendig wie nie. Am Morgen nach seiner Ankunft suchte er Isabel Zeale auf.
»Heiraten Sie mich, Isabel«, sagte er.
»Nein.« Sie sah aus, als wäre sie in höchster Panik.
Richard nickte und sagte scheinbar unerschüttert: »Dann machen Sie wenigstens einen Spaziergang mit mir. Ich muss mir nach der langen Fahrerei die Füße vertreten. Kommen Sie, wir nehmen den Hund mit.«
Er wählte einen Weg, der an Wiesen und Feldern oberhalb des Dorfs entlangführte, und berichtete ihr von dem, was ihn in der letzten Woche beschäftigt hatte: der Brand, der Einkommensverlust, die dringende Suche nach einer neuen Fabrik. Es war ein kalter, nebliger Tag, und vom höchsten Punkt ihrer Wanderung aus, wo Weideland in Ginstergestrüpp überging, blickten sie auf Wolken hinunter, die das Tal zu ihren Füßen verschleierten. Vor ihnen hingen Nebelfetzen am felsigen Hügelhang, die sich in der Wintersonne langsam lichteten.
Sie stiegen zum Valley of Rocks ab, wo Wind, Wasser und Frost Sand- und Kalkstein zu bizarren Formen geschliffen hatten. Die Felsstelen und Hügel aus willkürlich übereinandergeschichteten Gesteinsbrocken erhoben sich hoch über die grasbewachsenen Talmulden. Jenseits war die See.
»Ich kann verstehen, dass Sie dieses Land mögen«, sagte er. »Eines Tages werde ich Ihnen hier unten ein Haus kaufen.«
»Aber Sie müssen doch einsehen«, sagte sie schnell und leise, »dass eine Heirat unmöglich ist. Ich brauche Ihnen gewiss nicht erst zu erklären, warum.«
»Nichts ist unmöglich, wenn man es wirklich will.«
»Unsinn«, entgegnete sie scharf. »Das können Sie nur sagen, weil es Ihnen nie an etwas gefehlt hat. Es gibt vieles, was unmöglich ist.«
»Das habe ich bis jetzt noch nicht gemerkt.«
»Mr. Finborough –«
»Richard, bitte.«
»Gut, dann eben Richard. Ich kann Sie nicht heiraten. Sie – Sie verfolgen diesen Plan nur deshalb so hartnäckig, weil Sie zurückgewiesen wurden. Sie sind es wahrscheinlich gewöhnt, immer Ihren Kopf durchzusetzen.«
Er lachte. »Wahrscheinlich. Aber das ist nicht der Grund, warum ich Sie heiraten möchte.«
»Warum dann?«, fragte sie leise.
»Das habe ich Ihnen doch schon gesagt. Ich liebe Sie.«
»Ach, Sie haben sicher schon einige Frauen geliebt.«
»Nein. Ich glaubte, es sei Liebe, aber ich hatte mich geirrt.«
Ihre Augen blitzten zornig. »Tue ich Ihnen etwa leid? Machen Sie deshalb schöne Worte? Wenn ja, kann ich Ihnen nur sagen, dass das völlig unnötig ist. Ich kann sehr gut für mich selbst sorgen. Ich tue das seit Jahren.«
»Glauben Sie im Ernst, ich bitte Sie aus Mitleid, meine Frau zu werden?« Er schüttelte den Kopf. »Also wirklich, Isabel – das ist doch absurd. Es gibt unendlich viele junge Frauen, die in weit bedauerlicheren Verhältnissen leben als Sie. Da müsste ich ja jeder von ihnen einen Heiratsantrag machen.«
»Dann verstehe ich Sie nicht«, sagte sie.
Tief unten, am Fuß der roten Sandsteinklippen, toste die Brandung. Richard trat dicht an den Felsrand, um sich zu prüfen, und spürte den Sog der Leere unter ihm.
»Eigentlich müsste ich jetzt in London sein und nach neuen Räumen für meinen Betrieb suchen«, sagte er. »Aber ich bin hier, weil mir nichts auf der Welt wichtiger erscheint als Ihr Einverständnis, meine Frau zu werden. Ich möchte für Sie sorgen und Sie beschützen. Ich möchte Sie nach London mitnehmen, und ich möchte Ihnen Raheen zeigen. Ich möchte morgens, wenn ich aufwache, als Erstes Ihr Gesicht sehen. Ich möchte mit Ihnen zusammen alt werden. Mehr ist es gar nicht.«
Isabel Zeale wandte sich ab, ohne etwas zu sagen. Sie gingen ins Tal hinunter und weiter zur See. Er ließ sich jeden einzelnen ihrer Einwände gegen die Heirat nennen. Er wusste, dass er sie einen nach dem anderen hinwegfegen, auslöschen konnte und ihr am Ende kein Argument bleiben würde.
»Wir haben uns vor wenigen Wochen das erste Mal gesehen«, sagte sie. »Ich kenne Sie überhaupt nicht, Richard.«
»Das lässt sich leicht ändern. Wir können die Verlobungszeit so lang ausdehnen, wie Sie es wünschen, obwohl ich gedacht hätte, eine kürzere wäre Ihnen lieber. Und wenn ich Ihnen nach näherem Kennenlernen immer noch so zuwider bin, nun, dann muss ich mich eben geschlagen geben.«
»Sie sind mir nicht zuwider.«
Er ahnte, was dieses Geständnis sie gekostet hatte. »Dann ist das doch schon mal ein Anfang«, sagte er leichthin.
Am Fuß des Hügels ergoss sich ein Bach sprudelnd in eine kleine Bucht, in der scharfkantige Felsbrocken übereinandergetürmt lagen. Richard reichte ihr die Hand, als sie über die Steine hinwegstiegen. Der Hund rannte voraus und bellte die See an. Es war Ebbe, das ablaufende Wasser hatte körnigen grauen Sand und glänzende bunte Kiesel auf dem Strand hinterlassen. In einem Felsentümpel wehten die Tentakel einer pflaumenfarbenen Seeanemone; ein kleiner blassgrüner Krebs, der vielleicht die durch ihre Schritte hervorgerufene Erschütterung spürte, flüchtete unter einen Stein.
»Schon der Standesunterschied zwischen uns verbietet eine Heirat«, erklärte sie im Ton der Endgültigkeit. »Selbst Sie müssen zugeben, dass dieses Hindernis unüberwindlich ist.«
»Unsinn. Das macht mir nun wirklich keine Sorgen.«
»Richard!«
Es gefiel ihm, wie sie seinen Namen sagte, selbst wenn ihre Stimme voll Zorn und Empörung war. »Was ist denn?«
»Ganz einfach – Sie sind reich, und ich bin arm.«
»Wenn Sie mich heiraten, werden auch Sie reich werden. Nicht von heute auf morgen, aber ich habe die feste Absicht, ein reicher Mann zu werden. Außerdem war ich selbst arm. Es ist noch gar nicht so lang her. Unsere Familie hatte ihr ganzes Vermögen verloren.«
»Das, wovon Sie sprechen, ist keine Armut«, entgegnete sie bitter. »Arm ist man, wenn man nicht weiß, wo die nächste Mahlzeit herkommen soll und ob man nächste Woche noch ein Dach über dem Kopf hat. Richard, hören Sie mir zu. Mein Vater war Schreiber beim Buchhalter eines großen Guts in Hampshire. Als er krank wurde, kündigte man ihn, und wir mussten unser Haus räumen. Nach seinem Tod habe ich mir eine Anstellung gesucht. Ich war Kindermädchen bei einer Familie in Kent, bevor mich Mr. Hawkins als Haushälterin engagierte. Männer wie Sie, Richard, heiraten keine Frauen wie mich. Sie machen uns zu ihren Geliebten, aber sie heiraten uns nicht.«
»Ich möchte Sie aber heiraten. Und das ist das Einzige, was zählt.« Als nicht weit von ihnen eine Welle brach, wischte er ihr die Gischtspritzer mit den Fingerspitzen von der Wange und sah, dass sie zitterte. »Werden Sie meine Frau«, sagte er leise, »und lassen Sie Not und Entbehrung hinter sich zurück. Ich werde Ihnen das glückliche Leben bereiten, das Sie verdienen. Heiraten Sie mich, dann wird es Ihnen nie an etwas mangeln. Heiraten Sie mich, und Sie brauchen nie wieder allein zu sein.«
Er hatte den Eindruck, dass sie schwankte, in Versuchung war. »Ihre Familie…«, sagte sie.
»Meine Mutter wird von Ihnen begeistert sein. Sonst habe ich niemanden.«
»Wenn wir wirklich heirateten, würde Sie das unter Ihresgleichen zum Gespött machen. Ihre Freunde würden nichts mehr mit Ihnen zu tun haben wollen, und Ihre Angestellten verlören alle Achtung vor Ihnen.«
Wenn wir wirklich heirateten