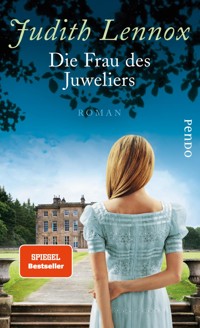10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Frauenfreundschaft von den Siebzigerjahren bis in die Gegenwart – Der große Roman der Bestsellerautorin Judith Lennox! Bea, Emma und Marissa lernen sich als junge Frauen im England der Siebzigerjahre kennen. Eine tiefe Verbundenheit entsteht, obwohl sie aus unterschiedlichen Elternhäusern stammen und jede einen anderen Lebensweg einschlägt: Um eine gute Ehefrau und Mutter zu sein, begräbt Emma ihren Traum von einer künstlerischen Karriere. Bea, von ihrer großen Liebe verlassen, gibt auf Druck ihrer Eltern ihr uneheliches Kind zur Adoption frei. Und Marissa muss sich nach der Flucht vor ihrem gewalttätigen Ehemann ein ganz neues Leben aufbauen. Aber die Vergangenheit holt die drei Frauen immer wieder ein und bedroht auch ihre Freundschaft. Doch gemeinsam versuchen sie, allen Stürmen des Schicksals zu trotzen. Bewegende Frauenschicksale, viel Atmosphäre und Zeitkolorit: Ihre Romane »Das Winterhaus« und »Die Mädchen mit den dunklen Augen« machten Judith Lennox berühmt. Seitdem verzaubert sie ihre LeserInnen mit jedem neuen Roman und ist regelmäßig in den Spiegel-Bestsellerlisten zu finden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:
www.piper.de
Aus dem Englischen von Mechtild Ciletti, Lina Robertz und Constanze Wehnes
© Judith Lennox 2023
Titel der englischen Originalausgabe: »Summer at Seastone«, Headline Review, London 2023
© der deutschsprachigen Ausgabe:
Piper Verlag GmbH, München 2023
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Covergestaltung: u1 berlin / Patrizia Di Stefano
Covermotiv: Arcangel (Ildiko Neer; Peter Greenway; Goanna Czogala); Getty Images (Jose A. Bernat Bacete)
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Prolog
Teil eins
Neubeginn
Eins
Zwei
Drei
Vier
Fünf
Sechs
Sieben
Acht
Teil zwei
Freunde und Familie
Neun
Zehn
Elf
Zwölf
Dreizehn
Vierzehn
Teil drei
Die Schmetterlingsspange
Fünfzehn
Sechzehn
Siebzehn
Achtzehn
Neunzehn
Zwanzig
Teil vier
Das Licht im Haus
Einundzwanzig
Danksagung
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Prolog
Die Fähre wird beladen. Am Himmel üben Möwen kreischend den Sturzflug, während ein stattlicher junger Mann mit einem dunklen Muttermal auf der Wange die Fahrzeugschlange mit kurzen, klaren Handbewegungen auf das Autodeck dirigiert.
Sie hatte sich für diese Fahrt über den Kanal blauen Himmel und sonnenglitzernde Wellen vorgestellt. Aber der Himmel ist grau und es tröpfelt, und sie kann das Meer noch nicht erkennen. Sinnlos, dieses ganze Unternehmen, denkt sie, während die Fahrzeuge vorankriechen. Schlimmer noch – es ist hirnverbrannt, ein Fehler. Anmaßend von ihr, sich einzubilden, sie könnte diesen Riss kitten.
Sie kann sich noch umentscheiden. Sie braucht nicht auf die Fähre zu gehen. Sie schaltet die Scheibenwischer ein, als der Regen dichter zu werden beginnt, und überlegt. Sie kann immer noch aus der Schlange ausscheren, umkehren und wieder fahren, raus aus Portsmouth. Manchmal, sagt sie sich, ist die beste Hilfe, die man als Freundin leisten kann, sich zurückzuhalten und nachher die Scherben aufzusammeln. Manchmal muss man einsehen, dass man nicht mehr tun kann, als Trost und Zuspruch zu spenden.
Der Wagen vor ihr, ein roter Fiesta, bleibt plötzlich stehen. Sie tritt auf die Bremse. Die Finger ineinandergeschoben, wartet sie, immer noch in Gedanken, nimmt die Huperei hinter sich kaum wahr.
Sie drei: Bea, Emma und Marissa. Sie denkt an alles, was sie miteinander geteilt haben. Sie erinnert sich, wie die Freundinnen ihre Freuden und Erfolge mit ihr gefeiert und sie in ihrem Kummer getröstet haben. Sie schuldet ihnen so viel. Sie kramt in ihrer Handtasche nach einem Tempo, um den Beschlag von der Windschutzscheibe zu wischen. Manchmal, denkt sie, muss eine Freundin eben bereit sein, alles zu tun, um zu helfen. Selbst, wenn sie sich dabei lächerlich macht, selbst wenn sie riskiert, sich in die Nesseln zu setzen. Das hier ist so ein Fall. Sie muss es versuchen, sie muss diese Reise machen. So einfach ist das.
Endlich springt der rote Fiesta an, und die Schlange setzt sich wieder in Bewegung. Einen Moment wartet sie unschlüssig, mit den Fingern aufs Lenkrad trommelnd. Dann legt sie den Gang ein und steuert den Wagen auf die Fähre.
Teil eins
Neubeginn
Eins
1970–1971
Er sagte: »Die haben wirklich Hunger heute, oder? Sieht aus, als könnten sie ein Sandwich gebrauchen.«
Der Junge, der Bea ansprach, stand auf der anderen Seite des Weihers. Er hatte schwarze, lockige Haare, einen irischen Akzent, und sein Schulblazer war grau, nicht braun wie ihrer. Ihre Mutter hatte sie ermahnt, nicht durch den Park nach Hause zu gehen, wegen komischer Männer, die einem da begegnen könnten, aber Bea, die so gern die Enten fütterte, fand nicht, dass dieser Junge als komischer Mann gelten könne.
»Ich heb immer die Rinden von meinem Pausenbrot auf.« Sie hielt ihm ein Stück Brot hin. »Möchtest du ihnen was geben?«
»Das wäre toll, ja, wenn’s dir recht ist.«
»Ich glaube, die kriegen hier nicht genug zu fressen.«
»Ach was, es gibt sicher andere barmherzige Samariter wie dich, die sie füttern.«
Als er zu ihr herüberkam, sah sie, dass er viel größer war als sie. Aber, na ja, jeder war größer als sie. Bea war siebzehn und schaffte mit Absätzen knapp einen Meter achtundfünfzig. Die dunklen Haare und Augen hatte sie von ihrer französischen Großmutter mitbekommen, die zierliche Figur und das lebhafte Temperament von ihrer Mutter Vivien.
Der Junge warf einer graubraunen Ente abseits der quakenden Schar ein Stück Brot zu.
»Gut gezielt«, sagte sie.
»Ja, das kann ich.«
»Und was kannst du noch?«
»Ich kann in zwanzig Minuten einen Autoreifen wechseln.«
»Wahnsinn.« Wenn der Wolseley der Familie einmal einen platten Reifen hatte und ihr Vater ihn wechseln musste, brauchte er Ewigkeiten dazu und reichlich Gestöhne.
»Ich arbeite nach der Schule und am Wochenende in der Autowerkstatt«, sagte der Junge. »Da will ich gerade hin. An meiner Uhr ist die Krone kaputt. Du weißt nicht zufällig, wie spät es ist …«
»Es ist halb fünf. Ich bin Beatrice«, sagte sie und bot ihm die Hand. »Beatrice Meade. Bea.«
»Ciaran O’Neill.«
»Ciaran. Das ist ein schöner Name.«
»Ciaran mit ›C‹. So wird’s richtig geschrieben.«
»Ich mag deinen Akzent.« Sie wurde rot. »So, wie ich rede, das ist so langweilig, so … so altmodisch.« Jemand hatte ihr einmal gesagt, sie höre sich an wie Celia Johnson. Seither bemühte sich Bea zum Missfallen ihrer Mutter, etwas mehr zu nuscheln.
Ciaran lachte. »Das finde ich nicht.«
»Auf welche Schule gehst du?«
Er nannte ihr den Namen des Gymnasiums in dem roten Backsteinbau, an dem sie jeden Morgen vorbeikam.
»Du gehst bestimmt auf irgendeine noble Privatschule, oder?«
»Wie kommst du darauf?«
Er legte den Kopf schief. »Dein Blazer. Und wie du mir die Hand gegeben hast.« Ein scheues Grinsen huschte über sein Gesicht. »Wenn ich morgen herkomme, kriegen sie nur geschnittenen Billigtoast, Bea.«
Dann ging er mit einem »Wiedersehen«. Auf dem Heimweg dachte Bea an Ciaran O’Neill. Sie hoffte, sie würde ihn wiedersehen.
Am nächsten Tag war freundlicheres Wetter. Während des Unterrichts und in der Pause überlegte sie, ob seine Worte ernst gemeint gewesen waren. Jungs sagten solche Sachen – bis dann, Wiedersehen –, und wenn man ihnen das nächste Mal begegnete, sahen sie einen gar nicht.
Nach der Schule ging sie in den Park, und ihr Herz machte einen kleinen Sprung, als sie ihn am Weiher stehen sah. Er hatte seine Schulkrawatte gelockert und trug seinen Blazer über eine Schulter geworfen.
»Hallo, Bea«, rief er ihr zu. »Wie war’s in der Schule?«
Sie schnitt eine Grimasse und machte schnell ein Lächeln daraus. Ihre Mutter schimpfte immer über ihre Grimassen. Du bist ein hübsches Mädchen, Bea. Warum immer diese Fratzen? Jungs mögen keine Mädchen, die aussehen wie böse Zwerge.
»Wir hatten in Französisch eine Übersetzung, und ich war mit dem Konjunktiv total überfordert.«
»Ach, die Franzosen sind doch selbst überfordert mit ihrem Konjunktiv.«
Sie lachte. »Und wie war’s bei dir?«
»Chemietest. Ging ganz gut, glaub ich. Hier.« Er zog einen Rest quietschweiches Toastbrot aus der Hosentasche und bot ihn ihr an.
»Willst du mal Wissenschaftler werden, Ciaran?«
»Irgendwann mal, ja. Ich möchte Chemie studieren.« Er schlenzte ein Stück Brot in den Weiher, und die Enten schossen quakend los. »Aber ich brauch gute Noten. Wenn ich’s schaffe, bin ich der Erste in der Familie, der studiert. Und du, was hast du vor?«
»Ich mach wahrscheinlich einen Sekretärinnenkurs.«
Kein Mädchen aus Beas Schule studierte. Sie gingen alle weiter auf anerkannte Sekretärinnen- oder Kochschulen, arbeiteten bei einer passenden Familie als Kindermädchen oder besuchten ein Pensionat. Ihre Mutter sagte, sie könnten sich ein Pensionat nicht leisten, deshalb blieb für Bea nur die Sekretärinnenausbildung.
»Ist das das, was du willst?«, fragte Ciaran.
Das hatte sie noch nie jemand gefragt. Ihre Zukunft war geplant gewesen, so weit sie zurückdenken konnte. Unerlässlich, dass ihr zukünftiger Mann vermögend und aus guter Familie sein würde. Sollte er dazu noch einen Titel haben, wäre das für ihre Mutter die Erfüllung ihrer kühnsten Träume. Beas hübsches Gesicht und ihr Charme waren die Schlüssel zu ihrer glänzenden Zukunft. Idealerweise würde sie diesem passenden jungen Mann auf einer Cocktailparty oder einem Wochenendausflug begegnen. Klappte das nicht, würde sie eben den Sekretärinnenkurs abschließen müssen und dann, wenn alles gut ging, ihren Chef heiraten.
Innerlich rebellierte sie immer heftiger gegen diese Zukunftspläne, die ihr hoffnungslos antiquiert erschienen. Als sie es einmal wagte, Zweifel zu äußern, fuhr ihre Mutter sie an. »Du wirst deinen Haushalt führen, deinen Mann unterstützen, seine Freunde einladen, eure Kinder großziehen. Was willst du denn noch?«
So vieles, dachte Bea, wagte aber nicht, es zu sagen. Ja, die Partys, zu denen ihre Mutter sie gehen ließ, machten ihr Spaß, weil sie gern unter Menschen war und gern tanzte, aber sie wusste, dass es in diesem Sommer 1970, gar nicht so weit entfernt von der herrschaftlichen Wohnung ihrer Eltern in Maida Vale, in anderen Vierteln Londons viel spannender zuging. Sie dachte an verrauchte Kneipen mit dröhnender Rockmusik und psychedelischen Lichtern, die farbige Schlieren über den Boden zogen. Wo die Mädchen Klamotten von Biba oder Bus Stop anhatten und die Jungs aussahen wie die Typen, die ihr Vater verächtlich als Hippies bezeichnete, bevor er schimpfend die Wiedereinführung der Wehrpflicht forderte. In den schummrigen Läden würde es nach Räucherstäbchen und Marihuana riechen.
»Ich weiß nicht«, sagte sie. »Ich hab gern mit Leuten zu tun.«
»Vielleicht könntest du Krankenschwester werden«, meinte er. »Meine Schwester Emer ist gerade in der Ausbildung. Sie findet’s toll.«
»Ja, vielleicht.« Der Gedanke gefiel ihr. Wäre das etwas?
»Du schaffst alles, Bea, ganz gleich, was du machst«, sagte Ciaran, als würde es nicht unangebracht sein, dass ein Mädchen wie sie Ambitionen hatte.
Am Freitag kaufte ihr Ciaran an dem Wagen, der am Parktor stand, ein Eis. Er ließ es sich nicht nehmen, dafür zu bezahlen. Bea war aufgefallen, dass sein Blazer an den Ellbogen abgewetzt und die Knie seiner Hose mit Flicken besetzt waren. Sie sagte, nächstes Mal würde sie das Eis bezahlen. Als er Einspruch erheben wollte, entgegnete sie: »Doch. Oder hast du noch nichts von Women’s Lib gehört?«
»Okay, gut. Tut mir leid.«
Sie aßen ihr Eis im Schatten der Bäume. Grünes Licht sickerte durch die Zweige und strömte über seine Augen, die tiefblau waren wie Kornblumen. Schlafzimmeraugen, hätte ihre Mutter gesagt.
Heute trug er eine Uhr. »Hast du sie repariert?«, fragte sie.
»Nein, Fergal, mein Bruder. Der kann alles wieder richten. Ich muss gehen, Bea. Ich möchte im Sommer ganztags in der Autowerkstatt arbeiten, da muss ich pünktlich sein. Das macht sonst einen schlechten Eindruck.«
»Sehen wir uns morgen?« Augenblicklich bereute sie die Frage. Jungs wollten den Ton angeben. Fordernde Mädchen gingen ihnen schnell auf die Nerven. Sie wollten die Jäger sein.
Anstatt ihr zu antworten, neigte er den Kopf und streifte mit den Lippen kurz ihre Wange. »Das wollte ich schon tun, als ich dich das erste Mal am Weiher gesehen habe.«
Sie bewegte ein wenig den Kopf, damit er sie auf den Mund küssen konnte. Der Kuss schmeckte nach Vanille. Die Stadt, der Park versanken unter der weichen, trockenen Berührung seiner Lippen und dem leichten Druck seiner Hände auf ihren Hüften.
Sie hatte schon Jungs geküsst, beim Pfänderspiel in einem kalten Landhaus oder heimlich auf einer Party, den Augen der wachsamen Mütter entronnen, aber keiner dieser Küsse hatte sie so berührt wie der von Ciaran. In den nächsten Wochen folgten neue Küsse, jeder eine Glückseligkeit, und bald vertauschten sie den Ententeich mit einem Fleckchen auf der Wiese am Gebüsch.
Sie verliebte sich so prompt in ihn, als hätte sie nur auf ihn gewartet, in sein Lächeln, seine Stimme mit dem weichen irischen Anklang, in seine Liebenswürdigkeit und Großzügigkeit.
Ciaran wohnte mit seinem Vater und seinem älteren Bruder Fergal zusammen in Nottinghill. Beide, Mr O’Neill und Fergal, arbeiteten auf dem Bau; im Sommer allerdings, erzählte Ciaran, arbeitete Fergal manchmal im Straßenbau, weil da besser bezahlt wurde. Im Moment war Ciarans Vater in Irland auf dem Hof der Familie in Cork, und Fergal und Ciaran hausten allein in der Wohnung. »Weißt du, hauptsächlich will Fergal, dass ich studiere, nicht Dad«, erklärte ihr Ciaran. »Dad findet’s nur Zeitverschwendung. Fergal meint, einer von uns muss es zu was bringen, und ich wär der mit dem Grips. Er musste Dad richtig einheizen, damit er mich auf der Schule ließ. Fergal hat mit fünfzehn aufgehört, weil er Dad helfen musste. Wenn ich ihn nicht auf meiner Seite gehabt hätte, wär ich vor einem Jahr abgegangen. So hab ich Glück und brauch nicht mitten im Winter auf irgendwelchen eisigen Baustellen Ziegelsteine rumzuschleppen.«
Bea wusste, dass ihre Mutter von einem irischen Jungen wie Ciaran nicht begeistert sein würde, darum erzählte sie zu Hause nichts von ihm. Auch ihren Freundinnen sagte sie nichts. Sie wusste selbst nicht recht, warum. Es war ja nicht so, dass sie ihnen nicht vertraute oder sich seiner schämte. Und sie hatte auch keine Angst, dass sie die Nase rümpfen würden, wenn sie hörten, dass sie sich in einen Jungen aus einer Arbeiterfamilie verliebt hatte. Vielleicht war es einfach so, dass er ihr so viel bedeutete, dass sie ihn ganz für sich haben wollte.
Ihre Freundinnen verliebten sich in alle möglichen Jungs. Manche hatten auch feste Freunde, keine allerdings gab zu, bis zum Letzten gegangen zu sein. Sie holten sich ihre Kenntnisse über Sex aus Zeitschriften wie Honey und Petticoat und hatten Todesangst davor, schwanger zu werden. Die Pille wagten sie nicht zu nehmen, weil sie fürchteten, ihr Arzt würde sie ausschimpfen oder ihre Mutter informieren. Wenn sie die Möglichkeit einer vorehelichen Schwangerschaft erörterten, dann immer nur theoretisch und in den abschreckendsten Tönen. Irgendeine von ihnen kannte ein Mädchen, die hatte heiraten müssen. Eine andere hatte von einem Mädchen gehört, die selbst abgetrieben hatte, mit einer Stricknadel.
Sie und Ciaran redeten über alles, Musik, Bücher Fernsehsendungen, Politik. Er war ein leidenschaftlicher Zeitungsleser und lieh ihr Ausgaben von Private Eye und Melody Maker. Bea fühlte förmlich, wie ihr Gehirn sich mit lauter neuem Wissen füllte. Sie erzählte ihm, dass sie sich, als sie noch kleiner gewesen war, immer einen Bruder oder eine Schwester gewünscht hatte. Ciaran, der außer seinem Bruder Fergal noch vier ältere Schwestern in Irland hatte, sagte, bei ihm herrsche Geschwisterüberschuss und sie könne sich jederzeit ein oder zwei Schwestern ausleihen. Seine Schwestern mischten sich ständig in seine Angelegenheiten. Seine Mutter war gestorben, als er neun war, und seitdem glaubten Aislinn, Nora, Clodagh und Emer ihn unbedingt bemuttern zu müssen. Alle vier Schwestern schrieben ihm wöchentlich und erwarteten Antwortbriefe von ihm.
Ciaran war ein dunkler Schatten unter einem Baum. Strömender Regen, der in Schwaden durch Londons Straßen fegte, verwischte den Zugang zum Park. Sie küssten sich unter pladdernden Tropfen.
»Scheußliches Wetter«, sagte Bea. »Was machen wir?«
»Fergal ist oben in Birmingham auf einer Baustelle. Wir könnten zu mir gehen, wenn’s dir nichts ausmacht.«
»Was sollte mir das ausmachen?«
Er antwortete mit einem halben Lächeln. »Es ist halt nichts Tolles, Bea.«
In der Untergrundbahn von Maida Vale nach Ladbroke Grove stellten sie sich einander gegenüber und küssten sich, und auf dem Weg vom Bahnhof nach Notting Hill legten sie immer wieder Kusspausen ein. Regen trommelte auf die Bürgersteige und sammelte sich in Schlaglöchern auf der Fahrbahn. Sie wollte sehen, wie und wo er lebte, weil alles an ihm sie faszinierte und anzog. Sie liefen an Reihen kleiner Läden vorbei, einem Waschsalon, einer Kirche mit Friedhof, wo zwischen überwachsenen Grabsteinen Wasserbäche durchströmten. Auf einem Spielplatz turnten Kinder trotz des Wetters auf Schaukeln und wackeligen hölzernen Klettergerüsten herum. Hinter den Wasserfluten auf den Fensterscheiben eines Cafés verschwammen die Konturen der dunkelhäutigen Männer und Frauen, die drinnen saßen. Grau und verwaschen wirkte das weiß getünchte Graffiti auf einer Hausmauer: Power To The People. Vor der offenen Tür eines hohen, schmalen Hauses, aus der wie im Rhythmus mit dem trommelnden Regen der hämmernde Beat von Jimi Hendrix’ Purple Haze schallte, hockten zwei junge Männer in geflickten Jeans und abgerissenen weißen Unterhemden mit ihren Zigaretten. »Hey, Ciaran«, rief der große Afroträger, »wer ist die Tussi?« Es war nur ein paar Haltestellen von Maida Vale nach Notting Hill, aber man kam sich vor wie in einer anderen Welt. Familien wie ihre eigene, dachte Bea, waren Relikte einer zu Ende gehenden Zeit. Sie hielten sich jetzt nur noch in kleinen Nischen Londons.
Die Wohnung der O’Neills befand sich in einer Seitenstraße. Sie mussten an einem Wettbüro und einer langen Schlange vor einer Fish-and-Chips-Bude vorbei, ehe Ciaran den Schlüssel zückte und eine grüne Tür aufsperrte. Eine schmale, mit rissigem Linoleum ausgelegte Treppe führte zu einem engen Flur hinauf. Bea roch Dettol. Irgendwo schrie ein Baby, ein Mann und eine Frau stritten sich lautstark.
In der Wohnung holte ihr Ciaran ein Handtuch, damit sie sich die Haare trocknen konnte. Während sie ihre Regenmäntel vor einen Elektroheizer hängten, sah Bea sich um. Das Mobiliar des Zimmers bestand aus einem Sofa mit Tisch und drei Stühlen. Auf dem Tisch lagen ein paar zerfledderte Taschenbücher neben einem Aschenbecher und einem Transistorradio.
»Das ist das Zimmer von meinem Dad.« Ciaran deutete auf eine Tür. »Und das ist Fergals Zimmer. Ich schlafe eigentlich immer auf der Couch, aber wenn Fergal weg ist, wohne ich in seinem Zimmer.«
Bea war überrascht, wie klein die Wohnung war. Vielleicht, dachte sie, war da noch irgendwo ein Zimmer, das sie nicht bemerkt hatte.
Ciaran nahm ihr das Handtuch ab. Sie saß ihm zu Füßen, während er ihre Haare frottierte. Hin und weder streifte seine Hand ihre Wange. Sie roch den Regen auf seiner Haut. Sie wusste, dass sie bald in Fergals Zimmer hinübergehen und sich aufs Bett legen würden.
Sie hätten abbrechen können wie sonst, als er fragte: »Ist es okay? Ich hab keine Kondome, ich dachte, wir bleiben im Park.« Sie wollte nicht, dass er aufhörte, dazu war ihr Begehren viel zu heftig. Das Prasseln des Regens am Fenster ging unter in einer Lust, die sie forttrug.
Später, als sie im Badezimmer ihr Kleid zuknöpfte, betrachtete Bea sich im Spiegel und war erstaunt, dass sie kein bisschen anders aussah. Obwohl sie jetzt doch erwachsen war, eine Frau.
Das Schuljahr ging zu Ende. Ciaran arbeitete jeden Tag in der Werkstatt, und Bea nahm einen kleinen Job als Putzhilfe bei Mrs Phillips an, einer Nachbarin, der das Alter zu schaffen machte.
Es war der schönste Sommer, den sie je erlebt hatte, sie wünschte, er ginge nie zu Ende. Nach der Liebe schlüpfte sie in eins von Ciarans Hemden, ging barfüßig in die Küche, kochte Tee und machte Toast dazu und stellte sich vor, sie lebten hier zusammen. Ciaran legte eine der Platten aus der Sammlung seines Bruders auf und sang mit seiner schönen Stimme die Lieder von Bob Dylan oder den Clancy Brothers mit. Während sie Tee tranken, schmiedeten sie Pläne. Wenn sie in einem Jahr die Schule abschlossen, wenn sie beide achtzehn waren, würde Ciaran auf die Uni gehen und Bea die Ausbildung als Krankenschwester anfangen. Wo sie lebten, würde keine Rolle spielen, dass sie kein Geld hatten, würde keine Rolle spielen, denn sie liebten sich.
»Fergal und ich haben uns heute Morgen gestritten.«
Sie lagen zusammen im Bett, und Ciaran hielt sie im Arm. Beas Kopf ruhte auf seiner Brust, sie spürte den ruhigen Schlag seines Herzens.
»Worüber?«
»Wegen dir. Aber das wusste Fergal Gott sei Dank nicht. Er hat so eine Ahnung, dass da was läuft. Er ist ja nicht blöd. Wir saßen am Tisch und haben unsere Cornflakes gemampft, und da sagt er plötzlich, ich wär mit meinen Gedanken ständig woanders, ich hätte wohl was mit einer von den Nachbarsmädels.«
Sie richtete sich auf und sah ihn an. »Was hast du gesagt?«
»Ich hab gesagt, er wär ein Vollidiot, so was auch nur zu denken. Fergal kann ganz schön nervig sein, wenn er sich einmal was in den Kopf gesetzt hat. Er hat gesagt, er würde mir den Kragen umdrehen, wenn er rauskriegt, dass ich mit ’nem Mädchen rummache, statt mich auf die Schule zu konzentrieren.«
Sie erstarrten beide, als plötzlich draußen an die Tür getrommelt wurde. »Scheiße«, brummte Ciaran. »Wer kann das sein?« Er rutschte aus dem Bett. »Bleib hier.«
Er stieg in seine Jeans und rannte hinaus. Die Tür flog hinter ihm zu. Bea begann in aller Eile sich anzuziehen. Was, wenn es Fergal war, der früher von der Arbeit kam und seinen Schlüssel vergessen hatte? Er würde ausflippen, wenn er sie hier vorfand. Er würde Ciaran vielleicht verbieten, sie wiederzusehen. Sie hörte das Schloss knacken, als Ciaran die Tür öffnete, dann gedämpfte Stimmen. Ungeschickt hakte sie ihren Büstenhalter zu, während sie angestrengt horchte.
Als Ciaran wieder ins Zimmer kam, schaltete er den Plattenspieler aus. »Das war unser Nachbar. Er hat sich über die Musik beschwert.« Er atmete tief durch. »Ich hatte vergessen, dass er diese Woche Nachtschicht hat.«
»O Gott, ich hatte solche Angst …« Mit einem schrillen Lachen zog Bea den Reißverschluss ihres Rocks hoch.
»Ich dachte, es wäre Fergal. Oder mein Dad, der aus Irland zurückgekommen ist. Mensch, das hätte einen Auftritt gegeben.« Ciaran zog sein Hemd über. Seine frohe Stimmung war wie weggeblasen. »Alles gut, Schatz.« Aber sein Blick war unglücklich. »Bea, was tun wir hier? Wie soll das weitergehen, kannst du dir das vorstellen? Seit Monaten belügen wir unsere Familien. Stört dich das überhaupt nicht?«
»Wenn meine Eltern nicht so unfaire Snobs wären, müsste ich nicht lügen.« Sie hörte selbst den Ton ihrer Worte, Trotz und schlechtes Gewissen.
Er setzte sich auf die Bettkante. »Wie soll das weitergehen, wenn es draußen kalt wird? Mein Dad kommt in ein paar Tagen wieder. Dann können wir uns nicht mehr hier treffen.«
Ciaran hatte am Nachmittag die Schule geschwänzt, um mit ihr zusammen zu sein. Für Bea würde die Schule in der folgenden Woche wieder beginnen. Das Laub der Platanen draußen begann sich gelb zu färben. Der Sommer lag in den letzten Zügen.
»Wir finden schon einen Weg, Ciaran.«
Mit einer heftigen Bewegung drehte er sich zu ihr um. »Glaubst du? Und was ist, wenn du eines Tages nicht kommst, ohne mir Bescheid zu geben? Geh ich dann einfach zu dir nach Hause, läute bei euch und frag deine Mutter, wo du bist? Das glaub ich kaum, oder?«
Bea streichelte seinen Nacken. »Nicht, Ciaran, bitte.«
»Vielleicht sollten wir’s eine Weile lassen.«
»Willst du das wirklich?« Sie war den Tränen nahe.
Er seufzte. »Nein, natürlich nicht. Wie denn?«
Sie streckten sich auf dem Bett aus, ihre Gesichter einander zugewandt, seine Hand in der Senke ihrer Taille. »Ich will nicht, dass dir wehgetan wird, Bea«, sagte er leise. »Ich möchte nicht der Mann sein, der dir wehtut.«
»Du könntest mir nie wehtun. Ich liebe dich.«
»Die Menschen tun ständig denen weh, die sie lieben. Sie wollen es nicht, aber sie tun’s. Wusstest du das nicht?«
Es war spät, als sie die Wohnung verließen. Ciaran begleitete sie zur U-Bahn. Nach einem letzten Kuss rannte Bea die Rolltreppe hinunter und sprang in den Zug, kurz bevor sich die Wagentüren schlossen. Ihr war schlecht, sie konnte kaum einen klaren Gedanken fassen, während sie in dem schlingernden Zug hin und her geworfen wurde, der von Haltestelle zu Haltestelle donnerte. Vielleicht sollten wir’s eine Weile lassen. Sie hatte gespürt, wie er sich von ihr zurückzog, sich innerlich mit der Trennung vertraut machte.
Der Himmel hing grau über ihr, als sie von der Haltestelle nach Hause ging. Der Glanz der Lorbeerbüsche hinter schmiedeeisernen Gittern war matt von schwarzem Ruß und Straßenstaub. Sie wünschte, sie wäre ein Jahr älter. Wären sie jetzt beide achtzehn, könnten sie ohne elterliche Erlaubnis heiraten. Sie waren einander zu früh begegnet, dachte sie, und die lähmende Panik, die sie am Nachmittag überfallen hatte, kehrte zurück.
Zu Hause stand Vivien vor den geöffneten Küchenschränken und inspizierte die Reihen von Dosen und Packungen. Sie wandte sich um, als Bea hereinkam. »Hast du den Schinken mit?«
»Ach, tut mir leid, den hab ich vergessen.«
»Herrgott noch mal, Bea!«
»Entschuldige, Mama.«
Die Verärgerung im Gesicht ihrer Mutter wich Argwohn. »Wo warst du überhaupt? Du kommst so spät. Sagtest du nicht, du wolltest zu den Prices?«
»Nein … äh, ich …« Sie suchte krampfhaft nach einer Ausrede.
»Ich habe Mrs Price angerufen, und sie sagte mir, Sarah sei beim Friseur.«
Bea dachte an die Wohnung der O’Neills und an Ciaran. Wir belügen unsere Familien seit Monaten. In diesem Moment empfand sie es als ungeheure Anstrengung, sich eine weitere Lüge auszudenken.
»Ich bin erst spät bei Mrs Phillips weggekommen«, sagte sie. »Und dann bin ich noch eine Runde spazieren gegangen.«
Vivien runzelte die Stirn. »Vielleicht sollte ich mal mit ihr reden. Sie kann dich nicht ständig mit Beschlag belegen. Ich brauch dich hier, auch wenn du so ein Schussel bist.«
»Ach, lass nur, Mama, ich seh zu, dass ich morgen früher wegkomme. Soll ich dir eine Tasse Tee machen?«
»Nein. Einen Gin Tonic.«
Bea ging zur Anrichte. Mit zitternder Hand holte sie die Ginflasche aus dem unteren Fach und strich sich hastig die Falten aus dem Rock, als sie sich wieder aufrichtete. Ihr schlug das Herz bis zum Hals, und ihr war so heiß, dass ihr der Schweiß ausbrach. In der Eile des Aufbruchs aus Ciarans Wohnung hatte sie vergessen, ihre Haare und ihr Make-up zu richten. Sie griff sich an den Hals. Vor einigen Wochen hatte Ciaran ihr ein silbernes Kettchen geschenkt. Sie trug es nur zu den Treffen mit ihm. Hatte sie daran gedacht, es abzunehmen? Genau solche Dinge fielen ihrer Mutter unweigerlich auf. Erleichtert spürte sie es in ihrer Tasche und erinnerte sich, es abgenommen zu haben, bevor sie ins Haus gegangen war. Als sie in den Spiegel über der Anrichte blickte, sah sie, dass ihre Stirnfransen wirr zur Seite hingen und unter einem Auge die Wimperntusche verschmiert war. Sie schenkte den Gin ein, richtete ihre Haare mit den Fingern und wischte die Wimperntusche weg. Sie musste vorsichtiger sein.
In der Küche hatte ihre Mutter eine Dose Bohnen geöffnet und Eier aus dem Kühlschrank geholt. Das Gefühl, dass sie heute Nachmittag nur knapp einer Katastrophe entgangen waren, dauerte an, und während Bea Eiswürfel in eine Schale kippte, ließ sie sich noch einmal das letzte Gespräch mit Ciaran durch den Kopf gehen. Sie wusste, wie sehr es ihm widerstrebte, Fergal zu belügen. Er sprach immer nur mit großer Zuneigung von seinem Bruder.
Ciaran hatte viel zu verlieren. Ihre Mutter beschwerte sich oft, dass das Geld nicht reiche, aber »knapp bei Kasse« hieß bei den Meades etwas ganz anderes als bei den O’Neills. Es kam ihr plötzlich vor, als lebten sie und Ciaran in einer bunt schillernden Seifenblase, die beim ersten kalten Windstoß platzen würde. Ihre Fantasien von einem Zusammenleben mit Ciaran in ihrem eigenen Nest waren genau das: Fantasien. Es würde Jahre dauern, ehe sie sich auch nur ein Einzimmerapartment würden leisten können.
Ihre Mutter schlug ein Ei auf, Gelb und Weiß glitten glibberig in eine Tasse. Eine heiße Welle der Übelkeit überflutete Bea. Sie schloss die Augen und drückte einen Eiswürfel an ihre Stirn, aber die Übelkeit ließ sich nicht bannen, und ihre Mutter drehte sich nach ihr um, als sie mit einem kurzen Aufstöhnen ins Badezimmer rannte.
Sie fühlte sich das ganze Wochenende miserabel und ging jeden Abend früh zu Bett. Ihr Vater verwöhnte sie mit kleinen Aufmerksamkeiten – einer Zeitschrift, Pfefferminzbonbons, einer Tasse Tee. Bea glaubte, sie habe sich ein Magen-Darm-Virus eingefangen. Ihre Mutter war weniger teilnahmsvoll, aber ihre Mutter war ja auch der Meinung, körperlicher Schwäche nachzugeben sei jämmerlich. Ihre Blicke beunruhigten Bea.
An diesem Wochenende kam ein starker Wind auf, der die Blätter von den Platanen riss und sie zu ledrigen braunen Haufen auf der Terrasse zusammenfegte. Sonst gingen Bea und ihr Vater am Sonntagmorgen immer zum Kiosk, um die Zeitung zu besorgen. Als er sich an diesem Sonntag zum Ausgehen anzog, sagte Vivien, er solle allein gehen. Bea glaubte, sie täte es aus Fürsorge für sie, aber als die Tür hinter ihm zufiel und sie in ihr Zimmer gehen wollte, hielt Viviens scharfe Stimme sie auf.
»Du bleibst hier.« Vivien schüttelte eine Zigarette aus einer Schachtel John Player’s. »Was geht hier eigentlich vor?«
»Wie meinst du das?«
Gereizt klopfte Vivien die Zigarette gegen die Packung. »Hast du Dummheiten gemacht? Und lüg mich ja nicht an.«
Im ersten Moment spürte Bea gar nichts, nicht einmal Furcht. Auf die Taubheit folgte schnell blanke Verzweiflung. Irgendwie hatte ihre Mutter das mit ihr und Ciaran rausbekommen. Aber wie? Sie konnte es sich nicht vorstellen.
Das goldene Feuerzeug klickte. »Also? – Na los, raus mit der Sprache.«
»Ich weiß nicht …« Sie wusste es wirklich nicht.
»Hast du was mit einem Jungen?« Das Feuerzeug sprang nicht an, und Vivien versuchte es von Neuem. Sie blickte auf. »Wenn du mir nicht die Wahrheit sagst, rede ich mit deinem Vater. Ich lass ihm gern das Vergnügen, seinem Schätzchen auf die Schliche zu kommen. Willst du das, Beatrice?«
Bea schüttelte den Kopf. »Nein«, sagte sie leise.
»Bist du schwanger?«
Schwanger. Die Vorstellung war so absurd, dass sie beinahe gelacht hätte. »Nein, natürlich nicht!«
»Ich meine«, sagte Vivien scharf, »könnte es sein, dass du schwanger bist? Warst du mit einem Jungen im Bett?«
Sie dachte an die Wohnung und Fergals Bett. Sich selbst mit bloßen Beinen in Ciarans Hemd, wie sie Tee kochte, auf dem Plattenspieler die Dubliners, durchs offene Fenster die Gerüche der Straße nach Fish und Chips und Autoabgasen.
Sie starrte ihre Mutter an. »Aber wir haben aufgepasst …«
»O Gott, du dummes, dummes Ding …«
Sie hatten aufgepasst, ja, außer, erinnerte sie sich mit Entsetzen, jenes erste Mal. Ihr wurde schon wieder schlecht, am liebsten wäre sie ins Bad gerannt. Aber das getraute sie sich nicht.
Ihre Mutter drückte eine Hand auf den Mund und schloss die Augen. Die Geste erschreckte Bea, traf sie ärger, als Vorwurf und Zorn sie hätten treffen können. Aber der weiche Moment war schon vorbei, ein Bombardement von Fragen folgte.
Wer ist es? Der junge Price? Nein? Wer dann?
»Er hat doch wohl einen Namen«, schloss Vivien mit Verachtung.
Anfangs sträubte sie sich, ihrer Mutter irgendetwas zu sagen, bis ihr aufging, dass sie sich vor allem deshalb weigerte, an eine Schwangerschaft zu glauben, weil diese Möglichkeit zu beängstigend war, um überhaupt in Betracht gezogen zu werden. Sie wusste praktisch nichts über Schwangerschaft und Kinderkriegen, und sie musste ständig an ihren Vater denken, dass er ja nichts erfahren, auf keinen Fall mitten in dieses Gespräch hineinplatzen durfte.
»Ciaran«, sagte sie schließlich. »Ciaran O’Neill.« Sie versuchte es mit Stolz zu sagen, aber es klang kläglich wie ein Wimmern. »Wir kennen uns aus dem Park.«
Die Augen ihrer Mutter sprühten vor Zorn. »Du bist mit irgendeinem Kerl ins Bett gegangen, den du im Park kennengelernt hast?«
»So war’s nicht.«
Sie hörten beide, wie draußen die Tür aufgesperrt wurde. Vivien zischte: »Wir gehen morgen zum Arzt und lassen dich untersuchen. Marsch jetzt in dein Zimmer. Und keinen Ton zu deinem Vater. Ich sag ihm, dir geht’s nicht gut. Es würde ihm das Herz brechen.«
Was dann folgte, war eine einzige Tortur. Zuerst kam der Besuch beim Hausarzt. Nachdem dieser sie untersucht hatte, meinte er nur: »Tja, da hast du wohl eine Riesendummheit gemacht, hm?« Danach sprach er mit ihrer Mutter. Beatrice, sagte er, sei in der elften oder zwölften Woche schwanger. Er würde zur Sicherheit noch einen Test vornehmen, aber er habe kaum Zweifel.
Noch schlimmer war der Abend, als ihre Mutter ihrem Vater von dem Kind erzählte. Bea wusste, sein Blick – Fassungslosigkeit, Verletztheit und Enttäuschung – würde sie ihr Leben lang verfolgen. Dass er alle Schuld Ciaran gab, machte es nur schlimmer.
Ihre Eltern erlaubten ihr keinerlei Kontakt mit Ciaran. Sie durfte nicht einmal die Wohnung verlassen – in der Schule hatte ihre Mutter sie krankgemeldet –, konnte daher die Briefe, die sie ihm schrieb, um ihm zu erklären, was passiert war, nicht aufgeben. Sie wusste nicht, ob sie infolge der Schwangerschaft ständig todmüde war oder ob die Mattigkeit daher rührte, dass sie sich in einem Albtraum gefangen fühlte.
Eines frühen Abends, als sie in dumpfem Elend auf ihrem Bett lag, schlief sie ein und erwachte irgendwann später desorientiert und mit schwerem Kopf. Aus dem Wohnzimmer hörte sie die Stimmen ihrer Eltern. Leise betrat sie den Raum. Ihre Mutter saß in einem scharlachroten Cocktailkleid auf dem Chintz-Sofa vor dem hohen Fenster. Eine Flasche und zwei Gläser standen auf dem Beistelltisch, und ihr Vater mixte Drinks.
Er drehte den Kopf und lächelte. »Hallo, Schatz.«
Ihre Mutter sagte: »Dein Vater hat mit den O’Neills gesprochen.«
Zum ersten Mal seit Tagen flammte bei Bea ein Funken Zuversicht auf. »Du meinst, mit Ciaran? Du hast mit Ciaran geredet? Was hat er gesagt?«
»Ich war bei ihnen zu Hause. Diese Wohnung, was für ein Loch!« Er schraubte die Cinzanoflasche zu. Im verwaschenen Abendlicht sah Jack Meade blass und müde aus. »Ich hab den Jungen nicht gesehen, Kind. Nur den Vater.«
»Das versteh ich nicht. Warum hast du nicht mit Ciaran geredet?«
»Kleines …«
»Er ist weg«, fuhr Vivien dazwischen.
»Weg?« Bea starrte ihre Mutter an. »Weg, wohin?«
»Er ist nach Irland zurück. Dein Vater hat Mr O’Neill vor ein paar Tagen geschrieben, um ihm die Situation zu schildern und sich mit ihm zu verabreden. Der Junge muss sich aus dem Staub gemacht haben, als er von dem Kind hörte.«
»Du lügst. So was würde Ciaran nie tun! Ich glaub dir das nicht.« Beas Stimme war schrill geworden.
»Es ist leider wahr, Kleines.« Jack drehte Bea den Rücken, um die Drinks mit Vermouth und Angostura aufzufüllen. »Mr O’Neill sagte mir, dass er nach Irland zurückgekehrt ist.«
Bea umklammerte die Sofalehne. »Nein, das kann nicht stimmen. Das muss ein Irrtum sein.«
Vivien zuckte mit den Schultern. »Darling, es ist kein Irrtum. So was ist bei Männern gang und gäbe.«
Jack klopfte auf die Armlehne des Sofas. »Komm, setz dich, Kind.«
Ohne den Blick von ihrem Vater zu wenden, kam Bea der Aufforderung nach. Nachdem er ihrer Mutter ihr Glas gereicht hatte, setzte er sich neben sie.
»Ich habe beim Militär einige Männer wie O’Neill kennengelernt. Typen, die nie lernen, Verantwortung zu übernehmen. Kaum taucht eine Schwierigkeit auf, kaum ist ein bisschen Mumm gefordert, tun sie alles, um sich rauszuwinden.«
»Du musst den Tatsachen ins Gesicht sehen«, sagte Vivien. »Der Bursche ist auf und davon, sobald er von seinem Vater hörte, was los ist.«
»Das würde er nie tun! Ich schreibe ihm …«
»Das tust du nicht.« Der Ton ihrer Mutter war scharf.
»Vivien, das reicht jetzt.« Die Stimme ihres Vaters wurde weich, als er zu ihr gewandt sagte: »Komm, Liebes, nicht weinen. Hier.« Er gab ihr sein Taschentuch. »Wir lassen nicht zu, dass dieser Junge dir wehtut. Jetzt wein doch nicht so, beruhige dich. Wir sind ja da. Das wird schon wieder. Das versprech ich dir.«
»Wie denn … wie könnt ihr sagen …« Sie schluchzte. »Ich liebe ihn.«
»Das bildest du dir ein«, sagte Vivien kurz.
»Vivien! Du hast einfach ein zu weiches Herz, Bea.«
Sie stellte sich ihr Herz vor, rot und wund und blutend, während ihr Vater weitersprach.
»Er ist es nicht wert, Schatz. Du wirst ihn bald vergessen haben, warte nur. Sei froh, dass du ihn los bist. Es wird alles gut, glaub mir. Mama und ich kümmern uns um alles, wir haben uns überlegt, was jetzt für dich das Beste ist. Erst mal musst du einen Schlussstrich ziehen, Schatz. Du wirst ein paar harte Monate durchmachen, aber dann kannst du neu anfangen.«
Im Auto, auf der Fahrt nach Gloucestershire, erläuterte ihr Vater noch einmal, was er und ihre Mutter für sie geplant hatten. Bis zur Geburt des Kindes würde Bea bei ihrer Tante Muriel in den Cotswolds bleiben. Ganz in der Nähe, in Stow-on-the-Wold, war eine Entbindungsklinik, wo sie das Kind zur Welt bringen konnte. Sie würde es zur Adoption freigeben, und danach könne sie nach London zurückkehren und ihr Leben wiederaufnehmen, als wäre nichts geschehen, sagte ihr Vater. Der Schule hatten ihre Eltern mitgeteilt, dass Bea sich gegen ein Studium entschieden habe und ein halbes Jahr zu Verwandten nach Frankreich reisen und sich darauf konzentrieren werde, ihre Französischkenntnisse zu verbessern.
In diesem langen, einsamen Winter drehte sie jeden Tag eine große Runde mit den drei Hunden ihrer Tante – ein Dalmatiner und zwei Cocker Spaniel. Immer führte ihr Weg durch ein Dorf, wo sie ihre Briefe an Ciaran aufgeben konnte. Jedem Brief, den sie in den Kasten steckte, gab sie einen Kuss mit.
Er schrieb nie zurück. Nicht ein einziges Mal. Jeden Tag durchlebte sie dasselbe Wechselbad der Gefühle: Hoffnung, solange sie auf die Post wartete, Verzweiflung, wenn kein Brief kam. Am Ende glaubte sie, dass zumindest ein Teil von dem stimmte, was ihr Vater gesagt hatte – dass Ciaran nach Irland zurückgekehrt war. Ihre Briefe erreichten ihn wahrscheinlich nicht, weil sein Vater und sein Bruder sie ihm nicht nachschickten.
Die Menschen tun ständig denen weh, die sie lieben, hatte er gesagt.
An einem Morgen im April setzten die Wehen ein. Tante Muriel fuhr sie in die Entbindungsklinik. Beas Sohn wurde in den frühen Stunden des folgenden Morgens geboren. »Darf sie den Kleinen sehen?«, hörte sie jemanden sagen, als die Schwestern sie frisch machten.
»Geben Sie ihn mir.« Ihre Stimme war kaum mehr als ein zittriges Piepsen, aber die Schwester legte ihr das Kind in den Arm. Die zarten, kleinen Gesichtszüge waren rot und zerknittert vom anstrengenden Weg durch den Geburtskanal. Ein Auge war geöffnet, das andere ein tiefblauer Schlitz. Das offene Auge suchte sie und heftete sich unverwandt auf ihr Gesicht.
»Hallo, Patrick«, flüsterte sie von Liebe überwältigt.
In der Nacht, nachdem sie ihr das Kind genommen hatten, hatte sie den Traum zum ersten Mal. Sie war in der U-Bahn. Es waren noch andere mit ihr im Wagen – ihre Eltern, eine Freundin, ein Fremder. Als die Türen sich öffneten, stieg sie aus. Niemand außer ihr verließ den Zug, der wieder anfuhr und in der Dunkelheit eines Tunnels verschwand, während sie allein auf dem Bahnsteig zurückblieb. Sie ging ein paar Stufen hinunter, gelangte in einen Gang und dann in einen weiteren. In dem von Schatten verdunkelten Labyrinth war nirgends auch nur eine Menschenseele zu sehen. Sie suchte ihr Kind und konnte es nicht finden. Es war ihre Schuld, sie hatte es irgendwo vergessen, allein zurückgelassen und wusste nicht mehr, wo. Ein Gefühl unendlicher Verlassenheit umhüllte sie wie ein erdrückender Mantel. Als sie sich aus dem Albtraum befreite, weinte sie.
Am folgenden Tag holte ihr Vater sie nach Hause. Neben ihm im Auto sitzend, fühlte sie sich leer, ihre Arme erschienen ihr unnütz. Zu Hause war alles unverändert, als wäre sie gar nicht fort gewesen, und doch erschien ihr alles fremd, als ginge es sie nichts an. Sie weinte viel und verließ ihr Zimmer nur, weil ihre Mutter darauf bestand, dass sie ihre Mahlzeiten mit ihnen einnahm und an die frische Luft ging. Ihr Vater schien völlig hilflos. Sie redeten kaum miteinander, doch Vivien hakte Bea entschlossen unter und zog sie mit sich hinaus ins Freie, zunächst in den Garten und später, als es ihr besser ging, in den Park.
Sobald Bea sich stark genug fühlte, nahm sie die U-Bahn nach Notting Hill und entdeckte, dass die Wohnung der O’Neills an andere Leute vermietet war. Niemand von den Nachbarn konnte ihr sagen, wohin Mr O’Neill mit seinen beiden Söhnen verzogen war. Die Straßen wirkten jetzt eher heruntergekommen als bunt.
Am Tag nach Patricks erstem Geburtstag reiste Bea nach Frankreich, zu ihren Verwandten in der Provence. Das Frühjahr und den Sommer über arbeitete sie mit ihrer Cousine Chantal in der Dorfbäckerei. Die Tage waren sonnig, die Luft roch nach Lavendel und wilden Kräutern. Sie erzählte niemandem von ihrem Kind und Ciaran, ihre Mutter hatte es ihr verboten.
Sie war neunzehn, als sie im Herbst 1972 nach London zurückkehrte. Sie zog mit Freundinnen zusammen in eine Wohnung in Earl’s Court und fand Arbeit als Assistentin eines Fotografen, ein Mann namens Vic aus dem East End, der ständig mit einer Zigarette im Mund herumlief und Interieurs für Zeitschriften wie House & Garden und Country Life fotografierte. Zu Beas Job gehörte es, die richtige Vase mit den richtigen Blumen auszusuchen oder im Trödelladen das perfekte Fundstück aufzutreiben, um einem Raum die besondere Note zu geben. Eines Morgens nahm Vic die Zigarette lang genug aus dem Mund, um zu sagen: »Du bist ein cleveres Ding, Bea. Dir brauch ich nichts mehr beizubringen, hm? Du hast einen Blick für den Job.« Sie glühte vor Stolz.
Sie nahm die Pille, hatte immer irgendeinen Mann am Bändel und stopfte sich die Abende und Wochenenden mit Partys und Kneipenbesuchen voll. Aber jeden Abend, gleich, wo sie war oder mit wem sie das Bett teilte, dachte sie als Letztes an Patrick und betete darum, dass er glücklich und gesund und gut versorgt sein möge. Dann sagte sie ihm, wie sehr sie ihn liebte, und wünschte ihm eine gute Nacht.
Zwei
1975–1976
Er saß in der Dienstagabendmaschine von Genua nach London und fiel Emma Romilly, der Stewardess, auf, weil ihm beim Aufreißen des kleinen Beutels mit Erdnüssen die ganze Bescherung aus den Händen zu Boden sprang. Er tat ihr leid; das Gleiche hätte ihr passieren können. Er hatte feine braune Haare der Art, die immer leicht zerzaust wirken, und er war groß und schlank, mit klar geschnittenen Gesichtszügen, genau wie sie es mochte. Sie war dreiundzwanzig. Er schien ihr im gleichen Alter zu sein, vielleicht ein paar Jahre älter.
Als sie beide hinuntertauchten, um die Erdnüsse einzusammeln, stießen sie mit den Köpfen zusammen.
»O Gott, tut mir leid«, sagte er und fuhr zurück. »Tut mir wirklich leid. Alles in Ordnung?«
»Ja, ja, nichts passiert. Wie geht’s Ihnen? Ich habe einen harten Schädel.«
Bei dem Zusammenstoß war ihm die Nickelbrille von der Nase gerutscht. Als er sie abnahm und blinzelnd seinen Blick auf sie richtete, stellte sie fest, dass seine Augen graublau waren wie der von Meereswellen überspülte Schiefer an der Küste.
»Lassen Sie mich das machen«, sagte sie. »Sie setzen sich besser wieder, Sir.«
Draußen tobten Herbststürme, und sie flogen über die Alpen. Emma sammelte die Erdnüsse ein, und kurz darauf leuchtete das Signal zum Anschnallen auf. Die Maschine rollte und stampfte wie ein Schiff im Sturm. Sie ging von Sitzreihe zu Sitzreihe, um zu prüfen, ob alle Passagiere angeschnallt waren, dann setzte sie sich zu ihren Kolleginnen auf einen der Klappsitze. Neben ihr saß ihre Freundin Kirsty, mit der sie und Susan, auch eine Kollegin, zusammenwohnten. Kirsty war länger bei der British Caledonian als Emma; sie war es gewesen, die Emma vorgeschlagen hatte, sich bei der Fluggesellschaft zu bewerben. Emma hatte die Vermutung, dass sie genommen worden war, weil einer der Männer, die das Bewerbungsgespräch mit ihr geführt hatten, angeblich eine Schwäche für Rothaarige hatte. Ganz sicher war nicht ihr tadelloses Auftreten oder ihre unschlagbare Kompetenz der Grund gewesen. Sie bemerkte mehrere Laufmaschen in ihren Strümpfen vom Herumkriechen auf dem Boden und zog ihren Rock weiter herunter. Die Purserin, Cecilia, war unheimlich pingelig bei der äußeren Aufmachung, jedes Schnipselchen abgeblätterter Nagellack, jedes Härchen, das nicht fest im Haarknoten verankert war, fiel ihr unentrinnbar auf.
Emmas Blick schweifte die Kabine hinunter, auf der Suche nach dem Mann mit den schiefergrauen Augen. Sie konnte nur den oberen Teil seines Kopfs erkennen. Er war ihr irgendwie bekannt vorgekommen, als wäre sie ihm schon einmal begegnet, aber sein Name (Dr. Max Hooper), den sie in der Passagierliste nachgeschlagen hatte, sagte ihr nichts.
Nach der Landung in Gatwick und dem Erlöschen der Warnsignale verabschiedeten Emma und Cecilia am Ausgang die Passagiere, die sich in langer Schlange an ihnen vorbeischoben. »Nochmals Entschuldigung«, sagte Dr. Hooper zu ihr, bevor er ins Freie hinaustrat. »Ich meine, wegen des Zusammenstoßes.« Er tippte sich an die Stirn.
Sie lachte. »Ich werd’s überleben. Seien Sie vorsichtig die Treppe runter.« Die Metallstufen glitzerten regennass. Im feuchten Asphalt spiegelten sich die Lichter.
In der Ankunftshalle stieß sie noch einmal auf ihn, als er gerade einen zerknitterten Trenchcoat aus seiner Aktentasche zog. »Turbulenzen sind nicht so mein Ding«, bemerkte er, als sie zusammen durch die Halle gingen. »Ich denke jedes Mal, wir stürzen ab. Sie haben so ruhig gewirkt. Ich frage mich, wie Sie das schaffen.« Der Trenchcoat, den er über den Arm genommen hatte, drohte immer wieder zu Boden zu rutschen, er schien es gar nicht zu bemerken.
»Das gehört zu meiner Arbeit.«
»Und mögen Sie Ihre Arbeit?«
»Ich liebe sie.« Es war wahr. Sie hatte noch nie in einem Flugzeug gesessen, bevor sie bei der British Caledonian anfing. Die Romillys waren keine Weltenbummler. In den letzten sechs Monaten aber war sie überall gewesen – LeTouquet, Lissabon und jetzt Genua.
Sie fragte ihn, ob er es weit nach Hause habe. »Nur ein Katzensprung«, sagte er. »Ich wohne in einem alten Gutshaus ungefähr zehn Kilometer von Horley. Zusammen mit Freunden. Kennen Sie die Gegend?«
»Ich wohne in Horley. Altes Gutshaus klingt gut.«
Sie sagte es nur ihm zu Gefallen, nicht aus Überzeugung. Sie liebte das Abenteuerliche an allem, was neu war, einer neuen Wohnung, einer neuen Arbeit, einem neuen Land. Bevor sie sich verabschiedeten, sagte sie aus einem Impuls heraus: »Ich bin Emma Romilly. Eine meiner Mitbewohnerinnen hat am Samstag Geburtstag, und wir machen eine Party. Kommen Sie doch, wenn Sie Lust haben. Und bringen Sie Ihre Freunde mit.«
Sie lud ihn ein, weil sie, Kirsty und Sue immer auf der Suche nach geeigneten Männern waren, um für den zahlenmäßigen Ausgleich zu sorgen. Doch es war nicht der einzige Grund. Vom ersten Moment an hatte sie eine so heftige Neigung zu ihm erfasst, dass sie sich wie benebelt fühlte. Ein bisschen wie nach einem Schlag auf den Kopf.
Marc Bolan sang Get It On, und die Party war in vollem Gang, als Emma am Samstagabend die Tür zu dem Doppelhaus in Horley aufsperrte. Über das Gewühl im Wohnzimmer hinweg winkte sie Sue und rief ihr ein »Happy Birthday« zu, dann ging sie, über diverse Pärchen hinwegsteigend, die auf den Treppenstufen hockten, nach oben in ihr Zimmer. Sie zog ihre schottisch karierte Uniform aus und schlüpfte in ein Midikleid aus pflaumenfarbenem Crêpe. Sie kämmte sich die lockigen Haare aus, trug frische Wimperntusche und Lippenstift auf. Noch ein Spritzer Aqua-Manda-Parfum, und sie war fertig.
Im Wohnzimmer hatten sie die Möbel auf die Seite geschoben, um Platz zum Tanzen zu haben. Ihr Herz schlug schneller, als sie Max Hooper entdeckte, der sich auf der anderen Seite des Zimmers mit zwei Männern unterhielt. Er stand mit dem Rücken zu ihr, und ihr fiel auf, wie gut das blaue Denimhemd über seinen Schultern saß. Auf dem Weg zu ihm schnappte sie ein paar Fetzen des Gesprächs zwischen den drei Männern auf. Ein Doppelhaus in Reigate … Der Modernismus ist wohl kaum mit dem britischen Klima vereinbar … Andy, ich fass es nicht, wie konservativ du bist …
Sie berührte leicht seinen Ellbogen. »Hallo, Max.«
Er drehte sich um und lächelte. »Emma, wie schön, Sie zu sehen.«
»Tut mir leid, dass ich so spät dran bin. Wir hatten in Frankfurt Probleme mit der Maschine. Ich freu mich, dass Sie kommen konnten.«
Max machte sie mit seinen Freunden bekannt. Phil war der breitschultrige blonde Mann, der lässig an ein Bücherregal gelehnt stand; Andy war schmal, dunkel und drahtig.
»Ich hab was zu trinken mitgebracht.« Max schwenkte eine Flasche. »Haben wir eigens aufgehoben, um sie mit Ihnen zu teilen. Als Wiedergutmachung für das Erdnuss-Debakel.«
Er goss ihr ein Glas ein. Der Wein war kühl und trocken. Sie sprachen über Wein, dann über Kochen. Sie mussten schreien, um die Musik und das Stimmengewirr zu übertönen. Nach einer Weile forderte Phil sie zum Tanzen auf. Als er sich nach dem Tanz ins Gewühl stürzte, um frische Getränke zu besorgen, tippte Emma Max auf die Schulter. Die ersten schleppenden Akkorde von This Guy’s In Love With You erklangen aus dem Kassettenrekorder, als er sie in die Arme nahm. Sie spürte die Wärme seiner Hand auf ihrem Rücken, das Spiel der Muskeln unter dem etwas rauen Denimgewebe unter ihren Fingerspitzen. Kirsty tanzte mit Phil. Emma beobachtete, wie sie sich ihm zuneigte und ihren Kopf an seine Schulter lehnte. Sie hätte das bei Max auch gern getan, aber irgendetwas hielt sie davon ab. Sie wusste nicht, wo sie mit ihm stand. Er war liebenswürdig, aber nicht mehr.
Sie hatte geglaubt, dieser Funke, der sich da bei der Begegnung mit Max Hooper im Flugzeug so plötzlich und heftig entzündet hatte, wäre längst erloschen, bis sie sich das nächste Mal sahen. Aber so war es nicht, und das überraschte sie. Seit der Beendigung ihres Studiums hatte sie das Leben auf die leichte Schulter genommen, in diesem und jenem Job gearbeitet, bevor sie bei der British Caledonian angefangen hatte, mit dieser oder jener Freundin zusammengewohnt. Sie hatte diverse Beziehungen gehabt, aber es waren immer nur oberflächliche Geschichten gewesen. Sie wollte Spaß haben und etwas erleben und mochte es am liebsten spielerisch. Dieses plötzliche sehnsüchtige Verlangen war nicht eingeplant gewesen.
Ehe Max und seine Freunde gingen, luden sie Emmy, Kirsty und Sue für das folgende Wochenende zum Abendessen ein. Sue, die mit ihrem Freund, einem Piloten, verabredet war, konnte nicht mitkommen, aber sie lieh Emma ihr Auto. Ein heftiges Unwetter peitschte die tiefen Pfützen zu braunen Wellen auf, und Emma, die von Sue gewarnt worden war, dass die Scheibenwischer nicht richtig funktionierten, fuhr langsam und vorsichtig auf den schmalen Landstraßen, während Kirsty neben ihr in die Karte schaute. Das Land rundherum war schwarz, die Wegweiser schwer zu erkennen im strömenden Regen, und sie fuhren eine Weile im Kreis, ehe sie auf ein von Hand beschriftetes Schild stießen, das sie einen schlammigen, von Furchen durchzogenen Fahrweg hinunterwies.
Emma, die fürchtete, der Wagen könnte im Schlamm stecken bleiben, parkte auf einem Flecken festem Boden nicht weit vom Haus entfernt. Im prasselnden Regen stapften sie durch den Matsch zur Haustür. Phil ließ sie herein und hängte ihre Mäntel auf. Ihre schlammbedeckten Stiefel zogen sie aus. Emma, die vergessen hatte, Schuhe zum Wechseln mitzunehmen, folgte Phil auf Strümpfen durch den Flur.
Er führte sie in eine große Wohnküche im hinteren Teil des Hauses. Mehrere Leute drehten die Köpfe, als sie hereinkamen. Eine Frau mit platinblonden Korkenzieherlocken musterte sie mit mokantem Lächeln. »Lieber Gott, Sie sind ja völlig durchweicht«, sagte sie. »Oder, Lionel? Sie sehen echt aus wie gebadete Mäuse.«
Der Mann, den sie angesprochen hatte, ebenfalls sehr blond, von gedrungener Statur, warf Emma und Kirsty ein Geschirrtuch zu. »Hier, trocknen Sie sich die Haare, bevor Sie sich erkälten. Und kommen Sie ans Feuer. Ich bin übrigens Lionel Sutton, und das ist meine Schwester Julia.«
Emma bat um Entschuldigung für die Verspätung. »Wir haben uns ziemlich verfranst«, erklärte sie.
Dann kam Max herein. »Sie haben es geschafft!«, sagte er. »Danke, dass Sie hier rausgetreckt sind. Ich wollte gerade eine Taschenlampe holen, um nach Ihnen zu suchen. Ich war nicht sicher, ob Sie bei diesem Wetter überhaupt kommen würden.« Er lachte. »Aber klar, ich hatte vergessen, dass Sie Turbulenzen gewöhnt sind.«
Eine Frau in geblümtem Rock und dunkelblauem Oberteil, das ihre Modelfigur betonte, trat neben Max. »Was meinst du damit, Darling?«
»Das ist Emma, und das ist Kirsty«, sagte Max. »Sie arbeiten bei der British Caledonian. Emma und ich haben uns im Flugzeug kennengelernt. Ich war total in Panik, als wir über die Alpen flogen.«
Julia, die Platinblonde, sagte: »Eigentlich ist doch eine Stewardess nicht viel mehr als eine bessere Bedienung.«
Kirsty warf Emma mit hochgezogenen Brauen einen kurzen Blick zu und setzte sich dann zwischen Andy und Phil aufs Sofa. Lionel sagte: »Also wirklich, Jules, du bist so ein Snob.«
»Ich bin nur ehrlich.« Julia sah ihren Bruder tadelnd an. »Ich mein, es ist doch so, oder nicht? Was bist du immer gleich persönlich beleidigt, Lionel? Sie sind doch nicht beleidigt, Emma?«
»Nicht die Spur«, sagte Emma.
Ihr Blick wandte sich Bridget zu, der Frau, die Max »Darling« genannt hatte. Dunkelbraune Haare, im Nacken zusammengenommen, ein breites, waches, freundliches Gesicht.
Bridget bot Emma die Hand. »Schön, dass Sie gekommen sind. Ich bin Bridget, Max’ Freundin.«
Emma antwortete mit einer höflichen Floskel. Während Bridget erzählte, dass sie in London lebte und nur übers Wochenende bleiben würde, ging Emma im Kopf ihre wenigen Gespräche mit Max durch. Sie hatte ihn nicht gefragt, ob er eine feste Freundin habe. Wie blöd kann man sein, dachte sie. Ihr fiel jetzt ein, dass sie es gewesen war, die ihn zu Sues Party eingeladen hatte, dass sie ihn auf der Party zum Tanzen aufgefordert hatte. Wenn hier jemand etwas missverstanden hatte, dann sie.
Bridget richtete ihre sehr blauen, leicht hervorstehenden Augen auf Emma. »Gott, Ihnen ist bestimmt eiskalt in dem Kleid«, rief sie. »Hast du sie nicht gewarnt, Max? Also wirklich! Das Haus ist echt der reinste Gefrierschrank. Darling, dein Hemd.« Sie zupfte seinen Kragen zurecht und glättete die Falten. »Ich leih Ihnen eine Jacke, Emma«, sagte sie und war auf und davon, bevor Emma sie aufhalten konnte.
Max ließ sich von Emma erzählen, wie ihre Woche verlaufen war, Lionel versorgte alle mit Getränken und deckte den großen Fichtenholztisch zum Essen. Phil stand vom Sofa auf, um sich um einen gusseisernen Topf auf dem Herd zu kümmern. Während Emma Max von dem Passagier erzählte, der versucht hatte, seinen Zwergpudel an Bord ihrer Maschine zu schmuggeln, machten ihre Gedanken immer wieder kurze Abstecher zu der Erkenntnis, dass Max eine Freundin hatte. Aber im Grund hatte das mit ihr nichts zu tun. Es konnte ihr völlig egal sein.
Bridget kam mit einer Wolljacke in die Küche zurück. »Hier, Emma, ziehen Sie die über. Wir wollen doch nicht, dass unsere Freunde erfrieren, oder, Max?«
»Mir fällt die Kälte gar nicht auf«, bemerkte Julia, die auf der Tischkante hockte. Ihrem Bruder Lionel, der Kerzen anzündete, mitten im Weg, dachte Emma. »Ich finde, so ein Unwetter hat was Erfrischendes.«
Emma zog dankend die Jacke über, die Bridget ihr gebracht hatte, obwohl die Kühle in der Küche, in der nur der offene Kamin und der Herd etwas Wärme verströmten, sie eigentlich nicht störte. Sie war in einem zugigen Haus an der Ostküste über der Nordsee groß geworden und Kälte genauso gewöhnt wie stürmisches Wetter.
Und auch Geschwisterkabbeleien war sie gewöhnt. Sie kam aus einer liebevollen, aber streitfreudigen Familie, und sie hätte schon blind sein müssen, um nicht zu merken, dass Julia ihrem Bruder irgendetwas gewaltig übel nahm. Als er die Servietten zu verteilen begann, kreischte sie: »Was? Hast du diese alten Fetzen immer noch nicht weggeschmissen?«
»Sie erfüllen ihren Zweck«, sagte Lionel ungerührt. »Sie sind da, wenn man kleckert.«
»Ich fahre morgen nach Guildford und kauf bei Habitat neue.«
»Spar dir dein Geld lieber. Sie würden nur im Schrank vermodern, weil ich Angst hätte, sie schmutzig zu machen.«
»Herrgott noch mal!«, sagte Julia verärgert. Sie rutschte vom Tisch und griff nach einer Flasche Wein. »Wenn du nur mal was einsehen würdest, dann müsste ich nicht über Geldverschwendung nachdenken. Die Bude hier geht doch bald völlig in die Brüche, und dann kriegen wir keinen Penny mehr für sie.«
Emma fragte Bridget, was sie beruflich machte. »Ich bin Referendarin in einer Anwaltskanzlei in London«, antwortete Bridget. »Julia und ich sind Kolleginnen. Ich überlege gerade, auf welches Gebiet ich mich spezialisieren soll. Roger – das ist der Seniorpartner – hat mir zu Sachenrecht geraten, aber ich weiß nicht, ob ich mit Familienrecht nicht glücklicher wäre. Es tut ja gut, gefragt zu sein, aber man muss dem Ruf des Herzens folgen, finden Sie nicht?«
Emma überlegte, als Phil zum Essen rief. Sie nahmen alle am Tisch Platz. Sie saß zwischen Max und Julia. Ihr Herz, dachte sie, hatte bisher keinen besonderen Ruf an sie ergehen lassen. Sie hatte sich nicht von Kindesbeinen an gewünscht, Stewardess zu werden oder so was. Der Job war ihr mehr oder weniger zugefallen. Sie hatte von zu Hause weggewollt und gewusst, dass sie im Gegensatz zu ihren Eltern mit Kunst nichts am Hut hatte. Mehr als ein Jahr lang hatte sie sich einfach treiben lassen und war damit gut gefahren.
Das Essen war hervorragend, und Phil und Lionel, die Köche, heimsten Lob von allen Seiten ein. Die Tischgespräche drehten sich vor allem um zwei Dinge. Am einen Ende der Tafel ging es um die steigende Inflation, die hohe Arbeitslosigkeit und andere politische Themen, während am anderen Ende Max und seine Freunde über Architektur diskutierten. Nachdem Andy zunächst Phil mit mildem Vorwurf seine Bewunderung für den Brutalismus unter die Nase gerieben hatte, taten sich die beiden gegen Max zusammen und deklarierten ihn mit gutmütigem Spott zum lebensfremden Idealisten. Max wehrte die freundschaftlichen Frotzeleien ab, ohne sich aus der Ruhe bringen zu lassen. Der Streit zwischen Lionel und seiner Schwester, worum auch immer es dabei ging, flammte von Zeit zu Zeit wieder auf.
Emma hüpfte von einem Gespräch zum anderen, abgelenkt allerdings von dem süßlichen Parfümduft der geliehenen Strickjacke, um einiges zu groß für sie und aus einer kratzigen Wolle in Rotbraun gestrickt, das sich mit dem Rehbraun ihres Samtkleids biss. Sie fragte Bridget, ob sie die Jacke selbst gestrickt habe.
Bridget strahlte. »Ja, hab ich.«
»Das find ich toll.«
»Ach, ich stricke eigentlich dauernd, oder, Max?«
Er sah sie an. »Ach, ja?«
»Aber das weißt du doch. Du weißt doch, der Schal, den ich dir gestrickt habe.«
Max setzte zu einem Kompliment über den Schal an, aber Julia fuhr dazwischen. »Also, für so was hab gar nichts übrig. Ich hatte noch nie Talent zum Hausmütterchen.« Sie schüttelte die platinblonden Locken und zog einen kleinen Flunsch. »Was meinst du, Andy, seh ich nach Hausmütterchen aus?«
Andy wandte sich ihr zu. »Nicht unbedingt, Jules.«
»Es ist ja nur ein Hobby«, murmelte Bridget.
Emma fragte Julia, ob sie in London lebe. Julia steckte sich eine Zigarette zwischen die Lippen und neigte sich, viel Dekolleté zeigend, zu Andy, um sich Feuer geben zu lassen.
»Klar, wo sonst? Ich würde nie woanders leben wollen.«
»Aber die Bomben …«, sorgte sich Lionel.
»Du meinst die IRA? Davon lass ich mich nicht einschränken.«
Bridget erzählte, dass sie beim letzten Bombenanschlag der IRA an der U-Bahn-Haltestelle Green Park ganz in der Nähe gewesen war. Sie hatte die Explosion gehört.
»Wie entsetzlich«, sagte Lionel. »Du solltest hierher ziehen, Bridget. Da wärst du viel sicherer.«
»Oh, hier könnte ich nicht leben«, entgegnete Bridget entschieden. »Ich bin eingefleischte Londonerin, wie Julia.«
Lionel spießte ein Stück Rindfleisch auf. »Julia ist keine Londonerin. Sie kommt von hier, genau wie ich.«
»Ja, aber ich gehöre nicht mehr hierher«, zischte Julia. »Darum geht’s.«
Als Nachtisch gab es Schwarzwälder Kirschtorte, die Bridget selbst gebacken und eigens aus London mitgebracht hatte. Das Gespräch wandte sich allgemeinen Themen zu – einem Film, den Kirsty und Emma gesehen hatten, einem Studienkollegen von Max, Andy und Phil, der vor Kurzem unerwartet geheiratet hatte.
Phil setzte Kaffeewasser auf, und sie wollten die Tafel gerade aufheben, als sämtliche Lichter im Haus ausgingen. Die Küche versank in Finsternis. Julia kreischte. Irgendetwas rollte über den Tisch und schlug krachend zu Boden.
»Vorsicht, Emma«, sagte Max. »Ich glaube, das war eine Weinflasche.«
»Keine Bange, das kommt immer wieder mal vor«, kam Lionels Stimme aus dem Dunkel. »Ich seh mal nach dem Sicherungskasten.«
»Du weißt, ich hab Angst im Dunklen.« Julia begann zu weinen.
Emma tätschelte ihr den Rücken und versuchte, sie zu beruhigen. Doch Julia weinte weiter. Lionel war mit einer brennenden Kerze verschwunden. Im Schein der Taschenlampe, die Max bei sich hatte, bückte sich Emma und begann vorsichtig, die Scherben der zerbrochenen Flasche aufzusammeln. Max half ihr, während Andy und Kirsty Julia zum Sofa führten. Emma war sich Max’ Nähe sehr bewusst, als er dicht neben ihr in die Hocke ging. Sein Arm streifte ihren. Ihr fiel auf, wie fix und gezielt er die Scherben auflas, obwohl er sonst eher ein bisschen zerstreut wirkte.
Die Lichter gingen so plötzlich wieder an, wie sie ausgegangen waren. Lionel meldete sich mit einem lachenden »Nur eine Sicherung! Nichts Ernstes«, zurück. Julia hatte aufgehört zu weinen und schniefte an Andy gekuschelt in dessen Hemd.
Phil machte jetzt den Kaffee, und Lionel begann, das schmutzige Geschirr in der Spüle zu stapeln. Als er vorschlug, Max solle Emma und Kirsty doch das Haus zeigen, erklärte Kirsty, sie habe aus ihrer Kindheit genug Erfahrung mit zugigen alten Bauernhäusern und würde lieber bleiben, wo sie war. »Ich helfe Ihnen dafür mit dem Geschirr, Lionel.«