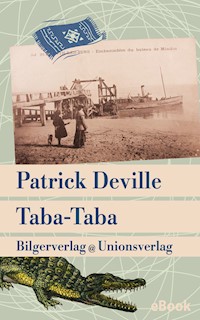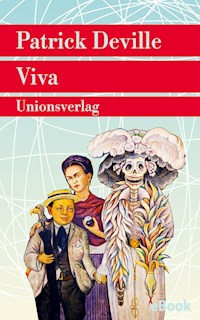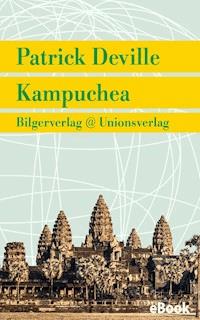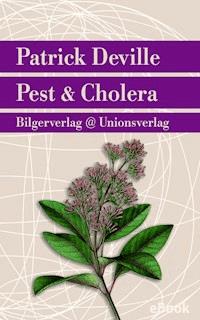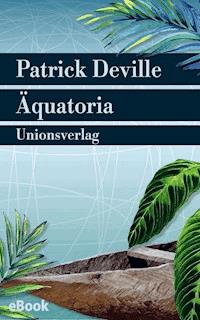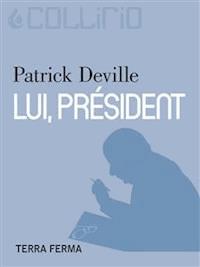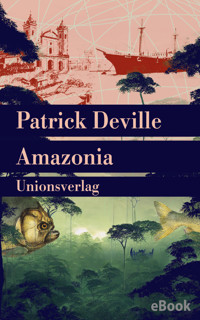
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der mächtige Amazonas trägt auf seiner Reise quer durch Lateinamerika Tausende Geschichten mit sich. Legenden von ungeahnten Reichtümern, Berichte von Abenteurern, Forschungsreisenden und Industriellen, von Gier, Goldrausch und Ausbeutung sind ihm eingeschrieben. Begleitet von seinem Sohn, hält Deville die Klänge und Düfte der schillernden Landschaft fest, lässt sich vom Fluss zurücktragen in vergangene Zeiten, die den Kontinent geformt und verwundet haben. Er folgt den Echos von Alexander von Humboldt, dem Konquistadoren Lope de Aguirre und Charles Darwin, vom Atlantik bis an den Pazifik, über die Anden bis zu den Galapagosinseln. Deville nimmt uns mit auf einen prächtig kolorierten literarischen Karneval und in die labyrinthischen Flüsse und Nebenflüsse der Weltgeschichte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 371
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Über dieses Buch
Der mächtige Amazonas trägt Tausende Geschichten mit sich, Berichte von Ruhm, Gier und Goldrausch, von Wissenschaft und Ausbeutung. Patrick Deville lässt sich von ihm in die Vergangenheit tragen, folgt den Echos von Humboldt und Darwin. Ein prächtiger literarischer Karneval und eine Reise durch die labyrinthischen Flüsse der Weltgeschichte.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Patrick Deville (*1957) studierte Literatur und Philosophie. Er lebte im Nahen Osten, in Afrika und bereiste Lateinamerika. Seine Werke wurden mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, unter anderem als »bester Roman des Jahres« der Zeitschrift Lire, mit dem Fnac-Preis und dem Prix Femina.
Zur Webseite von Patrick Deville.
Holger Fock (*1958) studierte Theaterwissenschaft, Germanistik und Philosophie. Er übersetzt seit 1983 französische Literatur, u. a. Gegenwartsautoren wie Andreï Makine, Cécile Wajsbrot (beide zusammen mit Sabine Müller), Pierre Michon und Antoine Volodine. Er lebt bei Heidelberg.
Zur Webseite von Holger Fock.
Sabine Müller (*1959) studierte Germanistik, Philosophie und Pädagogik. Sie übersetzt aus dem Französischen und Englischen, u. a. Werke von Andreï Makine, Cecile Wajsbrot, (beide zusammen mit Holger Fock), Erik Orsenna, Philippe Grimbert, Annie Leclerc und Alain Mabanckou.
Zur Webseite von Sabine Müller.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Patrick Deville
Amazonia
Roman
Aus dem Französischen von Holger Fock und Sabine Müller
E-Book-Ausgabe
Bilgerverlag @ Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Dieses E-Book des Bilgerverlags erscheint in Zusammenarbeit mit dem Unionsverlag.
Die Originalausgabe erschien 2019 bei Éditions du Seuil, Paris.
Die deutsche Erstausgabe erschien 2021 im Bilgerverlag, Zürich.
Originaltitel: Amazonia
© by Éditions du Seul, Paris 2019
© der deutschen Ausgabe by bilgerverlag GmbH, Zürich 2021
Diese Ausgabe erscheint mit freundlicher Genehmigung des Bilgerverlags.
© by Bilgerverlag, Zürich 2023
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Alamy Stock Photo
Umschlaggestaltung: Peter Löffelholz
ISBN 978-3-293-31181-7
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 25.05.2023, 11:15h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
AMAZONIA
Vater & SohnDie Blauen IndianerAn Bord»Über die Ähnlichkeit der Kinder mit ihren Vätern«In GuanabaraVater & TochterAn BordMit AntônioAm Mittelpunkt der WeltIm WaldIn PernambucoVater & SohnVon Grund auf GummiIn SantarémEin bolivianischer WaisenjungeVater & SohnÜber den OptimismusAn BordDie Nacht bei TakashiDie Expedition MontaigneKomische VögelCândido & AugusteVater & SohnDer Tod des VatersAn BordUnterwegs mit dem KonsulIn ManausUnterwegs zum InkaDie lange Fahrt flussabwärtsDas Wasser, das bei den Ruinen entspringtIn IquitosVater & TochterEin RebellAn BordEine VerstimmungBei AlbertoPierre & JulesVater & Sohn (dann Tochter)Wolfgang & FrederikVater & SohnAn BordCarlos & AntonioMit WernerSirenen & AmazonenPierre & RogerIm PutumayoAn BordAm ÄquatorDer furchterregende CandirúIn QuitoAlexander & AiméIn GuayaquilAlexander & SimonVater & SohnBei RamiroFür die LiebendenIm TrockendockIn Santa CruzAn BordJeanne & GeorgeCharles & AlexanderVater & SohnIn Tortuga BayEine kleine BordbibliothekQuellenangabenMehr über dieses Buch
Über Patrick Deville
Über Holger Fock
Über Sabine Müller
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Bücher von Patrick Deville
Zum Thema Brasilien
Zum Thema Lateinamerika
Zum Thema Frankreich
Zum Thema Kolonialismus
Zum Thema Geschichte
Ich verabscheue Reisen und Forschungsreisende.
CLAUDE LÉVI-STRAUSS, Traurige Tropen
Vater & Sohn
Ein heftiger Regenschauer schüttelte das Schiff, durch die Scharniere der Bullaugen drang Wasser ein. Wir zündeten eine kleine Lampe an. Im Halbdunkel der feuchtheißen Kabine saß Pierre im Gegenlicht und füllte ein Notizbuch. Ich hatte gewartet, bis wir an Bord waren, um ihn zu fragen, ob er sich noch an den Vers von Blaise Cendrars erinnere: »Gong Tamtam Sansibar Dschungeltier Röntgenstrahlen Schnellzug Skalpell Sinfonie«, das Fragment eines Gedichts, das er vor einem Dutzend Jahren aufgelesen und in eine seiner Zeichnungen eingefügt hatte. Für diese Entdeckung hätte damals sicher ich gesorgt, war seine Antwort.
Cendrars’ Vater, Vater und gescheiterter oder um den Erfolg gebrachter Erfinder, windiger Geschäftsmann, Importeur von gepanschtem Bier in Neapel und ruinierter Bauträger eines Phantompalasts in Ägypten, der ein Patent für Türfedern hielt und zu guter Letzt nach La Chaux-de-Fonds zurückgekehrt war, hatte seinem Sohn ein Buch von Gérard de Nerval geschenkt, das für sein Leben bestimmend wurde. In der väterlichen Bibliothek war ihm zudem L’ Asie russe (»Das russische Asien«) von Élisée Reclus in die Hände gefallen, und damit war die Idee zu seinem Langgedicht Die Prosa von der Transsibirischen Eisenbahn geboren. Lange nach seiner Brasilienreise schenkte Cendrars seinerseits seinem Sohn Rémy den Gedichtband La Chute d’un ange (»Fall eines Engels«) von Alphonse de Lamartine. Der Sohn war Flieger. Es war Krieg. Der Engel verlor sein Leben bei einem Übungsflug.
Man hüte sich vor Büchern, die Väter ihren Söhnen ans Herz legen: Aufgrund einer nachdrücklichen väterlichen Empfehlung, fast einer Anordnung, hatte ich als Kind Moravagine gelesen. Obwohl mir das merkwürdig erschienen war, hatte ich lange Zeit geglaubt, dieses Buch sei für mich geschrieben worden, da mein Vater es mir aufgezwungen hatte, und ich fand darin die Lust an Weltreisen, die Ähnlichkeit des Irren Moravagine mit dem Irren Taba-Taba, mit dem ich damals in der psychiatrischen Anstalt, in der wir wohnten, befreundet war. Die erotischen und pornografischen Szenen waren mir zweifellos entgangen.
Aber nicht »die Blauen Indianer«.
Als er 1924 von Bord der Formose geht, träumt Cendrars von brasilianischen Reichtümern. Er ist dafür so unbegabt wie sein Vater. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Er steigt die Stufen des Fallreeps hinab, streift die vergangenen zehn Jahre von sich ab: 1914 lebte er noch in Forges-par-Barbizon. Der Schweizer Cendrars, der sich der Mobilisierung hätte entziehen, sich nicht im Krieg die Finger hätte schmutzig machen müssen, startete damals einen Aufruf an »die ausländischen Freunde Frankreichs, die während ihres Frankreichaufenthalts das Land lieben und schätzen gelernt haben wie ein zweites Vaterland und deren dringender Wunsch es nun ist, ihm beizustehen«. Ein Jahr später riss ihm eine Granate den rechten Arm ab, und damit die Hand, mit der er diesen Aufruf verfasst hatte.
Mit jener Hand, die im Abfalleimer eines Feldlazaretts landete, hatte er die Gedichte Ostern in New York und Die Prosa von der Transsibirischen Eisenbahn niedergeschrieben. Züge und Schiffe wie auf Plakaten der Messageries Maritimes, eine Ananas und ein Papagei metonymisch für die Antillen, dieser Modernismus ist schon angestaubt, außer Mode, von Dadaismus und Surrealismus überholt. Er träumt davon, sich an einen Roman zu machen, schleppt seit Jahren in seinen Koffern die Pläne zu Gold und Moravagine mit sich herum. An Bord der Formose hat er selten die Zeilenglocke seiner tragbaren Remington gehört.
Am Kai erwarten ihn, ganz in Weiß gekleidet, Paolo Prado und die kleine Bande des Movimento Modernista. Später beschrieb er seinen Mäzen als einen »Mann aus der Familie des A. O. Barnabooth und fast ebenso reich wie Valery Larbauds Held, aber viel aparter, feinsinniger, belesener, professoraler« – vor allem ist er ein millionenschwerer Kaffeebaron. Prados Vater war ein Vertrauter Kaiser Pedros II. gewesen. Und Prado selbst hatte mit Paul Claudel, damals Botschafter in Rio, den Kriegseintritt Brasiliens aufseiten der Alliierten ausgehandelt. Seit dem Waffenstillstand weilte die kleine Bande oft in Frankreich, war zum Skifahren in den Pyrenäen. Cendrars hatte ihnen in Paris Valery Larbaud und Jules Supervielle, Éric Satie und Claude Debussy vorgestellt. Wie die normannischen Seefahrer im sechzehnten Jahrhundert Indianer aus Brasilien auf die Schiffe luden, um sie dem französischen König vorzustellen, kehrte Paolo Prado, wie ein Ethnologe mit seiner Trophäe, mit einem modernistischen französischen Dichter nach Brasilien zurück.
Die Blauen Indianer
Das typische Amazonas-Schiff, das wir Jangada nannten, schmal, kaum Tiefgang, der Rumpf aus Itauba-Holz, die Besatzungsmitglieder, auf deren Rücken der Schriftzug MARINHA MERCANTE prangte, das alles glitt seit Tagen durch ein Labyrinth. Nach Monaten auf dem Trockendock führten sie eine Testfahrt durch. Pierre und ich waren die einzigen Passagiere, wir genossen die stundenlangen monotonen Fahrten, begleitet vom Brummen der Maschinen.
Im Schatten des Deckshauses sitzend, ließen wir die hypnotisierende grüne Wand langsam an uns vorbeiziehen, die die ersten verstörten Seefahrer in den Wahnsinn oder zur Lyrik getrieben hatte. Bei schönem Wetter wuschen wir abwechselnd unsere Kleidung im Waschbecken der Kabine, hängten die ausgebreiteten Wäschestücke mit Wäscheklammern an die Reling. Ich hatte seit Langem keine Wäscheklammer mehr gesehen – gerne würde man der Menschheit etwas so Nützliches und Vernünftiges wie eine Wäscheklammer oder einen Dosenöffner hinterlassen. Jeder für sich vertieften wir uns dann wieder in unsere Bücher und Notizbücher, respektierten uns in unserer Einsamkeit, sprachen wenig.
Die Jangada war wendig genug, um die Autobahn der Containerschiffe, Linienschiffe und Schubleichter zu verlassen, sie bog in die zu Hochwasserzeiten schiffbaren Seitenarme ab, Paranas genannt, und ging für die Nacht vor Anker. Im Morgengrauen hörten wir von den auf Pfählen im Wasser stehenden Gehöften her das Schnorcheln oder Furzen der Delfine und das Krähen der Hähne.
Im Parana do Maica hatte uns unsere Gier, wilde Tiere zu sehen, da sie fast alle vom Aussterben bedroht sind, ja sogar immer schneller aussterben, zu einer Ansammlung gelber und grüner Hütten mit einem Ponton, Hunden und einer Zapfsäule geführt. Mit dem Vorsteher dieses von Caboclos bewohnten Dorfs, das einst von entflohenen Negersklaven gegründet worden war, weshalb es seit Abschaffung der Sklaverei einen Sonderstatus genoss, waren wir im Wald auf die Suche nach Brüll- und Kapuzineraffen gegangen, die schwer auszumachen sind, weil sie reglos in den Bäumen verharren, bevor sie an ihren Schwänzen hängend Faxen machen. Wir sahen auch Faultiere, große Blaue Morphofalter, aber keinen Indianer derselben Farbe.
Die häufigen Lektüren des Romans Moravagine hatten meine kindlichen Leseeindrücke längst verwischt, sodass ich nie mehr wissen werde, was ich empfand, als ich vor der weit weniger üppigen Landschaft der Loiremündung Sätze wie diese las: »Wir waren von baumartigen Farnen umgeben, von haarigen Blumen, von fleischigen Gerüchen, von meergrüner Erde. Ausströmung. Werden. Durchdringung. Dehnung. Schwellen einer Knospe. Öffnen eines Blattes, schuppige Rinde, schleimige Frucht, saugende Wurzel, gärender Samen (…).« Die Piroge fuhr den Fluss hinunter, landete zum Biwakieren an einer Böschung an. »Wir hatten sie nicht kommen hören. Sie rückten näher und näher heran und schlossen schweigend ihren Kreis. Moravagine wollte gerade zu einer Ansprache ansetzen, da traf ihn ein Schlag mit dem Paddel, und er wurde schnell gefesselt. Es waren blaue Indianer.«
Viel weiter im Süden hatte Cendrars von São Paulo aus am Steuer eines Ford Conversível die Straßen von Minas Gerais abgefahren. Dann kam die Revolution. Er war Paolo Prado gefolgt. Bei Aufständen ziehen sich die Reichen immer und überall eine Weile in ihre Landhäuser zurück. Bis sich alles wieder legt.
An Bord
Mit den Händen im Nacken kann man sich diese tausend Flüsse, die sich, aus zwei Hemisphären kommend, einige Grade unterhalb des Äquators im Bett des großen Stroms vereinen, vorstellen wie viele Tausend Geschichten. Dem Einarmigen fehlt ein gutes Thema. Die »Coluna Prestes« wäre eines. Seit Monaten dreht sich Cendrars im Kreis, hält Vorträge, um sich ein Taschengeld zu verdienen. Er ist kein Modernist mehr. Auch kein Dichter. Er würde gerne mithilfe der Kontakte von Paolo Prado Geschäfte machen, reich werden, das Büro Cendrars & Co. eröffnen. Diese Revolution kommt ihm ungelegen.
Anfang Juli 1924 rebellieren in Brasilien Militärangehörige, der Aufstand ist als Revolta Paulista bekannt. Junge Offiziere aus dem Mittelstand verlangen soziale Gerechtigkeit, geheime Wahlen, die Entwicklung eines öffentlichen Schulwesens, alles Forderungen, bei denen Kaffeebarone wie Paolo Prado nur mit den Schultern zucken und grinsen. Die Bewegung gewinnt Zuspruch. Aufstände im Norden bis Belém und Manaus und im Bundesstaat Rio Grande do Sul. Die Rebellen halten drei Wochen lang São Paulo, dann verlassen sie als Kolonne die Stadt. Waren es anfangs tausendfünfhundert Männer, sind es bald viertausend, die noch vor Mao in China und Savimbi in Angola zu einem langen Marsch aufbrechen, um die Bauern zum Aufstand zu bewegen. An ihrer Spitze steht der sechsundzwanzigjährige Hauptmann Luiz Carlos Prestes. Er vermeidet offene Zusammenstöße, beweist strategisches Genie, setzt strikte Disziplin durch, schließt Defätisten aus, darunter Filinto Müller. Als Müller zwanzig Jahre später Chef der politischen Polizei des Präsidenten Getúlio Vargas wurde, rächte er sich an Luiz Prestes, indem er dessen Frau, die deutsche Revolutionärin Olga Benário, an die Gestapo auslieferte, die sie erst ins Konzentrationslager Ravensbrück und dann in der Tötungsanstalt Bernburg ins Gas schickte.
Die »Coluna Prestes« aber wurde in diesen Zwanzigerjahren nie besiegt, zwei Jahre lang zog sie in großen Schleifen durch die fast leeren Wüstenlandschaften des Sertão, legte die unglaubliche Entfernung von fünfundzwanzigtausend Kilometern zurück, was der Strecke Paris–Wladiwostok hin und zurück entspricht, immer bedrängt von den Cangaceiros, Horden von Banditen, die die Armee mit dem Versprechen auf Amnestie und Aufstieg gedungen und bewaffnet hatte, darunter der grausame Lampião im Bundesstaat Pernambuco. An die West- und Südgrenzen gedrängt, hatte sich die Coluna im Laufe der Flucht aufgesplittert, bevor sie sich schließlich ganz auflöste, wobei ein Teil der Männer Zuflucht in Bolivien, ein anderer in Paraguay fand.
Aus kindlicher Verehrung hatte ich während meiner ersten Aufenthalte in São Paulo nach Spuren eifriger Cendrarianer gesucht, zu denen auch mein Vater gezählt hatte, der damals bereits seit einigen Jahren verstorben war. Für ein Interview suchte ich den Kulturbeauftragten von São Paulo, Carlos Augusto Calil, in seinem Büro in der Preifeitura auf. Er schenkte mir einen gerade von ihm herausgegebenen dicken Bildband von Alexandre Eulalio, A Aventura brasileira de Blaise Cendrars, in dem unveröffentlichte brasilianische Dokumente abgedruckt waren, doch nichts über die Coluna. Ich kam damals gerade aus Luanda. Im Konsulat hatte ich Sébastien Roy wiedergetroffen, der in Angola ein Buch geschrieben hatte. Durch ihn bekam ich Kontakt zu den brasilianischen Schriftstellern Luiz Ruffato und Bernardo Carvalho. Vor meiner Abreise deponierte ich einen Stapel Bücher in seinem Büro, über die er ein Jahr lang wachen sollte. Cendrars war nach drei Reisen in den Zwanzigerjahren nicht mehr nach Brasilien zurückgekehrt. Brasilien, eine Begegnung veröffentlichte er lange danach. Wir waren da.
Von meiner kleinen Unternehmung in den letzten zwanzig Jahren hatte Pierre in ungeordneter Folge mehrere Berichte gelesen, die im Bogen von West nach Ost um die Welt führten, von Mittelamerika über Afrika und Asien nach Mexiko. Im jüngsten Buch, das von einer Rundreise durch Frankreich handelt, die auch eine Kehrtwende darstellte, weil es danach weiterging, dieses Mal Richtung Westen, vom Atlantik zum Pazifik, hatte ich anhand der Archive meiner Tante Monne das Leben meines Vaters neben dessen eigenem Vater nachgezeichnet, und dessen Leben neben dem seines Vaters und so weiter. Ich stellte mir vor, wir könnten daran anknüpfen und diese Kette von Vätern und Söhnen weiterverfolgen. Mit dem beachtlichen Unterschied, dass wir lebten. Mal sehen, wie es ausgehen würde. Er hatte darüber nachgedacht. Und eingewilligt. Wir waren schon seit etlichen Jahren nicht mehr zusammen gereist.
Letztes Jahr flogen wir auf Einladung von Samuel Titan, einem Verleger von Belletristik und Fotobänden, nach São Paulo, reisten anschließend mit dem Auto an die Costa Verde und nach Paraty, wo wir den Entdecker Amyr Klink trafen und seine Schiffe, die Paratii und die Paratii 2 besichtigten, Einhandsegler, mit denen er mehrfach die Welt umrundet und dabei im Polareis überwintert hat. Klink wohnte in einer auf dem Landweg unzugänglichen Bucht, in der Schildkröten schwammen und über der, von Wald umgeben, sein Haus stand, das ursprünglich eine Cachaça-Destillerie gewesen war und in dem Thomas Manns Mutter ihre Jugend verbracht hatte. In der Mutter des alten Aschenbach aus Der Tod in Venedig kann man die Erinnerung an diese Frau, Julia da Silva Bruhns, die selbst Schriftstellerin war, ebenso erkennen wie die an die Landschaft: »Er (Aschenbach) sah, sah eine Landschaft, ein tropisches Sumpfgebiet unter dickdunstigem Himmel, feucht, üppig und ungeheuer, eine Art Urweltwildnis aus Inseln, Morästen und Schlamm führenden Wasserarmen – sah aus geilem Farrengewucher, aus Gründen von fettem, gequollenem und abenteuerlich blühendem Pflanzenwerk haarige Palmenschäfte nah und ferne emporstreben.«
Gustav von Aschenbach stieß in seiner Erinnerung auf diese Bilder. Sie entsetzten ihn, denn er sah, wie »wunderlich ungestalte Bäume ihre Wurzeln durch die Luft in den Boden, in stockende, grünschattig spiegelnde Fluten versenken, wo zwischen schwimmenden Blumen, die milchweiß und groß wie Schüsseln waren, Vögel von fremder Art, hochschultrig, mit unförmigen Schnäbeln, im Seichten standen und unbeweglich zur Seite blickten«.
In diesen Vögeln erkannte ich den Hoatzin mit seinen großen weinroten Flügeln, der unser Vogel-Fetisch werden sollte, dem Pierre und ich von einem Ende Amazoniens zum anderen nachstellten, da er überall heimisch ist, ein prähistorisches Monster, der Einzige seiner Art, Zeuge des Übergangs vom Dinosaurier zum Vogel, dessen überaus hässliche, schmutzig weiße Küken zwei Flügelkrallen besitzen, um sich an Bäumen hochzuhieven oder in dem großen, aus nachlässig geschichteten Zweigen errichteten Nest herumzuwandern. Wenn wir uns ihm im überschwemmten Wald mit dem Paddelboot näherten, das Fernglas auf ihn richteten, seinen struppigen, zerzausten, grimmigen Kopf anpeilten, das starre, furchterregende, runde rote Auge in seinem blauen Bett heranholten, wichen wir jedes Mal reflexhaft zurück, als ob er mit dem Schnabel das Objektiv durchstoßen und uns den Augapfel aushacken würde. Der Hoatzin, der einzige wiederkäuende und daher wie eine Kuh rülpsende Vogel, stinkt. Der Gestank, mit dem er sich umgibt, schützt ihn ebenso wirksam wie eine Tarnung durch Mimese oder ein Panzer. Außerdem ist er ungenießbar.
»Über die Ähnlichkeit der Kinder mit ihren Vätern«
Die Angst vor einem Streit in der engen Kabine der Jangada war sicher beiderseitig. Wie in allen Liebesgeschichten wurden Türen zugeschlagen, gab es Schreie, plötzliche Aufbrüche in der Nacht, doch an Bord des Schiffes wussten wir, dass unsere Möglichkeiten begrenzt waren, die Flucht zu Fuß durch den Wald war waghalsig, die Flucht ins Wasser wegen der Piranhas und Candirús gefährlich.
In den vergangenen zehn Jahren hatte Pierre fotografiert und Musik gemacht, manchmal dilettantisch, in anderen Zeiten mit großem Fleiß, unter verschiedenen Pseudonymen hatte er Schallplatten aufgenommen, zwischen Brüssel und Marseille Konzerte gegeben. Ich hatte ihn nur einmal auf der Bühne gesehen, wobei Bühne nicht das richtige Wort ist. Er spielte auf seiner E-Gitarre inmitten des stehenden Publikums im kleinen Veranstaltungsraum einer Galerie. In diesem Trancezustand erkannte ich ihn kaum wieder, düstere Texte, dunkle, schleppende und dann plötzlich sehr schneidende Stimme. Ich dachte an dieses Rätsel um Väter und Söhne, an dessen Bestandsaufnahme ich seit Langem arbeite: Malcolm & Arthur Lowry, Pietro & Ascanio Savorgnan de Brazza, Arthur & Frédéric Rimbaud, Rudyard & John Kipling, Jonas & Lote Savimbi, Percy & Jack Fawcett, Theodore & Kermit Roosevelt … Für die Reise auf der Jangada hatte ich die Essais von Montaigne eingesteckt.
Im Kapitel »Über die Ähnlichkeit der Kinder mit ihren Vätern« staunt er über das Wunder, »dass dem kleinen Samentropfen, aus dem wir hervorgehn, nicht allein die Körpergestalt, sondern auch die Denkweise und die Neigungen unserer Väter eingeprägt sind«. Jahrhunderte später und trotz des erlangten Wissens über die Vereinigung der beiden genetischen Codes ist man mit der Klärung dieses Mysteriums nicht weitergekommen.
Früher machte man einen Unterschied zwischen natürlichen und legitimen Kindern, doch alle waren natürlich. Nach zehn Jahren des Zusammenlebens hatten Florence und ich entschieden, dass dieses legendäre Kind, von dem wir ab und zu sprachen, endlich das Licht der Welt erblicken könnte. Vor seiner Geburt in einer Entbindungsstation im Anjou war Pierre an einem Juniabend 1988 am Ufer des Ozeans gezeugt worden, nicht weit weg vom LAZARETT, dem Ort meiner Zeugung im März 1957 vor meiner Geburt in Paimbœuf, der auf dem Landweg nächstgelegenen Entbindungsstation zu unserer psychiatrischen Anstalt.
Neue medizinische Techniken hatten es seitdem ermöglicht, diesen Zufällen ein Ende zu bereiten und Kinder zu zeugen, die man nicht als »künstlich«, sondern als »genetisch« bezeichnete und die manchmal, um die Vererbung bestimmter Krankheiten zu vermeiden, nicht nur aus zwei, sondern aus drei Mitochondrien in einer Eizelle hervorgingen. Hätte es zu meiner Zeit die Techniken der Frühdiagnose schon gegeben, dann hätte man meinen Eltern vielleicht geraten, ihren ersten missglückten Versuch zu vergessen, diesen Fötus mit seinen missgebildeten Beinen zu zerstören und sich wieder fröhlich ans Werk zu machen.
Es war also der allergrößte Zufall, dass wir hier zusammen an Bord waren.
Es mag oft nervig sein, seinen Vater zu beobachten, an ihm Züge und Ticks zu entdecken, von denen man weiß, dass man sie geerbt hat, auf die man aber gern verzichtet hätte, doch es ist faszinierend, seinen Sohn zu beobachten, mit diesen Eigenheiten, die man wiedererkennt, und anderen, unbekannten »Denkweisen und Neigungen«, und dieses Ungleichgewicht bei der Beobachtung wird mit der Zeit zur Quelle von Missverständnissen, da der eine wie der andere sich weiterentwickelt, sich verändert, während jeder wahrscheinlich gern der Einzige wäre, der sich wandelt, und der andere sich gefälligst gleich bleiben soll.
Seit dreißig Jahren war ich die meiste Zeit allein auf Reisen gewesen. Dennoch habe ich mit Pierre die meisten Kilometer zurückgelegt. Es bleibt nicht mehr genug Zeit, um ihn von dieser Position zu verdrängen. Eines Abends haben wir, während wir unsere Expedition vorbereiteten, im Bistrot des Amis aus einer gemeinsamen Vorliebe für Listen in einem Notizbuch nachgelesen, welche Orte wir gemeinsam besucht haben, und jedes Stichwort weckte in jedem verschiedene Bilder von uns in verschiedenen Lebensaltern, als ob wir diese beinahe dreißig Jahre im Zeitraffer durcheilten, Saint-Malo und Jersey und die Normandie, das Aubrac und das Quercy, Belgien, Dünkirchen, Brügge, die Niederlande, Paimpol und Tréguier, Bréhat, Port-Navalo, Rochefort-sur-Mer, Saint-Palaos, die Verdon-Schlucht, Biarritz … Gemeinsam reisten wir, Pierre anfangs im Kindersitz auf der Rückbank, dann, Jahre später, zu zweit vorn, in einem uralten, riesigen weißen Mercedes »Strich 8«, Baureihe W-115, einem Panzer, vertikale Scheinwerfer, als Kühlerfigur ganz vorn auf der Motorhaube ein Stern mit drei Schenkeln in Hundertzwanziggradwinkeln. Wir erinnerten uns auch an Bilbao, Asturien, Kantabrien, Galizien, und schlürften dazu unseren Chablis, als wäre es gerade ein Albariño. Nach unserer Rückkehr aus Paraty hatten wir beschlossen, dass 2018 für uns weiß und grün sein sollte, Alpen & Amazonien.
Anfang Februar verbrachten wir einige Tage in einem Chalet in Chamonix. Am Morgen fuhren wir zu zweit mit der kleinen roten Zahnradbahn auf den Montenvers zum Mer de Glace, dem Gletscher, der unter dem Einfluss der Klimaerwärmung um einige Dutzend Meter abgeschmolzen ist, seit Pasteur 1860 den Ort besuchte, um dort Erhebungen zur Luftreinheit durchzuführen. Am Berghang kletterten wir im Schneegestöber Richtung Aiguille du Midi. Pierre fotografierte die Nebelschleier, die denen in Jim Jarmuschs Film Stranger Than Paradise ähnelten. Am Abend im Chalet speisten wir mit Bruno Mégevand und seinem Sohn Matthieu, zwei Väter und zwei Söhne, jeweils etwa im gleichen Alter, unterhielten uns über das Projekt, das wir vorbereiteten, und auch sie erinnerten sich gerne an ihre Reisen zu zweit.
Nach unserer Rückkehr ins verschneite Paris war ich nach Marokko geflogen, auch um den Faden unserer Geschichte von ihrem Anfang her aufzunehmen. Pierre reiste mit einer Mitfahrgelegenheit zu seiner Liebsten in die Bretagne. Ich marschierte gerade in Marrakesch von der Feuerwehrkaserne in Guéliz die Route de Targa hinauf zu der Gasse, in der das Haus stand, das wir 1990 bewohnten, einer Sackgasse, die inzwischen eine Durchfahrt zu einer Straße am Fuß des kleinen Djebel geworden ist, auf dem sich die Stadtmauer erhebt, als ich diese Nachricht von ihm erhielt: »Bin gut angekommen trotz des Schnees. Liebe Grüße aus Saint-Nazaire.«
Zwanzig Jahre zuvor waren wir beide nach Marokko gereist, um das »Haus des Général Mangin« genannte Wohnhaus wiederzusehen, das er ebenso vergessen hatte wie den Garten, in dem er Stehen und Gehen gelernt hatte. Unter dem großen Zitronenbaum speiste ein Wasserhahn das gelbe Drehkreuz des Rasensprengers, eine große, flüchtige Rosette, die auf dem nassen Gras funkelte, ich sah ihn vor mir, wie er unsicher, torkelnd, durch die rotierenden goldenen Garben tapste, hörte sein Kinderlachen, als wäre ich wieder im Jahr 1990, ich schloss kurz die Augen, öffnete sie wieder, und durch dieses ganz alltägliche, ganz banale und dennoch erstaunlichste Wunder im Leben aller Menschen – erstaunlicher als ein Spaziergang von Paris nach Wladiwostok oder auf dem Mond –, durch diesen verblüffenden Zaubertrick befand ich mich, Abrakadabra, während ich noch das Gewicht seines winzigen, durchnässten Körpers in meinen Armen spüren konnte, neben einem rätselhaften Mann an Bord der Jangada.
In Guanabara
Pünktlich ein Jahr später, 2006, war ich wieder nach São Paulo gekommen, um die Bücher abzuholen, die ich im Büro von Sébastien Roy im Konsulat zurückgelassen hatte, darunter ein Band mit Fotografien von Marc Ferrez. Diesmal schlug ich ihm vor, in Brasilien die Verleihung eines Literaturpreises zu organisieren, den ich einige Jahre zuvor mit Unterstützung der besten Feuerzeuge der Welt geschaffen hatte, die auch die besten Kugelschreiber der Welt sein wollten. Es ging darum, einem jungen Schriftsteller zur Veröffentlichung seines Werks zu verhelfen und ihn mit einem Stipendium auszustatten. Ich hatte diesen Preis bereits in Uruguay, Costa Rica, Venezuela, Kuba und Mexiko verliehen. Sébastien Roy war bereit, eine Jury aus brasilianischen Schriftstellern zusammenzustellen, sich um die Logistik, die Aufrufe in der Presse und die Entgegennahme der anonymisierten Manuskripte im Konsulat zu kümmern.
Während ich in Afrika weiterhin nach Spuren von Savorgnan de Brazza suchte, stand ich zugleich mit einem Bein in Brasilien und brütete bei meinen Aufenthalten im Glória Hotel in Rio in den folgenden zwei Jahren die Idee aus, eines fernen Tages, mehr als fünf Jahrhunderte nach Pedro Cabral, meine eigene Eroberung Brasiliens zu schreiben. Die langen Korridore des Glória waren mit Schwarz-Weiß-Fotos berühmter Gäste geschmückt, Kim Novak und Isadora Duncan, Gina Lollobrigida und Marilyn Monroe, ich wusste aber auch von den Gesprächen zwischen Roger Caillois und Georges Bernanos an der Bar dieses Hotels, wenngleich man ihre Gesichter vielleicht für zu hässlich befunden hatte, um sie unter den Schauspielerinnen zu zeigen, und für nicht berühmt genug, um die Gäste dieser Art von Hotel anzulocken.
Ich saß auf der Terrasse über der Bucht, verbrachte die Tage über Geschichtsbüchern und Chroniken, Jean de Lérys Brasilianisches Tagebuch 1557, und die Abende mit dem Betrachten des kleinen, roten Schiffs mit der weißen Gangway am Bug, das jeden Abend pünktlich vor Sonnenuntergang vorbeifuhr. Ich las von den Streitigkeiten, die schnell zu jenem Krieg geführt hatten, der entscheiden sollte, ob der Januar-Fluss eines Tages französisch oder portugiesisch sein würde, erfuhr von der Ankunft des bretonischen Vizeadmirals Villegagnon, eines Soldaten und Renaissancegelehrten, mit dem Auftrag, hier eine Kolonie und vielleicht ein Königreich zu gründen, und der auf einer Insel in der Mitte der Bucht von Guanabara Fort Coligny errichtet hat. Der Vizeadmiral hatte die protestantischen Genfer um Unterstützung gebeten, und dieses Experiment wurde zum Prolog für die Religionskriege. Wegen theologischer Spitzfindigkeiten löschte sich die Kolonie selbst aus, und jede Seite tötete nebenbei ein paar Indianer.
Zuvor hatten jedoch normannische Kaufleute drei dieser Indianer nach Frankreich verschifft. Montaigne war ihnen mit König Karl IX. 1562 in Rouen begegnet, nachdem der Herzog von Guise die Stadt gerade von den Protestanten zurückerobert hatte. »Der König sprach lange mit ihnen. Man zeigte ihnen unsere Lebensweise, unsre Prachtentfaltung und das Erscheinungsbild dieser schönen Stadt.« Auf die Frage, was sie am meisten überraschte, antworteten die Indianer, sie verstünden nicht, warum »so viele große Männer, bärtig, stark und bewaffnet«, einem Kind gehorchten. König Karl IX. war zwölf Jahre alt. Sie wunderten sich auch darüber, dass die ausgehungerten Bettler vor den Toren der Stadt »eine derartige Ungerechtigkeit geduldig hinnähmen, statt die Reichen an der Gurgel zu packen und ihre Häuser in Brand zu stecken«.
In der Folge hatte Montaigne lange Zeit einen Mann bei sich, »der zehn, zwölf Jahre in jener anderen Welt verbracht hatte, die zu unsrer Zeit entdeckt worden ist, und zwar dort, wo Villegagnon, der ihr den Namen Antarktisches Frankreich gab, an Land ging«. Die Berichte dieses Mannes aus dem noch nicht existierenden Brasilien bildeten die Grundlage für sein humanistisches Denken. Er ergänzte sie durch seine Lektüre der Historia general de las Indias (»Allgemeine Geschichte Westindiens«) von Francisco López de Gómara, um die besten und für seine Zeitgenossen besonders schockierenden Beispiele für die Vielfalt der Bräuche zu versammeln. Er beschrieb Landstriche, »wo die Frauen mit ihren Gatten in den Krieg ziehen und nicht nur im Kampf ihren Mann stehen, sondern auch im Kommandieren, wo an Nase und Lippen, Wangen und Zehen Ringe getragen werden, ja sogar durch Brüste und Gesäßbacken gezogene schwere Goldstangen, wo man sich beim Essen die Finger an den Schenkeln, am Hodensack oder an den Fußsohlen abwischt«.
Er weiß, wie er seinen Leser erschüttert, und lobt diese Länder, »wo man sich grüßt, indem man den Finger auf die Erde legt und ihn dann gegen den Himmel hebt, wo die Männer die Lasten auf dem Kopf tragen und die Frauen sie schultern, und dortzulande pissen diese im Stehen, die Männer aber hingehockt«. Er bringt Beispiele aus Herodot, beschreibt dieses absolute Anderswo, führt den Kulturrelativismus und die Universalität des Menschen an: »(…) und noch mal anderswo sind diese [die Frauen], ohne dass es sündhaft wäre, Gemeinbesitz, ja in einem Land tragen sie gar als Ehrenzeichen so viel schön gefranste Quasten am Saum ihrer Röcke, wie sie Männern beigewohnt haben.« Damit will er sich für Toleranz und Respekt einsetzen und für seine Überzeugung, dass jeder Mensch über die Besonderheiten seines Volks hinaus einzigartig und bewundernswert ist, dass das, was hier selbstverständlich ist, anderswo seltsam erscheint und diese Indianer, sosehr sie sich von uns unterscheiden, »uns an natürlicher Geistesschärfe und folgerichtigem Denken in nichts nachstehen«.
Unter all den seltsamen Gebräuchen, die Montaigne in den Essais aufzählt, gibt es jedoch einen, bei dem undenkbar scheint, dass ein guter französischer Sohn sich ihm anschließen könnte: »Dort ist es fromme Kindespflicht, den eignen Vater umzubringen, wenn er ein bestimmtes Alter erreicht hat.«
Vater & Tochter
Unweit des Glória Hotels mündet die Avenida Princesa Isabel im rechten Winkel in die Avenida Atlântica, die am Strand von Copacabana entlangführt. An dieser Kreuzung steht die Statue der Infantin mit einer Schreibfeder in der Hand. Mit dieser Bronzefeder hat sie gerade das Gesetz zur Abschaffung der Sklaverei unterschrieben. Mit großer Verspätung. Im Mai 1888. Die Prinzessin ist Regentin. Ihrem Vater, Kaiser Dom Pedro II., war es, trotz seiner Drohung abzudanken, bisher nicht gelungen, die Regierung zu dieser Abschaffung zu bewegen. Er ist in Europa und krank. Der alte Mann mit der enzyklopädischen Neugier, der zeitlebens mit den Künstlern und Gelehrten korrespondierte, deren Bücher und Werke er studierte, mit Louis Pasteur und Charles Darwin, Friedrich Nietzsche und Richard Wagner, liegt in Mailand im Sterben. Die Bekanntgabe des Erfolgs seiner Tochter bringt ihn noch einmal auf die Beine. Für kurze Zeit kehrt er nach Brasilien zurück.
In seinem Amazonas-Roman Die Jangada sang Jules Verne ein Loblied auf Brasilien und dieses »tatenlustige kleine Volk (…). Jetzt bildet es weitaus den größten Staat des südlichen Amerika, mit dem intelligenten und Kunst liebenden Kaiser Dom Pedro als Oberhaupt.« Zweifellos hat Pedro wie jeder gebildete Brasilianer die Außergewöhnlichen Reisen gelesen und war empfänglich für das Kompliment. Doch seine Verehrung galt vor allem Victor Hugo. Als der Dichter Anfang 1872 nach der Pariser Commune aus dem Exil zurückgekehrt war, in das ihn ein anderer Kaiser aus Hass verbannt hatte, und er sich wieder ins politische Leben stürzte, kam keine Begegnung zustande, obwohl Pedro II. Théophile Gautier anvertraut hatte: »Meine Reise nach Europa wird mir wie ein Fehlschlag vorkommen, wenn ich nicht Victor Hugo treffe.« Fünf Jahre später schreibt dieser in sein Tagebuch: »Neun Uhr morgens. Besuch des Kaisers von Brasilien. Lange Gespräche. Sehr edler Geist. Er sah auf einem Tisch Die Kunst, Großvater zu sein liegen. Ich schenkte ihm den Band und griff zur Feder: Was wollen Sie schreiben?, fragte er. Zwei Namen, Ihren und meinen, antwortete ich. Darauf er: Weiter nichts. Darum wollte ich Sie gerade bitten. Ich schrieb: Für Dom Pedro de Alcantara. VICTOR HUGO. Und das Datum?, fragte er. Also fügte ich hinzu: 22. Mai 1877.«
Am selben Tag notiert Hugo einige Zeilen weiter unten: »Um zwei Uhr ging ich zur Sitzung der extremen Linken im Senat.« Und eine Woche später, am 29. Mai, nachdem er den Tag wieder mit den Senatoren der extremen Linken verbracht hatte: »Bei meiner Rückkehr erwartete mich der Kaiser von Brasilien, der zum Abendessen zu mir gekommen war.«
Nach Abschaffung der Sklaverei durch seine Tochter war der Kaiser von Großgrundbesitzern und Kaffeebaronen gestürzt worden, die einen Staatsstreich angezettelt hatten. Peter II. dankte ab, schleppte seine Saudade durch Europa und starb in Paris. Wie sechs Jahre zuvor Victor Hugo wurde auch der brasilianische Kaiser vom französischen Präsidenten Sadi Carnot mit einem Staatsbegräbnis geehrt. Angesichts der Bewunderung, die der alte Kaiser und der Dichter, ein Anhänger der extremen Linken und Freund Garibaldis, füreinander hatten, dachte ich an George Bernanos, der einige Jahrzehnte später in Brasilien sagte, er sei ein »von Proudhon inspirierter Sozialist mit einem Hang zur Monarchie«.
An Bord
Ganz gleich auf welcher Art von Boot, Schiff oder Barkasse, Einbaum oder Sampan, ich hatte schon immer das Gefühl, ich lebte besser auf etwas, das schwimmt. Als ich in der Kabine lag, fielen mir all diese Geschichten wieder ein, als stürzten sie in einem Erinnerungsstrom eine Klippe hinab und rieselten durch kleine Rinnen ins Bett des großen Flusses: Zwar hatten sich Schriftsteller aus ganz Brasilien um den Preis beworben, doch als Sébastien Roy in seinem Konsulatsbüro den zweiten Umschlag mit der Adresse des Gewinners öffnete, um ihn zu kontaktieren, entdeckte er, dass dieser Carioca war und hinter dem Glória Hotel wohnte.
Antônio Dutras Manuskript, Dias de Faulkner (»Faulkners Tage«), erzählte vom Aufenthalt des Romanciers in São Paulo im Jahr 1954. Dreißig Jahre nach Blaise war es nun Bill. William Faulkner war im besten Hotel, dem Esplanada, abgestiegen. Krank und oft betrunken, hatte er zur Verzweiflung der amerikanischen Diplomaten, die hofften, sie könnten ihr Image mit ihm aufpolieren, fast jeden Termin abgelehnt. Es waren die Jahre des Kalten Krieges, und die CIA hatte unter dem Vorwand einer kommunistischen Bedrohung auf Wunsch der United Fruit Company und der Großgrundbesitzer wenige Wochen zuvor, Ende Juni, den Strohmann Carlos Armas vorgeschickt und den guatemaltekischen Präsidenten Jacobo Arbenz gestürzt, um dessen Agrarreform zu beenden.
Als der elegante kleine Mann am Sonntag, dem 8. August 1954, um 18 Uhr 30 die Leiter der viermotorigen DC-6 von Braniff Airways hinabsteigt, ist das Image der Vereinigten Staaten in ganz Lateinamerika am Tiefpunkt. William Faulkner kommt aus Lima nach einem Zwischenstopp in Rio an. In diesem Moment wird ein Foto gemacht. Seine rechte Hand ruht auf dem Handlauf der Gangway, über dem linken Arm hängt ein Regenmantel, und in der Hand hält er ein etwas lächerlich wirkendes Köfferchen, das aussieht wie ein Schuhkarton mit Griff oder ein Kosmetikkoffer, vielleicht sind ein paar Flaschen Jack Daniel’s auf Vorrat drin.
Faulkner geht ein paar Schritte auf dem Rollfeld des kleinen Flughafens von Congonhas, setzt sich auf den Rücksitz des 54er Cadillacs neben den Konsul, der ihm eine Straßenkarte reicht. Er sagt, er wolle nichts unternehmen, er fühle sich nicht wohl. Seit fünf Jahren ist er Nobelpreisträger. Täglich. Von morgens bis abends. Er ist es leid, die Stockholmer Zeremonie in immer erbärmlicheren Szenarien nachzustellen. In ein paar Monaten wird Hemingway mit dem Nobelpreis ausgezeichnet. Dann lässt man Faulkner in Frieden. Die Diplomaten werden es bedauern. Denn Hemingway wird weder öfter nüchtern noch manipulierbarer sein. Während Faulkners Aufenthalt in Brasilien füllt der skandalöse Anschlag auf den Journalisten Carlos Lacerda in Copacabana die Zeitungen. Die Untersuchungen reichen immer höher hinauf bis zum Präsidenten. Getúlio Vargas wird zum Rücktritt aufgefordert.
Zusammen mit Antônio war ich, nachdem sich seit einigen Tagen eine Komplizenschaft, vielleicht sogar so etwas wie Freundschaft zwischen uns zu entwickeln begann, nach São Paulo gereist, um das Erscheinen seines Buchs vorzubereiten und die Rechte an diesem Foto von Faulkner zu erwerben, das ursprünglich in der Lokalpresse erschienen war und das wir aufs Buchcover bringen wollten. Abends sprachen wir immer wieder über die Zufälle, aus denen unser Leben gestrickt ist: Während er anlässlich dieser Buchveröffentlichung seine Reise nach Saint-Nazaire vorbereitete, erzählte er mir, er habe als Student über das Werk des brasilianischen Schriftstellers Harry Laus gearbeitet, der in Saint-Nazaire die Erzählung La Première Balle (»Die erste Kugel«) geschrieben hatte. In seinem Buch greift Antônio auf, was Faulkner in der Empfangshalle des Esplanada vor jungen Schriftstellern gesagt haben soll, als er sich für einmal bereit erklärte, sein Zimmer zu verlassen: »Künstler sind durch eine Art Kette in Zeit und Raum miteinander verbunden, kaum beginnt eine Generation zu altern, da erscheint schon die nächste, um die Arbeit der vorherigen fortzusetzen und das zu perfektionieren und zu verwirklichen, was die vorherige Generation manchmal nicht oder – auch das kommt vor – nicht gut gemacht hat.«
Wenige Tage nach Faulkners Abreise im August 1954 schoss sich Präsident Getúlio Vargas eine Kugel ins Herz. Der durchlöcherte Pyjama ist im Museu da República ausgestellt. Als wir zur Preisverleihung im Maison de France in Rio zurück waren, ging ich mit Antônio eines Nachmittags in den Botanischen Garten, wo alle Düfte des Landes versammelt sind. Unterwegs kamen wir durch die Rua Tonelero, in der das Attentat auf den Journalisten stattgefunden hatte. Dann sah ich uns wieder in Lagoa oder in den kleinen Restaurants von Botafogo. Ich hörte den Regen gegen die Kabinenwand trommeln. Zehn Jahre älter geworden, lag ich in meiner Koje an Bord der Jangada, streckte die Hand aus und griff zu Montaigne.
Wenngleich Montaigne im Alter noch immer das erste Buch lobt, das er als Kind allein gelesen hatte, die Metamorphosen des Ovid, sind doch Seneca und Plutarch seine beiden Hauptautoren. Bei ihnen bedient er sich, pflückt mal hier, mal da etwas heraus, erbeutet »ein wenig von jedem, vom Ganzen nichts, eben à la française«. Und wenn ihm die Sätze gefallen, macht er Anleihen bei ihnen: »Wahrheit und Vernunft sind Gemeinbesitz aller Menschen, und sie gehören dem, der ihnen zuerst das Wort geredet hat, nicht mehr als dem, der es nach ihm tut.« Aus alldem schöpft er: »Die Bienen holen sich von hier- und dorther aus den Blumen ihre Beute, aber daraus machen sie Honig, und der gehört ihnen voll und ganz.«
Dieses große, verzettelte Werk der Essais hatte das humanistische Denken in Europa verankert, aber jetzt kam es mir so vor, als erlebten wir dessen Verschwinden, das Ende des egalitären Traums angesichts der demografischen Explosion, der Verknappung der Ressourcen, der Erscheinung einer erweiterten Menschheit, die zuließ, dass Milliarden von Untermenschen sich für ein wenig Nahrung und Trinkwasser inmitten von Müllhalden gegenseitig umbrachten. Im Gegensatz zu meinem Vater, seinem Vater und dem Vater seines Vaters war mein Leben nicht von den Kriegen in Europa erschüttert worden, und ich hoffte immer, dass Pierre einmal denselben Satz schreiben könnte. Mein Optimismus schwankte.
Ab und zu legte er sein Buch beiseite oder schloss sein Notizbuch, holte Radiergummis und Stifte heraus und begann wieder zu zeichnen. Landschaften oder Insekten, Frachtschiffe. Eines Morgens hatte er mich mit Montaigne an einem menschenleeren, von Fliegen heimgesuchten Strand allein gelassen, um mit einem Deutschen brasilianischer Nationalität, Ex-Mitglied eines Dschungelkommandos, auf einen Hügel zu steigen. Pierre war zum Boot gegangen, dann aber kurz zu mir zurückgekehrt, um mir ein Regencape zu bringen. Die Angst, so zurückgelassen zu werden, hielt mich vom Lesen ab. Manchmal war diese Insel eine Landzunge, aber in dieser Hochwasserperiode war sie vom Ufer abgeschnitten. Ich bildete mir ein, ich könnte die Sandbank wiederfinden und bis zur Brust im Wasser, das voluminöse Exemplar der »Quarto«-Ausgabe wie eine wasserempfindliche Waffe über meinen Kopf haltend, wieder ans Festland gelangen, indem ich mich, Torpedorochen und Candirús fürchtend, mit den Füßen vorwärtstastete. Der Regen war ausgeblieben. Und Pierre zurückgekehrt.
Mit Antônio
Letztes Jahr waren wir von Paraty im Süden mit dem Wagen nach Rio zurückgefahren. Pierre und Antônio hatten sich zehn Jahre zuvor in Saint-Nazaire kennengelernt und seitdem nicht mehr gesehen. Wir stiegen hinauf nach Santa Teresa, gingen unter den von Krallenaffen belagerten Strommasten die Schienen der gelben Straßenbahn entlang zum Parque das Ruínas (»Ruinenpark«), stellten uns das Domizil zu einer Zeit vor, als es noch alles hatte, was es brauchte, Türen und Fenster, einen Flügel und Glaskunst von Lalique, Abendkleider, Frack und Fliege, Anatole France und Isadora Duncan, Heitor Villa-Lobos und Blaise Cendrars. Von der Terrasse sahen wir auf Rio hinab und auf das Glória Hotel, das seine Türen endgültig geschlossen hatte und ebenfalls zu verfallen drohte oder auf seine sehr ungewisse Restaurierung wartete.
Eines von Pierres Talenten war die Fotografie, auf die er sich hier besonders verlegte; er wanderte mit seiner Kamera durch die Straßen, besuchte zusammen mit Samuel Titan die Abteilung für Fotografiegeschichte des Instituto Moreira Salles, die Ausstellungen der Fotografen José Medeiros, Thomaz Farkas, Hans Günter Flieg und vor allem die von Marcel Gautherot. Manchmal habe ich mich ihnen angeschlossen. Während es für Pierre Expeditionen in die Kunst waren, waren sie für mich auch zeitgeschichtlich interessant, durch sie sah ich die Städte des Goldrausches von Minas Gerais, die Stadt Ouro Preto, den Rio das Velhas, Orte, die von den Bandeirantes ausgeplündert worden waren, Sammelbecken für Gesindel und Abenteurer, die auf der Jagd nach Sklaven zu Pferd durchs Land streiften und Fahnen schwangen, die in Kirchen gesegnet wurden, die flammenden Raffinerien glichen, an denen Gold und Frömmigkeit, Tränen und Exvotos herabrieselten, Kirchen, die man errichtet hatte, um Gnade von Senhor Bom Jesus und Vergebung für sein sündhaftes Leben zu erflehen, wofür man auch an der Kathedrale von Congonhas do Campo die großen Specksteinstatuen Antônio Francisco Lisboas aufgestellt hatte, des missgestalteten Sohnes eines portugiesischen Zimmermanns und seiner schwarzen Sklavin, genannt o Aleijadinho, das Krüppelchen, der Lahme, das Hinkebein, ein Schwerbehinderter, der sich Hammer und Meißel mit Lederriemen an seine Armstümpfe binden ließ, um arbeiten zu können, der Aleijadinho, der heute sicher nicht mehr geboren würde, weil das Genie durch Magnetresonanz nicht aufzuspüren ist: Man würde es nicht einmal wagen, den Eltern die Ultraschallbilder zu zeigen, bevor man das kleine Monster in den Mülleimer würfe.