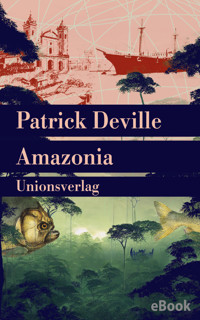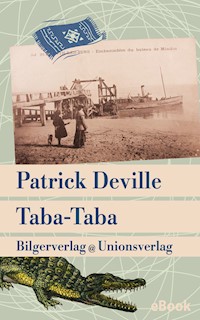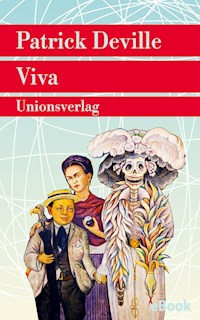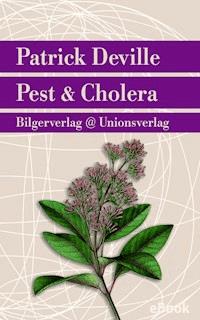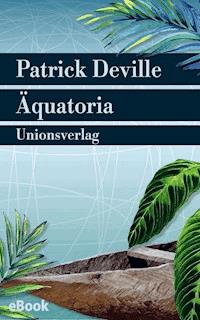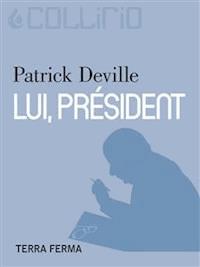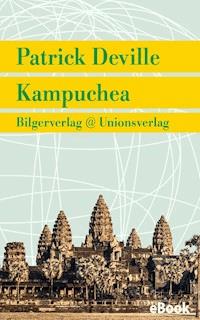
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der französische Forscher Henri Mouhot stößt sich bei einer Schmetterlingsjagd den Kopf, blickt auf und steht erstaunt vor den vergessenen Tempelanlagen von Angkor Wat. Rund hundertfünfzig Jahre später tobt in Thailand die Revolution der Rothemden, und in Kambodscha wird »Duch«, dem Leiter des Foltergefängnisses der Roten Khmer, der Prozess gemacht. Auf einer packenden Spurensuche durch das letzte Jahrhundert entfaltet sich zwischen Königen und Bauern, Generälen und Kommunisten das Drama der kambodschanischen Geschichte. Kampuchea wurde vom Magazin Lire zum besten französischen Roman 2011 gewählt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 324
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Über dieses Buch
Auf einer Schmetterlingsjagd steht Henri Mouhot plötzlich vor den vergessenen Ruinen von Angkor Wat. Hundertfünfzig Jahre später wird dem Leiter des Foltergefängnisses der Roten Khmer der Prozess gemacht. Zwischen Königen und Bauern, Generälen und Kommunisten entfaltet sich das Drama der kambodschanischen Geschichte.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Patrick Deville (*1957) studierte Literatur und Philosophie. Er lebte im Nahen Osten, in Afrika und bereiste Lateinamerika. Seine Werke wurden mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, unter anderem als »bester Roman des Jahres« der Zeitschrift Lire, mit dem Fnac-Preis und dem Prix Femina.
Zur Webseite von Patrick Deville.
Holger Fock (*1958) studierte Theaterwissenschaft, Germanistik und Philosophie. Er übersetzt seit 1983 französische Literatur, u. a. Gegenwartsautoren wie Andreï Makine, Cécile Wajsbrot (beide zusammen mit Sabine Müller), Pierre Michon und Antoine Volodine. Er lebt bei Heidelberg.
Zur Webseite von Holger Fock.
Sabine Müller (*1959) studierte Germanistik, Philosophie und Pädagogik. Sie übersetzt aus dem Französischen und Englischen, u. a. Werke von Andreï Makine, Cecile Wajsbrot, (beide zusammen mit Holger Fock), Erik Orsenna, Philippe Grimbert, Annie Leclerc und Alain Mabanckou.
Zur Webseite von Sabine Müller.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Patrick Deville
Kampuchea
Roman
Aus dem Französischen von Holger Fock und Sabine Müller
E-Book-Ausgabe
Bilgerverlag @ Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Dieses E-Book des Bilgerverlags erscheint in Zusammenarbeit mit dem Unionsverlag.
Die Originalausgabe erschien 2011 bei Éditions du Seuil, Paris.
Die deutsche Erstausgabe erschien 2015 im Bilgerverlag, Zürich.
Die Übersetzung durch Holger Fock und Sabine Müller wurde vom CNL (Centre National du Livre) unterstützt.
Originaltitel: Kampuchéa
© by bilgerverlag GmbH, Zürich 2015
© der Originalausgabe by Éditions du Seuil, Paris 2011
© by Bilgerverlag, Zürich 2024
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Lakhesis (Dreamstime)
Umschlaggestaltung: Sven Schrape
ISBN 978-3-293-30991-3
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 23.06.2024, 20:52h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
KAMPUCHEA
Beim FliegerSein Kommando kann man sich nicht aussuchenEin Revolutionsvorhaben in BangkokEin Wolf und MathematikerOstern in Phnom PenhDer ruhmreiche 17. AprilMit Mister LiemKeine war so reinMit SunthariDer große Sprung nach vorn in der MoralDie jungen FreundeDer König der KommunistenOpium essen & Hund rauchenEin SchmetterlingsjägerDer Tod von Pol PotDas literarische Werk Pol PotsDas Reich des BösenAllein und auf dem WasserErnest & FrancisIm MonsunEin kleiner TodZum Chinesischen MeerEin ganz stiller KambodschanerDer Maler & der FotografRichtung Mekong-DeltaEin Gespenst in My ThoPierre & GeorgeIn Can ThoMit dem KommissarBei PonchaudUnter dem WaldIn VientianeMit SinghMouhots TodPierre & AugusteDie Erfindung von LaosJenseits des Goldenen DreiecksDie Nacht ohne NaliAn der GrenzeDas große LagerDie triumphale Ankunft der GrandièreIn UdomxayDer Elefanten-FriedhofIm TalkesselIn der Bar des Métropole-HotelsFrancis & JeanSihanouk diniert bei Ho Chi MinhDer Sturz der Roten KhmerDas UrteilIns Delta des Roten FlussesReglosDie alten FeindeDas Verschwinden des KommissarsEin Revolutionsvorhaben in BangkokDanksagungBibliografischer HinweisMehr über dieses Buch
Über Patrick Deville
Über Holger Fock
Über Sabine Müller
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Bücher von Patrick Deville
Zum Thema Kambodscha
Zum Thema Frankreich
Zum Thema Kolonialismus
Zum Thema Asien
Zum Thema Geschichte
»Hirnkunden«, wiederholte Perken. »Sie haben recht. Es gibt nur eine einzige ›sexuelle Perversion‹ (wie die Dummköpfe sagen): die Ausschweifung der Einbildungskraft, die Unfähigkeit, sich je zu sättigen. Drüben in Bangkok habe ich einen Mann gekannt, der sich nackt von einer Frau in einer dunklen Kammer eine Stunde lang festbinden ließ.«
ANDRÉ MALRAUX
Beim Flieger
Mein Gepäck habe ich abseits des Dorfs im Pfahlbau-Bungalow des Wikingers abgestellt. Halbzahme Affen fressen auf der Wiese die Früchte, die er ihnen zugeworfen hat. Auf einem Tisch liegt eine Ausgabe der Bangkok Post vom Vortag. Der Wikinger sitzt an seinem Schreibtisch und hustet vor einem Computer. Er trägt einen blumigen Pareo, der gewaltige Oberkörper ist nackt und faltig, die erschlafften Muskeln sind sonnenverbrannt, das Haar ist lang und ausgebleicht, irgendwie sieht er aus wie ein alter Hippie. Nach längerem Zögern hat er schließlich Listen mit Orten, Namen, Telefonnummern für mich zusammengestellt. Auf seinem Hausaltar eine lange Pfeife aus Elfenbein. Einen solchen Körper hätte der Abenteurer Perken gehabt, hätte Malraux ihn länger leben lassen. Hätte er ihn wie Mayrena zum König der Sedang gemacht.
Von der Terrasse aus sieht man am Horizont die schwarzen Regensäulen über den Bergen von Burma. Den Drei-Pagoden-Pass, ganz am Ende der Eisenbahnlinie, die die Japaner gebaut haben, um das Indien der Engländer anzugreifen. Alte Bilder, ein Toter pro Schwelle, sagt der Flieger. Die schwammige Masse des smaragdgrünen Dschungels schluckt schwarze Lokomotiven, auf Grund gelaufene Kähne, gespenstische Bretterbuden, deren aufgerissene Wände im Wind der Taifune schlagen. Die Kulis, die in den Sümpfen der Siam-Kambodscha-Eisenbahnlinie am Fieber gestorben sind. Die Deportation des Neuen Volks im Demokratischen Kambodscha der Roten Khmer. Die erschöpften Sklaven, die entlang der Strecke von Pursat gefallen sind. Doch an den großen Mauern von Angkor, in denen die Schlachten, die beflaggten Elefanten und die Züge der Besiegten in den Stein gehauen sind, fehlen die Flugzeuge, die Panzerfahrzeuge, die Schienen und die schwarzen Lokomotiven. Vom Ausgang des Bahnhofs war ich zum Fluss hinuntergegangen. Dort flatterten gelbe Schmetterlinge über dem Wasser. Löschten Büffel ihren Durst. Entflammten Bougainvilleas ihr Feuer. Zitterten Libellen. Auch wenn dieses Gebiet zu Indochina gehört, hier sind noch immer die Geschichten aus Indien und die von Kipling lebendig. Mit jedem Kilometer hämmerten die Verse, die er der Königin gewidmet hatte, lauter unter den Drehgestellen. Beneath whose awful hand we hold dominion over palm and pine … Als hätte Gott ihnen die Palmen und die Kiefern anvertraut.
In Bangkok rollen die Rothemden brennende Busse vor die Panzerfahrzeuge. Sie haben sich in ihrem Lager am Victory Monument verschanzt, das einst gegen den französischen Feind errichtet worden war. Kurz zuvor ist der Wagen des Premierministers mit Schnellfeuerwaffen angegriffen, dann der Notstand ausgerufen worden. Auch hier im Dorf brüllen Aufständische, vom Regen gepeitscht, ihre Slogans auf der Ladefläche ihrer Pick-ups in die Megaphone, schwingen Fahnen und zünden Rauchbomben. Der alte Flieger zuckt die Achseln. Er glaubt keine Sekunde an ihren Sieg. Am Abend machen wir es uns in Bambussesseln vor einer Karaffe Reisschnaps bequem. Obwohl er mir seine Gastfreundschaft eher schweren Herzens, hustend und fluchend, angeboten hat, wirft er mir immer wieder vor, nicht früher gekommen zu sein. Jetzt sei es zu spät.
Er hätte mich lieber getroffen, als er noch im Blindflug Propellerflugzeuge steuerte. Er füllt die Gläser und räuspert sich. In der Dunkelheit zanken sich die Affen. Seit er bemerkt hat, dass mich die alten Fliegerlegenden interessieren, ist er mit jedem Abend ein wenig zugänglicher geworden. Sichtflug im Monsunregen bei zwei Metern Sichtweite und ohne Anhaltspunkte von der Funksteuerung. Die Augen auf Kursnadel, Geschwindigkeitsanzeiger und die Uhr am Handgelenk geheftet, um den richtigen Moment zu erwischen, nach Augenmaß abzutauchen und die Wolkendecke unter sich zu durchstoßen, wenn die zerzausten Wipfel der Zuckerpalmen und das Schachbrett der Reisfelder auftauchen und man nach den üblichen Anhaltspunkten sucht, nach einer Brücke, einem See, wenn man sich über den Flügel neigt, bis man das Rollfeld gefunden hat und darauf zuhalten kann. Die ältesten, die er kannte, waren alte Füchse aus Afrika, aber auch Ehemalige der Expeditionscorps, die, unfähig nach Europa zurückzukehren, bei ihren einheimischen Mädels und Bälgern geblieben waren.
Bis zum Sieg der Roten Khmer 1975 teilten sich etwa zwanzig Kompanien mit jeweils einer oder zwei Kisten den Himmel über Kambodscha. Unter der Hand gehörten sie Lon Nols Generälen, die sich darüber freuten, dass die Guerilla die Straßenverbindungen unterbrach. Das Kerosin zweigten sie von den Amerikanern ab, um die belagerte Hauptstadt mit Durianfrüchten und Schweinen zu versorgen; die Flieger hatten die Bruderschaft der Pigs Pilots gegründet. Der Wikinger landete in Vientiane, wo man ihm eine Beechcraft-18 anvertraute, damit er eine Piste im Norden von Laos irgendwo im Goldenen Dreieck anflog. Dort nahm er eine Ladung für die Chinesen an Bord, die er im weiteren Verlauf des Tages über dem Meer vor der Küste Hongkongs abwarf. Vientiane bedeutete Gold, Opium, Geheimdienst. Auf der einen Seite der marxistisch-leninistische Pathet Lao, auf der anderen Vang Pao und die Green Berets. Die Mächtigen ins Pokerspiel vertieft. Dann lieferten die Amerikaner die ersten DC3, sagt er achselzuckend. Alle Pisten wurden danach eingestuft, ob eine Dakota landen konnte oder nicht. Er hält inne, wartet ab, bis sich sein Hustenanfall legt, füllt sein Glas.
Der Generator ist ausgefallen. Wir unterhalten uns im Dunklen, ab und zu beleuchtet ein aufflammendes Feuerzeug oder die rote Zigarettenglut unsere Gesichter. Durch Laos zog sich der unsichtbare Ho-Chi-Minh-Pfad, den die B-52-Bomber auf gut Glück bombardierten. Die Schweine-Lieferanten, die in Wat Tai starteten, rauchten im Cockpit zur Entspannung dicke Marihuana-Joints. Jede über den Dörfern abgeworfene Bombe, sagt der Flieger, jede dieser Agent-Orange-Entlaubungsmittel-Wolken führte den Guerillagruppen des Pathet Lao und der Roten Khmer neue Truppen zu. Schau dir mal die Krater an. In der Ebene der Tonkrüge. Fast wie auf dem Mond. Große, nie wieder aufgefüllte Trichter, keine Pflanzen mehr, nichts mehr, die Hälfte der Bomben steckt noch im Dreck, kann jederzeit hochgehen. Schau dir mal die Krater an. Er leert sein Glas, steht unvermittelt auf, verschwindet dann unter seinem Moskitonetz, wo er weiterhustet.
Ich schreibe im Schein der Taschenlampe die Namen der Flugzeuge auf, gieße mir noch ein Glas ein, lese wieder in der Ausgabe der Bangkok Post vom 4. April 2009, The Newspaper you can trust, die seit mehreren Tagen auf dem Tisch liegt. Zigarette im Mund und barfuß auf den Fußhebeln überfliege ich am Steuer meiner Zweimotorigen, eine Flasche zwischen den Schenkeln, die Tagesmeldungen. Unter dem Rumpf zieht der Planet vorbei, und ich versuche dem Fortschritt der Vernunft in der Weltgeschichte und unter meinem Fahrgestell auf die Spur zu kommen. Kurz zuvor haben sich die thailändische und die kambodschanische Armee beim Preah Vihear Tempel gegenseitig beschossen, auf beiden Seiten der Grenze, deren Verlauf seit dem französisch-thailändischen Krieg in den vierziger Jahren strittig ist, forderte der Schusswechsel mehrere Opfer unter den Soldaten.
Unter dem Titel Khmer Rouge leader seeks freedom to go gardening fordert Khieu Samphan, der bald achtzigjährige ehemalige Staatschef des Demokratischen Kampuchea, über seinen französischen Anwalt Jacques Vergès seine Freilassung, um sich der Gartenarbeit widmen zu können. Der Schatten meiner Flügel gleitet über den Pazifischen Ozean. In Ciudad Juárez, im Norden Mexikos, wird der Boss des Drogenkartells Vicente Leyva beim Joggen geschnappt. In Lima wird der Prozess gegen den ehemaligen Staatspräsidenten Fujimori fortgesetzt. Der Schatten meiner Flügel gleitet über den Atlantik. Im tansanischen Arusha geht der Prozess um den ruandischen Völkermord weiter. In Den Haag setzt man den Prozess gegen die kroatischen Generäle Gotovina und Markac fort. Überflug beendet, ich kehre zum Stützpunkt zurück.
Man könnte aufhören, Zeitung zu lesen.
Sein Kommando kann man sich nicht aussuchen
Dieser Satz war bei Tagesanbruch in einer Kaschemme nicht weit entfernt vom Busbahnhof gefallen, ausgesprochen von einem der Matrosen, die hinter ihren Bieren saßen, englische oder australische Seeleute auf Landgang. Auch wenn er die Gepflogenheiten bei der Marine geißelte, für sich genommen nahm er eine universelle Bedeutung an. Weder das Jahrhundert noch den Ort. Matrosen werden aufs Geratewohl auf die Ozeane in die maritimen Gemetzel geworfen. Die hohen Geysire der Fehlschüsse vor dem Horizont und die Treffer, die die Blechrümpfe durchschlagen. Die schwarzen Rauchspiralen der Maschinen, die am blauen Himmel explodieren. Wir schreiben das Jahr 1941. Thailand greift Indochina an. Laos und Kambodscha werden überfallen. In Saigon laufen Avisos und Kreuzer aus, bilden auf See vor der Gefängnisinsel Poulo Condor einen Konvoi, nehmen Kurs auf Bangkok, durchqueren unter Funkstille den Golf, überraschen die Schiffe auf der Reede von Ko Chang. Die thailändische Flotte wird versenkt.
Zur Vergeltung bombardiert die siamesische Luftwaffe die Städte Vientiane und Battambang sowie den französischen Flughafen von Angkor, zerstört am Boden einige Renault FT-17-Panzer und die wenigen klapprigen Morane-Saulnier-Jagdflugzeuge. Zur Feier des Sieges über den französischen Feind lässt man einen Obelisken im Stil Mussolinis errichten, um den heute die Rothemden kampieren. Und von Ko Chang, dem einzigen Sieg der französischen Flotte im Laufe zweier Weltkriege, der zudem ein Sieg des Vichy-Regimes war, auch wenn sich die Matrosen in Toulon oder Saigon ihr Kommando nicht ausgesucht hatten, bleibt nichts als eine unauffällige Plakette im Hafen von Brest und ein Denkmal auf der Insel Ko Chang.
Einige der Flugzeuge, die diesen alten Krieg überlebt hatten, wurden später, bis zum moderneren Krieg der Amerikaner, notdürftig ausgebessert und von Piloten wie dem Wikinger geflogen.
Im Bus, der sich von der birmanischen Grenze entfernt, erwähnt eine englischsprachige Radiosendung, dass Thaksin Shinawatra, der unsichtbare Führer der Rothemden, einen nicaraguanischen Diplomatenpass besitzt, den der Spinner Daniel Ortega ihm geschenkt oder sehr teuer verkauft hat. Die Gelbhemden drohen den Ländern, die im Verdacht stehen, den reichen Flüchtling zu beherbergen. Mal soll er in Lateinamerika oder in Afrika sein, mal im Mittleren Osten oder in Kambodscha.
Nachdem er König des Mobilfunks, Besitzer eines englischen Fußballklubs und eines Fernsehsenders war, ist Thaksin heute nur noch ein Gauner auf der Flucht. Er will sich vor Songkran, dem Neujahrsfest der Tai-Völker, die Macht unter den Nagel reißen. Dann würden seine Anhänger das Lager am Victory Monument räumen, um den Beginn des Büffel-Jahres zu feiern, sich das Gesicht mit Wasser bespritzen und die Buddha-Statuen besprengen. Thaksin will so schnell wie möglich vom Himmel herabsteigen, mit seinem Jet inmitten der jubelnden Volksmenge und seiner siegreichen Truppen landen. Und wieder an sein verstecktes oder beschlagnahmtes Vermögen herankommen.
Der Bus fährt langsam die ehemalige Eisenbahnlinie entlang, deren Schienen die siegreichen Engländer beiderseits der Grenze herausgerissen hatten. Sie hatten Galgen aufgestellt und ein paar Dutzend japanische Offiziere aufgehängt, die sich ihr Kommando nicht ausgesucht hatten. Die Piste führt über steinige Hügel, durch Bambusplantagen, an einer langsamen Prozession von Bonzen in Orange vorbei. Der Himmel zieht zu. Wir sind erst durch zwei oder drei Dörfer gefahren und an ein paar Tagebauminen vorbeigekommen, als wir an einer Straßensperre von Aufständischen angehalten werden. Das Gewitter entlädt sich über dem Wellblechschuppen. Wir, ein Dutzend Gestrandete, sitzen auf Bänken irgendwo auf diesem Planeten, dieser entsicherten Granate in der Hand eines idiotischen und zerstreuten Gottes.
Ein Revolutionsvorhaben in Bangkok
Die Stadt ist ruhig. Bleierne Wolken wälzen sich am Himmel, der bereits safrangelbe Streifen hat. Müde vom Warten auf den Angriff schlafen die Rothemden in ihrem befestigten Lager.
Streunende Hunde. Gaskocher, die an Gasflaschen angeschlossen sind. Gerüste, an denen Fleisch über den Fritteusen im Dampf hängt, und der Lärm revolutionärer Radiosender. Über dem Chao Phraya bricht der Morgen an, die Passagiere der Fähren lehnen im Nebel an der Reling und rauchen. Hier hat Lord Jim eine Zeitlang bei Yucker Brothers, Charterer und Teakholzhändler, gearbeitet. Auf diesem Fluss hat es schon Schlachten, Kanonendonner und Pulvergeruch gegeben. Die Fähren kreuzen die Konvois aus Schuten, die an Schleppern hängen. Händler brechen auf, um ihre Stände vor den Tempeln des liegenden oder des stehenden Buddha aufzubauen. Diese vielen Tonnen reines Gold des Obskurantismus werden wir einschmelzen, Genossen, sobald wir die Macht übernommen haben. Um aus jedem Zahnlosen dieser Welt einen Chrysostomos zu machen. Damit er sich ein Messer zwischen die Zähne klemmen kann.
Am Flughafen habe ich mir die Wochenzeitschrift Cambodge Soir gekauft. Ich warte auf den Flug nach Phnom Penh, wo jetzt der erste Prozess gegen die Roten Khmer, der Prozess gegen Duch, begonnen hat. Wo die Überlebenden dem Bösen hinter einer Panzerglasscheibe in die Augen schauen können. Schon bei der ersten Anhörung, als der Ankläger ihn fragte, ob er zu Beginn eine Erklärung abzugeben wünsche, erhob sich dieser Mann, der angeklagt ist, mehr als zwölftausend Menschen in den Tod befördert zu haben, eine zierliche Silhouette hinter Gerichtsschranken aus lackiertem Holz, graues Haar, hohe Stirn, abstehende Ohren, kleine Augen, die in tiefen Augenhöhlen funkeln. Dieser schmächtige Mann, der die seiner Ansicht nach schwere Aufgabe übernommen hatte, mehr als zwölftausend seiner Landsleute foltern und anschließend ermorden zu lassen, räusperte sich, trank einen Schluck Wasser und rezitierte dann zur Bestürzung der für die Simultanübersetzung ins Khmer und ins Englische zuständigen Übersetzer, die nicht mit Alexandrinern gerechnet hatten, das Ende von Alfred de Vignys Gedicht La Mort du loup:
Gémir, pleurer, prier est également lâche
Fais énergiquement ta longue et lourde tâche
Dans la voie où le sort a voulu t’appeler
Puis, après, comme moi, souffre et meurs sans parler.
Jammern, weinen, bitten ist gleichermaßen feige
Mach deine harte Arbeit bis zur bitteren Neige
Auf dem Weg, den das Schicksal dir wies,
Dann, bis du stirbst, leide wie ich und schweige.
Ein Wolf und Mathematiker
Das Kind ist höchst begabt, doch von zu bescheidener Herkunft. Der zierliche Henker, den wir als Duch kennen, wird 1942, einige Monate nach der Seeschlacht von Ko Chang, geboren. Mitten in der japanischen Offensive und dem Pazifikkrieg. Er ist der Sohn armer Bauern. Die Familie bestellt ein kleines Stück Land, trocknet Fische und verarbeitet sie zu Prahok in einem Dorf am Ufer des Großen Sees, Tonle Sap, nicht weit entfernt von den Ruinen von Angkor und den im Jahr zuvor am Boden zerstörten alten französischen Flugzeugen.
Kurz zuvor hat das Vichy-Regime den jungen König Norodom Sihanouk auf den kambodschanischen Thron gehoben.
Duch hieß damals Kaing Guek Eav. Später nahm er noch andere Identitäten an. Er ist ein etwas schwächliches Kind mit schiefen Zähnen, einem schüchternen Lächeln, das er auch noch auf den Fotos zeigt, die vor dem Sieg gemacht wurden, als er im Dschungel das Gefangenenlager M-13 leitet. Als Kambodscha unabhängig wird, ist er elf Jahre alt. Nach dem Besuch der örtlichen Grundschule in Siem Reap schickt man den brillanten Knaben, außergewöhnlich für einen Bauernsohn, auf das Lycée Sisowath in Phnom Penh. Dort entdeckt er die Mathematik und die romantische Lyrik. Die Hände auf dem Rücken rezitiert er Alfred de Vigny.
Als Lehrer in Kompong Thom ist er bei seinen Schülern und seinen Vorgesetzten so hoch angesehen, dass man ihn an die Pädagogische Hochschule beruft, deren Direktor Son Sen kurz darauf in den Untergrund geht. Und plötzlich entgleist, was bis dahin einer Rede bei der Verleihung akademischer Würden entsprach.
Aus seinen Diskussionen mit Son Sen, seinem Leben in der Hauptstadt, umgeben von Ungerechtigkeit, zieht der junge Mathematiker den Schluss, dass man sich engagieren muss, er wird zum Untergrundkämpfer. Es folgen brutale Verhaftung und Gefängnis. Nach seinem proamerikanischen Staatsstreich verkündet General Lon Nol eine Amnestie. Duch schließt sich dem Untergrund in den Kardamom-Bergen an. Im Folterzentrum von Tuol Sleng in Phnom Penh, dem Gefängnis S-21, das er während der Herrschaft der Roten Khmer leitet, verschwinden zwölftausend Menschen. Nach dem Einmarsch der Vietnamesen taucht der Henker unter.
Zwanzig Jahre später, einen Monat nach der Einnahme von Anlong Veng und der Kapitulation der letzten Kämpfer der Roten Khmer, wird Duch im April 1999 zufällig von einem irischen Journalisten mit gutem Personengedächtnis erkannt. Er arbeitet unter falschem Namen als Pastor in einer Gruppe von Predigern, Freiwilligen im humanitären Dienst an der thailändischen Grenze. Er wird verhört und eingesperrt. In einem Interview mit der Far Eastern Economic Review sagt er, er sei zum Christentum konvertiert und habe unter verschiedenen Namen für mehrere internationale Organisationen gearbeitet, auch für das American Refugee Committee. »Es tut mir leid. Die Menschen, die gestorben sind, waren gute Menschen. Jetzt wird Gott über mein Schicksal entscheiden.«
Lange nach dem Fall der letzten Bastionen, dem Auf und Ab der Ermittlungen und dem Tod von Bruder Nr. 1, Pol Pot, nimmt das Rote-Khmer-Tribunal seine Arbeit auf. Es ist ein großer, isoliert stehender Neubau inmitten eines Militärgeländes, mehrere Kilometer vom Stadtzentrum Phnom Penhs entfernt hinter dem Pochentong Flughafen. Für die Busse mit den Dorfbewohnern, die anreisen, um ängstlich das Gesicht des Folterers zu beobachten, wurde extra ein großer Parkplatz angelegt.
Duch ist der einzige der fünf Angeklagten, der seine Schuld zugibt. Sein Prozess wird von dem gegen die Pariser abgetrennt. Er war nie in Paris. Er erklärt, er habe unter der Führung von Vorn Veth und Ta Mok gearbeitet. Letzterer wird zum Henker des Ersteren, dann verurteilt er Pol Pot wegen des Mordes an Son Sen, dem Chef des Santebal, der Staatssicherheit. Man fühlt sich an die Schreckensherrschaft Robespierres erinnert: Säuberungsaktionen, das endlose Eliminieren von Aufrührern, bei dem jede Gnade, jedes Erbarmen als Gleichgültigkeit gegenüber der Revolution gedeutet wird, die Flucht nach vorn, die Angst, selbst innerhalb der Partei hängt das Leben an einem seidenen Faden. Das ist die Verteidigungslinie von Duch, der die Geschichte kennt.
Er beteuert, sein Versetzungsgesuch sei im April 1975, kurz nach dem Sieg, abgelehnt worden. Er sei nur ein bedrängtes Rädchen im Getriebe gewesen. Er kommt auf das Gedicht über den Wolf zurück. Die Angka habe ihn zu dieser schweren und harten Aufgabe abgestellt, und er habe sie so gut wie möglich erledigt. Im S-21 wurden Verwaltungsberichte verfasst, Informationen wie am Fließband erpresst, den Beschuldigten mit barbarischen handwerklichen Methoden Geständnisse entlockt, bis sie selbst nicht mehr an ihre Unschuld glaubten, Woche für Woche musste man Hunderte von Verrätern produzieren wie anderswo jede Woche Hunderte von Karren oder Kanistern. Verräter waren damals das Einzige, was die entvölkerte Hauptstadt produzierte.
Ostern in Phnom Penh
Das Hotel Le Royal im nördlichen Stadtbezirk, dem Viertel Louk thom oder Grands messieurs, nicht weit vom Calmette Hospital und dem Institut Pasteur, in dem sich Khieu Samphan 1998 zu seiner bescheidenen Zerknirschung – ich bedaure – hinreißen ließ und das an die Nationalbibliothek grenzt, heißt heute Hotel Raffles. Am Ende der Empfangshalle befindet sich die Writers’ Bar, »in der schon alle saßen, die über Kambodscha geschrieben haben«, worauf ein Kupferschild hinweist, eine Tätigkeit, die nur in der unwiderruflichen Vergangenheit erwähnt wird. Havannabraune Ledersessel, helle Kleidung, Klimaanlage. Man erwartet die ersten Regengüsse. Ich erwarte zudem Mister Liem.
Früher sah man von hier aus die Kathedrale, deren Glocken an Ostern den Christen die Wiederauferstehung verkündeten, bevor sie von den Roten Khmer zerstört wurden. Ein durchschnittlich langes Menschenleben ist ein gutes Maß für die Geschichte, das Osterwochenende eine gute Momentaufnahme. Ich sitze an der Bar vor einem Notizbuch und rechne aus, dass ich Ostersonntag 1998, in dem Jahr, als Khieu Samphan in diesem Hotel bereute oder so tat, als würde er bereuen, von Nicaragua nach Uruguay gereist bin, wo ich in Montevideo durch Zufall auf eine Fotografie von Baltasar Brum stieß, auf der er, in jeder Hand eine Smith & Wesson, ein paar Sekunden vor seinem Selbstmord zu sehen ist. Als ob der Selbstmord eines einzigen Mannes einen Staatsstreich aufhalten könnte. Heute gehe ich in Begleitung von Mister Liem zurück zu den durchlöcherten oder zertrümmerten Schädeln, die in einem Vorort von Phnom Penh im Lager von Choeung Ek aufgestapelt sind, das neben Reisfeldern die Massengräber für S-21 birgt. Wir marschieren zwischen den langsam von der Vegetation aufgefüllten Gruben, in denen die Knochen, Zähne und Kleiderfetzen zum Vorschein kommen, die die Erde ausspeit.
Laut der Zeugenaussage von Houy, einem ehemaligen Wachmann, der diese Arbeit übernommen hatte, brachte man die Verurteilten von S-21 mit verbundenen Augen auf Lastwagen hierher. Die tägliche Lieferung an Verrätern. Man sperrte sie in eine Hütte neben einem Generator ein, damit sie nichts hörten, man ließ sie einer nach dem anderen an den Rand einer Grube kauern und brach ihnen mit einer Eisenstange den Nacken: »Dann kam eine andere Gruppe und schnitt ihnen die Kehle durch.«
In der menschenleeren Stadt schützte ein breiter Sicherheitsgürtel, der vom Boulevard Monivong bis zum Olympiastadion reichte, das Lycée Ponhea Yat, in dem Duch und sein S-21 untergebracht waren. Typische französische Schularchitektur. Vier Gebäude zu je drei Stockwerken mit einer Außengalerie um einen Pausenhof. Bis zu tausendfünfhundert Gefangene gleichzeitig. Folterkammern in gefliesten Klassenzimmern, Ketten und gemauerte oder aus Holz errichtete Zellen, eiserne Folterliegen, Eisenstangen und Halteringe; die Stützbalken unter den Decken beginnen zusammenzubrechen. Die letzten Fotos vor dem Tod, der graue Holzstuhl, der Anschlag für den Hinterkopf und die Positionierung. In einem Abstellraum ein vergammeltes, staubbedecktes Vergrößerungsgerät. Verängstigte Blicke, verlorene Gesichter auf den nebeneinander ausgestellten Abzügen. Zwölftausend Schatten. Die wenigen Überlebenden, die beim Prozess aussagen. Vierzehn an der Zahl. Die historische Aussage von Nuon Chea, Bruder Nr. 2, dem Ideologen mit der dunklen Brille, dreißig Jahre nachdem er Duch den Befehl erteilt hat, S-21 vor der Ankunft der vietnamesischen Truppen zu evakuieren, in der Halle des Hotel Le Royal: »Es tut mir sehr leid, nicht nur um das Leben der Bevölkerung, sondern auch um die Tiere, die wegen des Kriegs gestorben sind, es tut mir außerordentlich leid.« Nuon Chea, der für die Ideologie und die Slogans verantwortlich war:
EIN ODER ZWEI MILLIONEN JUNGE LEUTE GENÜGEN, UM DAS NEUE KAMPUCHEA AUFZUBAUEN!
Angka
Der ruhmreiche 17. April
Vor den Kaschemmen verschlingt man Nudelsuppe, die Kinder sind auf dem Weg in die Schule. Entlang den Straßen werden auf Karren Mangos, Zigaretten und frittierte Honigheuschrecken in grünen, zu Tüten gedrehten Blättern verkauft. Es ist schon heiß, fast dreißig Grad, der Himmel ist blau. Die Ruhe ist Fassade. Die besetzte Stadt wird durch eine Luftbrücke mit Lebensmitteln versorgt. Mit jedem Tag kommen das Pfeifen der Raketen und die Einschläge der Granaten näher. Lon Nol und die Amerikaner sind abgezogen, haben die Verteidigung, weil chancenlos, aufgegeben. Der Flughafen Pochentong hat den Betrieb eingestellt. Man wartet auf den Frieden. In den Vorstädten flammen immer wieder Brände auf. Die regulären Truppen ziehen sich zurück. Die Munitionsdepots explodieren. Die Lastwagen der Revolutionäre fahren die Reihen neuer Panzerfahrzeuge ab. Die Menge jubelt, Versöhnung unter den Kambodschanern, auf den Balkons schwingt man weiße Fahnen, kein Bombenhagel mehr auf die Reisfelder. Vereinzelt hört man Schüsse von Soldaten, die sich verschanzt haben und sich bald ergeben werden. Aus dem Äther ertönt Radio Phnom Penh, das bald zur Stimme des Demokratischen Kampuchea wird:
WIR BEFEHLEN ALLEN MINISTERN UNDALLEN GENERÄLEN, SICH UNVERZÜG-LICH ZUM INFORMATIONSMINISTERIUMZU BEGEBEN, UM DAS LAND ZU ORDNEN.HOCH LEBEN DIE SEHR MUTIGEN UND SEHRGROSSARTIGEN VOLKSSTREITKRÄFTE DERKHMER ZUR NATIONALEN BEFREIUNG!HOCH LEBE DIE GROSSARTIGE REVOLUTIONVON KAMPUCHEA!
Angka
Die wenigen Männer guten Willens oder Einfaltspinsel, die dem Aufruf folgen, werden ins Olympiastadion gebracht und hingerichtet. Geräuschlose, geordnete Gruppen ganz in schwarz gekleideter Jugendlicher ziehen durch die Straßen. Schwarze Mao-Mütze, Ho-Chi-Minh-Sandalen aus Reifen, AK-47 und Granaten vor der Brust, verschlossene Gesichter, Fledermäuse, kein Wort, kein Lächeln, sie sind erschöpft, hungrig, eine schwarze Flut, die die Stadt überschwemmt, fremd in der jubelnden Menge, der Musik, dem ganzen Rummel auf den Straßen nach der Ausgangssperre und den Bombardements, in der Angst; man tanzt, zündet Räucherstäbchen an und legt Blumen auf die Altäre, unaufhörlich strömen die Fledermäuse weiter zu Tausenden geräuschlos in die Stadt, besetzen die Kreuzungen, die Kreisverkehre, entfalten Pläne, halten jedes Fahrzeug an und durchsuchen es wortlos, sie räumen die Krankenhäuser, mit blutigen Verbänden werden die Patienten auf Tragbahren hinausgebracht oder hinken auf ihren Krücken, alle werden in Lastwagen verladen. Dann klopfen die schwarzgekleideten Jungen an die Haustüren, an eine nach der anderen. Die Amerikaner würden die Stadt bombardieren. Sofort fliehen, alles stehen und liegen lassen, nichts abschließen, wir wachen darüber. Die Angka wacht. Wer im Norden wohnt, soll die Stadt in Richtung Norden verlassen, wer im Süden wohnt, Richtung Süden, wer im Westen, Richtung Westen, die ganze Menschenmenge mit ihren Kleiderbündeln, Koffern, Fahrrädern, Marktkarren, Rikschas, in einer riesigen Kohorte, mittendrin im Schritttempo die Autos der Reichen, und alle angetrieben von den Gruppen peinlich genauer, methodisch vorgehender, eiskalter Jugendlicher und den weiblichen Kampfeinheiten der Nearis. Zwei Millionen Menschen sind auf den Straßen zu Fuß unterwegs. An Straßensperren werden Uhren und Kugelschreiber eingesammelt, alles Münzgeld in die Straßengräben geworfen, Riel- und Dollarscheine verbrannt. Man erschießt etliche Jungen mit langem Haar und Sonnenbrille, die von der kambodschanischen oder amerikanischen Popmusik, den Bars und Nachtclubs degenerierten »Civilaï« des neuen Volks. Die ersten Leichname blähen sich am Straßenrand. In der Sonne hat es jetzt vierzig Grad. Der April ist der heißeste Monat im Jahr.
Ausländer werden festgenommen und in den Park der französischen Botschaft am Ende des Boulevard Monivong gesperrt. Die Sowjetrussen versuchen, dieser Erniedrigung zu entgehen. Es ist die Zeit des kalten Kriegs. Sie hängen ein Schild an den Eingang ihrer Botschaft: Wir sind Kommunisten. Wir sind eure Brüder. Kommen Sie mit einem französisch sprechenden Übersetzer. Die Fledermäuse sprengen das Portal mit der Bazooka, dringen wortlos bis in die privaten Gemächer vor, öffnen vor den versammelten Sowjets die Kühlschränke, zeigen ihnen die Eier und zertreten diese auf dem Boden: Ein echter Revolutionär isst kein Ei, das ausgebrütet und zum Huhn werden kann, das eine ganze Gruppe von Menschen satt macht. Man bringt die Sowjetbürger in die Botschaftsräume, man zieht Kambodschaner, die hier um Asyl gebeten hatten, unter der Androhung, die Botschaft zu besetzen, aus dem Pulk und stößt sie in die Kohorten auf den Straßen, dort herrscht ein Wort, das die Jungen in Schwarz überall im Mund führen, ein Wort, das jeder kennt, das an diesem Morgen jedoch in Großbuchstaben geschrieben zum Eigennamen wird, zu einer neuen Gottheit, die Angka: die Organisation.
Am nächsten Morgen sind Teile von Phnom Penh geräumt, die letzten Widerstandsnester erstürmt. Überall umgestürzte oder verlassene Fahrzeuge mit offenen Türen. Die Fledermäuse zerschneiden die Reifen, um daraus Schuhsohlen zu machen, legen Stacheldraht quer über die Straßen. In wenigen Tagen ist die Stadt tot. Krankenhausbetten rollen durch die Stadt. Auf den Infusionsflaschen, an denen Schläuche baumeln, funkelt die Sonne. Die Fledermäuse knacken die Eisengitter vor den Geschäften, werfen alle Symbole der Korruption auf die Straße, wo sie von Lastwagen eingesammelt und an den Stadtrand zum Deich von Stung Kambot gefahren und verbrannt werden. Man räumt die Fernsehapparate aus den Wohnungen, man wirft alles aus den Fenstern, was die Angka fordert, Küchengeräte, Tonbandgeräte, Uhren, Kühlschränke, Konservenbüchsen, Medikamente, importierte Kleidung, Bücher, ganze Bibliotheken brennen. In den Vorstädten herrscht Stille, der Exodus der Stadtbewohner hinterlässt Spuren, die sich überall gleichen, in den Straßengräben liegen zu schwere Gepäckstücke, zu sperrige Matratzen, Motorräder ohne Benzin, doch für die meisten, Arme wie Reiche, ob sie ihre Ersparnisse in einem Banktresor versteckt oder in einem Stück Bambusrohr im Hof vergrabenen haben, ist das überraschendste Bild die Vernichtung des Geldes, all die Schnipsel der Fünfhundert-Riel-Scheine, die über die Gehwege wirbeln. Es gibt nichts mehr zu verkaufen und nichts mehr zu kaufen. Innerhalb von vierundzwanzig Stunden ist eine Welt ausgelöscht. Die Geldscheine, die in der Geisterstadt vom Himmel fallen und ihnen zum Abschied winken, zeigen ihnen, dass es kein Zurück gibt. Unwiderruflich.
Mit Mister Liem
Mister Liem scheint sich für den Prozess kaum zu interessieren, obwohl die Roten Khmer seine Familie vernichtet haben. Sein Vater war Offizier. Als wäre dieser Prozess für Ausländer organisiert, für die, die Kambodscha zugrunde gerichtet haben und jetzt über die Kambodschaner richten wollen. Er würde gerne wissen, wozu ich dieses tägliche Hin und Her zum Gericht in seinem alten Toyota Camry auf mich nehme. Ich könnte in München sein, beim Prozess gegen Josef Scheungraber, der dieser Tage beginnt, der vielleicht letzte Naziprozess. Schließlich sage ich ihm, nur um ihn zu beruhigen, dass ich für eine Zeitung arbeite. Was wie ungesunde Neugier aussieht, verwandelt sich so in eine Beschäftigung wie jede andere. Wir erfüllen beide unsere Pflicht, wie bei einem Kommando, das wir uns nicht ausgesucht haben. Wir verständigen uns in einem viel zu holprigen Englisch und Nuancen sind uns nicht möglich.
Im Rhythmus unserer Fahrten erzählt Mister Liem nach und nach von seinem Leben, das ich aus den einzelnen Bruchstücken zusammensetze. Als Kind wohnte er mit seinen Eltern in einer Straße in der Nähe des Lyzeums, das dann zum S-21 wurde. Heute besitzt er diesen alten, rechts gesteuerten Toyota Camry, ein Billigimport aus Thailand. Er behauptet, Anhänger Sihanouks zu sein, springt von einem Thema zum anderen, bricht in ruckartiges Gelächter aus. Um sich des Horrors überhaupt bewusst zu werden, muss man ein Privilegierter sein und zwischen einer historischen Katastrophe und einer Naturkatastrophe unterscheiden können, muss man gelten lassen, dass die Gestorbenen nicht alle ein schlechtes Karma hatten, muss man sich über den Planeten und den Kalten Krieg erheben, die Nase aus dem Reisfeld oder über das Lenkrad heben. Er ist jünger als ich. Am 17. April 1975 ist er acht Jahre alt. Er ist in der Schule, als die Fledermäuse die Klassenzimmer leeren. Alles liegen lassen, schnell, Bombardierung durch die Amerikaner. Zu Hause findet er niemanden mehr vor, seine Eltern sind schon fort. Er wird sie nie mehr wiedersehen, ebenso wenig wie Bruder und Schwester. Eine Tante packt ein wenig Handgepäck für die drei Kinder, die sie mitnimmt. Er erzählt mir, dass er nach zwei Tagen Marsch inmitten der Menschenmenge erst wenige Kilometer von Phnom Penh entfernt auf der Nationalstraße 4 gewesen sei, dort, wo heute das Gericht steht. Jähes Gelächter wie von einem Irren.
In lückenhaftem Englisch mit ein paar französischen Einsprengseln erinnert er mich daran, dass er seitdem nicht mehr zur Schule gegangen ist. Doch Französisch ist schwierig. Viele Konjugationen. Er erklärt mir, dass man Englisch mit dem französischen Alphabet schreibe, ich widerspreche ihm nicht. Als wir an der von den Japanern wiederaufgebauten Nationalbank vorbeifahren, erwähnt er die Fotos, auf denen die jungen Roten Khmer – Khmairou, sagt er – mit den Schnipseln von Geldscheinen spielen. Er behauptet, das ganze Geld sei nach Russland geflossen. Gold und Devisen hingegen seien nach China gewandert, aber ich will auch die Sowjets nicht von aller Schuld freisprechen. Auch Frankreich erneuere sich, meint er. Seit jeher, sagt er. Angkor! Er lacht. Erinnert sich daran, dass er mit acht Jahren die letzten Hubschrauber davonfliegen sah. Am 12. April flieht der amerikanische Botschafter, die zusammengefaltete Fahne unter dem Arm, und überlässt die letzten Soldaten von Lon Nol ihrem Schicksal, Jungen, die als GI verkleidet in viel zu großen Uniformen stecken und denen der schwere Helm über die Augen rutscht. Lon Nol ist schon auf Hawaii. Wenige Tagen vor dem Fall Saigons haben die Amerikaner andere Sorgen. Keine dreizehn Tage liegen zwischen dem ruhmreichen 17. April in Phnom Penh und dem Einmarsch der Vietminh in Saigon nach dreißig Jahren Krieg. Zwischen dem Abflug der Hubschrauber in Phnom Penh und dem Abflug der Hubschrauber von den Dächern Saigons. Die Erfindung des Wegwerf-Hubschraubers: Damit die nachkommenden Hubschrauber landen können, die vollbepackt mit Flüchtigen über den Schiffen schweben, entsorgt man die bereits gelandeten der Reihe nach und wirft sie vom Deck der amerikanischen Schiffe ins Chinesische Meer. Genau zwölf Tage und zweiundzwanzig Stunden, bevor das Bild jenes Panzers der Vietminh entsteht, der mit voller Geschwindigkeit das schmiedeeiserne Tor zu dem Gebäude durchbricht, das heute in Ho-Chi-Minh-Stadt der Wiedervereinigungspalast ist. Das Foto zeigt den Panzer, als er auf dem eingedrückten Tor zum Stehen kommt. Zwölf Tage und zweiundzwanzig Stunden zwischen dem Sieg der Roten Khmer in Kambodscha und dem Ende des Vietnamkriegs.
Der Sieg der Revolution.
Keine war so rein
Wir, die wir die Revolution so herbeigesehnt haben, die wir glaubten, fast überall auf dem Planeten Anzeichen für sie zu entdecken, wir wissen, dass keine Revolution, weder die französische noch die mexikanische, die russische, die kubanische oder die chinesische, es mit der Brüderlichkeit und Gleichheit der Menschen so weit getrieben hatte, dass Reichtum und Herrschaft des Geldes innerhalb von vierundzwanzig Stunden verschwunden waren.
Unter den wenigen Revolutionen, die siegreich endeten wie in Havanna, Managua und Hanoi, war die in Phnom Penh ein Höhepunkt, die schönste und die unnachgiebigste, die absolute Tabula rasa. Drei Jahre, acht Monate und zwanzig Tage lang. Eine Revolution so perfekt wie ein Laborexperiment. Lange Zeit bleibt die Angka anonym. Man kennt die historischen Figuren der Roten Khmer. Man weiß nicht, wer von ihnen nach so vielen Jahren im Untergrund noch am Leben ist. Das Radio betet Zahlen herunter, Bruder Nr. 1, Bruder Nr. 2 … Sie wollen die Reinheit der jungen Kämpfer des Alten Volks bewahren, die nie etwas anderes kannten als den Wald und die Disziplin. Sie wollen alle Produkte des Westens zerstören, damit sie gar nicht erst lernen, sich ihrer zu bedienen, damit der Geschmack daran sie nicht korrumpiert, wie er das Neue Volk korrumpiert hat. Selbst die Idee der Stadt soll verschwinden. Zurück ins Dorf und zur Reinheit der Khmer. Alle sollen die schwarzen Pyjamas der Khmerbauern tragen. Es ist die moralische Strenge des Alten Volks gegen die Ausschweifung der Städter. Phnom Penh kehrt zur Natur zurück, die mitten auf den jetzt pflasterlosen Wegen wächst. Die Fledermäuse pflanzen darauf Bananenstauden wie die Vietkong Jams, das wahre Gemüse des Guerillero, das sich zwischen der Munition im Marschgepäck tagelang hält. Phnom Penh ist eine verbotene Zone.