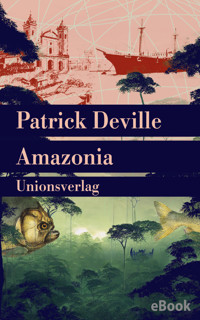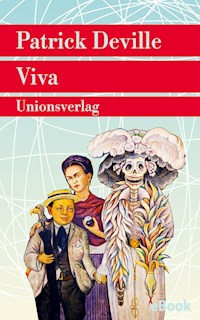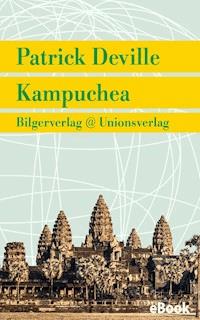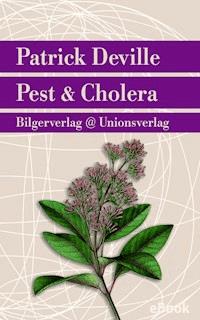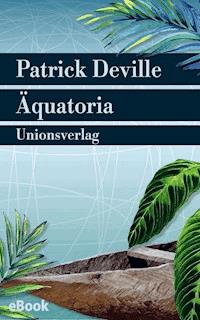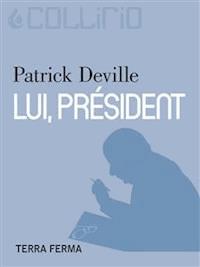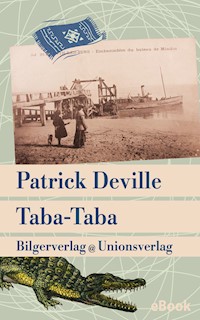
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Alte sitzt am Ufer der Loire, wippt vor und zurück und murmelt monoton vor sich hin: Taba-Taba-Taba. Er ist Insasse einer psychiatrischen Anstalt und der beste Freund eines hinkenden Jungen - dem Sohn des Anstaltsleiters. Der Junge fristet mit seinem zu kurz gewachsenen Bein einen einsamen Alltag zwischen Bett und Rollstuhl und flüchtet sich in die Welt der Bücher. Als Erwachsener reist er in die ausgebrannte nordfranzösische Provinz auf der Suche nach seiner Familiengeschichte. Gleichzeitig beginnt eine Reise durch die französische Vergangenheit - von der Kolonialzeit über die Suez-Krise bis hin zu den jüngsten Attentaten in Paris. Deville erzählt von weltbewegenden Ereignissen, historischen Krisen und persönlichen Wendepunkten - der Schlüsselroman seines großen Buchzyklus.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 573
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Über dieses Buch
Wegen eines zu kurzen Beins fristet ein kleiner Junge den Alltag im Bett und flüchtet in die Welt der Bücher. Als Erwachsener begibt er sich schließlich auf die Spuren seiner Familiengeschichte und der französischen Vergangenheit. Deville erzählt von weltbewegenden Ereignissen und persönlichen Wendepunkten - der Schlüsselroman seines Buchzyklus.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Patrick Deville (*1957) studierte Literatur und Philosophie. Er lebte im Nahen Osten, in Afrika und bereiste Lateinamerika. Seine Werke wurden mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, unter anderem als »bester Roman des Jahres« der Zeitschrift Lire, mit dem Fnac-Preis und dem Prix Femina.
Zur Webseite von Patrick Deville.
Sabine Müller (*1959) studierte Germanistik, Philosophie und Pädagogik. Sie übersetzt aus dem Französischen und Englischen, u. a. Werke von Andreï Makine, Cecile Wajsbrot, (beide zusammen mit Holger Fock), Erik Orsenna, Philippe Grimbert, Annie Leclerc und Alain Mabanckou.
Zur Webseite von Sabine Müller.
Holger Fock (*1958) studierte Theaterwissenschaft, Germanistik und Philosophie. Er übersetzt seit 1983 französische Literatur, u. a. Gegenwartsautoren wie Andreï Makine, Cécile Wajsbrot (beide zusammen mit Sabine Müller), Pierre Michon und Antoine Volodine. Er lebt bei Heidelberg.
Zur Webseite von Holger Fock.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Patrick Deville
Taba-Taba
Roman
Aus dem Französischen von Holger Fock und Sabine Müller
E-Book-Ausgabe
Mit einem Bonus-Dokument im Anhang
Bilgerverlag @ Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Dieses E-Book enthält als Bonusmaterial im Anhang 1 Dokument
Dieses E-Book des Bilgerverlags erscheint in Zusammenarbeit mit dem Unionsverlag.
Die Originalausgabe erschien 2017 bei Éditions du Seuil, Paris.
Die deutsche Erstausgabe erschien 2019 im Bilgerverlag, Zürich.
Originaltitel: Taba-Taba
© by bilgerverlag GmbH, Zürich 2019
© der Originalausgabe by Éditions du Seuil, Paris 2017
© by Bilgerverlag, Zürich 2024
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Teppich - Granger Historical Picture Archive (Alamy Stock Foto); Krokodil - Interfoto (Alamy Stock Photo); historische Postkarte
Umschlaggestaltung: Peter Löffelholz
ISBN 978-3-293-31096-4
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 18.05.2024, 01:41h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
TABA-TABA
Ein monumentales TorEin QuarantänebeckenEin Theater im italienischen StilEin ZauberteppichEine kleine BibliothekIn ManaguaKleine SpurenEin historischer KanalHeim zu den FranzosenAuf dem RundwegIn ZamalekEine ZeitmaschineIn die BeauceBeim SchuhmacherIn der SchuleEin Drama im SudanAuszug aus der Schulordnung für öffentliche Primarschulen im Departement Seine-et-OiseBarbizonner und ChaillotinerIn ChaillyParade im JuliErste LiebeDie amerikanische FreundinWeg aus Saint-QuentinZu den GrenzenIn der roten ZoneIn den JuraBei PoitevinVom Optimismus beim AutofahrenIn DôleDie Versuchung der FeuerwaffenEin junges PaarEin SchiffsuntergangEin HandlungsreisenderUnterwegs zu den FrankenEin blaues BandAuseinandergerissenMit den Worten von Vater und SohnKleine SpurenNach Süden»Chez Jules«Ein schöner KollaborateurDie WartezeitKlopft es an der TürIn AntibesWeit weg von ihrEin Sommer auf dem BauernhofIn MoissacIm WaldEine FeuerspurKleine SpurenIn ToulouseJunge MännerSorèze & UriageIn SorèzeEin AnglerBei Pater GrangeSaint-Simonisten und SorézianerAm Ende der WeltIm VercorsKleine SpurenIn die Wüste des NordensRichtung BretagneSaint-Simonisten & NazairinerLa poche – die AtlantikfestungIm Verein La BrévinoiseIm LAZARETTEine ReifenpanneUnterwegs nach ChâteaubriantDie IdylleAuszug aus der AnstaltsordnungKleine SpurenZwei NotizhefteEin Sonntag am MeerIn MindinEine BrückeKleine SpurenEin schön gerundetes BeckenIn Saint-Brévin-l’OcéanKleine SpurenDas Leben MonnesDas ArchivTaba-TabaZitatnachweisMehr über dieses Buch
Patrick Deville: »Taba-Taba ging eine fünfzigjährige Vorbereitungszeit voraus.«
Über Patrick Deville
Über Sabine Müller
Über Holger Fock
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Bücher von Patrick Deville
Zum Thema Frankreich
Zum Thema Kolonialismus
Zum Thema 2. Weltkrieg
Zum Thema Geschichte
Zum Thema Afrika
Das Einzige, was sich nicht ändert,ist der Anschein, dass sich»in Frankreich etwas geändert« hat.
MARCEL PROUST,IM SCHATTENJUNGER MÄDCHENBLÜTE
Ein monumentales Tor
Am äußersten Ende der Loire-Mündung steht in der Mitte der zur nördlichen Hemisphäre gehörenden Landmasse ein steinernes Tor mit einem bescheidenen Triumphbogen und seinen zwei vergitterten Türflügeln über dem Fluss. Monumental an ihm ist nur sein Name. Das LAZARETT brauchte ein Denkmal, und es sollte dieses Tor sein, das auf nichts hinausgeht, von Weitem sichtbar für die Schiffe bei ihrer Einfahrt in die Fahrrinne und ebenso graugrün wie das Süßwasser und das Salzwasser, die sich vor ihm mischen.
Die eisernen Gitterstäbe lassen einen Zwischenraum, durch den ich jeden Morgen mit der Schulter voraus schlüpfe, um zum Strand hinunterzugehen und mich wie ein Riese über den Pfützen niederzuhocken, die bei Ebbe in den Felsmulden zurückbleiben. Jeder dieser Tümpel zwischen meinen Sandalen ist ein winziges Binnenmeer mit seinen Klippen und Wäldern aus schwimmenden Algen, die man wie Haar zur Seite streichen muss, um die hinterlistigen Strandkrabben aufzustöbern und zu beobachten, wie die durchsichtigen Felsengarnelen und manchmal die Glasaale oder die Larven der Meeräschen in Panik geraten. 1965 war für mich Schluss mit diesen Naturgeschichten, als beschlossen wurde, dass acht Jahre hinter den Mauern einer psychiatrischen Anstalt genug seien, auch wenn meine Schwalbenschultern es mir immer ermöglicht hatten, ratzfatz aus dem Käfig zu schlüpfen.
Bis dahin hatte ich die Wörter Irrer oder Ästuar noch nie gebraucht. Ich wusste noch nicht, dass Lazarett kein Eigenname war, sondern eine allgemeine Bezeichnung. Die wohnen im LAZARETT, sagten die Kinder in Mindin, Söhne von Fischern, und verdrehten die Augen. Bei den Irren. Ich zuckte mit den Schultern und unternahm keine weiteren Versuche zu erklären, welches Glück es war, im LAZARETT zu leben, und kehrte schleunigst dorthin zurück. Im Lazarett sprachen wir von INSASSEN, um die zahllosen Geisteskranken zu bezeichnen, unter denen wir lebten.
Für uns teilte sich die Welt, diese fünfzehn unzugänglichen Hektar entlang des Flusses, rundum abgeschnitten durch einen Weg und eine ununterbrochene Mauer, also auf in INSASSEN und PERSONAL, Kategorien, die durchlässiger waren, als man vermuten könnte, denn das LAZARETT war voller Großbuchstaben, da zahlreiche der weniger schwer Erkrankten, einfache Gemüter oder Dorfdeppen, die man im Zuge der Landflucht hier abgeliefert hatte, damals im GARTEN oder in der TISCHLEREI, in der MALERWERKSTATT, der WÄSCHEREI oder der KÜCHE arbeiteten: Für sie gab es am Monatsende ein kleines Entgelt, das es ihnen gestattete, in der Cafeteria triumphierend eine Runde Limonade Marke Pschitt Orange oder Verigoud Citron auszugeben, Zelluloidkämme zu kaufen, oder Postkarten, die nie verschickt wurden.
Allerdings fielen mir nur manche von ihnen auf, unruhige Psychopathen, die mit bleichem Gesicht und offenem Mund einen braunen Lederhelm trugen, den Blick ins Innere ihres Hirns und ihres eigenen Rätsels gekehrt, die anderen wanderten, in blaues Tuch gekleidet, mit den nachdenklichen Mienen antiker Philosophen oder armer Schlucker auf den sandigen Wegen unter den Pinien auf und ab, setzten sich zum Plaudern auf die Bänke und besuchten einander am späten Nachmittag in den verschiedenen Gebäuden der Anstalt. Unter ihnen fand ich meine besten Kameraden.
Besonders einer von ihnen, ein umnachteter Einzelgänger, der bei allen nur Taba-Taba hieß, konnte, wenn das Wetter es erlaubte, stundenlang auf den Stufen des monumentalen Tors sitzen und warten; dabei wippte er mit dem Oberkörper vor dem graugrünen Wasser langsam vor und zurück und psalmodierte Taba-Taba-Taba/Taba-Taba-Taba, mit einer perfekten Zäsur in der Mitte des Alexandriners; zum Ende des ersten Halbverses erreichte sein Oberkörper die tiefste Position, und beim Aussprechen des zweiten hob er sich wieder, ohne dass ihm je die Kippe aus dem Mund gefallen wäre. Das war vierzig Jahre bevor die Post auf ihren Briefmarken Malraux’ Glimmstängel wegretuschierte. Die Krankenhausverwaltung, die damals noch keine Bedenken gegen den Tabakgenuss im Allgemeinen hatte und vor weitaus drängenderen Problemen stand, ließ ganze Packungen von Gauloises Troupes an die Insassen verteilen, Zigaretten mit Knaster aus den Lagern der SEITA, dem staatlichen Tabak- und Streichholz-Monopol, die damals für das soldatische Fußvolk im Algerienkrieg produziert wurden. Auch in der Cafeteria konnte man sie kaufen.
Doch wenn Taba-Taba, das Haar im Wind, verwirrt, aber beharrlich auf den Stufen des monumentalen Tors saß und sein entrücktes Dichter- oder Prophetenhaupt über den Fluss reckte, schien er etwas anderes, Größeres und Geheimnisvolleres heraufzubeschwören.
Ein Quarantänebecken
Keiner der Irren, neben denen ich in diesen acht Jahren lebte – aber in der Kindheit sind acht Jahre ein ganzes Jahrhundert –, hielt sich für Christus oder Napoleon, dessen Neffe unser Lazarett mit Unterzeichnung dieses kaiserlichen Dekrets vom 1. Mai 1862 gegründet hatte:
Napoleon, Kaiser der Franzosen von Gottes Gnaden und Volkes Wille,
Grüßt alle gegenwärtigen und künftigen Untertanen.
Auf der Grundlage des Berichts unseres Staatsministers für Landwirtschaft, Handel und Öffentliche Aufgaben;
In Anbetracht des gemeinsamen Berichts von Doktor Mélier, dem Generalinspekteur der Gesundheitsämter, und von Herrn Isabelle, Architekt im Regierungsauftrag, über die notwendigen Arbeiten zum Bau eines Lazaretts auf der Landzunge von Mindin am Südufer der Loire …
Mit den ersten Baumaßnahmen hatte man 1860 begonnen, im selben Jahr, in dem Louis Pasteur die These von der Urzeugung widerlegte und die Bakteriologie erfand. Ein Jahr später wütete eine Gelbfieberepidemie an den Ufern der Flussmündung. Daher wurde ein Quarantänebecken in die Salzfelder gegraben, das sowohl die Schiffe aufnehmen sollte, auf denen die Krankheit ausgebrochen war, wie auch alle verdächtigen Schiffe, bevor sie in die Häfen von Paimbœuf oder Nantes einlaufen durften. Das Becken musste tief genug sein, um den Dreimastern das Ankern zu ermöglichen, die, beladen mit Kokosnüssen, hübschen Muscheln, wahrscheinlich auch Papageien und Zuckerrohr, aus der Karibik zurückkehrten, und es musste genügend Platz bieten, damit die Mannschaft und die Passagiere von Bord gehen konnten; fast sieht man sie noch in ihren weißen Anzügen oder Kostümen und ihren Sonnenhüten, mit zitternden Händen halten sie ein Taschentuch vor ihre Lippen, sitzen abseits auf umgekippten Rumfässern. Auch das Expeditionskorps von General Bazaine, das Maximilian und dessen Frau Charlotte auf den Thron von Mexiko bringen sollte, musste hier warten.
Nach den Originalplänen, über die ich verfüge, standen westlich des Beckens die Krankenstation und die Desinfektionsabteilung, ihnen schloss sich ein weiträumiger Lagerplatz für die Matrosen an, dann das Haus des Hafenmeisters, ein Waschhaus, ein Speisesaal und, noch weiter westlich, in der Mitte einer von Mauern umschlossenen Kreisfläche, das eigentliche Lazarett, das Lazarett im LAZARETT, so etwas wie die Einzelzelle im Gefängnis, das Tabernakel des Altars oder die Gummizelle einer Irrenanstalt: Dort sollten die Kranken eingeschlossen werden, von denen eine Ansteckungsgefahr ausging; sie waren also doppelt eingesperrt, wurde doch die gesamte Anlage, ursprünglich acht Hektar, zu ihren drei Landseiten hin bereits von einer hohen Mauer gesichert, an der außen ein Weg entlangging, der nirgendwohin führte. Die einzigen Zugänge lagen im Norden: stromaufwärts gegenüber dem Quarantänebecken der Kanal für die ankommenden Schiffe, stromabwärts das monumentale Tor, das bei Flut auf einige Meter Sand hinausging, bei Ebbe auf etliche Dutzend Meter Schlick, und das nur geöffnet wurde, um die infizierten Leichen auf Barken fortzuschaffen, damit man sie in der Flussmitte auf der Insel Saint-Nicolas-des-Défunts beerdigte. Durch diesen Triumphbogen würden nur Besiegte in Rückenlage ziehen.
Anders als manch ein Arzt vielleicht behauptet hat – denn unter ihnen gibt es Spaßvögel, die den Schlüssel gerne zweimal umdrehen, wenn sie einen einsperren –, hat die Auferweckung des Lazarus mit der Etymologie des Lazaretts nichts zu tun. Das Wort entstand durch eine venezianische Kontamination von Lazaretto und Nazaretto im Namen der ersten Einrichtung zur geschlossenen Unterbringung von Pestkranken auf der kleinen Insel Santa Maria di Nazareth mitten in der Lagune. Auch jener heiliggesprochene römische Bürger namens Nazarius, über den Gregor von Tours im 6. Jahrhundert schrieb, man könne »die Reliquien des Heiligen Nazarius in einem Weiler am Ufer der Loire in der Diözese von Nantes« betrachten, hat nichts damit zu tun. Doch zur selben Zeit, als auf kaiserliche Anordnung hin das Quarantänebecken von Mindin am Südufer der Loire gegraben wurde, hob man gegenüber am Nordufer das Hafenbecken von Penhouët aus, und Saint-Nazaire erwachte zu neuem Leben: Der schottische Ingenieur John Scott errichtete dort auf Einladung der Brüder Pereire und der Saint-Simonisten eine Werft und begann mit dem Bau von Schiffen mit Stahlrumpf. Von überall strömten Arbeitskräfte herbei. Über diesen Ansturm im Westen berichtete La Revue des Deux Mondes 1858:
Wer sich eine Vorstellung davon machen möchte, wie in wenigen Monaten eine kalifornische Stadt beziehungslos und in Schüben entsteht, kann dieses Spektakel in Saint-Nazaire nachvollziehen. Derzeit ist Saint-Nazaire eine merklich wachsende Ansammlung von Zuwanderern. Schier endlose Straßen entstehen, und überall erheben sich wie zufällig zusammengewürfelte Bauten jeder Art, vom Pariser Wohnhaus mit Toreinfahrt bis hin zu Matrosenschenken. Alles ohne Straßenbauamt, ohne Brunnen, ohne Polizei. Vor zwei Jahren war Saint-Nazaire ein Dorf, heute ist es eine Stadt.
Im selben Jahr, 1858, kommt in Kairo eine kleine Eugénie-Joséphine zur Welt, ohne die ich das LAZARETT nicht gekannt hätte. Im Alter von vier Jahren erblickt dieses Mädchen im weißen Spitzenkleid die hohen smaragdgrünen Wellen mit ihren runden, in der Sonne durchsichtigen Kuppen, deren glasiges Herz goldgelb leuchtet, von der Gischt gesäumt wie von Stacheldraht. Das Schiff nimmt Kurs auf den Hafen von Marseille. Sieben Tage mit Zwischenstopp in Malta. Sie verlässt für immer das Land ihrer Geburt und weiß es nicht, freut sich über ihre Reise und gleitet unbekümmert von den Schlachten über die Skelette und die beim Rückzug Ertrunkenen. Im Jahr 1862 schließlich, dem Jahr ihrer Ankunft in Frankreich und der Gründung des LAZARETTS, lief im Hafenbecken von Penhouët die Impératrice-Eugénie vom Stapel, das erste in Frankreich gebaute transatlantische Linienschiff. Saint-Nazaire entwickelte sich zum Abfahrtshafen für den Linienverkehr nach Kuba und Mexiko. Hier löschte man importierte Steinkohle aus Cardiff, und damit war die Sache entschieden: Das Nordufer des Flusses sollte der Seefahrt und der Industrie dienen, das Südufer der Sommerfrische und dem Müßiggang. Nichts war unterschiedlicher als die beiden Ufer. Der Ästuar bildet eine Grenze, deren aufgewühltes Wasser bei jeder Flut das Beste mitnimmt.
Durch einen dieser Streiche, die der alte Ozean den Geographen gerne spielt, hatte Saint-Brévin auf der Südseite der Loire in einem Jahrhundert mehrere Hundert Hektar Uferzuwachs bekommen und durch diese Sandablagerung die Landfläche der Nation vergrößert, die Schüler von Brémontier, der weite Flächen des Departement Landes aufgeforstet hatte, ab 1860 durch einen Pinienwald zu erhalten versuchten, damit Wellen und Meeresströmungen sich nicht zurückholten, was sie vergessen hatten. Häuser im baskischen und normannischen Stil wurden darauf errichtet, Parks und Gärten angelegt, bald auch ein Kasino gebaut, man pflanzte Orchideen und Mimosen, zog Rosen. 1882 wurde der südliche Stadtteil Saint-Brévin-L’Océan gegründet, kurz L’Océan genannt, und 1900 erhielt das Seebad vom Staat das Recht, sich Saint-Brévin-les-Pins zu nennen. Mangels Bazillen und tropischer Viren in ausreichender Menge hatte das Lazarett für infizierte Seeleute bereits im Jahr zuvor dichtgemacht. An der Spitze des Kampfs gegen Pest und Cholera in Frankreich stand damals Adrien Proust, Marcel Prousts Vater. Er konzentrierte die Mittel für seinen Sperrgürtel auf die viel stärker bedrohte Mittelmeerküste.
Nachdem es während des Ersten Weltkriegs in ein Krankenhaus für Frontsoldaten umgewandelt worden war, beherbergte das ehemalige Lazarett nach dem Waffenstillstand »Kinder beiderlei Geschlechts, denen die gemäßigte Seeluft zuträglicher ist als ein raues Meeresklima«. Man taufte es um in »Genesungs- und Erholungsheim des Departements in Mindin«, eine Bezeichnung, die zu lang war für die Bréviner, die das LAZARETT logischerweise noch Jahrzehnte später, als die Einrichtung eine Irrenanstalt wurde, das LAZARETT nannten, da es ein solches ja einmal gewesen war.
Nach all dem Dreck, dem Stacheldraht und den verbrannten Lungen machte sich der Chefarzt des LAZARETTS, Doktor Dardelin, mit einem kleinen, 1931 im Verlag La Vague in Pornic erschienenen Werk zum Vorsänger jener zwischen den Weltkriegen aufgekommenen Schwärmerei für Seebäder, Sonne und gesunde Kinder. Darin findet man überzeugende Texte über Luftkuren, Meerwasser- und Sonnenlicht-Heilverfahren, vermischt mit ausschweifenden Überlegungen zur Geopolitik und Geburtenförderung:
Soeben hat man uns gesagt, wir sollten die alte Devise Si vis pacem para bellum durch die neue Si vis pacem para pacem ersetzen. Das ist nur Wortgeplänkel. Man hätte uns auch erklären müssen, wodurch: Generando pueros. Angesichts eines hasserfüllten Deutschlands und mit einem angriffslustigen Italien nebenan sollten die Frauen von Saint-Brévin wissen, dass es nur ein Mittel gibt, um nicht erneut vor einem Denkmal für Kriegsgefallene zu weinen: Kinder zeugen.
Dieser kinderlose Lateiner hatte auf alles eine Antwort: Sind 47°15’ nördlicher Breite, derselbe Breitengrad, auf dem Neufundland und der Sankt-Lorenz-Strom liegen, nicht ein wenig zu weit nördlich für die Balneotherapie? Nein, entschied er, denn genau auf 2°10’ westlicher Länge kommt der Golfstrom an:
Nachdem die warmen Süßwassermassen des äquatorialen Amazonasbeckens im Süden von Guyana ins Meer geströmt sind, fließen sie entlang der Küste Guyanas nach Nordwesten. Ihre stärkste Erwärmung erfahren sie im Golf von Mexiko, dem reinsten tropischen Heizkessel, bevor sie anschließend in nordöstlicher Richtung den Atlantik durchqueren. In Höhe des vierzigsten Grads nördlicher Breite, wo die Lufttemperatur oft null Grad beträgt, ist dieser gigantische Strom Heißwasser noch immer 26° warm. Dem Golfstrom verdanken wir die charakteristischen milden Temperaturen an den Stränden des Atlantiks. Er zieht im Januar eine Isotherme von plus sieben Grad parallel zur Küste, und auf dieser Linie liegt Saint-Brévin.
Daraus und ergänzt durch seine Aufzeichnungen über die Luft – außer dem natürlichen Ozon der Meeresluft gebe es in Saint-Brévin auch reichlich Ozon aus der Oxidation des Terpentins seiner Pinienwälder –, leitete Doktor Dardelin seine therapeutischen Indikationen ab:
Am allerbesten bekommt ein Aufenthalt in Saint-Brévin Kindern. Wenn sie wohlauf und bei guter Gesundheit sind, werden ihre Abwehrkräfte gegen Krankheiten gestärkt. Wenn sie geschwächt oder auf dem Weg der Genesung sind, erreichen sie bald eine normale Gesundheit. Besonders Kinder von adenoider Konstitution erleben, wenn sie ihre Atemgymnastik machen, eine Weitung ihrer Atemwege, und ihre Münder öffnen sich nur noch zum Essen, Sprechen oder Schreien. Husten aufgrund von Entzündungen der Luftröhre oder der Bronchien verschwindet. Bis zum Alter von vier Jahren streckt sich bei rachitischen Kindern das Skelett ohne die Hilfe von Apparaten. Vergrößerte Rachenmandeln schrumpfen. Muskelhypotonie verwandelt sich in Muskelstärke, Blässe in lebhafte Farbe …
Ich habe diesen Doktor Dardelin nicht gekannt. 1943 verfehlte er mit dem Auto die Rampe auf die Fähre nach Le Pellerin und ertrank in der Loire. Aber ich kann mir den argwöhnischen Blick vorstellen, mit dem mich seine Witwe, die leitende Krankenschwester des LAZARETTS, vermutlich betrachtete, wenn sie mir zufällig auf den Wegen begegnete und mein kreidebleiches Gesicht und meine schwache Garnelenmuskulatur sah. Vielleicht dachte diese griesgrämige Frau, die ihre Rot-Kreuz-Uniform, das enge weiße Stirnband und das marineblaue Cape, seit der Befreiung nicht mehr abgelegt hatte, damals kopfschüttelnd an ihren verblichenen Gatten und fragte sich, was bei den Berechnungen der Isotherme und der Oxidation des Terpentins wohl schiefgelaufen sein mochte, dass ein Kind, das nicht einmal hospitalisiert war und seit seiner Geburt in der Dienstwohnung neben dem monumentalen Tor des LAZARETTS wohnte, so unempfänglich für die hypertonischen und dardelin’schen Heilkräfte der Meeresgeographie bleiben konnte. Sie ahnte ja nicht, dass ich eigentlich der Schwarze Ritter war.
Nachdem das LAZARETT bombardiert, evakuiert, in ein Lager für deutsche Kriegsgefangene verwandelt und Anfang der Fünfziger Jahre schließlich seiner medizinischen Bestimmung zurückgegeben worden war, hatte es seinen Traum vom Phalansterium der Kinderheilpflege zugunsten der Pflege schwerer psychiatrischer Fälle aufgeben müssen. Statt gesunder rotbackiger Kinder, die an der heilsamen frischen Luft der Pinien und im Staub des hellen Dünensands Gymnastik machten, beherbergte das Lazarett nun alle Geisteskranken, deren Fall andernorts für aussichtslos und hier für noch aussichtsloser gehalten wurde, heftig verlaufende Psychosen, Enzephalopathien, Folgeerscheinungen des West-Syndroms.
Unter diesen rund tausend geistig Schwerbehinderten sollte Jahre später jedoch nur der umnachtete Taba-Taba mitverantwortlich sein für meinen Auszug aus dem LAZARETT und die Fortschritte, die ich in seiner Gesellschaft machte, wenn ich auf der Treppe des monumentalen Tors eine Stufe über ihm saß, mit meinem Oberkörper synchron zu seinem vor und zurück wippte und dabei unsere Litanei herunterbetete: Taba-Taba-Taba / Taba-Taba-Taba. Ich zog ins Exil in den Stadtteil L’Océan.
Das Archiv des LAZARETTS ist verschwunden. Ich werde Taba-Tabas richtigen Namen nie erfahren. Ich hätte auch gern die Berichte der ersten Gelbfieberkranken gelesen, die vor mir dort lebten, Gefangenen, denen sogar der Zugang zum monumentalen Tor verboten war und die 1862 nicht zuschauen konnten, wie am anderen Ufer die Impératrice-Eugénie vom Stapel lief, während im selben Jahr ein kleines, weiß gekleidetes Mädchen, das den Namen zweier Kaiserinnen trug, Eugénie-Joséphine, Ägypten den Rücken kehrte und in Frankreich eintraf.
Bot man diesen Eingeschlossenen wohl die jüngsten Neuerscheinungen des Buchhandels an? Victor Hugo veröffentlichte damals aus dem Exil Die Elenden, Gustave Flaubert Salammbô und Jules Verne Fünf Wochen im Ballon. Charles Darwins Über die Entstehung der Arten wurde erstmals übersetzt. Und war jener Architekt des Second Empire, Monsieur Isabelle, wohl zur Einweihung seines Lazaretts und jenes monumentalen Tors angereist, das er mit zwei Seitenflügeln versehen hatte, als wären sie mit ihren langen Fluren für ein Wachkorps bestimmt? Sicher konnte er nicht voraussehen, dass in einem der beiden Anbauten, dem linken vom Fluss aus gesehen, knapp ein Jahrhundert später ein Kind aufwachsen würde, dass es dort sogar eingeschlossen sein würde, tage- und nächtelang reglos auf dem Rücken liegend, die Beine gespreizt und das Fischlein im Freien.
Ein Theater im italienischen Stil
Denn Madame Dardelin, die Witwe des in der Loire ertrunkenen Chefarztes, hatte ein Auge dafür. Das Kind hat einen schiefen Gang. Ein lahmes Entlein. Jeden Morgen beobachtet sie ihn, runzelt die Brauen unter dem weißen Stirnband: Der Dreijährige zieht auf den Wegen des LAZARETTS ein Bein nach. Ein kleiner Quasimodo, aber in ihm steckt der Schwarze Ritter. Der Sand ist schuld, hält man ihr entgegen, der weiche Boden, der nachgebe. Sie bleibt beharrlich. Dieses Kind hinkt.
Schließlich fragt man Dardelins Nachfolger, Doktor Cholet. Alle sind jung, optimistisch. Witwe Dardelin dagegen hat schon viel gesehen. Sie bleibt dabei. Wiederholt sich. Lahmes Entlein. Kippeliger Gang. Man beschließt zu röntgen. Angeborene Hüftluxation mit Missbildung des Beckens. Die Oberschwester frohlockt. Exakte Diagnose. Der Vater, meint sie, könne nichts dafür. Er ist 1925 in Saint-Quentin im Departement Aisne geboren, jener Stadt, in der 1872 ihr verblichener Gatte Henri Dardelin zur Welt gekommen war, der es nicht versäumt habe, einer grassierenden Krankheit im Aisne ein kleines Werk zu widmen. Man macht sich schlau. Der Fluch ist bretonisch. In Tränen aufgelöst, nimmt die junge Mutter die Asymmetrie der Kinderbeine auf ihre Kappe.
Der erste Spezialist in Nantes, den man aufsucht, kennt kein Wenn und Aber: Nichts zu machen, der Junge wird hinken. Mehr nicht. Es gibt Schlimmeres. Aber das muss ich Ihnen ja nicht sagen bei all den unheilbar Verrückten, unter denen Sie leben. Die Eltern sind leichenblass, und der Junge hampelt wie ein Schwachsinniger in der ganzen Praxis herum. Der Arzt beobachtet ihn, doziert. Die Wege des Herrn sind unergründlich. Er liebt diese Untermenschen, denen Er das Leben geschenkt hat, vielleicht noch mehr als uns.
Als ich Jahrzehnte später im Archiv des Pasteur-Instituts in Paris über dem Briefwechsel Alexandre Yersins sitze, kopiere ich das Fragment eines Briefs, den der junge Medizinstudent 1885 aus Berlin an seine Mutter geschickt hat. Er teilte ihr mit, er habe »an einer hochinteressanten Operation« an einem seiner kleinen Freunde teilgenommen. »Er hatte eine pathologische Luxation des Oberschenkelknochens, das heißt, dass ein Bein kürzer war als das andere, weil der Oberschenkelkopf aus dem Hüftgelenk gesprungen ist. Man hat die Hüfte geöffnet, den Oberschenkelkopf mit Hammer und Schere herausgestemmt, dann das Bein weiter als im rechten Winkel vom Körper abgespreizt (sämtliche Knochen haben geknackt), anschließend wurde es in seine normale Lage zurückgebracht, und danach war es genauso lang wie das andere.«
Seitdem haben die Operationstechniken kleine Fortschritte gemacht: Bretonnière, ein ehrgeiziger junger Chirurg, will sich unbedingt in das Abenteuer stürzen. Man unterschreibt sämtliche Haftungsausschlüsse im Fall eines Misserfolgs, fängt das Kind mit dem Lasso ein, das wie ein Krebs kreuz und quer über die Wege des Lazaretts flieht, steckt es in einen rot-weißen Simca-Aronde-Krankenwagen. Im Operationsblock bekommt es eine Narkose, man sägt das Becken auf, klemmt einen Pfropfen aus einem Stück seiner eigenen kleinen Knochen zur Stütze hinein, legt ihn, Beine gespreizt, in ein Gipsbett: Nach einem Jahr würde man ihn herausnehmen, jetzt liegt er erst einmal auf dem Rücken. Wie eine umgekippte Schildkröte.
Genau am Mittelpunkt der Welt, ein Stück weit hinter dem monumentalen Tor, steht damals an der Stelle des alten Lazaretts im LAZARETT ein erst kurz zuvor errichtetes Theater. Es ist mit Schauspielergarderoben, einem festen Bestand an Bühnenprospekten und Kostümen, einer Bühnenmaschinerie mit Schnürboden und roten Theaterfauteuils ausgestattet, hat eine Bar im Untergeschoss, die in den Pausen geöffnet ist, eine Leiter in den Souffleurkasten unter der Bühne und einen Orchestergraben. Der junge Vater des flachgelegten Kindes ist ein Baritonsänger. Er leitet die Truppe, die von der Académie Ansaldi, dem Œuvre Nationale du Théâtre à l’Hôpital (der Nationalen Stiftung für Theater in Krankenhäusern), unterstützt wird. Auf dem Spielplan stehen Komödien, Operetten und Komische Opern. Die Musketiere im Damenstift von Jules Prével, eine Adaption des Romans Der Bucklige von Paul Féval, Die Arlesierin von Bizet, Die Glocken von Corneville von Louis Clairville, dessen große Baritonarie der Regisseur sein ganzes Leben lang schmettern sollte:
Dreimal umfuhr auf wechselvollen
Seereisen ich der Erde Rund;
Schon oft sah ich den Himmel grollen,
Das Meer erbeben bis zum Grund …
Die Idee zu dieser Schnurre hatten der Autor und Alphonse Allais an einem feuchtfröhlichen Abend in einem Hotel in der Normandie. Es ist das Frankreich, das sich amüsiert, das schäkert, seine fröhlichen Lieder trällert und in der Champagnerseligkeit Jacques Offenbachs schwelgt, das fern aller romantischen Melancholie zur Naivität der Vorkriegszeit, zu den Wilden Zwanzigern zurückfindet, in die man sich schmerzlich zurücksehnt. Ob die Insassen der Irrenanstalt für diese französische Leichtigkeit empfänglich waren? Die leichte Muse erschien der Ärzteschaft zuträglicher als Wagnerkonzerte. Selbst ein Nietzsche hatte sich zum Lob der mediterranen Klarheit bei Bizet und in Edmond Audrans Operette Der Glücksengel gegenüber der wagnerischen Düsterkeit aufgeschwungen.
Gleich dem Tabernakel, das die Hostie birgt und schützt, bewahrte das Theater inmitten des LAZARETTS, in diesem zweitausend Seelen zählenden Dorf mit tausend Betreuern und tausend Betreuten, das vollkommen abgeschnitten in einem Park lag, der mit Mimosen, Steineichen, ein paar Palmen und Strandkiefern bepflanzt war, die Doktor Dardelin wegen ihrer Terpentine ausgesucht hatte, wie unter einer Glasglocke einen Funken Geist, Musik und Poesie. Die Anstalt wird von hohen Steinmauern gesichert, auf denen Eidechsen dösen, und führt in ihrem Urkommunismus oder fourierschen Wahn ein autarkes Leben. Mit einem Garten für Blumen und Gemüse, einer Geflügelzucht und Schweinen. Geld gibt es nicht. Beim Essen hat man keine Wahl. Mittags wird uns die KISTE gebracht, in der die KÜCHE die Mahlzeiten anliefert. Nachmittags kommt ein dickes, vor eine Sturzkarre gespanntes, grauweißes Pferd vorbei und nimmt die Abfälle mit.
Alle Handwerksbetriebe sind vertreten: Die Namen der Werkstattleiter erinnern an den Vorspann mit den Nebenrollen im französischen Kino jener Epoche, Bouteau in der MALERWERKSTATT, Chadeigne in der FRISIERSTUBE, Pasquereau in der KÜCHE, Blanchard in der TISCHLEREI. Letzterer ist zudem Regieassistent und Bühnenbildner des Theaters. Wie die Heiligen Drei Könige machen sie dem schwächlichen und in die Horizontale gebannten Schwarzen Ritter ihre Aufwartung am Krankenbett. Die TISCHLEREI zimmert eine Karre, damit er an die frische Luft und ins Theater kommt. In der AUTOWERKSTATT stattet man das Gefährt mit Reifen und Federung aus. Die MAURERWERKSTATT bedauert, dass der Auftrag zur Anfertigung des Gipsbetts an Auswärtige ging.
Doch den ganzen Tag über lässt man mich allein mit dem Schwarzen Ritter in mir; die Augen an die Decke geheftet, schmieden wir zusammen die finstersten Pläne, manchmal im Beisein der kleinen Redon, die gegenüber an ihrem Fenster sitzt und immer verstohlen nach meinem Fischlein schielt: Eines Tages werde ich mit meinen spindeldürren Beinen in meine zu großen Shorts schlüpfen und mich auf und davon machen. Ich lese im Atlas, gehe mit dem Finger auf den Seiten spazieren, bereite meine Entdeckungsreisen vor. Ich werde zu Fuß die Tassili-Wüste von Algerien nach Libyen durchqueren, die ausgetrockneten Wadis der Rub al-Chali entlangwandern, mich durch die afrikanischen Dschungel schlagen, den Niger und dann den Mekong hinauffahren. Ich bin der Schwarze Ritter. Wer sich mir in den Weg stellt, wird in Stücke gehauen. Ich werde ein Krokodil mit bloßen Händen erwürgen und mir daraus Schuhe und einen Gürtel machen. Ich werde mit dem Taschenmesser allein gegen zehn kämpfen. Man wird mich in irgendwelchen fernen Gegenden umzingeln. Brüllende Indianer werden mich an den Marterpfahl binden. Ich werde über Ozeane fahren und auf der Äquatorlinie tanzen. Dann kehre ich zurück. Meine Eltern sind nicht gealtert. Wir wohnen noch immer im monumentalen Tor des LAZARETTS. Ich werde Taba-Taba grüßen, der auf den Stufen sitzt. Meine Shorts werden noch immer zu groß sein, aber ich werde Krokodillederschuhe tragen. Dann werde ich mich auf meinen Platz in der Küche setzen und trällern:
Dreimal umfuhr auf wechselvollen
Seereisen ich der Erde Rund.
Ein Zauberteppich
Wer auch immer sich damals zu mir ans Bett gesetzt hätte, neben dem meine Karre parkte, niemand hätte mich davon überzeugen können, dass alles Unglück der Menschen daher rühre, dass sie nicht ruhig in ihrem Zimmer bleiben könnten. Ich wollte hinaus. Man untersagte es mir. Ich wurde wütend. Um meine Ungeduld zu bändigen, kam man auf die seltsame Idee, mir Le Tapis volant (»Der fliegende Teppich«) zu schenken, von dem ich noch heute ein Exemplar besitze, ein Kinderbuch von Mary Zimmermann, auf Englisch in New York geschrieben, in einer französischen Übersetzung, die ohne Angabe des Übersetzers in Amsterdam erschienen war:
Jeden Abend las die Mutter Michel etwas vor. Eine seiner Lieblingsgeschichten war die vom Prinzen, der einen Zauberteppich besaß. Es genügte, ABRAKADABRA zu sagen, und schon hob sich der Teppich mit ihm in die Lüfte und brachte ihn, wohin er wollte … Doch das alles ereignete sich fern von hier, in Persien, wo es Kalifen und Moscheen gab, und hohe Türme, die Minarett genannt werden.
Weil es manchmal an Vorlesern mangelte, und da ich nichts anderes tun konnte, als stundenlang an die Decke zu starren und vor mich hin zu träumen, hatte mir die Schwester des Baritons, Simonne, genannt Monne, von Beruf Grundschullehrerin, das Lesen beigebracht. Man erinnert sich häufig an das erste Buch, das man entziffern konnte. Ist doch witzig, dass Lafontaines Jeannot Lapin durch räumlich und zeitlich so weit voneinander entfernte Werke wie Malcolm Lowrys Unter dem Vulkan, Chateaubriands Erinnerungen von jenseits des Grabes und Beatrix Potters Die Geschichte von Peter Hase hoppelt. Manchmal warf ich das Buch auf den Boden. Madame Payen, eine Insassin, die an meiner Seite wachte, legte ihr Strickzeug zur Seite und hob das Buch für mich auf. Ich warf es wieder hinunter.
Und doch ist so ein kleines Kind rührend. Ich war ein Tyrann. Gefangener im Gips und im LAZARETT. Manchmal kamen Schauspieler aus der Truppe oder Orchestermusiker, um vor dem rachitischen Prinzen zu proben. Die Truppe studierte die Adaption eines Textes ein, dessen Titel auf unsere Nachbarn, die Hochseefischer von Mindin, anzuspielen schien.
Als armes kleines Monster, das von einem frühreifen, maßlosen Größenwahn befallen war, durfte ich bei den Proben dabei sein und bedauerte es sogleich, dass eine so schöne Geschichte nur in unserem kleinen Kreis und nur vorübergehend, für die kurze Zeit einiger Aufführungen, bestehen sollte, und daher machte ich mich daran, die Handlung, die ich für die Erfindung eines Erwachsenen aus der Truppe, vielleicht sogar eines der LAZARETT-Insassen hielt, deren seltsame Äußerungen bisweilen ans Theatralische grenzten, einem breiteren Publikum zur Kenntnis zu bringen, indem ich alles auf mittig gefaltete Blätter schrieb, die ich dann mit blauem Karton und rotem Faden zu einem Buch band, ein Werk, das ich, ohne zu zögern, unterzeichnete, denn alles in allem war ich schließlich der Redakteur und Bearbeiter, und bestimmt wusste niemand, wer dieser sorglose Autor war, der besser daran getan hätte, die Geschichte aufzuschreiben, statt sie dem Publikum von meist wenig aufmerksamen, ja überdrehten Verrückten unseres psychiatrischen Krankenhauses vorzubehalten.
Bücher sind Raubvögel, die Jahrhunderte überfliegen, unterwegs manchmal die Sprache und das Federkleid wechseln und sich auf die Schädel staunender Kinder stürzen. Jahre später las ich den folgenden Satz in Alberto Manguels Tagebuch eines Lesers: »Machado de Assis war (wie Diderot und Borges) der Meinung, dass der Titel eines Buches den Namen des Autors und des Lesers tragen muss, denn beide teilen sich die Vaterschaft.« Ich hätte Die Arbeiter des Meeres gemeinsam mit Victor Hugo unterzeichnen sollen.
Eine kleine Bibliothek
Das Leben ist Verbrechen, Diebstahl, Eifersucht, Hunger, Lüge, Ficksaft, Dummheit, Krankheiten, Vulkaneruptionen, Erdbeben, Leichenhaufen. Daran kannst du nichts ändern, mein alter Freund, und du wirst doch hoffentlich nicht Bücher ausbrüten, oder?
BLAISE CENDRARS, MORAVAGINE
An diesem ziemlich ungebildeten Ort galt der Bariton mehr oder weniger als Gelehrter. In seiner kleinen Bibliothek konnte man einiges an Dichtern und Theaterstücken finden. Seine Helden: Verne, Kipling, Cendrars, symbolische Väter, denen dieselbe Verehrung zuteilwurde wie FLORETT und EISPICKEL, beide bereits verrostet und in den KELLER gewandert wie Reliquien aus einem anderen Leben, aus der Zeit vor dem Lazarett. Schon als er das erste Mal das Gedicht »If« von Rudyard Kipling für mich aufsagte, »Du wirst ein Mann sein, mein Sohn«, hasste ich es. Obwohl ich, wie sicherlich auch er, damals nicht wusste, dass dieses Gedicht Kiplings Sohn das Leben gekostet hatte, ahnte ich es bereits. Die Wut hielt mich dennoch nicht davon ab, die beiden Bände des Dschungelbuchs zu lesen, das mir wie eine Fortsetzung des Fliegenden Teppichs vorkam, von dem ich lange Passagen auswendig konnte, weil Unbeweglichkeit die Erinnerungsfähigkeit enorm steigert:
»An einem Winternachmittag entdeckte Michel durch Zufall die wunderbare Fähigkeit dieses Teppichs. Er saß auf seinem kleinen Stuhl direkt über dem Staat Florida und dachte an den Prinzen aus der Geschichte, die ihm seine Mutter immer erzählte. Plötzlich hatte Michel eine Idee. Er schloss die Augen und sagte: ABRAKADABRA, Teppich, flieg! Als Michel die Augen wieder öffnete, war er in Florida, mitten im Urwald. Er fuhr in einem Indianerkanu den Fluss hinunter. Im grünen Wasser schwammen Alligatoren. Dicke Flechten hingen von den Bäumen herab in den Fluss.«
Nachdem die TISCHLEREI eine Ablage mit geneigter Tischplatte für mich gezimmert hatte, die man mir aufs Bett stellte, strengte ich mich an, nach dem Vorbild von Taba-Tabas großer Rezitation neue Silben für seinen herrlichen, gehämmerten Alexandriner mit Zäsur in der Mitte zu finden. Zwölf Ringe hingen lange / an der Gardinenstange. Ich führte das Einsiedlerleben eines Tattergreises. Vielleicht würde ich rückwärts leben. Der schwarze Ritter wollte Romane zum Schmökern, diese aber selbst auswählen, Empfehlungen wies er zurück: Was hatte sich der Bariton dabei gedacht, als er mir Moravagine von Cendrars empfahl?
Bei der Lektüre der Einleitung, gezeichnet »Blaise Cendrars, La Mimoseraie, April bis November 1925«, muss ihm aufgefallen sein, dass er genau in der Mitte der erzählten Zeit, im August 1925, geboren war. Cendrars behauptet, dass die in Moravagine eingegangenen Dokumente, die er in einem Koffer gefunden habe, mit R. unterzeichnet seien; deshalb beschließt er sein Vorwort: »Und da wir nun einmal zum besseren Verständnis dieses Buches einen Namen brauchen, sagen wir, R. sei … sei … sagen wir, er sei RAYMOND LA SCIENCE.« Raymond la Science und die Anarchisten der Bonnot-Bande hatten sich eine Zeit lang hier im Badeort Saint-Brévin-l’Océan in einer Villa in der Avenue de la Hautière versteckt gehalten. Sie wollten sich hier ein wenig ausruhen, aber davon wusste der Bariton nichts. »Ein Café glich dem anderen. Es war überall dasselbe. In allen herrschte die gleiche Aufregung. Man sprach nur von der Affäre Bonnot.«
Was ihm dagegen nicht entgangen sein konnte, ist die Kritik an der Psychiatrie sowie der Internierung in diesem Roman, die Ablehnung von Einrichtungen wie unserem LAZARETT, wo »man überall die tragische Zucht ahnte, den strengen Stundenlauf, der den Tag der Entgleisten und der Irren regiert, wie eine Geometrie. (…) Ich hätte alle Käfige, alle Menagerien, alle Gefängnisse, alle Irrenhäuser öffnen, die großen Bestien frei sehen mögen, die Entwicklungen eines ungekannten menschlichen Lebens studieren wollen.« Moravagine ist der Erste, der in einem Flugzeug um die Welt reist, was zugleich an Jules Vernes Ballon und an die Weltreise von Phileas Fogg, aber auch an den Gassenhauer aus den Glocken von Corneville erinnert: »Dreimal umfuhr auf wechselvollen / Seereisen ich der Erde Rund«. Ebenso wenig konnte ihm entgangen sein, dass der Irre Moravagine ein krummes rechtes Bein hat und fürchterlich hinkt.
In Managua
Ich verließ das LAZARETT Mitte 1965, einige Monate vor der Präsidentschaftswahl im Dezember, bei der General de Gaulle wiedergewählt wurde. Ich hatte mit der Schere die Fotos und Glaubensbekenntnisse der sieben Kandidaten ausgeschnitten, sie in das Heft geklebt, in dem ich meine Enzyklopädie verfasste. Dann hatte ich einen Schlussstrich unter meine politische Karriere gezogen.
Fünfzig Jahre später, genauer gesagt im Mai 2015, war ich erneut in einem Zimmer eingesperrt, aber geplant und aus freien Stücken, nachdem ich Nahrungsmittel und Zigaretten in ausreichender, wenn nicht übertriebener Menge darin gebunkert, Weißwein kalt gestellt und das kleine Pappschild an den Türgriff gehängt hatte, um Ruhe zu haben.
Auf diese Weise ist es möglich, dem Durcheinander der Zeitzonen und der Unschärfe der beiden Kalenderdaten, die jeden Tag auf dem Planeten gebräuchlich sind, ein Schnippchen zu schlagen, sich aus dem Trubel herauszuhalten, mit im Nacken verschränkten Händen im Limbus zu verharren. Manchmal erwachte ich mitten in der Nacht oder am Nachmittag von einem fernen Singsang, einer Art gehauchtem Corrido auf der Gitarre, erinnerte mich an den Singsang eines marokkanischen Scherenschleifers und fliegenden Händlers, der vor fünfundzwanzig Jahren an der Route de la Targa ausgangs des Stadtviertels Guéliz in Marrakesch Wäschebleiche verkaufte und »Messer, Scheren, Eau de Javiiiil …« rief, oder an die Alexandriner Taba-Tabas auf den Stufen des LAZARETTS. Es gibt keine Chronologie mehr in diesem Halbschlaf, der unser wahres Dasein ist, den wir nur ab und zu verlassen sollten, um Wild zu jagen oder ein Sandwich und Zigaretten zu kaufen, vielleicht auch um die Gattung zu erhalten, und dann, von Neuem ausgestreckt, den Faden der Analogien wieder aufzunehmen, den unsere Träumereien spinnen.
Die ältesten Erinnerungen sind chemisch die haltbarsten. Proteinablagerungen in der Tiefe des Hippocampus. Sobald ich die Augen schloss, spannten sich die Zellen, ein Ton verknüpfte sich mit einer Farbe oder einem Geruch, und ich war zu Besuch im LAZARETT. Das monumentale Tor und der daran anschließende feuchte Seitenflügel. Das Küchenfenster, das zur Flussmündung hinausging, wo die Schiffe vorbeizogen. Der gepflasterte Hof und die Treppen, auf denen Taba-Taba schon morgens saß. Der Rundweg, der alles einschloss und auf dem, vor die Sturzkarre gespannt, ein Pferd trottete. Ich wusste nicht, was nach fünfzig Jahren aus diesen Orten geworden war. Außerdem war Monne, die Grundschullehrerin, zwei Jahre zuvor, im März 2013, in jenem LAZARETT gestorben, in dem sie mir mit dem Fliegenden Teppich das Lesen beigebracht hatte. Einige Wochen vor ihrem Tod hatte man sie als über Vierundachtzigjährige dorthin gebracht, nachdem auch sie diesen Ort jahrzehntelang nicht wiedergesehen hatte.
Monne hinterließ einen Haufen Trödel, drei Zimmer an der Rückseite ihres Hauses in Mindin, nicht weit vom LAZARETT, vollgestopft vom Boden bis zur Decke, aus denen ich drei Kubikmeter Archivmaterial herausgeholt und dann eingelagert hatte, ohne es zu sichten, quasi eine Aufforderung, ja, sogar ein Pharaonen-Fluch, wie sich herausstellte, als ich darin verstreut eine erkleckliche Menge an scharfer Kriegsmunition entdeckte, die jeden in Stücke gerissen hätte, der auf die Idee gekommen wäre, das alles ins Feuer zu werfen.
Kleine Spuren
Als ich im Mai 2015 an einem Nachmittag in Nicaragua im Zimmer des Hotels Barceló auf dem Bett lag, malte ich mir aus, die kommenden Monate damit zu verbringen, im Archiv von Monne zu lesen und mit dem Auto durch die Regionen Frankreichs zu fahren, die ich darin erwähnt finden würde. Um dieses noch recht vage Unternehmen vorzubereiten, blätterte ich, auf dem Bett sitzend und nun vollkommen wach, in einem Kalender, und bevor ich zu den noch weißen Seiten gelangte, las ich noch einmal die, die ich bereits geschwärzt hatte. Dabei zogen die Gesichter derer, denen ich seit Januar begegnet war, an mir vorüber.
Unter dem Vorwand, nach lange zurückliegenden Geschichten zu suchen, war ich häufig und fast überall auf kleine Spuren französischer Gegenwart gestoßen, denen ich seit vier Monaten immer mehr Aufmerksamkeit schenkte. Seit der Ermordung mehrerer Journalisten und Karikaturisten in Paris durch zwei junge Franzosen, die sich auf den islamischen Heiligen Krieg beriefen. Die Nachricht vom Blutbad in den Räumen von Charlie Hebdo hatte mich im Wallis im Chalet der Familie Yersin erreicht. Nachdem ich für einige Tage nach Paris und anschließend nach Saint-Nazaire zurückgekehrt war, hatte ich den Februar in Ecuador verbracht.
Eine Freundin überließ mir ein Appartement in Quito oberhalb des Ortsteils Guápulo. Gleich bei meiner Ankunft sprangen mir an einer steilen Straße die großen Buchstaben in weißer Wandfarbe auf einer ockerfarbenen Mauer entgegen: »Je ne suis pas Charlie« (»Ich bin nicht Charlie«), doch nirgends fand ich Hinweise darauf, wer den Satz geschrieben haben könnte und warum ausgerechnet in dieser Straße.
Ich erwähnte dieses Rätsel gegenüber Edwin Madrid, als wir entlang der Kordilleren-Vulkane nach Norden reisten. Ich setzte meine Recherchen zur Mission von Charles Marie de La Condamine fort, den Ludwig XV. dorthin gesandt hatte, um Breitengradmessungen am Äquator vorzunehmen, was dem Land schließlich seinen Namen gab. Daraufhin hatte ich mich mit der verrückten Idee von Präsident Gabriel García Moreno beschäftigt, aus Ecuador eine französische Kolonie zu machen, ein Vorschlag, den Napoleon III. 1862 ablehnte, der bereits mit seinem Mexiko-Abenteuer beschäftigt war und den Bau des LAZARETTS von Mindin in Angriff nahm.
Die jüngsten Erinnerungen, die der Hippocampus sich noch nicht einverleibt hat, sind fragiler. Jedes Mal notierte ich die Namen der Hotels, gefolgt von einer Telefonnummer und einer Adresse, in meinem Notizbuch: Ich war im Finch Bay Hotel von Puerto Ayora im Galapagos-Archipel abgestiegen, das García Moreno ebenfalls gerne Frankreich geschenkt hätte, dann auf den Spuren von General San Martín, der in Boulogne-sur-Mer starb, im Ramada-Hotel von Guayaquil am Malecón Simón-Bolívar. Ende Februar war ich nach Europa zurückgekehrt, zuerst nach Fribourg ins Hotel de la Rose, dann nach Lyon, anschließend war ich erneut im Walliser Chalet, dann in einem anderen in Chamonix, bevor ich ein Zimmer im Hotel Bauer in Venedig bezog, um das Werk Daniele Del Giudices zu würdigen. Daniele hatte uns Ende der Achtzigerjahre zusammen mit der kleinen Bande von Charlie Hebdo und der des Canard enchaîné auf unserem Erkundungszug nach London begleitet. Ich hätte gerne mit ihm unsere gemeinsamen Abende im Front Page Pub wiederaufleben lassen. Aber Daniele, der unter Gedächtnisschwund leidet, lebt schon lange zurückgezogen drüben auf der Giudecca in einer Klinik über der Lagune. Mit Véronique Yersin bin ich im Motorboot von Roberto Ferrucci und seinem Cousin Giorgio langsam an dem Fenster vorbeigefahren, das der Schriftsteller, der nicht mehr weiß, dass er einst Bücher schrieb, in seinem Zimmer aus unentwegt anstarrt.
Mitte März war ich wieder in Santiago de Chile und im Grand Hyatt an der Avenida Kennedy. In der Fremde erregt Frankreich häufig größeres Interesse als auf den Pariser Caféhaus-Terrassen. Bei einem Essen mit Jorge Edwards, der gerade seinen Botschafterposten in Frankreich aufgegeben hatte, konnte ich die Sorge ermessen, die die Attentate hier auslösten, und die Angst, wie es weitergehen würde. Bei meiner Rückkehr verbrachte ich einige Tage in Madrid in der Residenz des französischen Botschafters, einer maurischen Villa inmitten eines Parks, alles 1941 von Philippe Pétain erworben; eine Woche später, Ende April, war ich im Botolph Club auf der Commonwealth Avenue in Boston, Massachusetts, wo zum Winterende bereits die Bäume blühten, während nicht weit entfernt in Baltimore Rassenunruhen ausbrachen und mehrere Schriftsteller aus den Vereinigten Staaten sich in Zeitungsartikeln, in denen sie Frankreich wegen seiner übertriebenen Laizität anklagten – Anschuldigungen, die bereits Pétain gegen die Republik vorgebracht hat –, dagegen aussprachen, dass man in Washington Charlie Hebdo für den Einsatz für die Meinungsfreiheit auszeichnete, aber wenigstens hatte Salman Rushdie ihnen das Maul gestopft.
In diesem Mai 2015 hatte ich nach einem kurzen Zwischenaufenthalt in der Schweiz, im Hotel National Bern, und dem Besuch der Gauguin-Sammlung in Basel einige Tage im Hotel Victoria in Warschau übernachtet, wo ich unter all den Hinweisen auf Frankreichs Geschichte von Ludwig XVI. bis Pétain, die seit vier Monaten meinen Weg markierten wie zufällig ausgestreute weiße Kiesel, zum ersten Mal jene hohe Statue sah, die seit 2005 auf der Kreuzung der Nowy Swiat zu Ehren General de Gaulles steht, oder besser gesagt, zu Ehren des Stabsoffiziers de Gaulle, der in den Zwanzigerjahren die polnische Armee im Krieg gegen die Rote Armee Trotzkis beraten hatte. Doch im Text der polnischen Nationalhymne wird nach wie vor der Name Bonapartes besungen.
Als ich, auf diesem Hotelbett in Nicaragua liegend, den Kalender zuklappte, war für mich absehbar, dass ich diese kleinen Spuren der französischen Geschichte seit dem Zweiten Kaiserreich, seit der Epoche des kleinen, weiß gekleideten Mädchens aus Kairo und der Errichtung des LAZARETTS, nicht nur in Monnes Archiv, sondern rund um die Welt einsammeln würde.
Ein historischer Kanal
Zu den Erfindungen der Menschheit, die mir seit der Zeit im LAZARETT über alle Maßen gefielen, zählten Reiterstatuen und große, künstliche Schifffahrtswege: der Suezkanal, den Ferdinand de Lesseps durch Ägypten bohrte, der Panamakanal, dessen Bauleitung ihm entzogen wurde, ebenso wie der Nicaragua-Kanal, von dem nie ein Meter gegraben wurde.
Was Letzteren betrifft, so gab es Neuigkeiten, als ich von Warschau nach San José in Costa Rica gereist war, wo ich ausging und durch den Regen stapfte. Am Abend hatte ich Carlos Cortés und Rodrigo Soto in die Bar des Hotels Balmoral in der Avenida Central eingeladen. Sie hatten mir zwanzig Jahre zuvor dabei geholfen, das Leben William Walkers und seine drei großen Vorhaben zu rekonstruieren, die Wiedereinführung der Sklaverei, die Ablösung der spanischen durch die englische Sprache und die Grabung eines Kanals in Nicaragua zwischen dem Atlantik und dem Pazifik. Eineinhalb Jahrhunderte später haben sich nun die Chinesen des Projekts angenommen.
In Managua traf ich Sergio Ramírez und Antoine Joly wieder. Ersterer war nach der Revolution von 1979 Vizepräsident der Sandinistischen Republik gewesen. Er hatte gerade Un cuento chino (Eine chinesische Geschichte) veröffentlicht, ein Pamphlet, in dem er dieses absurde Projekt verspottete. Joly war damals unser Botschafter in Managua und hatte einen langen Artikel an die Presse geschickt, Un sueno frances, der an die Geschichte des Kanals seit dem Zweiten Kaiserreich erinnerte.
Nach der standrechtlichen Erschießung William Walkers 1860, als Lesseps gerade sein Kanal-Projekt in Ägypten abschloss, hatten Napoleon III. und die neue Regierung von Nicaragua einen Vertrag zum Bau dieses interozeanischen Kanals unterzeichnet. Die Vereinigten Staaten und England drohten mit Krieg. Der Kaiser warf das Handtuch und beschloss später, Mexiko anzugreifen. Aus diesen politischen Gründen und im Widerspruch zu den geologischen Bedingungen richtete Lesseps seine Baustelle, auf der Paul Gauguin als Erdarbeiter beschäftigt war, in Panama ein.
Soeben, im Jahr 2015, hatte Daniel Ortega, der alte und neue Präsident von Nicaragua, einen Vertrag mit der »Hong Kong Nicaragua Canal Development Investment Co. Ltd« über eine Laufzeit von hundert Jahren geschlossen. Er begann mit der Umsiedlung der Bauern in der Region, die sich dagegen auflehnten, und die Liste der seit eineinhalb Jahrhunderten durch diesen Phantomkanal Gestorbenen wurde immer länger. Auch wenn die Chinesen sich darauf berufen konnten, dass ihr technisches Wissen weit zurückreicht und sie bereits vor tausend Jahren den Großen Kanal von Hangzhou nach Peking über eine Strecke von fast zweitausend Kilometern gegraben hatten, schien das Vorhaben einen Imperialismus der neuen Art zu bemänteln. Die HKND plante den Bau von zwei Häfen, Brito am Pazifik und Aguila auf der karibischen Seite, doch vor allem riss sie sich riesige landwirtschaftliche Flächen unter den Nagel, ohne irgendeine Verpflichtung, den Kanal früher als in hundert Jahren zu bauen.
Mittelamerika war ein guter Ort, um erneut einen Anlauf zu nehmen und mich auf das Frankreich von 1860 zu stürzen. Ich erinnerte mich an dieses Jahr, als hätte ich es selbst erlebt. Ich wartete also jeden Morgen auf die Zeitung, durch die ich von der Entdeckung der Tempelanlagen von Angkor-Wat in Kambodscha durch Henri Mouhot erfahren würde. Oder ich verweilte unsichtbar, wie ein beim Tischrücken herbeigerufenes Gespenst aus der Zukunft, im Arbeitszimmer von Victor Hugo auf Guernesey und las, sechs Jahre bevor wir zusammen Die Arbeiter des Meeres verfassten, über seine Schulter gebeugt den Brief, den er im Mai zur Unterstützung Garibaldis und des Zugs der Tausend in Italien schrieb. Nachdem er die Seite mit Löschpapier getrocknet hatte, nahm er ein frisches Blatt Papier, um die Plünderung des Sommerpalasts in Peking im Oktober durch französische und englische Truppen zu brandmarken, die dieses eine Mal gemeinsame Sache gemacht hatten: »Einer der beiden Banditen würde Frankreich heißen, der andere England.« Und der große Name Hugos wird noch immer überall, in Asien ebenso wie in Mexiko, dafür verehrt, dass er sich der kolonialen Unternehmung des Zweiten Kaiserreichs, dem »niederträchtigen Gewaltakt gegen ein freies Volk«, entgegengestellt hat.
Heim zu den Franzosen
Was ist ein König neben einem Franzosen?
SAINT-JUST
Das Leben der Völker verläuft wie das der Menschen nicht chronologisch, manchmal sehen sie sich in ihrem Halbschlaf aufs Neue jung und stürmisch, beim Aufwachen werden sie traurig, weil sie entdecken, wie alt sie in den Augen der anderen sind, und Ereignisse, die man unter dem Staub der Jahrhunderte vergessen glaubte, wirken sich mit einem Mal auf die Gegenwart aus und erschüttern die Zukunft.
Wenngleich ich mit dem Gedanken spielte, die Geschichte des Kanals weiter zu verfolgen und in Nicaragua zu bleiben, war mir klar, dass ich mich schon seit einigen Tagen auf das »monneske« Vorhaben eingelassen hatte, und als mir dazu das Telegramm einfiel, das de Gaulle nach der Befreiung an den noch in Brasilien weilenden Bernanos schickte, »Ihr Platz ist unter uns«, spürte ich, dass meine Anwesenheit dort unbedingt erforderlich war und dass ich mich dem Appell meiner ungeduldigen Landsleute nicht entziehen konnte, die kurz davorstanden, sich auf dem Vorplatz des Trocadéro zu versammeln, sich in Massen zum Quai d’Orsay zu begeben, um meine Rückkehr zu fordern und mich an die Spitze eines Wohlfahrtsausschusses zu setzen.
Es schien mir also an der Zeit, das Zimmer im Barceló in Managua zu verlassen, zum Flughafen Augusto-César Sandino zu fahren, um im Archiv von Monne anderthalb Jahrhunderte französische Konfetti aufzuwirbeln und die Geister der Kindheit aufzusuchen: Taba-Taba in der blauen Anstaltskluft des LAZARETTS und das kleine Mädchen im weißen Spitzenkleid, das in Marseille mit seinen Eltern von Bord eines weißen Dampfers der Reederei Messageries Impériales ging und am Bahnhof Saint-Charles in den Zug nach Paris stieg, wie auch ihren Enkel, der Bariton war, aber auch Motorradfahrer, bevor er Clown wurde.
Auf dem Rundweg
Es könnte den Ausgangspunkt für die Nachforschungen bilden: ein Schwarz-Weiß-Foto von 1956, ein typischer Abzug aus der damaligen Zeit, auf allen vier Seiten von einem weißen Rand umgeben. Das Motorrad hat einen geringen Hubraum und ist mit einem leicht erhöhten Sitz für den Sozius ausgestattet. Es steht nicht weit weg vom monumentalen Tor, wo Taba-Taba immer saß, vor dem LAZARETT im Sand. Im Vordergrund hält ein Mann, der eine zugeknöpfte dunkle Jacke und eine Reithose trägt, mit behandschuhten Händen die beiden Griffe des Lenkers fest. Die schwarze Haarsträhne ist nach hinten gestrichen, der Blick ernst, der Oberkörper stramm. Er sieht nicht über ein halbes Jahrhundert hinweg auf die Nachwelt, sondern auf seine Schwester Monne, die ihn fotografiert. Seine Mutter und seine Schwester nennen ihn immer noch Loulou, und das ärgert ihn ein wenig. Er ist einunddreißig Jahre alt, Monne vierunddreißig. Beide sind unverheiratet. Was ihn angeht, nicht mehr lange, wie er hofft. Deshalb kann er es kaum erwarten, auf den Kick-Starter zu treten, um loszufahren und sich hundert Kilometer weiter im Norden, nicht weit von Rennes, mit seiner Verlobten zu treffen. Monne macht sich einen Spaß daraus, ihn aufzuhalten. Er setzt seinen Helm auf, zurrt den Kinnriemen fest. Wie alle jungen Männer seines Alters hat er schon viel erlebt, in Flüchtlingslagern, Gefangenenlagern, bei Fluchten zu Fuß über die Landstraßen. Er hat Geige und Fechten gelernt, im Maquis gekämpft, war mit neunzehn Jahren als Sieger im Triumph durch das befreite Cahors gezogen: Jetzt würde er, wenn’s geht, gerne ein friedliches Leben führen.
Er weiß wohl, dass Frankreich seit der Befreiung trotz allem weiter im Krieg ist. Die Kämpfe in Indochina haben erst zwei Jahre zuvor, im Mai 1954, in Diên Biên Phu ein Ende gefunden. Einige Monate später, am »Roten Allerheiligen«, dem blutigen 1. November, beginnt der Algerienkrieg. Im Jahr 1956 folgt dann die Suezkrise. Frankreich und England verbünden sich erneut und schicken Truppen nach Ägypten, um eine Verstaatlichung des Suezkanals durch Präsident Gamal Abdel Nasser zu verhindern. Nicht, dass ihm die internationale Lage gleichgültig wäre, er liest die Zeitungen, aber jetzt reicht es. Jetzt geht es um etwas anderes. Lassen wir ihn nicht länger warten, sondern mit einem Tritt sein Motorrad starten. Gehen wir von der Fotografie zum Film über und schauen ihm nach, wie er über den Rundweg davonfährt und das LAZARETT hinter sich lässt, um zu seiner Verlobten zu gelangen. In einem Jahr werden sie heiraten. Von da bis zur Geburt eines Hinkebeins ist es nur ein kleiner Schritt.
In Zamalek
Aber das alles könnte ebenso ein Jahrhundert zuvor, 1858, auf der anderen Seite des Mittelmeers begonnen haben, im Kielwasser von Bonapartes sehr kurzlebiger Französischer Republik in Ägypten, an die man sich kaum noch erinnert. Während Ferdinand de Lesseps, jetzt Generalkonsul, zusammen mit den Saint-Simonisten das Unternehmen Suezkanal in Angriff nimmt, entwirft ein gewisser Eugène Lorion für Fürst Mustafa Bey die Gärten von Kairo und Alexandria.
Ich war auf der Insel Gezira im Hotel Longchamps an der Ismail-Mohammed-Straße im Kairoer Stadtteil Zamalek abgestiegen mit dem Ziel, die Geschichte von ihren Anfängen her aufzurollen. Zur Zeit des weiß gekleideten Mädchens war die Insel noch wild und wurde oft vom Hochwasser überschwemmt. Nach der Trockenlegung entstanden gehobene Wohnviertel, siedelten sich Botschaften an. Die Engländer pflanzten Niem- und Zedrachbäume, die sie aus Indien mitgebracht hatten, die Franzosen wie überall Platanen. Von dieser ein wenig altersschwach und gebrechlich gewordenen pflanzlichen und architektonischen Üppigkeit bewahrt das Longchamps noch eine diskrete Eleganz, eine kleine, von Topfpflanzen überwucherte Terrasse und auf den Fluren dunkle Bücherregale und Schwarz-Weiß-Fotos in Mahagonirahmen. Von hier kann man zu Fuß über die Löwenbrücke, heute Kasr-El-Nil-Brücke, wo noch immer die vier großen, von Henri-Alfred Jacquemart geschaffenen Raubkatzen thronen, zum Tahrir-Platz gehen. Es ist dieselbe Brücke, über die Ende Januar 2011 Zehntausende von Demonstranten zusammenströmten, um den Rücktritt von Husni Mubarak zu fordern, was sie schließlich erreichten.
Vom Café Riche unweit des Tahrir-Platzes aus hatte ich einige Straßen weiter das ehemalige französische Konsulat ausfindig gemacht, wo Pater Schehadé, ein Dominikaner aus der Abtei École de Sorèze, 1946 ein Duplikat der Geburtsurkunde des weiß gekleideten Mädchens hatte anfertigen lassen. Zuvor, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, war unser Geburtenregister in Alexandria aufbewahrt worden, bis die Engländer 1882 das französische Konsulat dort bombardierten.
Mit dem ägyptischen Romancier Mahmoud Tawfik, mit dem ich in Saint-Nazaire wenige Tage nach den Attentaten auf Charlie Hebdo und den koscheren Supermarkt zu Abend gegessen hatte, war ich in der Gegend um die Al-Ahzar-Moschee durch die Gassen der Altstadt von Kairo bis zum Café Nagib Machfus geschlendert, dann waren wir zum Mittagessen über jene schnurgerade Straße in Gizeh zum Mena House gefahren, an der die Islamisten seit ihrer Entmachtung 2013 von Zeit zu Zeit auf die wenigen Touristenbusse schießen, um das Land zu ruinieren und seinen neuen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi in Schwierigkeiten zu bringen.
Tatsächlich waren wir an diesem Tag die einzigen Gäste in dem riesigen Saal mit der lackierten Holztäfelung. Rund ein Dutzend zur Untätigkeit verdammte Kellner und eilfertige Oberkellner boten uns mit einer burlesken, kinoreifen Einlage den besten Tisch an, vor dem sich majestätisch die Große Pyramide erhob, an der hinter den Palmenwedeln die Flammen des Pharaonengottes hinabglitten, und eine Lehmmauer den etwaigen Gästen des Palasts den Anblick der armseligen Verkaufsbuden und der Ställe mit den ungenutzten Kaleschen ersparte. Bei einer Flasche Weißwein und Heringskartoffeln in Öl kamen wir auf unsere Unterhaltung in Saint-Nazaire zurück, sprachen über die Lage der muslimischen Welt insgesamt und besonders über die in Kairo und Paris.
Nach meiner Rückkehr ins Stadtzentrum legte ich jenes Dokument auf meinen Schreibtisch im Zimmer Nr. 3 des Longchamps, das Kairo im Koffer eines libanesischen Dominikanerpriesters verlassen hatte und das ich in meinem Gepäck mitführte:
Das Französische Konsulat von Kairo, Auszug aus dem Geburtenregister, Urkunde Nr. 120 vom 13. Januar 1858:
wurde in Kairo, Ägypten, ein Kind weiblichen Geschlechts geboren, das den Vornamen Eugénie Joséphine bekam; der Vater ist Herr Lorion Eugène, Gärtner im Dienste Seiner Hoheit, Fürst Mustafa Bey, wohnhaft in Kairo, die Mutter Frau Joséphine Thirion, wohnhaft in Kairo;
hiermit wird bestätigt, dass dieser Auszug mit den Angaben im Geburtenregister übereinstimmt. Kairo, den achten August neunzehnhundertsechsundvierzig, der Französische Konsul in Kairo.
Im selben Jahr, dem Geburtsjahr des weiß gekleideten Mädchens, gründet der französische Ägyptologe Auguste Mariette, ein Schüler Champollions, das Museum von Kairo. Weiter südlich bekommen die englischen Forschungsreisenden Speke und Burton als erste Europäer den Tanganjikasee zu sehen. Und vier Jahre später – vielleicht hat Fürst Mustafa aus botanischen oder geopolitischen Gründen genug von französischen Gärten und bevorzugt nun englische? – beschließt der Vater, Ägypten mit Frau und Kind zu verlassen und seine kleinen Ersparnisse in die fruchtbare Erde der Beauce im Herzen Frankreichs zu investieren. Einen Dattelbaum, eine Bananenpflanze oder einen Baum der Reisenden würden sie wohl nie wieder in ihrem Leben sehen.
Von der Flutung des Timsahsees mit Wasser aus dem Mittelmeer am 18. November 1862 sollte das Paar einige Monate nach seiner Abreise aus den Zeitungen erfahren. Der Suezkanal wurde jedoch erst sieben Jahre später für die Schifffahrt freigegeben. Zusammen mit dem algerischen Emir Abd el-Kader wohnte Kaiserin Eugénie der Eröffnungsfeier unter einem hübschen Glaspavillon mit Trägern aus Gusseisen bei, den man extra zu diesem Zweck in Frankreich hergestellt hatte. Als nach der Kanaleröffnung der Weg nach Asien frei war, machte der Kaiser ihn König Norodom von Kambodscha zum Geschenk, der ihn in seinem Palast im Stadtzentrum von Phnom Penh aufstellen ließ, wo er heute noch steht.