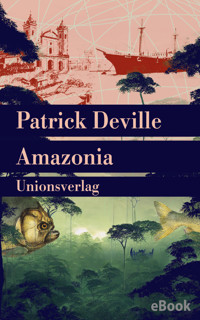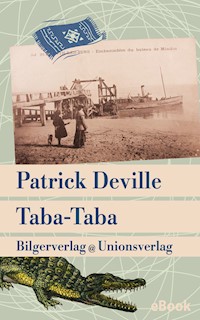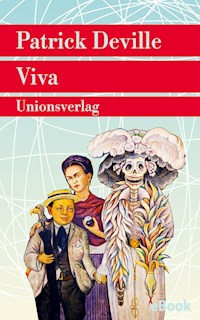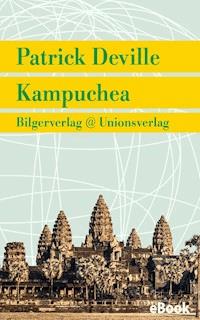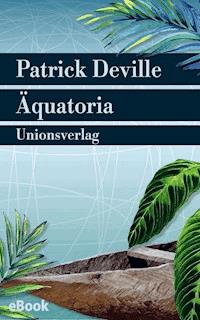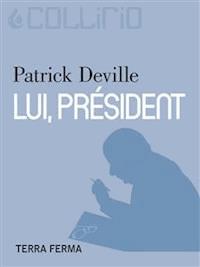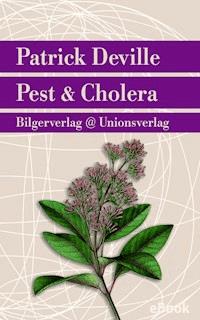
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Alexandre Yersin, Arzt, Forscher, Seefahrer, Landwirt, Geograf und Mitarbeiter Louis Pasteurs, wird von einer unbändigen Neugier um die Welt getrieben. Als Schiffsarzt befährt er die Meere Asiens und stürzt sich in immer neue wissenschaftliche Abenteuer. In China gelingt ihm unter dramatischen Umständen eine sensationelle Entdeckung: Er identifiziert den Pestbazillus und entwickelt als Erster einen Impfstoff gegen die Geißel der Menschheit. Der französische Schriftsteller und Bestsellerautor Patrick Deville erzählt in einem leidenschaftlichen Abenteuerroman von diesem außergewöhnlichen Mann und seiner Epoche.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 294
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Über dieses Buch
Der französische Bestsellerautor erzählt in einem leidenschaftlichen Abenteuerroman von einem außergewöhnlichen Mann und seiner Epoche. Alexandre Yersin, Arzt, Forscher, Seefahrer, Landwirt, Geograf und Mitarbeiter Louis Pasteurs, entdeckt in China den Pestbazillus und entwickelt als Erster einen Impfstoff gegen die Geißel der Menschheit.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Patrick Deville (*1957) studierte Literatur und Philosophie. Er lebte im Nahen Osten, in Afrika und bereiste Lateinamerika. Seine Werke wurden mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, unter anderem als »bester Roman des Jahres« der Zeitschrift Lire, mit dem Fnac-Preis und dem Prix Femina.
Zur Webseite von Patrick Deville.
Holger Fock (*1958) studierte Theaterwissenschaft, Germanistik und Philosophie. Er übersetzt seit 1983 französische Literatur, u. a. Gegenwartsautoren wie Andreï Makine, Cécile Wajsbrot (beide zusammen mit Sabine Müller), Pierre Michon und Antoine Volodine. Er lebt bei Heidelberg.
Zur Webseite von Holger Fock.
Sabine Müller (*1959) studierte Germanistik, Philosophie und Pädagogik. Sie übersetzt aus dem Französischen und Englischen, u. a. Werke von Andreï Makine, Cecile Wajsbrot, (beide zusammen mit Holger Fock), Erik Orsenna, Philippe Grimbert, Annie Leclerc und Alain Mabanckou.
Zur Webseite von Sabine Müller.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Patrick Deville
Pest & Cholera
Roman
Aus dem Französischen von Holger Fock und Sabine Müller
E-Book-Ausgabe
Bilgerverlag @ Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Dieses E-Book des Bilgerverlags erscheint in Zusammenarbeit mit dem Unionsverlag.
Die Originalausgabe erschien 2012 bei Éditions du Seuil, Paris.
Die deutsche Erstausgabe erschien 2013 im Bilgerverlag, Zürich.
Originaltitel: Peste & Choléra
© by bilgerverlag GmbH, Zürich 2013
© der Originalausgabe by Éditions du Seuil, Paris 2012
© by Bilgerverlag, Zürich 2024
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Franz Eugen Köhler (Wikimedia Commons)
Umschlaggestaltung: Heike Ossenkop
ISBN 978-3-293-30993-7
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 18.05.2024, 04:21h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
PEST & CHOLERA
Letzter FlugInsektenIn BerlinIn ParisDie AbfuhrIn der NormandieEin großer Eisenturm im Zentrum der WeltEin SchiffsarztIn MarseilleAuf SeeParallele LebenAlbert & AlexandreWährend des FlugsIn HaiphongEin Arzt für die ArmenDer lange MarschIn Phnom PenhEin neuer LivingstoneIn DalatArthur & AlexandreUnterwegs zu den SedangIn HongkongIn Nha TrangIn MadagaskarDer ImpfstoffIn KantonIn BombayDas wahre LebenIn HanoiDie HühnerkontroverseEine ArcheEin Vorposten des FortschrittsDer Kautschuk-KönigFür die NachweltObst & GemüseIn VaugirardMaschinen & WerkzeugDer Chinarinden-KönigAlexandre & LouisBeinahe ein DwemAuf der VerandaDas Gespenst der ZukunftDie kleine BandeDas MeerDanksagungMehr über dieses Buch
Über Patrick Deville
Über Holger Fock
Über Sabine Müller
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Bücher von Patrick Deville
Zum Thema Frankreich
Zum Thema Schweiz
Zum Thema China
Zum Thema Sri Lanka
Zum Thema Geschichte
Zum Thema Medizin
Zum Thema Kolonialismus
Oh ja!, legendär werden an der Schwelle
Zu den Jahrhunderten der Scharlatane!
Laforgue
Letzter Flug
Die alte, fleckige Hand mit dem gespaltenen Daumen schiebt eine pongéseidene Gardine zur Seite. Auf die schlaflose Nacht folgt das rote Leuchten der Morgendämmerung mit dem gloriosen Messingbecken. Das Hotelzimmer in Schneeweiß und Mattgold. In der Ferne der große, hinter einem dünnen Nebelschleier aufragende Eisenturm, der mit seinen Sprossen das Licht zerteilt. Unten die leuchtend grünen Bäume des Square Boucicaut. Die Stadt ist ruhig im Kriegsfrühling. Von Flüchtlingen überschwemmt. All den Menschen, die glaubten, sie würden sich in ihrem Leben nicht mehr vom Fleck bewegen. Die alte Hand löst sich vom Fensterriegel und fasst nach dem Griff des Koffers. Sechs Stockwerke tiefer geht Yersin durch die Drehtür aus lackiertem Holz und Messing. Ein Fahrer in Uniform schließt die Taxitür hinter ihm. Yersin flieht nicht. Er ist nie geflohen. Er hat diesen Flug schon Monate zuvor in einem Reisebüro in Saigon gebucht.
Er ist nun nahezu kahlköpfig, mit weißem Bart und blauen Augen. Trägt ein Gentleman-Farmer-Sakko und eine beigefarbene Hose, ein weißes Hemd mit offenem Kragen. Die großen Fenster des Flughafens Le Bourget gehen auf das Rollfeld hinaus, wo ein Flugboot auf seinem Fahrwerk wartet. Ein kleiner weißer Wal mit rundem Bauch für ein Dutzend Passagiere. Man rollt die Gangway an die linke Seite des Rumpfs, denn die ersten Flieger, zu denen Yersin gehörte, waren Reiter. Er will zu seinen kleinen annamitischen Pferden zurückkehren. Auf den Sitzbänken im Warteraum eine Handvoll Flüchtlinge. Tief unter den Hemden und Abendkleidern in ihrem Gepäck Geldbündel und Goldbarren. Die deutschen Truppen stehen vor Paris. Die Passagiere hier, die auf die Wanduhr und auf ihre Armbanduhren schauen, sind reich genug, um nicht zu kollaborieren.
Ein Motorrad mit Beiwagen der Wehrmacht würde genügen, um den kleinen weißen Wal am Boden festzunageln. Der Start verzögert sich. Yersin beachtet die besorgten Gespräche nicht, er notiert einen oder zwei Sätze in sein Notizbuch. Über dem Cockpit, wo die Flügel auf den Rumpf treffen, beginnen die Propeller sich zu drehen. Das Flugboot rollt über den Teermakadam. Am liebsten würden die Flüchtenden es anschieben, zur Eile antreiben. Alle haben an Bord Platz genommen. Man hilft ihm die Leiter hinauf. Es ist der letzte Maitag 1940. Die Hitze lässt das Trugbild einer Pfütze auf dem Rollfeld tanzen. Das Flugzeug vibriert und hebt ab. Die Flüchtlinge wischen sich über die Stirn. Es ist für mehrere Jahre der letzte Flug der Air-France-Fluggesellschaft. Noch weiß man es nicht.
Es ist auch der letzte Flug für Yersin. Er wird nie mehr nach Paris zurückkommen, nie mehr in seinem Zimmer im sechsten Stock des Lutetia wohnen. Er ahnt es wohl und beobachtet tief unten die Kolonnen der Massenflucht durch die große, nahezu baumlose Tiefebene im Südwesten von Paris. Fahrräder und Karren, vollgestopft mit Möbeln und Matratzen. Lastwagen im Schritttempo zwischen denen, die zu Fuß unterwegs sind. All das unter den Schauern der Frühlingsstürme. Schwärme aufgeschreckter Insekten, die vor den Hufen der Herde fliehen. Alle seine Nachbarn im Lutetia haben das Hotel verlassen. Der hoch aufgeschossene irische Brillenträger, Joyce, immer im Dreiteiler, ist bereits im Département Allier. Matisse erreicht Bordeaux und von dort Saint-Jean-de-Luz. Das Flugzeug fliegt Richtung Marseille. In der Zange zwischen Faschismus und Franquismus. Während im Norden, bevor er zuschlägt, der Skorpion den Schwanz aufrichtet. Die braune Pest.
Er, Yersin, kennt beide Sprachen und beide Kulturen, die deutsche und die französische, und ihre alten Streitigkeiten. Er kennt auch die Pest. Sie trägt seinen Namen. An diesem letzten Tag im Mai 1940, als er das letzte Mal durch den stürmischen Himmel über Frankreich fliegt, schon seit sechsundvierzig Jahren.
Yersinia pestis.
Insekten
Der alte Mann blättert im Notizbuch, dann schläft er unter dem Brummen der Motoren ein. Seit Tagen hatte er keinen Schlaf finden können. Das Hotel war überschwemmt von Freiwilligen der Zivilverteidigung mit ihren gelben Armbinden. Nachts Fliegeralarm. Im Schutzraum am Ende der Gänge im Untergeschoss, in denen die Flaschen lagern, waren Sessel aufgestellt. Hinter den geschlossenen Augenlidern das Spiel der Sonne auf dem Meer. Fannys Gesicht. Die Reise eines jungen Paars in die Provence und bis nach Marseille, um Insekten zu fangen. Wie soll man die Geschichte des Sohnes ohne die des Vaters schreiben. Dessen Geschichte war kurz. Der Sohn hat ihn nie gekannt.
Bei den Yersins und ihren Nachbarn in Morges, im Kanton Waadt, regiert nicht die Not, aber strikte Genügsamkeit. Ein Rappen ist dort ein Rappen. Die abgelegten Kleider der Mütter werden von den Bediensteten aufgetragen. Diesem Vater gelingt es, mit Hilfe von Privatunterricht in Genf einen höheren Schulabschluss zu erwerben, eine Zeitlang unterrichtet er an einem Gymnasium, begeistert sich für Botanik und Insektenkunde, doch um sein täglich Brot zu verdienen, arbeitet er in der Verwaltung der Munitionsanstalt. Er trägt die lange, taillierte schwarze Jacke und den Zylinder der Wissenschaftler, er weiß alles über Käfer, spezialisiert sich auf Heuschrecken und die Familie der Feldheuschrecken.
Er zeichnet Grashüpfer und Grillen, tötet sie, betrachtet die Deckflügel und Fühler unter dem Mikroskop, korrespondiert mit der waadtländischen Gesellschaft für Naturkunde und sogar mit der Entomologischen Gesellschaft Frankreichs. Dann hat er es geschafft, er übernimmt die Leitung der Munitionsanstalt. Er untersucht weiter das Nervensystem des Heimchens und modernisiert die Munitionsanstalt. Seine Stirn zerquetscht eine letzte Grille. In einem letzten Krampf stößt ein Arm die Glasbehälter um. Alexandre Yersin stirbt mit achtunddreißig Jahren. Ein grüner Käfer wandert über seine Wange. Eine Heuschrecke verfängt sich in seinem Haar. Ein Kartoffelkäfer spaziert in seinen offenstehenden Mund. Seine junge Frau Fanny ist schwanger. Die Witwe des Leiters wird die Munitionsanstalt verlassen müssen. Nach der Grabrede kommt, inmitten von Wäschebündeln und aufgestapeltem Geschirr, ein Kind zur Welt. Es erhält den Vornamen des verstorbenen Gatten.
In Morges erwirbt die Mutter ein Haus am Ufer des klaren und kalten Sees, La Maison des Figuiers, und verwandelt es in ein Mädchenpensionat. Fanny ist eine elegante Frau mit guten Umgangsformen. Sie bringt den Mädchen Hauswirtschaft und Kochen bei, dazu ein wenig Malerei und Musik. Der Sohn wird diese Tätigkeiten sein Leben lang verachten, Kunst und Unterhaltung verwechseln. Malerei und Literatur und der ganze Quatsch wird ihn immer an die Belanglosigkeiten derer erinnern, die er in seinen Briefen Vogelscheuchen nennt.
Stellen wir uns also einen Wildfang vor, Schlingen legen, Getier aufstöbern, mit einer Lupe Feuer entfachen, völlig verdreckt heimkehren wie aus dem Krieg oder von einer Forschungsreise in den Dschungel. Der Junge ist allein und streift durch die Felder, badet im See oder baut Drachen. Er fängt Insekten, zeichnet sie, spießt sie mit einer Nadel auf und fixiert sie auf einem Karton. Das rituelle Opfer erweckt die Toten wieder zum Leben. Vom Vater erbt er Embleme – wie in einem kriegerischen Volksstamm Lanze und Schild –, Mikroskop und Skalpell, die er aus einem Koffer auf dem Speicher holt. Vor uns steht ein zweiter Alexandre Yersin und ein zweiter Insektenkundler. Die Sammlungen des Toten befinden sich im Genfer Museum. Das kann ein Lebensziel sein: seine Tage mit trockenen Studien verbringen, so lange, bis einem selbst ein Blutgefäß im Gehirn platzt.
Außer der Folterung von Insekten gibt es im Kanton Waadt seit vielen Generationen kaum etwas zur Zerstreuung. Schon der Gedanke daran ist verdächtig. In diesem Landstrich ist das Leben Buße für die Sünde zu leben. Die Familie Yersin sühnt im Schatten der evangelischen Freikirche, die in Lausanne aus einer Spaltung innerhalb des waadtländischen Protestantismus hervorgegangen ist. Diese verweigert dem Staat das Recht, ihre Pfarrer und den Unterhalt der Kirchen zu bezahlen. In ihrer Mittellosigkeit und Strenggläubigkeit bluten die Frommen, um zum Unterhalt ihrer Prediger beizutragen. Das ist ein anderes Paar Stiefel als einen Geistlichen zu verköstigen, auch wenn der bei Tisch kräftig zulangt. Der gottgefällige Pfarrer – seid fruchtbar und mehret euch – ist vom Schlage derer, die sich mit wahnwitziger Geschwindigkeit fortpflanzen. Riesige Familien sitzen im Nest und sperren den Schnabel auf. Die abgetragenen Kleider der Mütter gehen nicht mehr an die Bediensteten. Die Frommen hüllen sich in eine Toga aus elitärem Bewusstsein und Rechtschaffenheit. Sie sind die Reinsten und dem materiellen Leben Fernsten, Aristokraten des Glaubens.
Von dieser hochmütigen Kälte im blauen Frost der Sonntage habe der kleine Kerl, heißt es, die schroffe Aufrichtigkeit und die Verachtung für weltliche Güter bewahrt. Der aus Langeweile gute Schüler wird ein fleißig lernender Jugendlicher. Die einzigen Männer, die in dem kleinen, blumengeschmückten Salon der Maison des Figuiers vorgelassen werden, sind mit der Mutter befreundete Ärzte. Nun heißt es, zwischen Frankreich und Deutschland und ihren beiden Universitätsmodellen wählen. Östlich des Rheins Hauptvorlesungen und große Theorie, Wissenschaft von der Kanzel herab, verkündet durch Gelehrte in schwarzem Anzug mit Zelluloidkragen. In Paris die klinische Ausbildung am Krankenbett und im weißen Kittel, das sogenannte Patronats-Modell, das der Erfinder des Stethoskops, René Laënnec, entwickelt hat.
Die Wahl fällt auf Marburg, wegen der Mutter und den Freunden der Mutter. Yersin wäre lieber nach Berlin gegangen, doch er ist in der Provinz gelandet. Fanny mietet für ihren Sohn ein Zimmer bei einem angesehenen Professor, einer Kapazität, der an der Universität predigt, aber die Messe besucht. Yersin gehorcht und meidet das andere Geschlecht. Ist in Bewegung. Seine Träume sind die eines Kindes. Er beginnt einen Briefwechsel mit Fanny, der erst mit ihrem Tod endet. »Wenn ich Arzt bin, hole ich dich und wir lassen uns in Südfrankreich oder in Italien nieder, nicht wahr?«
Französisch wird eine Geheim-, eine mütterliche Sprache, ein Schatz, die Sprache der Abende und der Briefe an Fanny.
Er ist zwanzig und muss sein Leben nun ganz auf Deutsch führen.
In Berlin
Doch zuerst muss er sich ein langes Jahr gedulden. In einem Brief vom Juli schreibt er, »es regnet wie immer, es ist kalt, Marburg ist eindeutig nicht das Land der Sonne«. Die Arztausbildung ist ebenso enttäuschend wie das Klima. Yersin denkt pragmatisch, experimentell, er muss die Dinge sehen und berühren, sie in den Händen haben, Drachen bauen. Die Koryphäe, bei der er Untermieter ist, hat ein ernstes Gesicht, das einer Banknote zur Zierde gereichen würde. Die Amerikaner haben dafür ein Wort: Dwem (Dead white european male), tote weiße Europäer, piekfein und hochgelehrt, mit Spitzbart und Kneifer.
Marburg besitzt vier Universitäten, ein Theater, einen botanischen Garten, ein Gericht und ein Krankenhaus. Alles zu Füßen des hessisch-landgräflichen Schlosses. Ein Rechercheur und Schreiber, bewaffnet mit einem Maulwurfsleder-Notizbuch, ein Gespenst aus der Zukunft, das auf den Spuren Yersins im Hotel Zur Sonne absteigt und auf der Suche nach der Jugend des Helden die abschüssigen Straßen und die Lahn entlanggeht, findet mitten in dieser friedlichen Insel der Kultur unter dem grauen, tiefhängenden Himmel mühelos das hohe Fachwerkhaus, in dem der Jüngling mit den ernsten blauen Augen und dem aufkeimenden Bart Trübsal bläst.
Das Gespenst kann ebenso durch Mauern gehen wie durch die Zeit, es sieht die dunklen Holzmöbel, die dunklen Ledersessel hinter der Fachwerkfassade und die dunklen Ledereinbände in der Bibliothek. Schwarz und Braun auf einem flämischen Gemälde. Abends das Gold der Lampen beim gemurmelten Segen, beim schweigsamen Abendessen. Das Pendel der Uhr fängt einen Lichtstrahl ein. Oben bewegt es das Räderwerk mit einem Klick eine Kerbe vorwärts. Am Frontgiebel des Rathauses dreht der Tod jede Stunde sein Stundenglas um. Man kümmert sich nicht darum. Diese Gegenwart währt ewig. Die Welt würde wenig gewinnen, wenn sie sich noch weiterentwickelte. Diese Zivilisation ist auf ihrem Gipfel angelangt. Einige Einzelheiten müssen vielleicht noch geregelt, Medikamente zweifellos noch verbessert werden.
Am anderen Ende des Tisches sitzt feierlich und schweigend Jupiter, Professor Julius Wilhelm Wigand, Doktor der Philosophie, Direktor des Pharmazeutischen Instituts, Konservator des Botanischen Gartens, Dekan der Fakultät. Abends empfängt er den jungen Waadtländer in seinem Büro. Er kümmert sich paternalistisch um ihn. Er möchte den jungen Mann bei seinem akademischen Aufstieg leiten und ihm helfen, peinliche Fehler zu vermeiden. So wirft er ihm den Umgang mit diesem Sternberg vor, dessen Name schon alles sagt. Er rät ihm, einer Burschenschaft beizutreten. Aber Yersin, dieser schüchterne Student, der vor ihm im Sessel sitzt, hat nie einen Vater gehabt. Und bislang ist er gut ohne einen ausgekommen.
Ob in Medizin, Jura, Botanik oder Theologie eingeschrieben, neun von zehn Marburger Studenten haben damals eines gemein, sie gehören einer Burschenschaft an. Nach den Aufnahmeritualen, den geleisteten Schwüren besteht die gemeinsame Aktivität darin, sich Abend für Abend in derselben Kneipe zu treffen, deren Wände mit Wappen geschmückt sind, um sich dort volllaufen zu lassen und sich im Duell zu schlagen. Den Hals mit einer Schärpe, das Herz mit einem Plastron geschützt, zieht man die Klingen. Beim ersten Blutstropfen ist Schluss. Unverbrüchliche Freundschaften entstehen. Stolz stellt man die Schmisse auf dem Körper zur Schau wie später die Orden auf der Uniform. Einer von zehn ist jedoch von dieser Kameradschaft ausgeschlossen. Das ist der Numerus clausus, den das Universitätsgesetz für Juden vorsieht.
Der kleine junge Mann in Schwarz entscheidet sich für die Ruhe des Studiums, Wanderungen im Umland, Diskussionen mit Sternberg. Die Vorlesungen in Anatomie und klinischer Medizin werden im Großen Hörsaal gehalten, diese beiden würden jedoch schon gerne die Arbeit im Krankenhaus kennenlernen. Sezieren. In die Praxis eintauchen. In Berlin, wohin es Yersin schließlich zieht, nimmt er in einer Woche an zwei Hüftresektionen teil, während eine solche Operation in Marburg nur einmal im Jahr stattfindet. Endlich wandert er durch die Straßen einer Großstadt. In diesem Jahr sind die Hotels voll von Diplomaten und Entdeckern. Berlin wird zur Hauptstadt der Welt.
Auf Initiative Bismarcks haben sich dort alle Kolonialmächte vor dem Atlas versammelt, um Afrika unter sich aufzuteilen. Es ist der Berliner Kongress. Der sagenumwobene Stanley, der vierzehn Jahre zuvor Livingstone gefunden hat, repräsentiert dort den belgischen König, den Besitzer des Kongo. Yersin liest die Zeitungen, erfährt viel über das Leben Livingstones, und Livingstone wird sein Vorbild: Der Schotte, zugleich Entdecker, Mann der Tat, Gelehrter, Priester, Entdecker des Sambesi und Arzt, jahrelang in unbekannten Gebieten Zentralafrikas verschollen, entscheidet sich, als Stanley ihn endlich findet, zu bleiben, wo er ist, und dort zu sterben.
Eines Tages wird Yersin der neue Livingstone sein.
Das schreibt er in einem Brief an Fanny.
Deutschland schafft sich wie Frankreich und England mit Säbel und Maschinengewehr ein Weltreich, kolonisiert Kamerun, das gegenwärtige Namibia und das heutige Tansania bis nach Sansibar. Im Jahr des Berliner Kongresses begleitet Arthur Rimbaud, der Autor von Bismarcks Traum, auf dem Rücken eines Kamels zweitausend Gewehre und sechzigtausend Patronen zu König Menelik II. nach Abessinien. Er, der einst ein französischer Dichter war, macht sich für den französischen Einfluss stark, widersetzt sich den territorialen Zielen der von Gordon angeführten Engländer und Ägypter. »Ihr Gordon ist ein Idiot, ihr Wolseley ein Esel und alle ihre Unternehmungen eine unsinnige Folge von Absurditäten und Plünderungen.« Er betont als Erster die strategische Bedeutung jenes Hafens, den er Dhjibouti schreibt, wie Baudelaire Saharah schrieb, er verfasst einen Bericht über seine Forschungsreise für die Société de Géographie in Paris, schickt geopolitische Artikel an den Bosphore égyptien, die in Deutschland, Österreich und Italien Widerhall finden. Er spricht von den Verheerungen des Krieges. »Die Abessinier haben in wenigen Monaten den Vorrat an Sorghumhirse verzehrt, den die Ägypter zurückgelassen hatten und der für mehrere Jahre ausgereicht hätte. Jetzt stehen Hunger und Pest ins Haus.«
Ein Insekt verbreitet die Pest. Der Floh. Noch weiß das niemand.
Von Berlin aus fährt Yersin nach Jena. Bei Carl Zeiss erwirbt er ein Mikroskop, an dem alles perfektioniert wurde und das ihm überallhin folgen, ihn auf seiner Reise um den Erdball im Gepäck begleiten sollte, jenes Mikroskop, mit dem er zehn Jahre später den Pestbazillus identifiziert hat. Carl Zeiss ist eine Art Spinoza, bei beiden war das Schleifen von Gläsern fruchtbar für die Reflexion und die Utopie. Baruch Spinoza war ebenfalls Jude, sagt Sternberg. Jetzt sind die beiden Studenten wieder in Marburg, beugen sich nacheinander über das nagelneue Okular, spielen über der Geometrie eines Libellenflügels mit der gerändelten Stellschraube. Yersin hat auch die antisemitischen Ausschreitungen erlebt, die eingeschlagenen Scheiben, die Fausthiebe. In die Unterhaltung der beiden Studenten schleicht sich vielleicht das Wort Pest ein.
Häufig werden, solange man sich nicht mit einer der beiden ansteckt, die Pest und die Lepra verwechselt. Die große Pest des Mittelalters, der Schwarze Tod, forderte fünfundzwanzig Millionen Opfer, die man ins Verhältnis zur Bevölkerungsdichte setzen muss. Die Bevölkerung Europas wird um die Hälfte dezimiert. Noch hat kein Krieg je ein solches Massensterben verursacht. Das Ausmaß der Seuche ist metaphysisch, sie gilt als göttlicher Zorn, die Strafe Gottes. Die Schweizer waren nicht immer wohlmeinende Zeloten für Toleranz und Mäßigung. Fünf Jahrhunderte zuvor haben Bewohner von Villeneuve am Ufer des Genfer Sees Juden der Verbreitung der Seuche durch Brunnenvergiftung angeklagt und sie bei lebendigem Leib verbrannt. Fünf Jahrhunderte später mag der Obskurantismus zwar zurückgegangen sein, doch der Hass ist gleich geblieben. Über die Pest weiß man noch immer nicht mehr. Wie sie auftaucht, tötet und verschwindet. Eines Tages vielleicht. Die beiden Studenten glauben an die Wissenschaft. An den Fortschritt. Mit der Heilung der Pest würde man zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, sagt Sternberg. Yersin kündigt ihm an, dass er nach Frankreich reisen will.
Im folgenden Jahr setzt er sein Studium in Paris fort. In diesem Jahr des Berliner Kongresses, als Arthur Rimbaud seine Beine in der steinigen Wüste auf dem Rücken von Kamelen verschleißt, hat Louis Pasteur gerade das Kind Joseph Meister gerettet. Die Tollwut durch einen Impfstoff zu heilen, stößt eine Tür auf. Bald wird man nicht mehr zwischen Pest und Cholera wählen müssen, sondern heilen. Yersin hat den Vorteil, zweisprachig zu sein. Sternberg an seiner Stelle würde zögern. Zwischen Berlin und Paris wie zwischen Skylla und Charybdis. Dieser Sternberg ist lieber ein Pessimist mit klarem Verstand, wenn das nicht ein Pleonasmus ist. Zehn Jahre später, zu Beginn der Dreyfus-Affäre, wird man Yersins Namen vergeblich unter einer Petition suchen. Es stimmt schon, alle diese Schreckensgeschichten in Europa machen einem schnell Lust aufs andere Ende der Welt. Als der Prozess stattfindet, ist Yersin in Nha Trang oder in Hongkong.
In Paris
Als Yersin die andere Hauptstadt entdeckt, stößt er vor allem auf den Antigermanismus. In Paris tut man besser daran, den komischen Schweizerhut statt Pickelhaube zu tragen, zu jodeln statt bayrische Lieder zu singen.
Seit fünfzehn Jahren, seit Sedan ist Frankreich kleiner, und das kann man nicht durchgehen lassen. Für die Abtrennung des Elsass und Lothringens rächt sich Frankreich durch die Eroberung eines ausgedehnten Übersee-Imperiums, das weit größer ist als das der Deutschen. Von den Karibischen Inseln bis nach Polynesien, von Afrika bis Asien: Über der Trikolore geht die Sonne ebenso wenig unter wie über dem Union Jack. In jenem Jahr trifft Auguste Pavie, der Erforscher von Laos, Pierre Savorgnan de Brazza, den Erforscher des Kongo. In der Rue Mazarine, im Restaurant La Petite Vache, versammelt sich auch die kleine Schar der Sahara-Reisenden. Zwei Jahre zuvor hatte sich die französische Marine von Cochinchina aus der Provinzen Annam und Tonkin bemächtigt. Yersin liest die Berichte, studiert die Karten. Hier hat er es mit Männern zu tun, und die würden nicht nach Marburg gehen und dort vor sich hinvegetieren. Er ist überzeugt von der Richtigkeit seiner Wahl. Hier muss man leben.
Paris ist vielleicht zum letzten Mal in seiner Geschichte eine moderne Stadt. Die Renovierungsarbeiten nach Haussmanns Plänen sind abgeschlossen. Man entwirft den Plan einer U-Bahn. »Ich betrete den Louvre. Heute besuche ich die ägyptische Sammlung.« Im Salon des Bon Marché liest Yersin Zeitungen. Gegenüber hat die Familie Boucicaut, Besitzer dieses Warenhauses, fünfundzwanzig Jahre später das Hotel Lutetia bauen lassen. Und gegen Ende seines Lebens bezieht Yersin dort jedes Jahr regelmäßig für ein paar Wochen ein Zimmer, nachdem er dafür um die halbe Welt gereist ist, immer dasselbe Eckzimmer im siebten Stock, ein paar hundert Meter von seiner ersten Studentenbude entfernt, einer armseligen Mansarde in der Rue Madame, von wo aus er den Kirchturm von Saint-Sulpice sehen kann, wenn er sich den Hals verrenkt, wie er Fanny schreibt.
In der Rue d’Ulm ist Louis Pasteur gerade eine zweite Impfung gegen die Tollwut gelungen. Nach dem Erfolg bei dem kleinen Elsässer Joseph Meister jetzt der bei Jean-Baptiste Jupille aus dem Jura. Bald kommen Patienten von überall her. Bislang bestand die medizinische Behandlung in allen schneebedeckten Landstrichen und Wäldern mit Wölfen, in Frankreich wie in Russland, häufig darin, die Tollwütigen zu fesseln und zu ersticken, bevor man selbst gebissen wurde. Das Abenteuer liegt um die Ecke in der Rue d’Ulm ebenso wie an den Hängen der Dünen in der Sahara. Die neue Grenze der Mikrobiologie. Der zweiundzwanzigjährige ausländische Student, der über den Zeitungen sitzt, liegt noch seiner Mutter auf der Tasche. Wie alle Männer damals trägt er einen kurz geschnittenen Bart und eine dunkle Jacke, speist in Kellerkneipen zu Abend, in denen Proletarier gerne ein Gläschen über den Durst trinken, denn jedes geleerte Glas mehr ist ein Glas weniger für die Boches, und es wäre doch idiotisch, Herr Wirt, wenn man ihnen das Fass überließe. »Ich war Zeuge eines heftigen Streits zwischen den Arbeitern und einer aus Deutschland stammenden Person, die, glaube ich, das Pech hatte, ihre Muttersprache zu sprechen und dafür fast erschlagen wurde.«
Im Augenblick muss er sich kümmerlich durchschlagen. Er schreibt sich in den Grundkurs für Bakteriologie ein, den Professor Cornil hält. Es ist ein neues Fach. Sein Leben lang wählt Yersin das Neue, das ganz und gar Moderne.
In wenigen Monaten wird bei Pasteur geimpft wie verrückt. Januar sechsundachtzig: Von fast tausend Geimpften sterben noch sechs, vier, die von einem Wolf, und zwei, die von einem Hund gebissen wurden. Im Juli: Auf jetzt fast zweitausend erfolgreiche Impfungen kommen nur noch zehn Fehlschläge. Deren Leichen werden in die Leichenhalle des Hôtel-Dieu gebracht, wo Cornil Yersin mit der Autopsie beauftragt. Das Mikroskop von Carl Zeiss lässt nur ein Urteil zu: Die Untersuchung des Rückenmarks zeigt die Wirkungslosigkeit der Impfung bei den Verstorbenen: Sie waren zu spät behandelt worden. Yersin übergibt seine Ergebnisse Pasteurs Assistenten Émile Roux. In der Leichenhalle des Hôtel-Dieu begegnen sich zwischen den Leichen von Tollwütigen zwei Waisen im weißen Kittel; es sollte ihr Leben verändern.
Der Waisenjunge aus Morges und der Waisenjunge aus Confolens.
Roux stellt Yersin Pasteur vor. Der schüchterne Jüngling sieht den Mann und die Stätte seines Wirkens, in einem Brief an Fanny schreibt er: »Das Sprechzimmer von Herrn Pasteur ist klein, quadratisch, mit zwei großen Fenstern. An einem der Fenster steht ein kleiner Tisch, darauf Stilgläser, die die Impfviren enthalten.«
Bald hat Yersin einen Platz bei den Ärzten in der Rue d’Ulm. Jeden Morgen bildet sich im Hof eine lange Schlange ungeduldig wartender Tollwütiger. Pasteur hört sie ab, Roux und Grancher impfen, Yersin bereitet den Impfstoff vor. Er wird besoldet, erhält ein mageres Gehalt. Nie wieder wird er jemandem Geld schulden. Der Waisenjunge aus Morges und der Waisenjunge aus Confolens haben in dem strengen Gelehrten aus dem Jura einen Vater gefunden. Der Mann im schwarzen Gehrock trägt einen großen biblischen Namen, einen Namen, unter dem man die Herden zu den Weiden führt und die Seelen zur Erlösung.
Schon krank, aber noch Kanzler der École normale supérieure, beendet Louis Pasteur vor der Akademie der Wissenschaften seinen Bericht. Es gibt gute Gründe, ein Zentrum zur Tollwutimpfung zu schaffen. Die Stadt Paris stellt ihm vorübergehend ein heruntergekommenes dreistöckiges Gebäude aus Backstein und Holz in der Rue Vauquelin zur Verfügung, und die kleine Bande richtet sich dort ein. Es ist der Anfang ihrer Wohngemeinschaft. Auf den Hof hinaus Pferdeställe, Hundezwinger und der Impfsaal. Roux, Loir, Grancher, Viala, Wasserzug, Metschnikow, Haffkine, Yersin. Der ein düsteres Gesicht macht und die Stirn runzelt, wenn man seinen Namen wegen seines Akzents Yersine wie Haffkine ausspricht. Jeden Morgen geht er aus dem Haus, um in der Rue des Saints-Pères seine Medizin-Vorlesungen zu hören. Mittags isst er in einer kleinen Kneipe in der Rue Gay-Lussac. Seine Doktorarbeit widmet er der Diphtherie und der Tuberkulose, die man zu jener Zeit in der Dichtung noch Schwindsucht nennt. Im Hôpital des Enfants-Malades führt er klinische Studien durch, nimmt Abstriche aus entzündeten Kehlen, extrahiert die Pseudomembranen, versucht das Diphtherietoxin zu isolieren, liest in Zeitschriften die Berichte der Entdecker.
Bei der Banque de France wird ein internationales Konto zur Unterstützung von Louis Pasteur eingerichtet. Die Spenden fließen. Der russische Zar, der brasilianische Kaiser und der Sultan von Istanbul steuern ihren Teil bei, aber auch kleine Leute, deren Namen jeden Morgen im Journal Officiel veröffentlicht werden. Der alte Pasteur geht die Aufzählung durch. Er weint, als er sieht, dass der junge Joseph Meister ihm drei Sous zukommen lässt. Man erwirbt ein Gelände im fünfzehnten Arrondissement. Roux und Yersin inspizieren wöchentlich die Arbeiten in der Rue Dutot, kehren dann in die Rue d’Ulm zurück, wo die kleine Bande sie in der Wohnung des Ehepaars Pasteur über die ausgerollten Baupläne gebeugt erwartet. Der alte Mann im schwarzen Gehrock hat bereits zwei Schlaganfälle erlitten, das Sprechen fällt ihm schwer, sein linker Arm ist gelähmt, sein Bein lahm. Für das Institut entwerfen Roux und Yersin mit dem Architekten eine Innentreppe, die niedrigere Stufen hat, dafür aber mehr.
Auf den alten Pasteur warten keine Entdeckungen mehr. Den Stab übernimmt Roux, der Auserwählte, der Beste unter den Söhnen, er soll das Erbe antreten. Seinen letzten Kampf führt Pasteur in der Theorie. Seit mehr als zwanzig Jahren schießen seine Gegner, die Anhänger der Spontanzeugung, wie Pilze aus dem Boden. Er verteidigt seine Auffassung, dass nichts aus dem Nichts entsteht. Und was ist mit Gott? Warum gibt es alle diese Mikroben und warum blieben sie uns jahrhundertelang verborgen? Warum müssen Kinder sterben und vor allem die Kinder der Armen? Fanny macht sich Sorgen. Pasteur tönt wie Darwin. Der Ursprung der Arten und die biologische Evolution, von der Mikrobe bis zum Menschen, widersprechen den heiligen Texten. Yersin lacht darüber, und mit ihm die ganze verschworene Bande. Bald wird das alles vollkommen klar sein, es wird genügen, es zu erklären, zu lehren, die Untersuchungen zu wiederholen. Sie alle hätten sich kaum ausmalen können, dass eineinhalb Jahrhunderte nach ihnen die Hälfte der Weltbevölkerung noch immer den Kreationismus verteidigt.
In diesen Jahren, in denen sich die Bande der Pasteur-Schüler bildet, trifft sich die kleine Bande der Sahara-Reisenden weiterhin in der Rue Mazarine, während sich die Schar der Parnassiens zerstreut. Eine Zeitlang existieren die drei nebeneinander. In derselben Stadt und in denselben Straßen. Banville, der sanfte Dichter, haust noch in der Rue de Buci, wo er Rimbaud sein Dienstmädchenzimmer überließ, bevor dieser mit Verlaine in die Rue Racine zog. Seit der »Seher« weggegangen ist, dümpeln die Parnassiens vor sich hin. Aus Gewohnheit suchen sie noch ihre Bistros auf, ihre Laboratorien, in deren Retorten andersartige Elixiere entstehen, die bunten Feengestalten, die sich im Hirn der nicht mehr ganz taufrischen Parnassiens einnisten und durch den schemenhaften Alexandriner geistern, dessen Halbverse sich unablässig entgegenstehen, doch immer blutleerer werden. Im selben Moment, da Mikroskop und Injektionsnadel als absolu-te Neuheiten auftauchen, verstummt der Alexandriner, erledigt durch den Meisterstreich des jungen Dichters, der aufgebrochen ist, um dem König der Choa und dem künftigen Kaiser von Äthiopien, Menelik II., Gewehre zu verkaufen.
Yersin seinerseits liest alles, sofern es eine wissenschaftliche Arbeit oder der Bericht von einer Entdeckungsreise ist. Er arbeitet in aller Stille und Einsamkeit, erweckt den Anschein eines Blenders, eines Mannes, der keinen Finger krumm macht, und darin zeigt sich wahre Eleganz. Nachts kocht er sein Mikroben-Süppchen und bereitet seine Reagenzien vor. Das viele Material, das er zur Verfügung hat, ist faszinierend. Endlich praktische Arbeit, Drachen. Er öffnet die Käfige der Hühner und der Mäuse, entnimmt, impft und erkennt, ein Geniestreich, an einem Kaninchen einen neuen Typ experimentell erzeugter Tuberkulose: die Typhobazillose.
Der kleine junge Mann in Schwarz kommt damit ins Labor zurück und hält Roux das Reagenzglas hin. Oder aber er zieht ein weißes Kaninchen aus seinem Hut, hält es an beiden Ohren und legt es auf den Labortisch. Ich habe da etwas gefunden. Roux dreht das gerändelte Einstellrad des Mikroskops zwischen Daumen und Zeigefinger, hebt die Augen, wendet den Kopf, sieht zu den schüchternen Studenten hinauf und runzelt die Stirn. Die »Yersin-Typ-Tuberkulose« findet Eingang in die medizinischen Lehrwerke, und so lebt sein Name fort in der Nachwelt der Allgemeinmediziner und der Medizinhistoriker. Doch in der breiten Öffentlichkeit ist sein Name schnell wieder vergessen, und auch heute ist er, trotz der Pest, nicht sehr bekannt. Das arme tuberkulöse Kaninchen spuckt und hustet sich die Lungen aus dem Leib, haucht sein Leben auf dem Labortisch aus. Mit roten Blutflecken auf seinem weißen Fell. Dieser Märtyrer verhilft dem jungen Mann zu einer ersten Veröffentlichung in den Annales de l’Institut Pasteur, unterzeichnet mit Roux & Yersin. Dabei ist Letzterer noch nicht einmal Arzt, noch nicht einmal Franzose.
Drei Jahre nach seiner Ankunft in Paris schreibt Yersin mit fünfundzwanzig seine Doktorarbeit, verteidigt sie, erhält die Bronzemedaille, die er in seine Tasche steckt, um sie Fanny zu schenken. Am Morgen wird er zum Doktor der Medizin ernannt und am Abend nimmt er den Zug nach Deutschland. Pasteur hat ihn gebeten, sich in das Seminar über die Technik der Mikrobiologie einzuschreiben, das Robert Koch, der große Entdecker des Tuberkelbazillus, soeben am Hygiene-Institut der Humboldt-Universität zu Berlin ins Leben gerufen hat. Yersin ist Schweizer und zweisprachig. Das ist schon fast Spionage. Der Mann, den er in seinen Notizbüchern »den großen Lama Koch« nennt, greift Pasteur in seinen Schriften scharf an. Yersin besucht die vierundzwanzig Seminarstunden, füllt seine Notizbücher, übersetzt Koch für Pasteur, zeichnet einen Plan des Labors, schreibt einen Bericht und kommt zu dem Schluss, dass es nicht besonders schwierig sei, es in Paris besser zu machen.
Kaum ist er zurück, erscheint ein zweiter mit Roux & Yersin gezeichneter wissenschaftlicher Artikel. Die Gebäude des zukünftigen Institut Pasteur werden mit Pomp von Präsident Sadi Carnot und seinen internationalen Gästen eingeweiht. Noch ist Yersin Schweizer. Das Gesetz erlaubt die Ausübung des Arztberufs nur den Bürgern der Republik. Er leitet die notwendigen Schritte ein, schickt einen Brief an Fanny. Seine Vorfahren mütterlicherseits stammen aus Frankreich: calvinistische Spitzköpfe, die vor den Religionskriegen geflohen waren. Die Angelegenheit ist schnell geregelt. Frankreich nimmt sein Wunderkind mit offenen Armen auf.